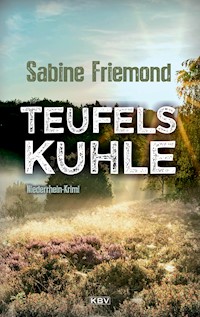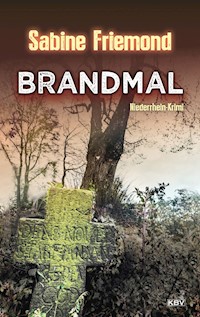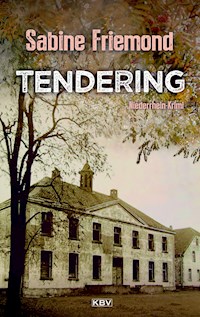12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Christin Erlenbeck
- Sprache: Deutsch
Pfarrerin Erlenbecks Gespür für Geheimnisse Im Rheindorf Mehrum werden die erhängten Leichen eines alten Ehepaars gefunden. Die erste Vermutung eines gemeinschaftlichen Freitods bestätigt sich nicht. Stattdessen alles darauf hin, dass die beiden ermordet wurden. Zunächst geraten die drei Kinder der Toten ins Visier der Ermittler, doch dann rückt zunehmend die sogenannte »Mehrumer Gilde« in den Fokus, eine jahrhundertealte Gemeinschaft, der fast alle Bewohner des Ortes angehören. Und als ob das Ermittlerteam um Freddie und Skalecki nicht schon genug Verdächtige hätte, erfahren sie auch noch, dass zwei Fremde sich nur wenige Tage vor dem Tod des Ehepaares nach diesem erkundigt haben. Vielleicht bringt Christin Erlenbecks untrüglicher Spürsinn für die geheimen, tief vergrabenen Dinge vergangener Tage die Ermittler auf die richtige Spur?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sabine Friemond
Hitzewelle
Von der Autorin bisher bei KBV erschienen:
Hochbahn
Teufelskuhle
Tendering
Brandmal
Sabine Friemond, geb. 1968 in Duisburg, wuchs in der Gemeinde Spellen am Niederrhein auf. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Ihre Liebe zu Büchern ist bereits daran ersichtlich, dass sie am Niederrhein eine Buchhandlung in Voerde betreibt. Ihre Heldin Pastorin Christin Erlenbeck ermittelt bereits in ihrem fünften Fall.
Sabine Friemond
Hitzewelle
Kriminalroman
Originalausgabe
© 2023 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von
© Stephan Sühling - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-666-0
E-Book-ISBN 978-3-95441-674-5
Für Mali
Mögen Dir noch viele Romane gewidmet werden!
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel – Joe, Youssef, Josef
5. Kapitel
6. Kapitel – Ahn, Anne
7. Kapitel
8. Kapitel – Eremias, Jeremias
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Wie immer, an dieser Stelle ein Wort an die Leser!
Prolog
Mehrum 1944
Die Luft war erfüllt von kleinen goldenen Funken. Man konnte sie nur sehen, wenn sie durch das Sonnenlicht, das wie kleine Strahlen durch die Astlöcher hereinfiel, rieselten. Verließen sie das Licht, waren sie nur noch Staub.
Auch Mateusz’ Haare schimmerten mal wie ein goldener Kranz um sein markantes Gesicht, mal nahmen sie wieder das Stumpfblonde an, das ihm die Natur gegeben hatte – je nachdem, ob er seinen Kopf hob, um sie liebevoll anzulächeln, oder ob seine Lippen ihren Körper entlangfuhren, um jeden Zentimeter von ihr zu liebkosen.
Sofija schloss die Augen, versuchte, die gestohlenen Minuten zu genießen, die Bilder von Frau Täufner, die sie mit »Gnädige Frau« ansprechen sollte, zu verdrängen. Versuchte, nicht daran zu denken, was passieren würde, wenn man, wenn SIE sie hier erwischen würde.
Es ist jetzt sicher hier, beruhigte sie sich. Die Täufner ist um diese Zeit immer bei ihrer Mutter, um ihr das Abendbrot zu richten. Und wenn diese alte Frau nicht so große Angst vor ihr, der Ukrainerin Sofija, die die Alte für eine Russin hielt, hätte, müsste sie selbst jetzt dieser Frau das Abendbrot richten und wahrscheinlich noch die vollgemachte Bettwäsche wechseln und frisches Wasser holen und, und, und.
Mateusz musste solche Ängste nicht haben. Er war bei der Familie Ritter untergebracht, die ihn mochte und respektierte wie einen von ihresgleichen. Im Grunde konnte er kommen und gehen, wie er wollte, solange er seine Arbeit tat und sich an die Regeln hielt. Wobei die Ritters es selbst ja auch nicht taten, da es für sie selbstverständlich war, dass Mateusz bei den Mahlzeiten mit ihnen am Tisch saß. Wichtig war nur, dass Alfons Rettmann davon nichts merkte. Als Dorfpolizist war er überaus eifrig dabei, sämtliche Verstöße gegen den »Ostarbeitererlass« zu melden, was für die- oder denjenigen oft zu harten Bestrafungen führen konnte.
In der kleinen Scheune, in der sich Mateusz und Sofija trafen, lagerte das frische Heu. Mateusz hatte es so umgeschichtet, dass es eine kleine Nische bildete, die vom Eingangstor aus nicht zu sehen war.
Es war warm, für einen Tag im Juni schon fast heiß, und die Hitze staute sich in der Scheune. Mateusz hatte Sofijas dünne, fadenscheinige Bluse aufgeknöpft. Mit einem tiefen Seufzen zog Sofija Mateusz zu sich heran, drückte sein Gesicht zwischen ihre Brüste und schloss die Augen. Das kleine, goldene Kreuz, das sie an einer langen, feinen Kette um den Hals trug, pikste ihn dabei leicht in die Wange.
»Nazavzhydy«, murmelte sie leise.
Ja, für immer, dachte Mateusz.
Dann verloren sie sich ineinander.
Mateusz musste seine Hand sanft auf Sofijas Mund drücken, damit niemand ihre kleinen, unterdrückten Schreie hörte. Vergessen war das Schicksal, das sie beide schon vor über einem Jahr in die Fremde geführt hatte. Von einem Tag auf den anderen ihren Familien entrissen, zu Gefangenen gemacht, unter erniedrigenden Umständen zu Menschen verfrachtet, die ihre Feinde waren und für die sie jetzt von morgens bis abends schuften mussten, da in diesem Moment deren Männer, Brüder und Söhne auf ihre Männer, Brüder und Söhne schossen.
Sie klammerten sich aneinander, weil das Schicksal ihnen ein klein wenig Glück in diesem Unglück geben wollte. Oder weil sie sich dieses kleine Glück nahmen. Eine Ukrainerin und ein Russe, deren Blicke und Körper sofort zueinandergefunden hatten, die sich gegenseitig liebkosten, hielten und Kraft gaben. Die sich verstehen konnten, da ihre Sprachen sich ähnelten und so der Klang der Heimat den Schmerz etwas linderte.
Bevor sie sich wieder ankleideten, um zu den Höfen und Menschen zurückzukehren, für die sie arbeiteten, streichelten sie einander die erhitzten Gesichter. Kichernd zupften sie sich gegenseitig die Halme aus den Haaren, küssten sich noch einmal.
»Do skorogo«, seufzte er leise. Bis bald.
Sofija musste zurück zu ihrer Dienstherrin und dort wahrscheinlich bis zum Einbruch der Dunkelheit – und die ließ jetzt, im Frühsommer, lange auf sich warten – noch hart arbeiten, bevor sie ins Mehrumer Schloss zurückdurfte, wo sie und einige andere ukrainische Zwangsarbeiterinnen untergebracht waren.
Das leise Schleifen des Scheunentors ließ sie zusammenfahren. Wieder drückte Mateusz Sofija seine Hand auf den Mund, diesmal jedoch, damit sie nicht vor Schreck aufschrie. Die Panik in ihren Augen schnürte ihm vor Mitleid die Kehle zu, am ganzen Körper spürte er das heftige Pochen ihres Herzens. So vorsichtig wie möglich löste er seine Hand und richtete sich etwas auf, um über das Heu zu gucken. Aber er konnte niemanden sehen. Das Tor war nur wenige Zentimeter geöffnet, niemand hätte dort hindurchgepasst. Vielleicht hatte nur eine kleine Windbö gegen das Tor gedrückt, die Luft wurde immer drückender, sicher würde es gleich ein Gewitter geben.
Er verabschiedete sich mit einem aufmunternden Lächeln von Sofija und stieg laut pfeifend die Leiter hinab, jederzeit bereit, zur Tarnung ein Bündel Heu zu schultern und mit hinauszunehmen.
Vor der Scheune schaute er unauffällig nach links und rechts. Nur Willi Ritter, den neunjährigen Sohn der Familie, bei der er untergebracht war, konnte er sehen.
»Was du sein hier?«, rief Mateusz. »Hilf mir, die Tiere füttern.«
»Diere«, verstand Willi, grinste aber schon lange nicht mehr über den harten Akzent des Russen. Mateusz strubbelte dem Jungen durch die Haare, legte ihm den Arm auf die Schultern und führte ihn von der Scheune weg.
»Hans wollte bei uns Erdbeeren klauen«, beschwerte sich der Junge und versuchte, mit Mateusz’ lang ausholenden Schritten mitzuhalten.
»Hans Täufner?«, fragte der Russe. »Der sein gerade hier?« Ein leichter Schatten fiel über sein Gesicht, was Willi jedoch nicht bemerkte. Ihm fiel nur auf, dass es ein wenig nach »Teufel« geklungen hatte, als Mateusz den Namen ausgesprochen hatte.
1. Kapitel
Samstag, Sommer 2022
»Zielperson nähert sich dem Tatort. Over.«
»Roger. Sehe auch, wie sie sich nähert. Over.«
»Roger. Guckt sich um. Geht weiter. Over.«
»Roger. Bleibt stehen. Scheint zu überlegen, ob sie es wirklich durchziehen will. Over.«
»Roger. Over.«
»Sollen wir die Observation abbrechen? Over.«
»Roger. Nein. Over. Ich will die erwischen. Over.«
»Roger. Du wirst dann aber den Zugriff alleine vornehmen. Du hast die Aktion geplant, du wirst mit den Konsequenzen klarkommen müssen. Over.«
»Ja, klar, Roger. Das werde ich schon schaffen. Zielobjekt geht weiter! Roger! Äh, over!«
Maria Skalecki stellte das Funkgerät auf »off«. Mit der gleich wie am Spieß schreienden Flora wollte sie nichts zu tun haben. Mit einem mühevoll unterdrückten Grinsen im Gesicht stieg sie über die große Wolfsspitzhündin Laika, die versuchte, auf den Steinplatten im Schatten etwas kühler zu liegen, und gesellte sich wieder zu ihrem Mann Rolf und zu ihren Gastgebern, ihrem Kollegen Freddie samt seiner Frau Christin und Tochter Mathilda, genannt Matti. Auch Kollege Schlüter und seine Frau Susanne sowie ihre junge Kollegin Laura mit ihrem Freund Hamza waren zu der Grillparty eingeladen.
Natürlich war Christin nicht entgangen, dass Skalecki ohne Oskar und Flora wieder auf ihrem Gartenstuhl Platz genommen hatte. Gerade als sie die Polizistin darauf ansprechen wollte, hörte sie ein ohrenbetäubendes Geschrei aus Richtung der Gartenhütte. Da die Hütte auf der anderen Seite des Hauses stand, konnte sie nicht sehen, warum Flora so laut schrie, aber dass ihr jüngstes Kind anscheinend nicht ernsthaft verletzt, sondern nur furchtbar wütend war, konnte sie aus der Tonlage heraushören. Also erst einmal sitzen bleiben.
»Skalecki?«, wandte sie sich mit fragend hochgezogenen Augenbrauen an Freddies Kollegin, die zusammen mit ihrem Mann zu den engsten Freunden des Erlenbeck-Neumann-Haushaltes zählte.
»Was?«, fragte diese zurück, zog ihre Schultern hoch, streckte die geöffneten Handflächen vor sich aus und setzte eine beleidigte Miene auf, die unterstreichen sollte, wie unschuldig sie an dem Geschrei der Kleinen war und wie empört über Christins angedeutete Vermutung. »Oskar hat das eingefädelt. Er hat mich um Unterstützung gebeten. Und ich finde, in der Sache hat er recht. Das ist quasi schon Verkehrserziehung.«
Wie aufs Stichwort kamen Oskar und Flora um die Hausecke herum. Die blonden Haare des kleinen Mädchens hingen ihr tropfnass ins Gesicht, wütend versuchte sie, sich aus Oskars Griff um ihren Oberarm zu befreien.
»Sie wollte es wieder tun«, rief Oskar. »Sie ist wieder zur Hütte geschlichen, um sich ihr Laufrad zu nehmen und abzuhauen.«
»Und warum ist sie so nass?«, wollte Freddie wissen, nahm seine kleine Tochter auf den Arm und strich ihr die feuchten Strähnen aus dem Gesicht.
Oskar streckte sich stolz. »Ich habe Wasser auf den Türrahmen platziert, das sollte sie so erschrecken, dass sie sich nicht mehr in die Gartenhütte traut.«
Alle Gäste der Grillparty schauten angestrengt in eine andere Richtung und versuchten, mehr oder weniger erfolgreich, sich ihr Lachen zu verkneifen.
»Und du, Skalecki«, fragte Christin, »hast du davon gewusst? Flora hätte sich verletzen können!«
»Es waren Wasserbomben«, erklärte die Polizistin. »Die sind ganz weich.«
»Woher hast du denn die Wasserbomben her?«, wollte die Pfarrerin nun von ihrem Sohn wissen.
Oskar guckte Skalecki an, doch bevor er etwas sagen konnte, sprang Skalecki auf. »Komm, Rolf, wir holen jetzt den Sekt aus dem Kühlschrank.«
2. Kapitel
Samstagabend
Sanft lächelnd beobachtete Hans, wie Anneliese, in jeder Hand ein schmutziges Glas, ganz in Gedanken versunken aus dem großen Wohnzimmerfenster starrte. Die Spannung der angewinkelten Arme ließ langsam nach, die Hände sanken nach unten. Hans sagte nichts, die Gläser waren leer, so konnte nichts auf den Teppich fließen. Und wenn schon, dachte er, der Teppich war alt, seine Zeit vorbei.
Was sah sie jetzt wohl dort draußen, in der Dunkelheit? Sah sie die Kinder, die im Garten spielten? Josef, der mit einem Holzschwert den Stamm des alten Kirschbaums malträtierte? Anne, die mit ernstem Gesicht Kuchen im Sandkasten backte? Oder konnte sie Jeremias sehen, der mit seinem Kinderrädchen Bahnen durch den Garten zog? Er sah nur Annelieses leicht gebückte Gestalt, die sich in der großen Fensterscheibe spiegelte. Ihr Gesicht erschien ihm dagegen wie das einer wesentlich jüngeren Frau. Entspannt, ganz leicht lächelnd, mit rosigen Wangen.
Als wenn ein innerer Akku die Stromzufuhr wiederhergestellt hätte, lief sie plötzlich weiter. »Warum haben wir so viele schmutzige Gläser hier herumstehen?«, fragte sie ihren Mann, jetzt mit einem verwirrten Gesichtsausdruck.
»Ach, Liebes! Die Kinder waren doch hier«, erklärte er ihr geduldig.
Langsam ging seine Frau weiter in die Küche, in die man vom Wohnzimmer aus kam. Sie stellte die Gläser ab. Guckte sich um, lächelte dann wieder.
»Stimmt. Sie haben auch hier gegessen. Aber wir haben uns gestritten«, fasste sie ihre Erinnerung an den Abend zusammen.
»Ja«, bestätigte Hans. Er nahm seine Frau in die Arme, drückte sie an sich. »Das war zu erwarten gewesen. Lass uns weitermachen. Ich möchte fertig werden.«
Kurze Zeit später schauten sie sich zufrieden um. Alles so, wie es sein sollte.
Hand in Hand gingen sie zur Treppe, die in das obere Stockwerk, in dem ihr Schlafzimmer lag, führte.
Fast wäre Hans die erste Stufe hinaufgestolpert, als Anneliese plötzlich an seiner Hand zog.
»Hast du das auch gehört?«, fragte sie ihn.
Beide lauschten. Ja, nun hörte er es auch.
* * *
»Was für eine grandiose Neuigkeit!«, rief Michael Schlüter aus und hob sein Sektglas.
»Das ist wunderbar«, bestätigte seine Frau und drückte Skalecki an sich. »Dann werden wir ja Nachbarn. Wir Mehrumer freuen uns sehr über neue Dorfbewohner. Übrigens«, fügte sie mit einem verschmitzten Lächeln hinzu, »der Frauenchor probt montags, dass du das schon mal weißt. Auch Rolf ist herzlich willkommen, wir brauchen auch immer Männer.«
Skalecki und ihr Mann sahen sich an, dann fingen beide gleichzeitig an zu stottern. »Ja, mal gucken …«
»Da überrascht ihr uns aber wirklich«, sagte Freddie. »Dass ihr euch von der Stadt lösen könnt!«
Mit nachdenklichem Blick betrachtete Skalecki die umstehenden Menschen. Ihr ansonsten eher spöttischer Gesichtsausdruck wurde ganz weich. »Rolf und mir ist irgendwann klar geworden, dass ihr die Menschen seid, mit denen wir am liebsten zusammen sind. Dann fiel uns die Anzeige von diesem traumhaften Haus in Mehrum in die Hände, und als wir es uns anguckten, war uns sofort klar, hier wollen wir wohnen. Dort am Deich ist es wie im Urlaub. Außerdem …«, jetzt blitzte wieder die Skalecki heraus, die die Geschehnisse um sich herum stets mit einer spöttischen Distanz betrachtete, »habe ich dann nicht so lange Anfahrtswege, wenn hier mal wieder etwas passiert.«
»Werdet ihr dann Oskar zu euch nehmen?«, fragte Mathilda, die genervt ihren jüngeren Bruder anstarrte. »Bitte, bitte!«
Skalecki musterte den mittlerweile hoch aufgeschossenen Fünfzehnjährigen und schien ernsthaft über diese Frage nachzudenken. »Nein«, antwortete sie dann, »Rolf würde ihn zu sehr verwöhnen, dann würde er noch frecher werden.«
»Wenn ihr Hilfe bei der Renovierung oder beim Umzug braucht«, schaltete sich nun Hamza, Lauras Freund, ins Gespräch ein, »sagt mir auf jeden Fall Bescheid.« Mit einem Blick zu Rolf fuhr er fort: »Ich kenne eine Menge Leute, die euch sehr gerne helfen würden.«
Rolf Trautmann konnte sich denken, auf wen Hamza anspielte. Nicht selten hatte Rolf in seiner Funktion als Staatsanwalt dafür gesorgt, dass Bekannte von Hamza glimpflich aus Schwierigkeiten herauskamen. Der junge Mann engagierte sich neben seinem Bauingenieurstudium in einem Duisburger Jugendzentrum.
»Ich helfe natürlich auch gerne, stecke aber im Moment in einer Klausurenphase«, sagte Laura. Nachdem sie vor einem Jahr ihre Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst beendet hatte, hatte sie sich dazu entschieden, Psychologie zu studieren. Der Mord an ihrer Mutter, als sie ein kleines Kind gewesen war, und dessen Aufklärung Jahre später hatten sie, die jahrelang ein eher zwiespältiges Verhältnis zur Polizei gehabt hatte, dazu gebracht, Teil des Rechtssystems werden zu wollen. Durch das Studium wollte sie lernen zu verstehen. Die dunklen Seiten der Menschen. Zu verstehen und vielleicht zu verhindern.
Mit einem Nicken bedankte sich Rolf bei Hamza. »Darauf kommen wir bestimmt zurück.«
3. Kapitel
Mittwoch, fünf Tage später
Sabine Sommer ärgerte sich. Sie wollte sich nur einen Kaffee aus dem Vollautomaten ziehen und ihn gemeinsam mit einer Zigarette an dem noch kühlen Morgen im Garten genießen, aber die Maschine zögerte dieses Vergnügen gehässig heraus.
Zuerst verlangte sie, dass der Kaffeesatz geleert wurde. Dann schrie sie nach Wasser, und zu guter Letzt hörte Sabine an dem heiseren Geräusch des Mahlvorgangs, dass der Behälter mit den Kaffeebohnen leer war.
Nicht aufregen, dachte sie. Wenn dies alles ist, was mich am heutigen Tag ärgern wird, kann ich zufrieden sein. Wenn die Klimaanlage im Büro ausfallen würde, wäre das bei der Wetterprognose viel schlimmer. Positiv denken. Noch kühlten die Fliesen auf dem Küchenboden ihre Füße.
Mit der Tasse Kaffee in der einen und einer Zigarette samt Feuerzeug in der anderen Hand ging sie in den Garten. Sie setzte sich auf einen abgesägten Baumstamm, den ihr Mann Henno nach einer Rückschnittaktion auf ihren Wunsch dort stehen gelassen hatte. Sabine schloss die Augen. Nahm einen tiefen Zug von der Zigarette, genoss den leicht bitteren Geschmack des Kaffees. Sie liebte es, hier in Mehrum zu wohnen. Ihr Haus stand fast direkt am Deich, hinter dem der Rhein floss. Sie war Mehrumerin und hatte nie damit gehadert, dass sie und ihr Mann nicht weggezogen waren, weg vom Land, weg von dem Rheindorf, in dem es noch nicht einmal mehr einen Kaugummiautomaten gab.
Sie konnte das Duisburger Ehepaar, das jetzt hierhin zog, gut verstehen. Sie machten einen patenten Eindruck. Beide waren auffallend groß, die Frau, eine Polizistin, sah in Uniform bestimmt imposant aus. Maria und Rolf, man war sofort per Du gewesen, waren im Moment oft in dem Haus, das sie gekauft hatten. Vielleicht würde sie heute Abend einfach mal mit einem kühlen Sekt bei ihnen vorbeigehen.
Während sie die Ruhe des beginnenden Tages genoss, stellte sie plötzlich fest, dass es zu ruhig war. Mit einem Ruck öffnete sie die Augen, schaute sich um, versuchte, einen Blick in den Garten des alten Ehepaars Täufner zu werfen. Wann hatte sie die beiden zuletzt gesehen? Normalerweise werkelte mindestens Hans um diese Zeit schon im Garten herum, goss ein paar Blumen, setzte den Rasensprenger um, fegte den Gehweg.
Sabine stand auf, stellte die Tasse auf dem Baumstumpf ab, drückte die Zigarette in dem bereitstehenden Aschenbecher aus und ging zu dem Zaun, der das Grundstück der Familie Sommer von dem ihrer alten Nachbarn trennte.
Es war ihr unangenehm, so neugierig in den Garten von Anneliese und Hans zu gucken, aber in ihr machte sich ein leises Unbehagen breit, sodass sie diese Indiskretion für gerechtfertigt hielt.
Die Blumen in den Beeten ließen die Köpfe hängen, die Erde sah hart und vertrocknet aus, und die Spitzen des gepflegten Zierrasens waren braun. Von dem Ehepaar war keine Spur zu sehen, und wenn sie so darüber nachdachte, fiel ihr auf, dass die Rollos seit Tagen nicht bewegt worden waren.
Entschlossen ging Sabine ins Haus zurück, zog sich ihre Sandalen an, lief zur Haustür ihrer Nachbarn und klingelte. Das ihr vertraute laute Schellen konnte sie deutlich hören, aber ansonsten blieb alles still. Sie klingelte noch einmal, diesmal länger. Aber auch danach vernahm sie keinen Laut aus dem Haus.
Sie schaute sich unschlüssig um. Sollte sie Malte, ihren Sohn, wecken, der jetzt in den Sommerferien bis mittags schlief? So ein Verhalten sah den Täufners nicht ähnlich. Die Familie Sommer und das Ehepaar Täufner pflegten zwar kein inniges nachbarschaftliches Verhältnis, dafür war der Altersunterschied zu groß … und da war auch immer eine leichte Abneigung gegen die beiden älteren Menschen. Trotzdem lebte man ein höfliches Miteinander. Und das bedeutete, dass man sich gegenseitig darüber informierte, wenn man längere Zeit weg war und, dies galt allerdings nur für Täufners, dass Sommers sich gegebenenfalls um deren Garten kümmerten.
Sabine entschied sich dagegen, Malte zu wecken. Sie ging um das Haus herum, um durch die Terrassentür zu gucken. Dort war die Küche, vielleicht konnte sie etwas erkennen, das Rückschlüsse auf Täufners Verbleib zuließ. Sie legte die Stirn an die Glasscheibe und umschattete mit beiden Händen ihre Augen, um besser hineinsehen zu können, als plötzlich die Terrassentür nachgab und Sabine einen kleinen Schritt über die Schwelle nach vorne stolperte.
Ihr Herz fing an zu klopfen.
Die Tür war nicht versperrt gewesen. Jetzt war sie sich sicher, dass etwas nicht stimmte. Sie trat in die Küche und nahm sofort einen ekelerregenden Geruch wahr. Verwesung? Kot? Sie unterdrückte den Reflex, sofort das Haus zu verlassen, überlegte, Malte doch zu wecken, als sie ein Geräusch aus dem angrenzenden Wohnzimmer hörte. Ein leises Summen, wie von einem Radio, das keinen Sender empfangen konnte. War doch jemand im Haus?
»Hans? Anneliese?« Sabine rief sehr laut. »Kann ich reinkommen?«
Keine Antwort.
Zögernd ging sie durch die Küche. Der Gestank wurde noch intensiver, sie musste ein Würgen unterdrücken. Das Summen wurde lauter.
In dem Moment, in dem sie die Tür zum Wohnzimmer aufdrückte, fiel in ihren Gedanken alles an den richtigen Platz.
Die vertrockneten Blumen. Der Gestank, das Summen. Das Fehlen jeglichen Lebens.
Und das Bild, das sich ihr bot, war lediglich eine grausame Konsequenz des Ganzen.
4. Kapitel – Joe, Youssef, Josef
Samstag, fünf Tage zuvor
Der harte Rap dröhnte so laut aus den Lautsprechern des BMW, dass er die Vibrationen am Lenkrad spüren konnte. Der Mittelstreifen der A31 flog dicht an seiner linken Seite vorbei. Abbremsen. Wieder ein Penner, der, trotz seiner Lichthupe, im Schneckentempo herauszog, ihn ausbremste, statt seinem doch offensichtlich hoch motorisierten Wagen den Vortritt zu lassen. Als die lahme Gurke endlich wieder nach rechts zog, riss er, in Andeutung eines Stinkefingers, den Arm hoch und warf dem Fahrer einen wütenden Blick aus seinen fast schwarzen Augen zu. Dabei verriss er leicht das Lenkrad, eine Nanosekunde Panik, sofort wieder Kontrolle, Fuß auf dem Gaspedal wieder durchdrücken.
Mit der rechten Hand tastete er nach der Dose Red Bull, die über den leeren Beifahrersitz kullerte. Er umschloss sie, die Augen fest auf die Fahrbahn vor ihm geheftet, der Zeigefinger suchte den Verschluss, die Fingerkuppe schob sich unter das Metall, zog den Ring hoch, es zischte, keinen Tropfen verschüttet, geübt ist geübt.
Die Bahn vor ihm war jetzt frei, so konnte er gelassen wieder etwas vom Gas gehen, die Dose ansetzen und trinken.
Er schüttelte sich. Ekelhaft, pisswarm, ging gar nicht, aber dafür blieb er nach der schlaflosen Nacht wach.
Wieder die Augen starr nach vorne, rechten Fuß durchgedrückt.
Noch knapp zwei Stunden, dann wäre er da.
Joe, Youssef, Josef.
Sein Herz fing an zu pochen.
»Joe«, hatte er plötzlich Katrins Stimme im Ohr, »ich denke, es ist vielleicht besser, wenn ich mit den beiden Kindern eine Weile zu meinen Eltern ziehe.«
Das hatte sie vor einigen Wochen zu ihm gesagt. Als er in ihr schmales, schönes Gesicht schaute, sah er Angst in ihren Augen und Entschlossenheit um ihre Mundwinkel. Martin, ihr Vater, sein Schwiegervater, wartete schon im Auto vor der Haustür. Plötzlich sah er sich mit ihren Augen.
Youssef.
Der Türke mit den krummen Geschäften. Nicht mehr Joe, der Mann, in den sie sich verliebt hatte.
»Das habe ich für dich getan!«, schrie er das Lenkrad an und schlug darauf ein. Seine Kehle schnürte sich zu, das Herz raste. »Du wolltest doch ein Haus. Du wolltest die Auszeiten an der Küste, die Finca auf Mallorca, die Skiurlaube in den Weihnachtsferien!«, presste er hervor.
Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, er spürte, wie sein T-Shirt unter den Achseln nass wurde.
»Ey, Youssef, Bruder«, hatte er plötzlich die Stimme von Ali im Ohr. Leise, einschmeichelnd. »Ich glaube, du hast ein Problem, Bruder. Er will das Geld haben. Am besten noch diese Woche.«
Ali brauchte seinen Namen nicht auszusprechen, Youssef wusste, wer »Er« war. Einer, mit dem man sich nicht anlegen sollte.
Er musste aufstoßen, Galle stieg ihm in die Kehle hoch, plötzlich hatte er das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Geistesgegenwärtig warf er einen Blick in den Rückspiegel und über die Schulter, das Bordsystem zeigte ihm keine Gefahr an, er ging vom Gas, sah das »P« eines Parkplatzes.
Zwei Minuten später stand er. Stellte mit einem Ruck die Musik aus.
Sein Herz raste immer noch, es dröhnte in seinen Ohren, aber seine Atmung fing an sich zu beruhigen.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
Es war ungerecht, Katrin die Schuld in die Schuhe zu schieben. Im Grunde seines Herzens wusste er, dass er, als es eng geworden war, immer mit ihr hätte reden können. Schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Verkäufe rückläufig gewesen. Alle wollten auf einmal Elektroautos, wollten die Prämie vom Staat kassieren. Wieder schlug er auf das Lenkrad. Er hätte einfach nur mit ihr reden müssen! Dass man den Gürtel etwas enger schnallen müsse, einfach etwas weniger ausgeben. Er hätte seiner Frau vertrauen müssen, sie hätte ihm keine Vorwürfe gemacht, sie hätte sofort die Finca storniert. Hätte, hätte, hätte, dachte er wütend.
Aber nein. Dazu war er zu sehr Youssef. Türke. Macho.
Ali, der schon einige Jahre bei ihm seine Autos kaufte, hatte das gerochen. Man dünstet den Misserfolg wie kalten Schweiß aus. Vielleicht, weil man ein wenig zu freundlich, zu bemüht beim Kundengespräch ist.
»Ich hätte einen interessanten Auftrag für dich, falls du im Moment ein bisschen Zeit übrig hast.«
So fing es an.
Leicht verdientes Geld, nur Autofahren. Probefahrten, Testfahrten. Und dabei kleine Päckchen mitnehmen. Von Bahnhof zu Bahnhof.
Ein freundliches Arbeitsklima. So hätte er die Kontakte beschrieben, wenn er eine Google-Bewertung hätte schreiben müssen.
Wie dämlich er gewesen war! Fühlte sich als der große Youssef, war aber nur der kleine Josef. Eine Spielfigur, die Leute wie »Er« einfach wegwischen würden.
Befand er sich gerade richtig in der Scheiße, ja sogar in tödlicher Gefahr? Wusste »Er«, dass er eine Frau und zwei Töchter hatte? Wo sie sich aufhielten? Wie weit würden diese Typen für fünfundfünfzigtausend Euro gehen? Sollte er umdrehen und seine Familie außer Landes bringen?
Verdammter Mist! Wo sollte er innerhalb von ein paar Tagen fünfundfünfzigtausend Euro herkriegen?
Wieder stieg ihm Galle die Kehle hoch. Tränen schossen ihm in die Augen.
Er wollte seine Frau zurück. Wollte seine beiden Töchter zurück. Morgens in das verschlafene Gesicht von Katrin gucken, sich mit den Mädchen um die Zeit im Badezimmer streiten, abends das spielerische Handgemenge um den besten Platz auf der Couch.
Dann dieser irrwitzige Anruf seiner Eltern. Hans und Anneliese. Plötzlich wieder Josef, das adoptierte Kind türkischer Herkunft, einer der drei bunten Pudel in Mehrum.
»Josef, wir möchten mit euch reden. Mit euch allen dreien«, hatte Hans mit seiner immer noch vollen Stimme ins Telefon gedröhnt. »Es ist wichtig. Am Samstag. Bei uns im Haus.«
Joe konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt mit seinen Eltern gesprochen hatte. Kira war jetzt dreizehn, Meike elf Jahre alt. Hatten seine Eltern Meike überhaupt schon kennengelernt?
Bilder von seinen Adoptiveltern stiegen in ihm hoch. Hans. Groß, schlank, immer mit einem selbstbewussten, geschäftigen Gebaren. Anneliese. Kleiner, schlank, immer mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, aber streng und unnachgiebig, wenn es um ihre Prinzipien ging.
Er erinnerte sich daran, dass es eine Zeit in seiner Kindheit gegeben hatte, in der er so etwas wie Glück und Zufriedenheit verspürte. Anneliese las ihm jeden Abend vor, es gab Kakao, zubereitete Pausenbrote, Ballspiele im Garten. Irgendwann war Ahn, Anne, plötzlich dabei. Dann saßen sie nebeneinander und hörten gemeinsam beim Vorlesen zu. Im Kindergarten hatte er Annes unglaublich kleine und zarte Hand gehalten, sie leicht gedrückt, versucht, ihr Mut zu geben. Ein Lächeln aus ihren dunklen Mandelaugen hatte alles für ihn bedeutet.
Dann war auf einmal Jeremias dabei.
»Neger, Neger, Schornsteinfeger!«, rief ein Junge im Kindergarten. Und weil Jeremias angefangen hatte zu weinen, hatte er, Josef, diesem Jungen einfach seine Faust ins Gesicht geschlagen.
War das der Wendepunkt in der Beziehung zu seinen Adoptiveltern gewesen? Nein, bestimmt nicht. Aber ab da verschwand seine Erinnerung in einer diffusen Masse aus Streit, Geschrei, Hausarrest, Gespräche mit Lehrern, zugeschlagenen Zimmertüren. Mittlere Reife mit Ach und Krach. Bundeswehr. Verpflichtung für vier Jahre, dort in Quakenbrück Katrin kennengelernt. Schon bevor er beschlossen hatte, in Niedersachsen zu bleiben, hatte er kaum noch Kontakt zu Hans und Anneliese gehabt. Nachdem Katrin ihm dann einmal auf den Kopf hin zugesagt hatte, er sei wie ausgewechselt, wenn er bei seinen Eltern gewesen war, schlecht gelaunt, wortkarg und unruhig, stellte er die Besuche und Telefonate ganz ein.
Auf einmal hatte er den Garten in Mehrum vor Augen. Den alten Kirschbaum, auf den er so toll klettern konnte. Das Haus lag in der Nähe des Deiches, wie alle Häuser in Mehrum. Er hatte es geliebt, am Ufer des Rheins zu spielen.
Sie lebten anscheinend immer noch in dem riesigen Bau. Wie alt waren sie jetzt? Er überlegte. Hans hatte immer erzählt, dass er als Achtjähriger den Rheinübergang der alliierten Mächte miterlebt habe. Fünfundvierzig minus acht gleich siebenunddreißig. Fünfundachtzig. Hans war jetzt fünfundachtzig Jahre alt und Anneliese ein Jahr jünger.
Was war so wichtig, dass sie ihn, sie alle drei, so bestimmt zu ihnen zitiert hatten?
Nun ja. Irgendwann mussten die beiden Alten ja ihre Angelegenheiten regeln. Vollmachten und so.
Und er, sie, waren schließlich adoptiert.
Vielleicht erwartete ihn an diesem Abend die Lösung seiner Probleme.
5. Kapitel
Mittwoch, fünf Tage später
Während Rolf versuchte, die völlig aufgewühlte, zitternde Sabine zu beruhigen, schritt Skalecki mit großen Schritten zu ihrem Auto und nahm aus dem Kofferraum Überzieher für die Schuhe und ein Paar Einweghandschuhe. Eigentlich hatte sie die Sachen für die Renovierungsarbeiten eingepackt. Dann lief sie weiter zu dem Haus, das Sabine ihnen beschrieben hatte. Sie glaubte keine Sekunde, dass ihre zukünftige Nachbarin sich einen Scherz erlaubte oder sich getäuscht hatte, wollte aber erst mit eigenen Augen sehen, was Sabine nur stotternd, von Schluchzern unterbrochen, erzählt hatte, bevor sie weitere Kollegen anforderte.
Die Kommissarin hatte nur »Täufners«, »hängen« und »es stinkt so furchtbar« verstanden. Sie befürchtete Schlimmes.
Bilder von alleinlebenden, einsamen Menschen, deren Tod oft erst nach Tagen, Wochen oder Monaten bemerkt wurde. In einer so großen Stadt wie Duisburg leider nicht selten. Immer wurde die Kripo hinzugezogen, deswegen hatte Skalecki schon einiges gesehen und fühlte sich innerlich gewappnet.
Aber was sie nur wenige Momente später in dem alten, aber geschmackvoll renovierten Haus sah, war doch schockierender als viele Tatorte, die sie bisher gesehen hatte.
Schon vor der Terrasse, über die auch Sabine gegangen war, streifte Skalecki die Plastiktütchen über ihre Sneaker und zog die dünnen Einweghandschuhe an. Sofort fingen ihre Hände an zu schwitzen. Mit weit ausholenden Schritten lief sie über die Terrasse, drückte mit einem Finger die Terrassentür auf und ging vorsichtig, aber zügig weiter durch die Küche zu der einzigen Tür, die sich dort befand. Der Geruch, der ihr fast den Atem nahm, und das Summen, das sie hörte, waren ihr vertraut. Sie atmete flach durch den Mund. Sie überlegte, gar nicht erst weiterzugehen, um einen möglichen Tatort nicht weiter zu kontaminieren, dachte aber dann an die Fragen, die die Kollegen bei dem Anruf vielleicht schon stellen würden. Ebenfalls wieder mit nur einem Finger drückte sie die Küchentür auf, die in das Wohnzimmer schwang.
Der Gestank schlug ihr wie eine Faust ins Gesicht. Sie presste kurz die Augen zusammen, aber das Negativ dessen, was sie in der einen Sekunde in dem sonnendurchfluteten Wohnzimmer gesehen hatte, hatte sich schon auf ihre Netzhaut gebrannt.
Wie zwei riesige Früchte baumelten zwei Personen an Seilen von einem Dachbalken, der dekorativ durch das Wohnzimmer ging. Da sich die Haut der Leichen schon verfärbt hatte, schätzte Skalecki, dass die beiden schon ein paar Tage dort hingen. Der starke Fäulnisgeruch und die rege Tätigkeit der Fliegen schienen ihre Annahme zu bestätigen.
Genauer würde es ihr Ricken, der zuständige Rechtsmediziner, sagen können.
6. Kapitel – Ahn, Anne
Samstag, fünf Tage zuvor
Ahn hatte die Augen geschlossen und ihren Kopf gegen das Polster des Sitzes gelehnt. Ihre AirPods schirmten sie zusätzlich von der Außenwelt ab. Sie liebte es, erster Klasse in einem ICE zu reisen, nichts war komfortabler.
Sie hatte sich gegen Musik entschieden. Die leicht jazzigen Töne, die sie eigentlich sehr mochte, würden sie heute nicht ablenken, deswegen hörte sie einen Podcast zum Thema Liebesromane. Nicht dass sie vorhatte, jemals so etwas wie einen Liebesroman zu lesen, aber dieses für sie völlig uninteressante Thema hatte große Chancen, keine Panikattacke in ihr aufkommen zu lassen. Wenn das nicht helfen würde, könnte sie zu einem Podcast über Hochseefischen wechseln. Genauso uninteressant und beruhigend langweilig.
Gott sei Dank dauerte die Fahrt von Frankfurt nach Voerde nicht sehr lange. Von Voerde nach Mehrum zu kommen, gestaltete sich da schon schwieriger, aber Joe würde sie in Duisburg am Bahnhof abholen.
Sie rechnete damit, spätestens mit dem letzten Zug wieder nach Frankfurt zurückzufahren. Anneliese und Hans hatten ihr unmissverständlich klargemacht, dass eine Übernachtung bei ihnen zu anstrengend für sie sei. Natürlich. Für ein Kaffeetrinken von Frankfurt nach Mehrum und zurück zu pilgern war natürlich nicht anstrengend.
Ihr Sitznachbar, ein stark übergewichtiger Mann, stieß ihr mit seinem Ellenbogen in die Seite. Mit aufrichtigem Bedauern in seinem Blick entschuldigte er sich – wahrscheinlich jedenfalls, Ahn konnte es nicht hören, sah nur seine Lippenbewegung und sein Lächeln. Sie senkte nur kurz, zum Zeichen ihres Verzeihens, ihre Augenlider, bevor sie wieder aus dem Fenster schaute.
»Dieser Roman ist so zauberhaft! Die Autorin schafft es auf ihre unnachahmliche Art …«, lullte die vor Aufregung förmlich quietschende Moderatorin Ahn fast ein, doch plötzlich überlagerten Ahns Gedanken genauso kreischend die Stimme. Fünfundvierzigtausend Euro musst du beschaffen, um aus diesem Moloch herauszukommen … Erschreckt riss Ahn sich die AirPods aus den Ohren und nestelte an ihrem iPhone herum. Jetzt bitte keinen Blutdruck, langsam ein- und ausatmen. Dabei konzentrierte sie sich auf ihre Hände.
Wie alles an ihrem Körper waren ihre Hände klein und schmal. Trotz ihrer zweiundvierzig Jahre sahen sie noch immer wie Kinderhände aus. Genau wie ihre knabenhafte Figur, ihr braver Zopf und ihre schmalen, mandelförmigen Augen. Wenn sie anderen Menschen Kinderbilder von sich zeigte, lachten diese immer, erstaunt darüber, wie wenig Ahn sich verändert hatte. Dabei fühlte sie sich steinalt. Ständig hatte sie das Gefühl, riesige Steine mit sich herumzuschleppen, die sie nicht vorankommen, ja sogar auf der Stelle treten ließen.
Schon als Hans und Anneliese sie nach Deutschland in das große Haus geholt hatten und ihr Joe, Josef, vorstellten, hatte sie gefühlt, wie falsch das war. Obwohl sie gerade einmal zwei Jahre alt gewesen war. Musste sich daran gewöhnen, dass sie jetzt Anne war und nicht mehr Ahn. Konnte nicht den Ballast ihres bisherigen Kinderlebens abschütteln. Joe war nicht ihr Bruder, sie hatte einen anderen, echten gehabt; Hans und Anneliese nicht ihre Eltern, die waren von einem Tag auf den anderen weg. Die einzige Erinnerung an sie war eine riesengroße Explosion. Die vietnamesischen Behörden konnten nie herausfinden, wer für den Tod ihrer Eltern verantwortlich gewesen war, letztendlich waren sie nur ein Einzelschicksal in einem Land, das sich nach Jahrzehnten der Fremdherrschaft und des Krieges erst langsam wieder stabilisierte.
Wegen ihres asiatischen Aussehens sah jeder im Dorf und später auf der Schule sofort, dass sie adoptiert war. Andere Mädchen wollten mit ihr befreundet sein, sie war eine Exotin, war interessant. Auch das fühlte sich falsch an. Sie hasste es, wenn andere sie »beschützen« wollten, sich vor sie stellten. Ihr Lächeln wurde leise und unecht, sie teilte keine Geheimnisse, ließ sich an den Rand drängen. Später wurde Ahns Hochbegabung zum Problem. Ohne jemals auch nur eine Minute lernen zu müssen, war sie überall Klassenbeste, sogar in Sport und Kunst. Das machte sie unbeliebt. Nur ihre »Brüder«, Joe und Jeremias, akzeptierten sie so, wie sie war. Anneliese und Hans akzeptierten nur ihre guten Noten, schleppten sie aber wegen ihres nicht vorhandenen Sozialverhaltens von einem Therapeuten zum anderen. Meldeten sie im Chor und beim Volleyball an, damit sie lernte, mit anderen Menschen zu interagieren.
»So sind sie, die Asiaten. Kühl. Anders. Müssen immer ihr Gesicht wahren.« Wenn Ahn diesen klischeehaften Satz hörte, hätte sie am liebsten ihr Essen aus ihrem zierlichen, kleinen Mund herausgespien.
Zielstrebig bewarb sie sich nach dem Abitur an der von Mehrum am weitesten entfernten Universität. München. Das war ihr erster Schritt, den Kontakt zu ihren Adoptiveltern einzuschränken.
Aber trotz ihrer überragenden Fähigkeiten im Umgang mit allem, was mit Computern und Informatik zu tun hatte, machte sie nie die richtig große Karriere.
Wegen ihres nicht vorhandenen Sozialverhaltens.
Kein männlicher »Förderer« mag es, von einer wie ein Kind aussehenden jungen Frau auf seine Fehler bei der Programmierung einer neuen Software hingewiesen zu werden. Kein männlicher Vorgesetzter mag es, wenn eine mit einer Rüschenbluse und einem Chanel-Kostüm gekleidete junge Frau bei einem geschäftlichen, geselligen Beisammensein nur Orangensaft trinkt, hauchzart lächelt und ansonsten kein Wort sagt.
Männer, die sie näher an sich heranließ, irritierten sie erst, dann stießen sie sie ab. Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis sie Ahn rosa Unterwäsche mit irgendwelchen Katzenmotiven schenkten, die sie doch bitte tragen sollte.
Sie begann, eigene Programme zu schreiben, und lernte im sich immer weiterentwickelnden Internet endlich Gleichgesinnte kennen, denen es egal war, ob sie eine Frau, eine Asiatin oder sonst was war.
Dann zog sie nach Frankfurt, kaufte sich eine Eigentumswohnung. Zu Hans und Anneliese hatte sie mittlerweile fast gar keinen Kontakt mehr. In Frankfurt arbeitete sie bei einer Privatbank und betreute dort den Bitcoinhandel. Ihr Plan war, mit einem befreundeten Programmierer ein eigenes Start-up zu gründen.
Dazu brauchten sie allerdings Geld.
Und für das Kokain, das das Geräusch der Explosion in ihrem Kopf dämpfte und sie nachts wach hielt, um arbeiten zu können.
Geld, das sie sich von ihrem Arbeitgeber »ausgeliehen« hatte.
Sie hatte nur ein Zeitfenster von ein paar Monaten, in dem sie das veruntreute Geld der Privatbank unbemerkt zurückbuchen konnte. Und da die Balance aus ihrem Gehalt, ihren Ausgaben und den Rücklagen schon längst aus dem Gleichgewicht und somit ihr Plan völlig aus den Fugen geraten war, hatte sie ein Problem.
Wenn Ahn nicht die fünfundvierzigtausend Euro zurückbuchte, würde eine sofortige Strafanzeige folgen. Damit wäre sie erledigt.
Ob Joe ihr aus der Klemme helfen könnte? Er hatte ein Autohaus für »Angeberkarren«, wie Jeremias immer sagte. Aber dann müsste sie zugeben, dass sie ihr Leben nicht im Griff hatte.
Ahn schloss die Augen, atmete durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ihr Magen zog sich zusammen, nein, bitte nicht würgen. Ausatmen. Gar nicht atmen.
Sie hatte sich im Griff und würde das Problem lösen.
Sie ging davon aus, dass Hans und Anneliese mit ihnen über ihre Pläne für die Zukunft reden wollten. Die beiden erwarteten bestimmt nicht, dass einer von ihnen zu ihnen ziehen und sie pflegen würde. Aber wenn sie in ein Heim gingen, würde das Haus für die Unterbringungskosten herangezogen werden.
Unangenehmer Gedanke.
Das schöne, große Haus in bester Lage.
7. Kapitel
Mittwoch, fünf Tage später
Eine gute halbe Stunde später war das Haus der Täufners voller Menschen.
Skalecki hatte einen Notarzt gerufen, obwohl ihr nach über dreißig Jahren Polizeidienst diese Notwendigkeit immer noch wie ein zynischer Scherz der Bürokratie vorkam. Die beiden Menschen waren tot; um das festzustellen, brauchte es keinen Arzt.
Dieser war, wie erwartet, auch schnell wieder abgefahren.
Freddie Neumann hatte den fassungslosen Schlüter mitgebracht. Kurz überlegte Skalecki, ihn wieder wegzuschicken, der Polizeihauptkommissar war sichtlich erschüttert.
»Ich kannte Hans und Anneliese mein Leben lang«, sagte er kopfschüttelnd, »ich wusste nicht, dass es ihnen so … schlecht ging.«
»Wie meinst du das?«, fragte die Duisburger Kommissarin.
Sie stand mit Schlüter und Freddie im Garten des Hauses. Drinnen machten die Kollegen der Kriminaltechnik ihre Arbeit, für die Polizisten hieß es jetzt: warten.
»Na, dass sie sich dazu entschieden haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen«, erklärte Schlüter.
Ein Ende zu setzen. Wie ein Schlusspunkt, dachte Skalecki. Hatten sie und Rolf sich auch deswegen entschlossen, in die Nähe ihrer Freunde zu ziehen? Damit sie nicht … Sie wollte diesen Gedanken nicht weiterdenken, konzentrierte sich wieder auf ihre Kollegen.
»Haben, hatten sie Kinder?«, wollte Freddie wissen und schaute sich um, als ob er welche in der Nähe ausmachen könnte.
Schlüter nickte. »Ja, drei erwachsene Kinder. Zwei Jungen und ein Mädchen. Aber sie leben nicht hier, also«, fügte er erklärend hinzu, »weiter weg.«
»Wir müssen sie benachrichtigen«, sagte Skalecki, »kennen sie dich? Vielleicht kannst du das erledigen?«
»Ich habe keinen Kontakt zu ihnen, auch früher schon nicht. Sie sind jünger als ich«, antwortete Schlüter und überlegte kurz. »Josef. Anne. Der dritte fällt … Jeremias!«, rief er dann aus und nickte zufrieden. »Ich versuche mal, in unserem Rechner die Kontaktdaten herauszufinden. Soll ich sie hierhin kommen lassen?«
»Klar«, brummte Skalecki, »natürlich. Die müssen doch sowieso kommen und die Formalitäten erledigen.«
8. Kapitel – Eremias, Jeremias
Samstag, fünf Tage zuvor
Hätte er geahnt, wie voll der ICE sein würde, hätte er sich eine Platzreservierung gegönnt. So musste er schon seit Hamburg im Gang stehen, eingeengt zwischen den Massen von anderen Reisenden.
Stillstehen. Nicht seine Königsdisziplin.
Immerhin war das Internet ziemlich stabil, sodass er mit Philine schreiben konnte. Er hätte sie gerne mitgenommen, um sie Hans und Anneliese vorzustellen, aber sie hatten es nicht gewollt. »Wir wollen über Familienangelegenheiten reden«, hatte Hans gesagt.
Wahrscheinlich hätte Philine Hamburg sowieso nicht verlassen dürfen. Wenn er daran dachte, wurde ihm ganz schlecht. Er war froh, dass seine Adoptiveltern nicht verlangten, dass er das ganze Wochenende blieb. So würde er am nächsten Morgen hoffentlich wieder in Hamburg sein.
An die leicht ruckelnde Wand des Waggons gelehnt, starrte er aus dem Fenster. Der Zug fuhr durch eine ländliche Gegend, ganz ähnlich wie der Ort, in dem er aufgewachsen war.
Mehrum.
Wenn er und Philine ein Kind bekommen würden, würde er den Kontakt zu Hans und Anneliese vielleicht wiederherstellen. Sie würden sich bestimmt über ein weiteres Enkelkind freuen. Wenn das alles in Hamburg überstanden war, würden er und Philly auf jeden Fall von dort wegziehen. So weit weg wie möglich.
Er betrachtete Philines Profilbild und spürte, dass er wie ein verliebter Idiot grinste.
Niemals hätte er gedacht, dass es ihn so erwischen könnte. Dass er alles für eine Frau tun würde, ja sogar an Kinder dachte!
Seit seiner Kindheit wurde er von den Frauen umschwärmt. Mit seiner kaffeefarbenen Haut und den schwarzen Locken, die sein Gesicht umrahmten, brachte er jede Frau zum Lächeln. Schon als er ein kleiner Junge war und seinen neuen Namen kaum aussprechen konnte – Hans und Anneliese bestanden auf »Jeremias« und nicht »Eremias« –, suchten die gleichaltrigen Mädchen seine Nähe. Obwohl er keine Minute still sitzen konnte, hatte er bald den Ruf, ein guter Zuhörer zu sein. Und wenn aus dem guten Zuhören und der tröstenden Umarmung mehr wurde, machte ihm keines der Mädchen Vorwürfe, wenn er sie nicht zur festen Freundin haben wollte.
Seine deutsche Mutter hatte ihn im Alter von zwei Jahren zur Adoption freigegeben. An sie hatte er kaum Erinnerungen, und seinen afrikanischen Vater hatte er nie kennengelernt. Aber wenn er auf seine Herkunft angesprochen wurde, sagte er immer, dass seine Mutter die Schwarze gewesen war und sein Vater der Weiße. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass seine weiße Mutter so nicht als Schlampe abgestempelt wurde, die sich mit einem Afrikaner eingelassen hatte, und sein Vater nicht als Afrikaner, der sowieso die deutschen Frauen nur ausnutzte. Dass seine erfundene schwarze Mutter von einem fiktiven Deutschen im Stich gelassen worden war, fühlte sich für ihn besser an.
Bei diesem Gedanken zog sich wieder sein Herz zusammen, weil er sofort wieder an Philine denken musste. An ihre Haut, die wie schwarzer Lack glänzte. An die Traurigkeit in ihren Augen, die manchmal unendlich und unrettbar schien.
Schnell steckte er sein Smartphone weg, schaute wieder angestrengt aus dem Fenster. Ruhig weiteratmen, er würde eine Lösung finden.
Die Lösung waren fünfzigtausend Euro.
Dafür hatte er bis Mittwoch Zeit.
Wenn er es nicht schaffte, das Geld aufzutreiben oder seine Bank davon zu überzeugen, ihm einen Kredit in dieser Höhe zu geben, würde Philine ab Donnerstag wieder anschaffen müssen. Das durfte, das würde er nicht zulassen.
Bisher war er immer ein Mensch gewesen, der keine hohen Ansprüche an das Leben stellte. Im Gegensatz zu Joe oder Ahn waren ihm teure Autos und schicke Designerklamotten total egal. Nachdem er mit Ach und Krach sein Fachabitur geschafft hatte, dank Anneliese, die ihn mit hartnäckiger und energischer Geduld durch jedes Schuljahr schob, entschied er sich gegen den Wehrdienst und für den Zivildienst. Auch dort flogen ihm die Herzen der alten Bewohner, jungen Pflegerinnen und Pfleger zu. Die meisten Nächte verbrachte er nicht mehr zu Hause. Hans und Anneliese missbilligten seinen lockeren Umgang mit der geschlechtlichen Liebe zutiefst, so entfernte er sich immer mehr von seinen Adoptiveltern. Auch die dörfliche Enge bedrückte ihn. Als Kind musste er die Blicke und Bemerkungen zu seiner dunklen Hautfarbe akzeptieren, als Erwachsener nicht mehr. Ein Studium der Sozialpädagogik mitten im Ruhrgebiet brachte ihm die erwünschte Freiheit. Dann die Stelle als Streetworker in Hamburg. Leben von der Hand in den Mund, Sekt und Selters, Hummer und Hamburger, ganz nach Lust und Liebe.
Er versuchte, längere und tiefere Beziehungen aufzubauen. Was aber nicht funktionierte. Kurz nach dem Zusammenziehen wurde es ihm immer zu eng, und er bereitete behutsam den Rückzug vor.
Dann blickte er in Philines Augen. Nie zuvor hatte er so etwas empfunden. Sein Herz fing an zu klopfen, sein Magen überschlug sich.
Leider »gehörte« Philine einem Zuhälter, der sie nur gegen Geld freigeben würde. Da konnte auch die Beratungsstelle, an die Philly sich gewendet hatte, nicht helfen. Philine war eine Schönheit, dazu jung und schutzlos. Aber für fünfzigtausend Euro würde der Zuhälter sie laufen lassen. »Ein Freundschaftspreis, weil ich dich mag«, hatte er höhnisch gesagt. Nie zuvor hatte Eremias einem Menschen die Faust in das schmierige Grinsen rammen wollen. Er hatte nur genickt. »Aber ich nehme sie jetzt schon mit.«
»In einer Woche will ich das Geld. Hast du es dann nicht, muss sie wieder ran«, er hatte gegrinst, »und die Woche wieder reinholen. Also ’ne Weile Doppelschichten. Und komm ja nicht auf dumme Ideen. Wir wissen, wo du wohnst und wer deine Freunde sind.«
Eremias war schlecht geworden, aber er hatte wieder nur genickt.
Das erste Mal in seinem Leben ärgerte er sich über das Leben, wie er es bisher geführt hatte. Keine Rücklagen gebildet, nicht in eine Eigentumswohnung investiert. Keine Karriere in einer Institution gemacht, Verantwortung und Schreibtischkram abgelehnt. Er hatte gedacht, dass es kein Problem sei, fünfzigtausend Euro von der Bank zu bekommen, aber man hatte ihn mit bedauerndem Lächeln mitgeteilt, dass sein Gehalt als Sicherheit nicht reichte. Man bräuchte noch Zeit, seinen Antrag zu prüfen. Zeit, die er nicht hatte.
Bisher hatte es ihn nie interessiert, wie vermögend Hans und Anneliese waren. Ob er sie um so viel Geld bitten könnte oder wenigstens um einen Teil davon. Eremias fühlte sich sehr unbehaglich bei dem Gedanken, seine Adoptiveltern nach so langer Zeit, in der er sich nicht gemeldet hatte, um Geld zu bitten. Er hätte es vielleicht auch gar nicht in Erwägung gezogen, wenn Hans am Donnerstag nicht angerufen und ihn und seine Stiefgeschwister nach Mehrum beordert hatte.
Der Zug fuhr in einen Bahnhof ein. Eremias schob sich vorsichtig entgegengesetzt an den Passagieren, die den Zug verlassen wollten, vorbei und suchte sich einen Sitzplatz, der nicht reserviert war. Er fand einen und fragte die Frau, die dort mit einem kleinen Baby in einem Tuch vor sich gebunden saß, ob dort noch frei sei, was sie mit einem breiten Lächeln bestätigte. Als er seinen Rucksack auf die Gepäckablage legte, rutschte sein T-Shirt etwas hoch. Mit einem verstohlenen Blick sah er, wie die Frau ihn wohlwollend musterte. Ihrem Äußeren nach, sehr dunkle Haare, ein dichter Kranz aus langen Wimpern um die schwarzen Augen und einer eher ausgeprägten Nase, vermutete er, dass sie Türkin war. Noch vor drei Wochen wäre er nach ein paar Minuten in ein Gespräch mit ihr vertieft gewesen. Heute wollte er nur in Ruhe nachdenken.
Schon kurze Zeit später störte der Zugbegleiter seine Überlegungen. Er und seine Nachbarin hielten ihm beide ihre Handys hin, auf denen ihre digitalen Zugfahrkarten zu sehen waren. Seine Nachbarin grinste wieder breit und zeigte dabei ihre perfekten, weißen Zähne.
Auf jeden Fall besaßen Hans und Anneliese viel Land. Vielleicht würden sie, wenn sie nicht genug Geld auf der Bank hatten, etwas davon verkaufen? Immerhin hatten sie drei Kinder adoptiert, die aus schwierigen Verhältnissen gekommen waren, also waren sie im Herzen doch gut? Sie würden doch nicht wollen, dass die Frau, die ihr … Sohn liebte, keine Chance bekam und als Prostituierte missbraucht wurde?
9. Kapitel
Mittwoch, fünf Tage später
»Ich habe die Kinder von Täufners schon ewig nicht mehr hier gesehen«, überlegte Schlüter weiter. Freddie und Skalecki merkten, wie sehr ihn der Tod der beiden alten Mehrumer mitnahm. »Alle drei sind von den beiden«, Schlüter deutete vage zum Haus, »adoptiert worden, als sie noch kleine Kinder waren. Alle drei sind … ausländisch, also, nicht deutsch.«
»Kanntest du das Ehepaar gut?«, wollte Skalecki wissen.
Schlüter zuckte mit den Schultern. »So gut, wie man sich hier auf dem Dorf kennt. Man kennt sich eben. Meistens ein Leben lang. Freundschaftlich haben Susanne und ich nicht mit denen verkehrt, die sind ja auch viel älter als wir, aber«, wieder zuckte der Polizist mit den Schultern, »man weiß einiges voneinander. Mein Vater ist mit Hans zusammen in der Schule gewesen. Ich muss ihn mal fragen, ob er sich erklären kann, warum die beiden den Freitod gewählt haben.«
»Warum gehst du so sicher davon aus, dass sie Suizid begangen haben?«, hakte Skalecki nach.
Schlüter runzelte die Stirn, auch Freddie schaute seine Kollegin fragend an. »Na«, Schlüter guckte verunsichert von Skalecki zu seinem alten Freund und Kollegen Freddie Neumann, »also, da bin ich jetzt von ausgegangen … ein erhängtes, altes Ehepaar …«
»Ich war bisher nur kurz in dem Wohnzimmer, wo die beiden hängen, konnte mich auch noch nicht richtig umsehen. Also«, Skalecki presste die Lippen aufeinander, zögerte, »wir werden natürlich alles genau untersuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, keinen Stuhl oder so gesehen zu haben.«
»Stuhl?«, wunderte sich Schlüter. »Was meinst du?«