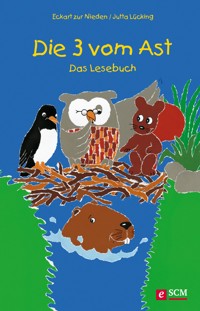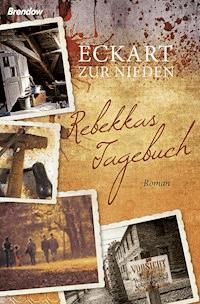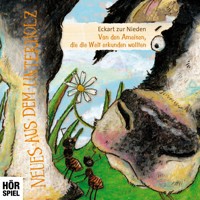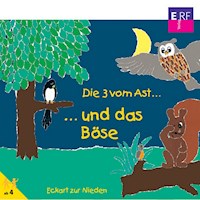Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Eschenrode brennen zwei Häuser – und jedes Mal kommt ein Mensch ums Leben. Der junge Gemeindepfarrer ist erschüttert und fragt sich: Wer steckt dahinter? Was geht hier vor? Die Spur führt zu einem Mann, der erst vor wenigen Tagen nach dreißig Jahren Abwesenheit in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Doch das Dorf, das er einst verließ, ist nicht mehr dasselbe. Die vertrauten Bilder seiner Erinnerung passen nicht zu der Realität, die ihn nun empfängt. Während er mit diesen Veränderungen ringt, sorgt seine Rückkehr für Unruhe – eine Unruhe, die nicht nur die Dorfgemeinschaft erschüttert, sondern auch verborgene Fragen ans Licht bringt. Es geht um mehr als nur die Brände. Was gibt Halt im Wandel der Zeit? Was ist der Sinn des Lebens? Wohin führt der Weg? Die Antworten darauf werden für das ganze Dorf zur Herausforderung – und zur Chance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brandstiftung in Eschenrode
Eckart zur Nieden
Impressum
© 2014 Folgen Verlag, Wensin
Autor: Eckart zur Nieden
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Mark Rehfuss, Schwäbisch Gmünd
ISBN: 978-3-944187-59-4
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt:[email protected]
Brandstiftung in Eschenrode ist früher als Buch im Christlichen Verlagshaus, Stuttgart, erschienen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 1
»So«, sagte der junge Pfarrer, als er die Sakristei betrat, »das hätten wir.«
Eine merkwürdige Art, eine Beerdigung abzuschließen, dachte der ältere Küster, während er die Tür schloss. Dann half er dem Pfarrer aus dem Talar. »War eine gedrückte Stimmung, nicht wahr?«
»Ja, sehen Sie, Herr Maurer, das ist bei Beerdigungen nicht ungewöhnlich.«
Der Küster merkte die Ironie, fühlte sich aber nicht gereizt. Eher tat ihm der Pfarrer leid, der sich offenbar schwer tat zu spüren, was die Leute dachten. Und er fühlte sich verantwort-lich, es ihm zu sagen: »Das meine ich nicht, Herr Pfarrer. Es ist etwas anderes. Die Leute sind alle voller Angst. Wenn so ein verrückter Kerl zweimal Feuer gelegt hat, wird er es auch ein drittes Mal tun. Bei dem Gedanken schläft man schlecht. Aber es ist nicht nur das. Es ist ... Ja, was soll ich sagen? Mag sein, dass es mit dem Gewissen zusammenhängt oder so.«
»Weil die alte Frau Hahn so einen schrecklichen Tod hatte?«
»Das mag mitgespielt haben. Aber auch wegen der anderen schrecklichen Vorgänge hier in Eschenrode. Die zwei Brände. Und was da so alles ... Sie haben ja gesehen: Das ganze Dorf kam zur Beerdigung. Das hat alle ziemlich mitgenommen. Und Sie werden sehen, wenn Sie morgen den Ernst Göbel begraben, dann kommen noch mehr Leute.«
»Ist ja auch ein tragischer Tod gewesen. Bei uns drüben in Dutenhausen ist viel davon erzählt worden. In der Zeitung hab’ ich natürlich auch davon gelesen. Sie haben den Brandstifter immer noch nicht – oder?«
»Nein, jedenfalls habe ich nichts gehört.«
»Wer mag das wohl gewesen sein?«
»Ich sage dazu nichts!«, antwortete der Küster, mehr zu sich selbst.
»Warum nicht?«
»Man soll niemand beschuldigen, wenn seine Schuld nicht bewiesen ist. Besonders bei so was, wo zwei Menschen umgekommen sind.«
»Hoffentlich finden sie ihn bald.«
»Man sieht die Polizei ja schon überall rumschnüffeln. Auf der Beerdigung waren sie auch, in Zivil natürlich. Morgen werden sie sicher auch da sein, wenn sie bis dahin nicht zugegriffen haben.«
»Ich werde mir ein paar gute Worte überlegen müssen. Schade, dass ich so wenig über diesen Göbel weiß. Es hieß, er hätte keine Verwandten. Wer kann mir denn etwas über ihn erzählen?«
Der Küster ging auf die Frage gar nicht ein. Wie kann ich ihm nur klarmachen, dachte er, während er sich umdrehte und endlich den Talar auf den Bügel hängte – wie kann ich ihm nur klarmachen, dass das nicht genügt? Dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Dass alle im Dorf von Fragen umgetrieben werden, auf die sie Antworten suchen. Dass alle darauf warten, ausgesprochen zu hören, was sie unausgesprochen bewegt!
Dann erst kam ihm die Frage des Jüngeren ins Bewusstsein. »Erzählen? Ja, das wird schwierig sein. Im Grunde weiß keiner so richtig über ihn Bescheid. Er ist ja sehr, sehr lange nicht hier gewesen. In Afrika hat er gelebt. Und erst vor kurzem ist er wiedergekommen.«
»Aber an irgendjemand muss ich mich doch wenden können! Wenn die Sache so wichtig ist, wie Sie sagen ... Ich glaube Ihnen das ja. Aber wie soll ich mir denn ein Bild machen, wenn mir niemand Genaueres erzählen kann?«
»Ein Mosaik müssen Sie sich machen! Ein Mosaik: Die Steinchen müssen Sie suchen und selbst zusammensetzen. Ihnen kann sicher keiner alles erzählen, aber viele können Ihnen etwas berichten. Sie müssen mal rumfragen.«
»Hm«, machte der Pfarrer und ließ sich auf den einzigen Stuhl fallen. Dann noch einmal: »Hm. Eigentlich hab’ ich ja nicht so viel Zeit. Aber irgendwie beginnt mich die Geschichte zu interessieren. Und es gehört ja eigentlich auch zu meinen Pflichten.«
Dann sah er den Küster gerade an. »Können Sie mir nicht etwas erzählen? Sie kennen ihn doch auch noch von früher.«
»Kaum. Er ist doch ein anderer Jahrgang. Aber Sie könnten die Elke fragen, dem Franz Liese seine Frau. Die sind früher mal zusammen gegangen.«
»Vom Fabrikanten Liese die Frau? Denen das Lager abgebrannt ist?«
»Ja, die. Aber ich könnte Ihnen auch etwas erzählen.« »Na, dann erzählen Sie doch mal!«
»Es hat eigentlich nicht direkt mit Ernst Göbel zu tun. Ein bisschen schon. Es geht um den ersten Brand. Manche munkeln ja, Ernst wäre der Brandstifter gewesen. Das ist natürlich Unsinn, wenn Sie mich fragen. Aber irgendwie hängt das sicher alles zusammen.«
Plötzlich fiel dem Pfarrer ein, dass er vielleicht dem Älteren den einzigen Stuhl anbieten sollte, wenn sich das Gespräch nun noch eine Weile hinzog. »Möchten Sie sich setzen?«, fragte er und stand auf, ärgerte sich aber dann doch ein wenig, als der Küster als der Rangniedrigere in der kirchlichen Hierarchie das Angebot auch tatsächlich annahm. »Danke«, sagte er und setzte sich.
Jetzt aber erwies sich, dass das gut war, denn es regte offenbar seine Erinnerung an. Der Küster rückte den Stuhl gerade vor den kleinen Tisch und lehnte sich mit den Unterarmen darauf.
Dann begann er: »So saßen wir im Wirtshaus, beim Karl. Hier saß ich, da saß der Franz – Franz Liese, der Fabrikant. Und da drüben – nein, mehr hier – na, ist ja auch egal, also jedenfalls: Da saß der Otto. Otto Frese, unser früherer Bürgermeister.
Übrigens sind die beiden ein Jahrgang und auch genauso alt wie Ernst Göbel, den Sie morgen beerdigen. Die sind früher Freunde gewesen und in eine Klasse gegangen. Dicke Freunde sogar. Na, das nur nebenbei.
Jedenfalls sitzen wir da und langweilen uns eigentlich ein bisschen. Vorher haben wir uns über Ernst unterhalten, der ja gerade ins Dorf gekommen war. Aber wir wussten nicht recht, was wir von ihm halten sollten. Und dann waren wir in einigen Dingen auch ziemlich unterschiedlicher Meinung. Da wir uns nicht streiten wollten, hatten wir das Thema abgesetzt.
Es ist schon spät, und ich sage, ich will nach Hause gehen. Da sagt Otto: ›Bleibt doch noch ein bisschen!‹ und hält sein leeres Bierglas in die Höhe, als Zeichen für Karl, den Wirt, dass er noch ein volles bringen soll. ›Ihr müsst euch doch nicht mehr bei Muttern melden, wenn es dunkel geworden ist‹, sagt er. Er betont das manchmal extra so, weil er weiß, dass man von ihm sagt, seine Frau ließe ihn nicht gerne gehen. Das stimmt wohl auch und ist auch verständlich. Aber jeden Donnerstag ist er wieder da.
Alles, was dann kam, wäre sicher anders gelaufen, wenn er das nicht gesagt hätte. Aber was heißt das schon. Alles im Leben wäre schließlich anders gekommen, wenn irgendwo in der Vergangenheit etwas anders gelaufen wäre, als es lief. Aber das nur so nebenbei.
Also, Karl bringt ihm noch ’n Bier. Ich bestelle mir noch ’nen Schnaps, und Franz zündet sich seine kalt gewordene Pfeife wieder an.
›Wo wir gerade so gemütlich zusammensitzen‹, fängt Franz an, ›da will ich doch noch mal auf das alte Kirchlein zu sprechen kommen. Du, Otto, als wichtiger Mann im Dorf und ehemaliger Bürgermeister, und du, Karl-Heinz, als Küster, wenn ihr ein gutes Wort einlegt, dann dürfen wir das alte Ding vielleicht doch abreißen!‹
Sie wissen ja, Herr Pfarrer, das ist schon jahrelang ein Gesprächsthema, seit die neue Kirche hier draußen steht. Aber Sie wissen ja auch, dass ich ein Freund der alten Fachwerk-kirche war und bin.
Ich gehe also hoch und sage: ›Das kommt überhaupt nicht in Frage!‹ oder so ähnlich.
Otto sagt: ›Also, das ist ein schwieriges Thema. Als Bürgermeister habe ich gelernt, immer beide Seiten zu sehen. Ich weiß, dass das alte Gebäude wichtig ist. Aber ich sehe auch, dass Franz dadurch Schwierigkeiten hat. Es ist wirklich schwierig, wie man sich da entscheiden soll.‹
Übrigens, Otto redet oft so, dass er beiden Seiten recht gibt und sich nicht richtig entscheidet. Aber sonst wäre er wohl auch kein Bürgermeister geworden. Doch das nur so nebenbei.
Ich sage ihm, er soll sich doch mal auf eine Haltung festlegen. Er antwortet, er wäre nicht so beteiligt. Ich gebe zurück, jeder ist hier beteiligt. ›Leg doch meine Worte nicht auf die Goldwaage!‹, antwortet er, ›ich jedenfalls bin nicht so direkt beteiligt wie Franz. Ich kann ja verstehen, dass er die Kapelle abreißen will. Wenn die LKWs nicht um die Ecke kommen.‹
Ich murmele: ›Sie kommen ja rum!‹
›Aber wie!‹, ereifert sich Franz. ›Sie müssen jedes Mal hin und her rangieren. Und mit den Anhängern ist das schrecklich umständlich. Einmal ist ja schon etwas von der Ecke abgeschrappt worden.‹
Darauf ich: ›Dann musst du dir eben eine eigene Straße bauen. Hintenherum auf dein Fabrikgelände. Die Wiese hinter Sauers Hof gehört dir ja sowieso schon. Da brauchst du nur ...‹
›Lass deine klugen Ratschläge!‹, unterbricht er mich. ›Würdest du für ein paar zigtausend Mark eine neue Straße bauen, wenn es nicht nötig ist? Wenn man das gleiche erreichen kann, indem man diese alte Bruchbude einreißt, die sowieso nicht mehr benutzt wird? Außerdem ist fraglich, ob der Gemeinderat mir die neue Straße genehmigen würde.‹
›Das ist schließlich dein Problem, nicht unseres!‹, sage ich.
Da geht der Franz aber hoch, sage ich Ihnen! ›Ja, natürlich mein Problem! Ich bin ja auch der Kapitalist im Dorf! Das wolltest du doch sagen, nicht? Ob es mit meiner Firma gut läuft, das geht ja auch sonst niemand was an! Und die fünfundvierzig Arbeitsplätze, die verlorengehen, wenn ich Pleite mache, die könnte Otto zum Beispiel spielend auf seinem Bauernhof stellen! Mensch, begreifst du denn nicht, dass das ganze Dorf davon abhängig ist? Wo willst du denn deinen Jüngsten hinschicken, wenn er bei mir keine Arbeit mehr hätte? War es übrigens nicht dein Junge, der neulich mit dem LKW an der Kapelle angeeckt ist?‹
Ja, das muss ich natürlich zugeben, denn es war so. Er ist aber sonst ein guter Fahrer.
›Natürlich‹, sagt Franz. ›Er ist ein guter Fahrer. Ich mache ihm ja auch keinen Vorwurf. Im Gegenteil, ich sage ja grade, dass das jedem passieren kann. Eben deshalb muss das alte Ding da weg! Diese Bruchbude!‹
Otto wendet ein: ›Diese Bruchbude, wie du es nennst, steht immerhin unter Denkmalschutz.‹
›Was heißt das schon! Was irgend so ein versponnener Liebhaber alter Bauten in irgend so einer verstaubten Behörde beschließt, das kann doch nicht den wirtschaftlichen Aufstieg unseres Dorfes behindern. Das dürfen wir uns einfach nicht gefallen lassen!‹
›Was willst du denn dagegen tun?‹, fragt Otto.
In der Pause, die nun entsteht, weil Franz nichts zu antworten weiß – was soll er auch antworten–, lehne ich mich zurück, trinke meinen Schnaps aus, und fange an, ihm in Ruhe noch einmal alles zu erklären. ›Du hast das anscheinend immer noch nicht richtig begriffen, Franz. Angenommen, du setzt dich in deinen Mercedes und fährst in Richtung Kassel. Durch was für Dörfer kommst du dann?‹
›Was soll denn diese Frage? Meinst du, ich wüsste das nicht?‹
›Sicher weißt du’s. Aber sag’s doch mal!‹
›Na, wenn’s dir Spaß macht. Also erst kommt Dutenhausen, dann Wickenborn, dann Oberdietenbach, dann Unterdietenbach, dann ... na, so geht’s eben weiter.‹
Und nun frage ich ihn, woran er die einzelnen Dörfer unterscheiden kann.
›Unterscheiden?‹, fragte er. ›Wozu denn? Es kommt halt eins nach dem anderen. Wenn ich in Kassel ankomme, merke ich es schon.‹
Otto mischt sich ein: ›Nun tu ihm schon den Gefallen und sag, worin sie sich unterscheiden!‹
Franz überlegt. ›Also in Oberdietenbach wird die Straße ganz eng und ist in einem schlechten Zustand. Da kann man nur dreißig fahren. Und Wickenbom – nun, das besondere ist, dass es im Tal liegt, und dass man es unten liegen sieht, wenn man von dieser Seite den Berg runterkommt.‹
›Und im Dorf selbst? Ich meine das Bild, das es für den Durchreisenden abgibt.‹
›Och, das ist doch überall gleich. Häuser eben und ein paar Geschäfte. Bauernhöfe kaum noch.‹
›Siehst du, genau das ist es, was ich meine. Nichts zeichnet ein Dorf aus gegenüber dem anderen. Alle haben ihre Bäume gefällt, und die alten Brunnen stehen schon lange nicht mehr. Alle haben ihr Fachwerk verputzt oder mit Platten vernagelt. Alle haben ihr Dorf zweckmäßig gestaltet, wie es so schön heißt: Breite Durchfahrten, die meisten Kurven und Winkel begradigt, an den Häusern keine unnötigen Erker und Ecken gelassen. Sicher, wer die Dörfer kennt, kann sie unterscheiden ...‹
Er unterbricht mich: ›Was soll das denn, ich kenne sie doch.‹
Ich fahre fort: ›Lass mich ausreden. Und nun kommt ein Reisender durch unser Dorf. Auf einem kleinen Platz sieht er links an der Straße eine hübsche Fachwerkkirche stehen. Kein Gebäude in dieser Art gibt es in der ganzen Gegend. Ein kleines Türmchen mit schlanker Spitze oben drauf. Auch sieht man noch die Reste der Treppe, die früher von außen hinaufführte, als der obere Teil noch als Scheune benutzt wurde. Eine Einmaligkeit in Nordhessen.‹
Franz knurrt nur: ›Du spinnst schon genauso wie dieser Landeskonservator aus Wiesbaden. Als wenn ein Durchreisender im Vorbeifahren die Balken zählen würde. Und wenn schon – was gehen mich die Durchreisenden an? Die sollen drüben auf der Autobahn fahren. Mich interessiert nur, was uns nützt. Und ich brauche keine Fachwerkkirche, um mein Dorf von anderen unterscheiden zu können. Ich erkenne es auch so.‹
So spricht er! Einer, der hier geboren ist! Das sag ich ihm auch: ›Mensch, Franz, du bist hier geboren! Eschenrode ist deine Heimat! Du hast noch wie wir alle deine Konfirmation in der Kapelle erlebt, hast deinen Namen in die uralten Bänke geschnitzt, wenn’s allzu langweilig war. Die Kirche, das ganze Dorf ist doch ein Stück von uns selbst! Es gehört zu unsrer Lebensgeschichte! Oder nicht? Wir machen uns ärmer, wenn wir alles nach und nach vernichten, was uns an unsere eigene Kindheit erinnert. Wenn wir alle Besonderheiten unsrer Heimat Zug um Zug einebnen.‹
›Tut mir leid‹, sagt er, ›das verstehe ich nicht. Muss wohl eine besondere Lebensphilosophie sein. Ich weiß nur, dass ich bald ärmer werde, wenn ich nicht mit größeren LKWs in meinen Fabrikhof fahren kann.‹
Darauf ich: ›Ich glaube, die Armut, von der ich spreche, die kriegst du nicht erst, die hast du schon – bei all deinem Reichtum!‹
›Was soll denn das nun wieder heißen?‹
›Nun streitet euch nicht‹, besänftigt Otto. ›Das lohnt sich nicht. Ihr könnt sowieso nichts dran machen. Wenn die in Wiesbaden es nicht erlauben, könnt ihr euch noch so sehr auf die Hinterbeine stellen – die Kapelle bleibt stehen.‹
›Na‹, murmelt Franz vor sich hin, ›das wollen wir erst mal sehen.‹
Und dann war es da.
Ich hab’s zuerst gehört. ›Seid mal still!‹
›Was ist denn?‹
›Seid doch mal still!‹
Alle schweigen. Da hören es die anderen auch. Ganz deutlich: Ein langgezogener Schrei. Sehr leise zwar, wie aus großer Entfernung, aber deutlich zu vernehmen.
›Da ist irgendwas!‹
›Wir müssen mal gucken.‹
Wir drei springen auf und rennen zur Tür. Karl, der Wirt, hat sich in der Küche zu schaffen gemacht und nichts mitgekriegt. Wir laufen auf die Straße.
Da sehen wir es: Feuer! Rechts drüben, wo die Fachwerkkirche steht, ist ein heller Schein zu sehen. Und da lodern auch schon hohe Flammen in den schwarzen Nachthimmel.
›Ich alarmiere die Feuerwehr!‹, ruft Otto. ›Rennt ihr rüber und seht nach, was da brennt!‹ Er eilt zurück ins Haus. Wir beide laufen hinüber zu der alten Kirche.
Am vorderen Teil, wo die schön geschnitzte Tür hineinführt, lodern die Flammen aus der Wand empor und breiten sich schnell aus.
›Was machen wir denn jetzt?‹, stoße ich noch ganz verwirrt hervor.
›Rufen müssen wir‹, sagt Franz. ›Hilfe rufen. Feuer! Feueeeeer!‹
Ich sage: ›Ich laufe schnell rüber zu uns und hole ein paar Eimer. Vielleicht nützt es was, bis die Feuerwehr kommt.‹
Aber Franz hält mich zurück: ›Lass doch den Quatsch! Was nützt denn da ein Eimer Wasser! Ja, wenn wir noch den Graben hätten!‹
Da fährt es mir heraus: ›Du hast wohl auch kein besonderes Interesse am Löschen, wie?‹
›Was willst du damit sagen?‹, zischte er.
Für einen Moment blicken wir uns im flackernden Schein des Feuers in die Augen. Jeder will wohl im Blick des anderen lesen.
›Nichts will ich sagen. Ich stelle nur fest, dass hier jemand etwas Brennbares ausgeschüttet hat. Benzin oder so. Sonst würde das niemals so lichterloh brennen.‹
Otto kommt angerannt. ›Sie kommen gleich. Habt ihr rausgekriegt, wer da so geschrien hat?‹
Erst jetzt fällt uns wieder der Schrei ein.
›Vielleicht da drin?‹
›Möglich. Wir müssen nachsehen!‹
›Durch die brennende Tür? Durch diese Feuerwand?‹
›Komm mit! Die Fenster!‹
Wir rennen an die Seite der Kapelle, unter das kleine Fenster. Noch ist niemand außer uns da. Überall rundum sind zwar die Fenster erhellt, aber nach meinem Zeitgefühl ziehen sich die Leute anscheinend erst ihren Sonntagsanzug mit Krawatte an, ehe sie zu Hilfe kommen.
Das Fenster ist so hoch, dass wir es nicht erreichen können. Es fehlt immer noch ein Meter, wenn man sich mit ausgestreckten Armen darunter stellt.
›Mach eine Spitzbubenleiter!‹
Otto stellt sich mit dem Rücken an die Wand und faltet die Hände vor dem Bauch. Franz steigt rauf, ich helfe ihm. Es geht recht mühsam. Wir sind ja alle drei nicht mehr die Jüngsten. Jetzt steht Franz auf Ottos Schultern und kann hineinsehen.
›Siehst du was?‹
Als keine Antwort kommt, drängt Otto: ›Nun rede doch endlich!‹
›Ich kann nicht viel erkennen‹, berichtet er zögernd. Dann schlägt er vorsichtig mit dem Ellenbogen die Scheibe ein.
›Ich glaube, da liegt jemand.‹
Inzwischen sind die Leute auf die Straße gerannt. Lautes Geschrei übertönt das Prasseln des Feuers.
›Wir brauchen eine Leiter!‹, ruft Franz und versucht, von seinem Untermann herabzuklettern. Als er die Hände nicht findet, springt er. Er ist immer noch der Sportlichste von uns dreien.
›Eine Leiter!‹, rufe ich.
Jemand anders gibt es weiter: ›Bring doch mal jemand eine Leiter!‹
›Wann kommt denn nun die Feuerwehr?‹
Einige Leute haben inzwischen begonnen, mit Eimern Wasser in die Flammen zu schütten. Das nützt aber kaum etwas. In Schlafanzügen und Morgenröcken rennen die Menschen aufgeregt durch den flackernden Schein.
Jemand bringt eine Leiter. Die beiden Jungen von Brunners, zwanzig und achtzehn Jahre alt, steigen hinauf. Mühsam zwängen sie sich durch das kleine Fenster, schneiden sich dabei an den Scherben.
Nach einer Weile, die uns hier unten wie eine Ewigkeit erscheint, streckt der Jüngere den Kopf raus.
›Oma Hahn ist es. Sie liegt da unten. Wahrscheinlich tot oder bewusstlos. Wir kommen nicht von der Empore runter. Die Treppe brennt.‹
›Zieh die Leiter rauf!‹, schreit Franz. ›Wir holen inzwischen eine andere für außen.‹
Mehrere Leute packen zu und schieben die Leiter hinauf durchs Fenster. Der Junge zieht sie ganz rein.
Jetzt kommt die Feuerwehr. Schläuche werden ausgerollt. Ein kräftiger Wasserstrahl zischt in die Flammen.
›Zurück, Leute! Zurück! Behindert doch nicht die Löscharbeiten!‹
Allgemeines Rufen und Drängen der Neugierigen.
Immer noch warten wir unter dem Fenster. Eine zweite Leiter ist inzwischen herangebracht worden, aber die jungen Männer lassen sich nicht blicken.
›Jens! Dirk!‹, schreit der alte Brunner, ihr Vater, hinauf. ›Kommt raus! Wenn sie doch schon tot ist! Kommt raus!‹
›Doktor!‹, ruft jemand, ›Kommen Sie mal hier her, unters Fenster. Oma Hahn ist da drin. Vielleicht lebt sie noch.‹
Der alte Doktor steht mit der Nottasche in der Hand in Pantoffeln da. Unter dem Mantel blickt die Schlafanzughose hervor.
Jetzt erscheint der Kopf von einem der jungen Männer. ›Sie lebt, aber sie ist bewusstlos. Wir kriegen sie nicht die Leiter rauf. Was sollen wir denn machen?‹
Der Doktor ruft ihnen zu: ›Verzieht euch in eine Ecke, möglichst weit vom Feuer weg. Wir haben es gleich gelöscht, und dann könnt ihr zur Tür raus. Legt sie flach hin!‹
Tatsächlich, die Flammen haben deutlich nachgelassen. Noch sind sie nicht überall gelöscht. Aber schon dringen einige Feuerwehrleute gegen die Tür vor, schlagen, was davon noch hält, mit Äxten ein und eilen hinein.
Schon fährt der Krankenwagen, der in Dutenhausen stationiert ist, mit Blaulicht vor. Als die alte Frau herausgebracht wird, steht alles bereit. Der Doktor setzt ihr, so bald sie im Wagen liegt, die Sauerstoffmaske auf, und in rasender Fahrt preschen sie davon.
Man löscht die letzten Flammen. Im Licht der Scheinwerfer macht die Kapelle einen sehr beschädigten Eindruck. Die schöne geschnitzte Tür ist völlig zerstört. Später stellt sich heraus, dass die übrigen Holzteile doch nicht so sehr verbrannt sind. Seine Nahrung muss das Feuer hauptsächlich von etwas anderem bekommen haben.
Man munkelt von Brandstiftung. Es gibt ja genug Leute im Dorf, die daran ein Interesse haben, dass die alte Fachwerkkirche verschwindet. Besonders einen.
Aufgeregt reden die Leute, tuscheln auch, stapfen herum, besehen sich den Schaden und stehen den Feuerwehrleuten im Weg, die bereits ihre Schläuche wieder einrollen. Die Polizei stöbert herum und lässt sich zu keiner unbedachten Äußerung hinreißen.
Erst nach einiger Zeit drängen die Mütter ihre Kinder energisch in die Häuser und in die Betten. Der allgemeine Lärm ebbt ab, man zerstreut sich. Als am Horizont schon der erste Morgenschimmer zu ahnen ist, legen die letzten sich noch einmal zu kurzer Ruhe nieder. Auch ich gehe endlich nach Hause. Nur Polizei und eine Feuerwache bleiben zurück.«
Kapitel 2
Einige Augenblicke verstrichen, als der Küster mit seinem Bericht fertig war, dann sagte der Pfarrer: »Ist ja eine tolle Geschichte. Aber was hat das nun mit Herrn Göbel zu tun?«
»Das werden Sie noch merken, Herr Pfarrer. Ich weiß es auch nicht genau. Aber Sie glauben doch nicht, dass die beiden Brände gar nichts miteinander zu tun haben! Das wäre schon ein komischer Zufall. Ebenso die Tatsache, dass das Feuer so kurz nach seiner Ankunft ausbrach. Mindestens da, wo Göbel die alte Frau Hahn im Krankenhaus besucht hat, kommt er ins Spiel. Aber die Einzelheiten werden Sie selbst rausfinden müssen. Nur dass er die Kirche nicht angesteckt hat, da bin ich ziemlich sicher.« »Sie haben schon durchblicken lassen, wen Sie als Brandstifter vermuten.«
»Ich habe anfangs Franz Liese verdächtigt, aber je mehr ich darüber nachdenke ... Also eigentlich verdächtige ich ihn gar nicht mehr.«
»Hm«, machte der andere. »Na ja, es geht mich ja auch nichts an. Mich interessiert Göbel. Ich werde versuchen, mir ein Bild der Ereignisse zu machen, und damit auch ein Bild dieses Mannes, von dem jetzt alle reden.«
Er hatte während der Erzählung des Küsters halb gestanden, halb auf der Tischkante gesessen, sich mit den Armen nach hinten abstützend. Jetzt gab er sich einen Ruck und richtete sich ganz auf, als wollte er seine Entschlossenheit unterstreich-en, der Sache auch wirklich auf den Grund zu gehen.
Dann fiel ihm noch eine Frage ein: »Ach ja, weiß man eigentlich, was die Frau Hahn in der Kirche gemacht hat?« »Gebetet.«
»Sie hat gebetet?«
»Das hat sie oft gemacht. Wissen Sie, sie liebte das Kirchlein. Sie war ja seit vielen Jahren – Jahrzehnten sogar – dort Küsterin. Erst als diese neue Kirche gebaut wurde, habe ich sie abgelöst. Sie war dann doch zu alt geworden. Und sie hätte sich an die neue Kirche auch nicht mehr gewöhnen können.«
»Jaja, das leuchtet mir schon ein, dass sie an der alten Kapelle gehangen hat. Aber musste sie denn nachts da hingehen, wenn sie beten wollte? Warum denn nur?«
»Wenn Sie das nicht wissen, Herr Pfarrer ...«
Der Jüngere ärgerte sich ein bisschen über diese Bemerkung, murmelte aber nur ein leises »Hm« vor sich hin.
»Sie hatte noch den Schlüssel«, ergänzte der Küster. »Ich weiß ja nicht, Herr Pfarrer, wie gut Sie sie kennengelernt haben. Sie war eine fromme Frau. Verstehen Sie, nicht so, dass sie nur am Sonntag in den Gottesdienst ging, wie das bei den meisten hier im Dorf ist, die sich noch zur Kirche halten. Sie lebte damit. Wie die ihre Bibel kannte! Und vielen hat sie in schweren Zeiten Trost gegeben, hat ihnen mal was vorgelesen und mit ihnen gebetet. Ich sage das nur, weil ich annehme, Sie wissen es nicht so genau. Weil Sie es in Ihrer Predigt nicht erwähnt haben oder nur am Rand. Alle haben sich gern von ihr helfen lassen mit Trost und Zuspruch und so. Die Alten meine ich natürlich, die Jüngeren nicht so. Ja, bei der Oma Hahn, da könnte mancher Pfarrer noch was lernen.«
Als er den Satz aussprach, merkte er sogleich, dass er etwas Unüberlegtes gesagt hatte. Das musste sein Gegenüber als Angriff auffassen. Das wollte er natürlich nicht. Er wurde verlegen und überlegte schnell, wie er das wieder richtigstellen könnte. Weil ihm aber nichts einfiel, ließ er es eben.
Der Pfarrer schien aber nicht sonderlich beleidigt. Offenbar erschien es ihm nicht als erstrebenswertes Ziel, für seine Frömmigkeit bekannt zu sein. Überhaupt war ihm der Vergleich mit Oma Hahn eher peinlich als verletzend.
Er wechselte das Thema. »Wenn ich nun etwas über Ernst Göbel erfahren will – an wen wende ich mich da? Meinen Sie, ich sollte mit Frau Liese anfangen?«
»Würde ich empfehlen. Da erfahren Sie die Vorgeschichte am genauesten, bis zu dem Tag, als er Eschenrode verließ.«
»Gut, dann mache ich das. Am besten gleich. Vielen Dank, Herr Maurer, und auf Wiedersehen!«
»Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Und für die Beerdigung morgen um elf bereite ich alles vor, wie immer.« Der Pfarrer trat nach draußen.
Es war wieder wärmer geworden, nachdem in den vergangenen Tagen ein unangenehm nasskaltes Wetter geherrscht hatte. Gerade suchte sich die Oktobersonne zaghaft einen Weg durch die Wolken.
Der Pfarrer ging zu seinem Auto, entschloss sich dann aber, es stehenzulassen und ging zu Fuß ins Dorf.
Es waren nur einige hundert Meter, da stand er vor der kleinen alten Kirche, von der ihm gerade erzählt worden war. Zum ersten Mal eigentlich betrachtete er sie nun mit Bewusstsein. Bisher hatte er von dem alten Gebäude kaum Notiz genommen, da die Gemeinde längst in das neue Gotteshaus umgezogen war, als er diese Pfarrstelle übernahm. Er hatte mit der Kapelle nur Umstände, Schreiberei mit den Behörden und so.
Im vorderen Teil, wo das Feuer gewütet hatte, waren einige Balken schräg angesetzt, die das Bauwerk vor Einsturz sichern sollten. Eine Absperrung aus Seilen und rot-weißen Latten lief in geringem Abstand um das Provisorium. Es arbeitete niemand daran.
Der Pfarrer ging um die Kirche herum.
Eigentlich ist sie wirklich hübsch, dachte er. Schlicht natürlich, sehr schlicht. Weshalb das Gebäude kunsthistorische Bedeutung haben sollte, konnte er sich kaum denken. Aber wenn er mal seine Gefühle sprechen ließ: Es war anheimelnd, irgendwie freundlich in seiner Bescheidenheit.
Er war froh, dass er dort nicht zu predigen brauchte. Nein, was er zu sagen hatte, passte nicht in einen nostalgischen Rahmen. Es war wichtig, dass die Menschen von heute Christentum nicht mit altertümlich gleichsetzten. Allerdings musste er zugeben: In die neue Kirche kamen weniger Leute, als früher in die alte gekommen waren. Das wurmte ihn etwas.
Diese senkrechten Balken tragen das Dach und geben Halt. Und diese schrägen stützen sie ab, damit das ganze nicht zusammenklappt. Eigentlich genial einfach, so ein Fachwerk. Wer wohl zum ersten Mal auf die Idee gekommen ist? Na ja, es wird wohl langsam über viele Generationen so entwickelt worden sein.
Hier ist die Reihe der Balken zu sehen, die innen die Empore tragen. Geschickt gemacht. Immer stützt ein Balken den anderen und wird von ihm gestützt. Sie halten sich gegenseitig.
Vielleicht benutze ich das einmal als Beispiel in einer Predigt, dachte der Pfarrer. Das verstehen die Leute sicher, weil sie es immer vor Augen haben. So wie die Balken, sollen wir uns gegenseitig Halt geben. Wir sind aufeinander angewiesen. Na, ist vielleicht doch ein bisschen zu banal, das Beispiel. Ich denke, ich lasse es lieber.
Dann ging er zwischen der Kirche und den angrenzenden Häusern hindurch, die hier eine einigermaßen gerade Front bildeten, aus der nur die Kapelle hervortrat. Da war die Durchfahrt für die Lastwagen, die zu Lieses Fabrik mussten.
Der Pfarrer ging hindurch und kam bereits nach wenigen Schritten auf das Gelände. Dort drüben rechts – unübersehbar – ragten die verkohlten Balken in die Luft. Das war also die zweite Brandstelle, das Holzlager. Das musste allerdings ein viel größeres Feuer gewesen sein als das erste. Gut, dass das Lager nicht direkt an die Wohnhäuser angrenzte.
»Guten Tag, Herr Pfarrer!«, sagte ein Arbeiter, der vorbeikam.
Der Angesprochene nickte freundlich, denn er kannte noch nicht alle Namen seiner Gemeindeglieder, auch nicht diejenigen derer, die gelegentlich in den Gottesdienst kamen.
»Eine schreckliche Geschichte, nicht?«, versuchte der Mann ins Gespräch zu kommen und zog dabei seine Arbeitshose hoch, was aber unnötig war, da sie wegen seines vorspringenden Bauches doch wieder runterrutschte.
»Ja, ja, tragisch«, antwortete der Seelsorger, schämte sich dann aber ein bisschen wegen der geistlosen Worte. »Wollen Sie sich die Brandstelle ansehen?«
»Nein, ich wollte eigentlich zu Lieses.«
»Ach ja, da müssen Sie hier um die Werkhalle herumgehen. Da sehen Sie gleich das Wohnhaus stehen. Ein moderner Bungalow.«
»Vielen Dank«, sagte der Pfarrer und ging in die gewiesene Richtung, ohne sich zu verabschieden.
Da stand das Haus. Nicht gerade protzig, aber doch einiges Kapital vermuten lassend. Weitgehend aus Holz, sehr warm und geschmackvoll.
Er trat heran und klingelte.
Ein etwa achtjähriger Junge öffnete. »Guten Tag!« »Guten Tag, ich wollte gern Frau Liese sprechen.« »Oma! Komm mal! Da ist ein Mann, der will was von dir!«
Es dauerte eine Weile, bis die Gerufene kam. Sie machte einen bedrückten Eindruck, was durch die schwarze Kleidung noch unterstrichen wurde.
»Ach Sie sind’s, Herr Pfarrer. Kommen Sie bitte rein.«
Sie traten durch einen weiten Flur in ein gemütliches, helles Wohnzimmer, das so modern eingerichtet war, wie es der Besucher hier auf dem Dorf nicht vermutet hätte. Fast traute er sich nicht weiterzugehen, als er auf den hellen, auffallend flauschigen Teppich trat.
»Hier herein, bitte! Michael, du machst deine Schulaufgaben weiter. Ich habe mich noch nicht umgezogen von der Beerdigung. Nehmen Sie doch Platz!«
Der Sessel war tief und bequem, vor allem für einen, der nun schon einige Zeit gestanden hatte.
Auch die Frau setzte sich und sah ihren Besucher heraus-fordernd an. Er musste das Gespräch beginnen.
»Ein ziemlicher Verlust, den Sie erlitten haben, nicht? Ich meine die Lagerhalle.«
»Na ja, wir sind versichert«, sagte sie nur und verbarg ihre Enttäuschung darüber, dass der Pfarrer zuerst von dem Holz sprach statt von dem Menschen, der umgekommen war.
Ihm fiel das jetzt auch auf. Und weil er nichts Geeigneteres wusste, musste er die Worte wiederholen, die ihm eben schon einmal nichtssagend vorgekommen waren. »Eine schreckliche Geschichte, mit dem Herrn Göbel. Tragisch.«
Sie nickte nur.
Weil er nun wieder nichts Passendes zu sagen wusste, schwiegen beide. Dann sagte sie mit bitterem Unterton: »Und da verdächtigen sie nun auch noch uns! Was wir schon alles an Verhören über uns ergehen lassen mussten! Als wenn wir unser eigenes Lager anstecken würden!«
Da der Pfarrer auch darauf nichts zu sagen wusste, endete der Gesprächsansatz wieder in einer Sackgasse.
Dann atmete er tief durch und begann: »Frau Liese, ich muss morgen die Beerdigung halten. Da bin ich ein bisschen in Verlegenheit. Ich müsste etwas über den Verstorbenen wissen. Aber man sagte mir, dass er keine Verwandten hätte. Es hieß, Sie könnten mir da weiterhelfen, weil Sie ihn früher gut gekannt hätten.«
Sie blickte zur Seite und antwortete nicht.
So lange dauerte das Schweigen, dass der Pfarrer überlegte, ob denn seine Worte nicht klar genug gewesen seien und er noch eine richtige Frage stellen müsste. Aber dann sagte sie, ohne die Augen zu heben: »Einiges kann ich Ihnen schon erzählen. Jedenfalls von früher. Von den Jahren, als er in Afrika war, weiß ich so gut wie gar nichts.«
»Ja, das meinte ich auch, von früher.«
Sie ließ wieder einige Zeit verstreichen, bis sie von neuem begann.
»Es ist nicht leicht für mich, müssen Sie wissen. Nicht, dass ich mich nicht deutlich genug erinnern könnte. Das kann ich wohl. Ich habe manchmal in den letzten Tagen, als Ernst hier war, an die alte Zeit gedacht. Auch schon vorher übrigens. Vergessen hatte ich das nie. Aber ich erzähle eigentlich nicht gerne davon. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Es wird da etwas aufgewühlt, was ich lieber ruhen lassen möchte. Irgendwie schäme ich mich fast, dass ich damit nicht fertig bin, nach beinahe dreißig Jahren.«
Dann sah sie ihren Besucher an, als bemerkte sie ihn erst jetzt. »Na ja, Sie als Seelsorger hören sicher öfter solche Geschichten.«
Ohne das zu verneinen oder zu bestätigen antwortete er: »Sie können sicher sein, Frau Liese, dass ich die persönlichen Dinge für mich behalte. In der Ansprache werde ich natürlich nur die wichtigsten Stationen aus dem Leben des Verstorbenen erwähnen. Einzelheiten passen da ja auch nicht hin.«
Für einen Moment war sie verwirrt. Ach ja, natürlich, es ging dem Pfarrer ja nicht um sie, sondern um Ernst. Sie hatte sich schon darauf eingestellt, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Einerseits schade. Vielleicht würde es ihr gut tun, sie jemandem erzählen zu können. Der Mann, der ihr da gegenübersaß, war zwar noch ziemlich jung. Aber mit wem, um alles in der Welt, sollte sie sonst darüber sprechen? Es gab niemanden.
»Kann ich Ihnen etwas anbieten, zu trinken vielleicht?«, fragte sie plötzlich, erleichtert über diesen Einfall. »Nein, danke!«
Jetzt sah er sie herausfordernd an. Sie versuchte sich zu konzentrieren.
»Er war von hier. Aber er war doch nicht richtig zu Hause, denn seine Eltern lebten nicht mehr. Die Mutter ist an einer Krankheit gestorben und der Vater im Krieg gefallen. Sie wissen ja, wie das war, nach dem Krieg – ach nein, das haben Sie ja nicht miterlebt. Nun ja, sicher hat man’s Ihnen erzählt. Da kamen viele Flüchtlinge und mussten untergebracht werden. Manche sind hängengeblieben, manche sind weitergezogen. Zum Beispiel der Metzger vorne an der Straße …«
Ich schweife ab, dachte sie. Ich muss zur Sache kommen.
»Ernst – also Ernst Göbel – kam das zugute. Er kam auf irgendwelchen Umwegen zu einem Flüchtlingsehepaar. Die Leute hatten ihre Kinder auf der Flucht verloren und nahmen nun Ernst auf. Sie wohnten drüben in der Quellengasse, bei Priems, oben unterm Dach. Die Frau Priem hat ihn übrigens auch die letzten Tage wieder aufgenommen, obwohl sie schon über siebzig ist.
Also – die Flüchtlingsfrau kümmerte sich rührend um den Jungen. Sie hat ihm ihre ganze Liebe zugewandt.
Wir kamen dann zusammen in eine Klasse in der Mittelschule, wie es damals hieß. Wir mussten dazu jeden Tag über den Berg in die Stadt wandern. In der gleichen Klasse waren auch mein Mann und Otto Frese, der Bauer, der früher Bürgermeister war, und Anna, seine Frau. Die Jungen freundeten sich an und machten viele Streiche zusammen – wie das eben so ist in dem Alter. Genauso war es auch bei uns Mädchen. Anna und ich waren eng befreundet, waren den ganzen Tag zusammen, schrieben die Schulaufgaben voneinander ab, spielten und kicherten uns gemeinsam durch eine unbeschwerte Jugend. Für unsre Eltern war die Zeit schwer, aber davon merkten wir jungen Leute wenig.
Als wir mit der Schule fertig waren, tat es uns allen leid, dass wir nicht mehr zu fünft diesen Weg machen mussten, weil wir dabei immer so unseren Spaß hatten. Aber gelegentlich trafen wir uns noch.
Franz ging damals in eine kaufmännische Lehre, Otto stieg in der Landwirtschaft seines Vaters mit ein, und Ernst begann eine Lehre als Koch …
Wie gesagt – manchmal trafen wir uns noch alle fünf. Aber verständlicherweise wurden solche Gelegenheiten seltener. Jetzt trafen wir uns mehr in Zweiergruppen.
Schon als wir zusammen in die Schule gingen, hatte eine gewisse Verliebtheit angefangen. Ernst umwarb mich – zunächst ein bisschen linkisch, wie das Jungen so tun. Er trug mir die Schultasche und pflückte mir mal ein paar Wiesenblumen und so weiter. Ich ließ mir das gern gefallen. Später wurde die Verbindung tiefgehender, ernsthafter. Ich hatte ihn wirklich gern, und es schien alles dafür zu sprechen, dass wir Mann und Frau werden würden.
Ich denke noch an den ersten gemeinsamen Spaziergang allein. Wie er plötzlich meine Hand nahm. Äußerlich taten wir so, als wäre das das Selbstverständlichste von der Welt – na ja, das war es wohl auch – aber innerlich waren wir so aufgewühlt von dem Sturm der Gefühle, dass wir kaum atmen konnten. Komisch, dass ich immer, wenn ich an Ernst denke, diese Augenblicke vor mir sehe, oder besser gesagt: In mir nachfühle. Und an den ersten Kuss denke ich oft. Und an das Erstaunen erinnere ich mich noch genau, mit dem ich registrierte, dass es mich wie ein Blitz durchfuhr, wenn wir uns zufällig berührten. Es war eine glückliche Zeit. Verstehen Sie, es war nicht so wie heute oft bei den jungen Leuten. Sie treffen sich ein paarmal in der Diskothek, und dann gehen sie schon zusammen ins Bett. Wenn man das glauben kann, was so gesagt und geschrieben wird. Das ist doch furchtbar! Schon bei meinen Kindern war es da nicht einfach. Und heute erst …! Will nur hoffen, dass meine Enkel – na, wir werden’s ja sehen. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, Herr Pfarrer, aber ich finde das schrecklich. Die bringen sich doch um das Schönste. Vielleicht halten Sie mich jetzt für schrecklich altmodisch. Aber was ich damals erlebt habe, war nun wirklich nichts Verschrobenes oder Verklemmtes, wie man uns heute gerne glauben machen will. Im Gegenteil, es ist die schönste Erinnerung, die ich habe.
Stundenlang haben wir oben am Waldrand gesessen, auf Gräsern gekaut, uns unterhalten, Pläne geschmiedet oder einfach gemeinsam geschwiegen. Das war etwas Wunderbares: Gemeinsam schweigen oder aufeinander zu schweigen. Man weiß, der andere fühlt wie ich. Wenn ich meine Gedanken wandern lasse, wandern seine mit, sie sind immer bei mir.
Aber genug davon. Ich erzähle Ihnen das auch nur, um zu zeigen, wie verliebt wir waren. Nur vor diesem Hintergrund können Sie alles weitere, was ich noch zu berichten habe, richtig beurteilen. Na ja, ich erzähle es auch gern. Die Erinnerung, wissen Sie. Und wem sollte ich es sonst erzählen!
Also zwischen Ernst und mir entwickelte sich ein festes und glückliches Verhältnis. Und ähnlich schien es zwischen Franz und Anna zu sein. Dazu muss ich nun sagen, dass eigentlich jeder im Dorf, der die beiden heranwachsen sah, fest damit rechnete, dass sie ein Paar würden. Aus einem ganz einfachen Grund: Jeder von beiden brauchte keine Konkurrenz zu fürchten.
Sie haben meinen Mann schon kennengelernt und wissen, dass er heute noch sportlich ist und gut aussieht. Damals war er der begehrteste junge Mann weit und breit, über den sich die Mädchen auf den Schulhöfen unterhielten. Mit männlich-schönem Aussehen bestach er alle, wenn er mit federndem Schritt und imponierendem Selbstbewusstsein daherkam. Dazu kam, dass er klug war und außerdem – man kann schon sagen – verhältnismäßig reich. Sein Vater hatte damals das Sägewerk, das dann später die Grundlage für unsere Fabrik bildete.
Was für Franz bei den jungen Männern galt, das galt genauso für Anna bei den Mädchen. Man kann es nicht anders sagen, sie war sehr schön. Wir anderen beneideten sie um ihr hübsches Gesicht mit den dunklen Augen, um ihre schlanke Figur, um ihre langen kastanienbraunen Haare. Die jungen Männer hielten die Luft an, wenn sie in ihre Nähe kamen, oder – je nach Temperament – redeten sie in einem fort. Wir anderen Mädchen haben es oft halb belustigt, halb neidisch beobachtet, wie sich da, wo Anna stand, immer gleich eine Traube von jungen Burschen bildete.
Nun, Sie wissen ja, wie das so ist: Der begehrteste Junge und das begehrteste Mädchen – die kommen gar nicht aneinander vorbei. Ob sie dann wirklich zusammenpassen, ist dabei gar nicht so entscheidend. Der umschwärmte Junge sucht sich halt das hübscheste Mädchen. Und das Mädchen, das zwischen vielen wählen kann, nimmt den, der ihr am meisten imponiert.
Damit will ich nicht sagen, dass die beiden nicht auch verliebt gewesen wären. Das waren sie sicher auch. Aber wahrscheinlich wäre es nicht zu dem Verhältnis gekommen, wenn sie nicht durch diese besonderen Umstände fast dahin gedrängt worden wären. Ich weiß das so genau, weil ich mich natürlich mit Franz später darüber unterhalten habe.
So stand es mit Franz und Anna. Das war also das zweite Paar aus unserem Freundeskreis von fünf Leuten. Übrig blieb Otto. Er tat uns zwar furchtbar leid, wenn uns anderen sein Los mal so richtig ins Bewusstsein kam. Aber das passierte selten, denn meistens beschäftigten wir uns nur mit uns und unseren jeweiligen Partnern.
Es war auch kaum zu erwarten, dass Otto so bald anderswo eine Freundin finden würde. Er imponierte den Mädchen nicht gerade. Ein etwas rundlicher Junge war er, ziemlich kräftig, aber ein bisschen linkisch in seinen Bewegungen. Dumm war er durchaus nicht, aber oft machte er diesen Eindruck. Er war nicht gerissen genug. Darum wurde er oft übervorteilt, und alle lachten über ihn. Aber er war so gutmütig, dass er das niemandem übelnahm, jedenfalls merkte ich nie tiefgehenden Ärger bei ihm.
Diese seine Gutmütigkeit war es, die ihn zu einem ganz lieben Freund machte. Man konnte mit ihm prächtig auskommen. Er konnte auch so herrlich unbefangen lachen, wenn es irgendetwas zu lachen gab. Meistens war er selbst der Anlass. Dauernd passierte ihm ein Missgeschick. Er zog mit seiner etwas tollpatschigen Art das Unglück geradezu magisch an. Das erregte immer so ein Gefühl, das ich als eine Mischung aus Sympathie und Mitleid bezeichnen möchte. Aber das, was ein Mädchen an einem jungen Mann faszinierend findet, das schwang nicht mit. Das war so etwa die Lage der Dinge, als wir achtzehn, neunzehn Jahre alt waren.
Dann geschah etwas, was ganz harmlos begann und doch so weitreichende Auswirkungen hatte! Anna und ich saßen mal ein bisschen zusammen. Es war ein unangenehmer Regentag, und wir waren in ihrem Zimmer. Das kam nur noch selten vor, weil wir die meiste Zeit mit unseren jeweiligen Freunden verbrachten. Der Grund war auch diesmal nur, dass wir zu viert etwas unternehmen wollten und nun auf die beiden warteten.
Ich weiß nicht, wie es eigentlich kam, jedenfalls redeten wir uns in eine angeheizte Stimmung hinein. Vielleicht war es, weil wir plötzlich wieder die alte Zeit nacherlebten, wo wir als junge Gänse so viel gekichert hatten. Vielleicht stach uns der Hafer, weil wir uns der Liebe unserer Freunde so sicher waren. Jedenfalls beschlossen wir einen Streich: Wir wollten sie glauben machen – ich den Ernst und Anna den Franz –, dass wir jeweils den anderen für besser hielten. Es sollte nur ein Spaß sein. Wir wollten sehen, wie sie reagieren würden. Dabei hatten wir nicht den geringsten Zweifel, dass der Spuk binnen kurzem wieder vorbei sein würde.
Allerdings muss ich gestehen, dass der Gedanke, ein bisschen zum Spaß mit Franz zu kokettieren, mir nicht gerade unsympathisch war. Er übte wirklich eine ungeheure Anziehung auf alle Mädchen aus.
Franz kam zuerst. Wir hatten uns eigentlich vorgestellt, wir würden mit dem Spaß beginnen, wenn wir zu viert waren. Das hätte unser Geheimnis natürlich auch durchsichtiger gemacht. Aber Anna konnte nicht an sich halten und ließ so ein paar Bemerkungen wie unbeabsichtigt fallen, dass sie Ernst ungeheuer sympathisch fände.
Erst war Franz offensichtlich befremdet. Dann, als Anna deutlicher wurde, schien er unsicher zu sein, ob es sich um Ernst oder Spaß handelte. Solch eine Unsicherheit ist ja peinlich und unangenehm. Er fand einen Ausweg: Er sagte, wie nett er mich fände. Das war aus seiner Sicht genial: Waren Annas Bemerkungen nur ein Scherz, dann konnte seine Annäherung an mich ja auch nur Spaß sein. Meinte sie es aber ernst, dann konnte er sich damit rächen.
Ich habe später viel und lange überlegt, was eigentlich in diesen dreißig, höchstens vierzig Minuten vorging. Darum kann ich es jetzt so genau schildern. Wenn ich die Worte im einzelnen auch nicht mehr weiß, so weiß ich doch noch genau, welche Gedanken und Empfindungen im Raum standen. Man konnte sie fast körperlich spüren.
Anna reagierte falsch. Sie ärgerte sich über die moralische Niederlage und wehrte sich, indem sie den Scherz übertrieb und mit ernsthaften Zügen versah. Sie war sich wohl selbst nicht klar, wie sehr sich ihr langsam wachsender Zorn unter den Humor schob und ihr Handeln zu beeinflussen begann.
Dass sie sich ärgerte, das wiederum ärgerte Franz. Er ist ein Typ, der sehr trotzig reagieren kann, auch heute noch. Das hängt mit seinem Selbstbewusstsein zusammen. Er setzte sich eng neben mich und schlang den Arm um mich.
Ich muss gestehen, dass ich damals überhaupt nicht merkte, was hier geschah und worauf es hinauslief. Ich war immer noch bei unserem Spaß. Zusätzlich angeheizt durch die Umarmung des sympathischen Franz ging ich darauf ein und küsste ihn auf die Wange. Das brachte natürlich Anna noch mehr auf, so sehr, dass auch ich merkte, dass die Sache ausartete. Aber ich war so in Stimmung, dass ich nur auf sie einredete, sie solle sich nicht so anstellen, was wäre denn schon dabei und so weiter.
Da kam Ernst. Als er Franz und mich in der Umarmung sah, blieb er zunächst wie angewurzelt in der Tür stehen, dann versuchte er ein etwas ungezwungenes Lächeln. Natürlich ahnte er, so merkwürdig ihm die Szene auch erschien, dass hier eigentlich etwas Lustiges stattfinden sollte, das nur missraten war. Aber Anna redete – wieder um sich an Franz und mir zu rächen – heftig auf ihn ein. Wir wären jetzt ein Paar. Und sie beide, Anna und Ernst, doch auch. Um ihrer inzwischen kochenden Wut mit Rache Luft zu machen, fiel sie Ernst um den Hals und begann ihn zu küssen.
Auf diese Weise schaukelten wir uns gegenseitig hoch. Denn nun drückte Franz mich noch mehr an sich, und ich ließ es nicht ungern geschehen. Ernst aber ging überhaupt nicht darauf ein. Stocksteif stand er einige Sekunden da, angewidert von dem Anblick, der sich ihm bot und von dem, was die schon fast keifende Anna mit ihm tat. Dann befreite er sich gewaltsam von ihr, stieß sie heftig von sich, so dass sie auf den Boden fiel, drehte sich wortlos und mit eckigen Bewegungen um, verließ das Zimmer und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen.
Anna heulte wütend. Erst trommelte sie mit ihren Fäusten auf den Fußboden. Dann sah sie uns mit blitzenden Augen an, schoss auf uns zu und begann auf mich einzuschlagen und zu treten. Noch Wochen später tat mir von ihren Tritten mein Schienbein weh.
Franz sprang auf, packte sie mit festem Griff, bewarf sie mit allen möglichen Schimpfwörtern und setzte sie, obwohl sie sich heftig wehrte, in die Sofaecke. Sie sprang nicht mehr auf, als er sie losließ, sondern sackte heulend in sich zusammen. »Komm, wir gehen«, sagte Franz und schob mich zur Tür hinaus.
Unten vor dem Eingang blieben wir einen Augenblick stehen, dann murmelte er: »Ich bring dich noch nach Hause.« Schweigend gingen wir nebeneinander her. Vor unserer Haustür blieben wir wieder eine Weile in der Dunkelheit stehen und sagten nichts. Dann erst brachte ich ein paar Worte heraus: »Es sollte nur ein Scherz sein.«
Nach einiger Zeit antwortete er: »Man soll nicht mit dem Feuer spielen.«
»Aber wir waren uns ganz sicher, dass es harmlos werden würde.«
»Lass nur«, sagte er, »vielleicht ist so nur sichtbar geworden, was sowieso schon da war.«
Ich fragte ihn naiv: »Was meinst du damit?«
Seine Antwort brach heftig aus ihm hervor: »Sie ist nicht ein Mädchen, das man wirklich liebt. Sie hat etwas – etwas Hartes, etwas Bösartiges. Sie gibt sich oft so von oben herab, verstehst du? Und das kann ich nicht vertragen!«
»Aber ich denke …« Ich ließ den Satz unvollendet.
Nach einer Weile sagte er: »Ein Mädchen, das ich wirklich lieben soll, muss anders sein. Sanft, liebenswürdig – so wie du.«
Dann nahm er ganz behutsam meinen Kopf in beide Hände, zog ihn heran und küsste mich langsam auf den Mund. Es war ganz anders als vorhin in Annas Zimmer, völlig anders.
»Gute Nacht!«, sagte er leise und ging.
Das Gefühl, mit dem ich zurückblieb, kann ich nicht beschreiben. Einerseits fühlte ich mich hundeelend in Gedanken an das, was ich Ernst antat. Andrerseits aber hatte ich mich über seine Reaktion geärgert. Und dass nun Franz, nach dem sich immer alle Mädchen umdrehten, an mir Interesse hatte, das erhob mich ganz eigenartig. Es schmeichelte mir, es wickelte mich ein und ließ in mir ein Ja zu dieser neuen Entwicklung entstehen, das das Nein meines Gewissens immer mehr zurückdrängte.
In dieser Nacht schlief ich fast gar nicht.
Die Ereignisse der nächsten Tage verstärkten noch, was in jener halben Stunde in Annas Zimmer entstanden war. Ernst mied mich verbittert und beleidigt. Das aber tötete überrasch-end schnell die Gefühle, die ich für ihn gehabt hatte – jedenfalls glaubte ich das – und machte mich empfänglich für die Annäherung von Franz. Der meinte es tatsächlich ernst.
Wochen ging das so. Allmählich änderte sich Ernst. Er versuchte, sich mir wieder zu nähern. Er sagte mir auch einmal, dass er alles vergessen wolle, was passiert sei, wenn ich es auch vergäße und zu ihm zurückkäme. Aber merkwürdig – es zog mich gar nicht mehr so stark zu ihm hin. Es war nicht mehr der Ärger, der war tatsächlich vergessen. Aber ich musste ihn nun immer mit Franz vergleichen, und da zog Ernst den Kürzeren.
Franz verwöhnte mich. Er hatte gerade den Führerschein erworben und chauffierte mich manchmal mit dem Auto seines Vaters durch die Gegend. Es war ein klappriger alter Kasten für unsre heutigen Begriffe. Aber damals, als sonst niemand im Dorf ein Auto hatte, imponierte mir das ungeheuer. Wir ließen uns überall zusammen sehen. Franz wollte das so. Er genoss es zu zeigen, dass er nun nicht mehr mit Anna ging, und ich genoss es, an der Seite eines solchen prachtvollen jungen Mannes gesehen zu werden.
Ich schäme mich, wenn ich an all das zurückdenke. Ich kann es nicht leugnen: Mit Gefühlen wie Stolz und Trotz unterdrückte ich die Stimme in mir, die mich mahnte, nicht einfach wegzuwerfen, was mir noch kurz zuvor so wichtig gewesen war.
Ernst machte noch einen Versuch, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber ich sorgte dafür, dass wir uns nie trafen. Einige Male wollte er mich zu Hause besuchen, aber ich ließ ihn nicht herein. Ich war wie in einem Rausch und wollte alles von mir fernhalten, was mich da herausreißen könnte.
Schließlich schrieb er mir einen Brief. Ich habe ihn nicht mehr, weil ich ihn gleich nach dem Lesen zerriss. Ungefähr weiß ich aber noch den Inhalt. Er wollte mit mir unter vier Augen sprechen. Er verspräche, mich nicht zur Rückkehr zu ihm überreden zu wollen. Es läge ihm nur an einem klärenden Gespräch, damit er wüsste, woran er sei.
Er hat nie eine Antwort bekommen.
Zwei oder drei Wochen später war Ernst aus dem Dorf verschwunden. Zunächst fiel es mir gar nicht auf. Dann aber sprach Franz davon. Ihn ließ die Sache wohl doch nicht ganz gleichgültig, wenn er auch mir gegenüber so tat.
Nachdem nochmal einige Zeit vergangen war, ging Franz zu dem Flüchtlingsehepaar, Ernsts Pflegeeltern. Er fand sie in Tränen aufgelöst. Ernst hatte nur eine kurze Notiz hinterlassen, sich für alles bedankt, was sie für ihn getan hatten, und geschrieben, er käme wahrscheinlich vorläufig nicht zurück.
Wissen Sie, Herr Pfarrer – ich meine auch heute noch, dass man die Frage, wen man heiratet, nicht aus einem Gefühl des Mitleids heraus entscheiden kann. Aber das ändert nichts daran, dass ich ihm Unrecht getan habe. Und dass es ihn zutiefst getroffen hat, war ja an seiner Reaktion zu sehen.
Damals aber bewirkte das alles bei mir kein Umdenken. Im Gegenteil, eher entstand eine Haltung, die man mit »nun erst recht« beschreiben könnte.
Ich drängte auf baldige Heirat. Franz war einverstanden. Wir verlobten uns öffentlich und heirateten ein Jahr später.
Das ist nun fast dreißig Jahre her. Dreißig Jahre Ehe. Ich kann nicht sagen, dass sie unglücklich war. Wenn ich an manche Familien denke, die ich kenne … Aber wenn Sie mich fragen, ob die Ehe glücklich war … Verstehen Sie mich recht, ich spreche nicht von gelegentlichen Krisen, wie sie wohl normal sind. Ich spreche von dem Gedanken an Ernst, der sich über alles legte, mal stärker, mal schwächer. Und von manchen Enttäuschungen. Da war die Fabrik, die Franz einen großen Teil seiner Zeit stahl. Ich meine allerdings auch, dass er mehr Zeit damit zubrachte, als für uns nötig und gut gewesen wäre. Aber lassen wir das. Das gehört wohl auch nicht hierher, da Sie ja nicht meine, sondern Ernsts Geschichte hören wollen.
Die ist aber damit noch nicht abgeschlossen.
Etwa zwei Jahre, nachdem er verschwunden war, starb sein Pflegevater. Seine Pflegemutter konnte allein mit ihrem Kummer kaum fertig werden und siechte dahin. Ein halbes Jahr später starb auch sie. Niemand konnte Ernst Bescheid geben, weil keiner wusste, wo er war. So kam er noch nicht einmal zur Beerdigung.
Nach abermals zwei Jahren bekam Otto von ihm Post. Er hat mir den Brief nicht gezeigt. Aber Franz hat sich mit Otto darüber unterhalten und herausbekommen, dass Ernst in Südafrika war. Seine Adresse hatte er aber nicht angegeben. Offenbar wollte er nicht, dass ihm jemand schrieb. Das einzige, was Otto wusste, war, dass der Brief in Durban abgestempelt war. Das ist eine Hafenstadt an der Ostküste von Südafrika. Ich hab’s mir im Atlas angesehen.
Ernst schrieb in dem Brief, er hätte ein kleines Lokal gepachtet und könnte davon gut leben. Er sehnte sich zurück nach Eschenrode. Aber noch könnte er nicht kommen. Wenn alle Wunden verheilt wären und wenn es ihm auch wirtschaftlich möglich wäre, würde er zurückkehren. Spätestens, wenn er seinen Lebensabend begänne. Den wolle er auf jeden Fall zu Hause verbringen.
Ja, das war alles, was wir in diesen drei Jahrzehnten von ihm gehört haben. Es kam kein Brief mehr, und er selbst ließ sich erst recht nicht blicken. Bis er dann auf einmal vor etwa drei Wochen hier auftauchte.«
Kapitel 3
Elke Liese schwieg.
Der Pfarrer auch. Er spielte nur gedankenlos mit einem Knopf in der Bespannung seines Sessels.
Erst nach einiger Zeit ergriff Frau Liese noch einmal das Wort.
»Ich habe oft darüber nachgedacht, wie wir Menschen doch unser Schicksal gegenseitig beeinflussen. Da flieht ein junger Mann aus seiner Heimat und verbringt die Hälfte seines Lebens auf einem fernen Kontinent. Er leidet dreißig Jahre an Heimweh, heiratet nicht – das alles als Folge unserer Entscheidung damals, die eigentlich noch nicht einmal eine bewusste Entscheidung war.«
»So dürfen Sie das nicht sehen«, begann der Geistliche etwas verlegen. »Sie konnten doch nicht wissen, was daraus wird. Wenn alle Mädchen die Männer heiraten wollten, die ihnen nachstellen, aus Angst, deren Schicksal könnte ungünstig beeinflusst werden …«
»Na, Herr Pfarrer, dieser Trost, den Sie mir da spenden wollen, trifft wohl nicht ganz meine Situation. Gut, Sie haben recht, im vordergründigen Sinn bin ich höchstens zum Teil an der Entwicklung schuld. Aber …«
»Wenn Sie nicht bereuen, Ihren Mann geheiratet zu haben, dann war dieser Weg richtig. Und wenn er richtig war, dann haben Sie auch keine Schuld.«
Sie blickte ihn unter den gesenkten Augenlidern hervor skeptisch an. »Dass einer von der Kirche einem Schuldgefühle ausreden will, finde ich merkwürdig. Ich dachte immer, Ihre Aufgabe bestände darin, uns Schuld bewusst zu machen, damit wir bereit werden, auf das zu hören, was Sie von der Vergebung sagen.«
Er schaute unsicher von seinem Knopf auf. »Ich muss gestehen, ich weiß nicht recht … ist das jetzt Ironie, oder ist es Ihr Ernst?«
»Tja …«, sagte sie, »ich glaube, ich weiß es auch nicht.«
Wenn ich nicht aufpasse, dachte er, bin ich im Begriff, als Seelsorger zu versagen. Laut sagte er: »Frau Liese, Sie brauchen sich da wirklich keine Gedanken zu machen. Jeder nimmt irgendwie auf das Leben anderer Einfluss, positiv oder negativ. Das lässt sich gar nicht vermeiden, wo Menschen zusammenleben. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie anders richtiger hätten handeln können, haben Sie auch keine Schuld auf sich geladen.«
Fast resignierend wirkte ihr Gesichtsausdruck, als sie zur Antwort gab: »Was viele falsch machen, ist damit nicht entschuldigt, hat Ihr Vorgänger mal in einer Predigt gesagt. Das habe ich mir gut gemerkt. Und ob eine Sache Schuld ist oder nicht – nun, dass unser manchmal überempfindliches und verformtes Gewissen das nicht letztgültig entscheiden kann, das mag wohl sein. Aber ob unsere nüchternen menschlichen Überlegungen das entscheiden können?«
Er wusste nichts anderes zu erwidern als: »Sie haben sich wohl viel mit der Frage nach der Schuld und den menschlichen Verstrickungen beschäftigt?«
Sie nickte nur.
Er fuhr fort, damit überhaupt etwas gesagt wurde: »Vielleicht haben Sie sich da in etwas hineingesteigert … Und jetzt, wo sich das alles so dramatisch zugespitzt hat, steht es plötzlich dunkel vor Ihnen.« Er überzeugte sich selbst, während er redete. »Der tragische Tod von Ernst Göbel hat da etwas in Ihnen ausgelöst, das … ja, das jeder realistischen Grundlage entbehrt. Glauben Sie mir …«
Sie machte eine fahrige Handbewegung. »Das ist es nicht! Ich habe mich doch schon lange damit herumgeschleppt.«
Der Pfarrer setzte sich ein klein wenig gerader hin. »Frau Liese, wenn das so ist, dann können Sie wissen – ich meine – auch auf die Gefahr hin, dass Sie das für eine theologische Pflichtübung halten, aber Gott ist doch barmherzig.«
Genau das ist es, was ich hier rede, dachte er dabei, genau das: Eine theologische Pflichtübung.
Die Frau ihm gegenüber machte noch einmal diese wegwischende Handbewegung und sagte leise: »Schon gut, Herr Pfarrer, schon gut!«
Das verletzte ihn, denn es zeigte, dass sie seine Worte auch so empfunden hatte. Aber er konnte sich dagegen nicht wehren. Sie hatte ja recht.
Es dauerte eine längere Zeit, bis er den Eindruck hatte, er müsste jetzt unbedingt die Stille unterbrechen. Aber womit?
Da fiel ihm etwas ein. »Frau Liese, eins würde mich noch interessieren. Wie hat denn Ihre Freundin Anna das alles verkraftet?«
Frau Liese zog langsam und tief Luft ein und sagte, nun mit einer veränderten Stimme: »Sie hat den Otto geheiratet.«
»Ja, das weiß ich. Ich meine, wie hat sie reagiert, war sie böse – oder wie?«
»Ich weiß schon, was Sie mit Ihrer Frage gemeint haben. Meine Antwort war die richtige Antwort darauf.« »Äh – das verstehe ich nicht ganz …«
»Dass Anna Otto geheiratet hat, das sagt alles. Unter normalen Umständen hätte sie das nie getan. Es war eine reine Trotzreaktion. So sehe ich es. Bitte – andere werden sicher etwas anderes sagen. Sie selbst natürlich erst recht. Aber ich bin überzeugt, dass es so war.«
»Und Otto? Ich meine, Herr Frese?«
»Der hat sie natürlich gern genommen. Mit der Chance hatte er schon gar nicht mehr gerechnet, ausgerechnet die schöne Anna zu kriegen. Inzwischen wird er es vielleicht schon bereut haben.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ach, vergessen Sie es. Fragen Sie ihn selbst. Ja, ich glaube, ich sollte nicht so über die Ehe anderer Leute tratschen. Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe.«
Er nickte verständnisvoll.
»Und wie sind Sie miteinander ausgekommen?« »Sie meinen Anna und ich?«
»Ja.«
»Gar nicht.«
»Sie sind sich aus dem Weg gegangen?«
»Nicht nur das, ich war für sie gar nicht mehr da. Sie hat seit jener Zeit kein überflüssiges Wort mehr mit mir gesprochen, keinen Gruß. Dass sie überhaupt mal etwas gesagt hat, war nur, weil ich sie gelegentlich angesprochen habe. Man trifft sich ja immer mal – beim Einkaufen, beim Elternabend in der Schule oder so. Im Übrigen aber war ich für sie so gut wie tot.«
»Und ihr Mann?«
»Mit Franz hat sie es genauso gehalten. Er hielt aber weiterhin Kontakt mit Otto. Anna hat das sicher nicht gern gesehen, aber das hat Otto sich nicht nehmen lassen. Was mich wundert! Einmal in der Woche haben die Männer ihre Freundschaft mit ein paar Glas Bier in der Wirtschaft aufgefrischt.«
Der Pfarrer versuchte, sich ein möglichst vollständiges Bild dieses merkwürdigen Verhältnisses zu machen. Dabei fiel ihm ein, dass er etwas Wichtiges noch nicht wusste. »Als Ernst Göbel zurückkam – hat er Sie da mal aufgesucht? Haben Sie mit ihm gesprochen? Oder hat er Sie gemieden?«