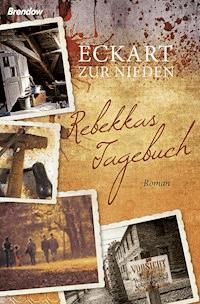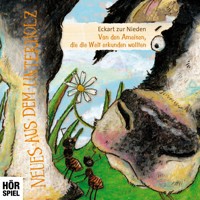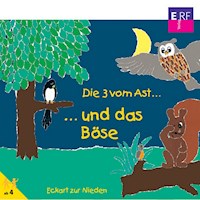Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brendow, J
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kassel 2016. Die 19-jährige Judith findet auf dem Familien-Dachboden einen alten Brief, der an ihren gefallenen Urgroßonkel adressiert wurde. Leider ist er in Geheimschrift verfasst. Nur mühsam gelingt es ihr, ihn zu entschlüsseln. Doch die Mühe lohnt sich: Ein jüdischer Freund des Urgroßonkels berichtet darin vom Versteck des Familienschatzes, den er vor den Nazis in Sicherheit bringen konnte. Bald weckt das Schriftstück Begehrlichkeiten, die nicht nur Judiths Zuhause zu entzweien drohen. Auch die Profiteure der Vertreibung der jüdischen Familie bekommen Wind davon, und ein gefährliches Katz- und Mausspiel beginnt … Eine spannende Familiengeschichte rund um ein dunkles Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eckart zur Nieden
Der verschwundene Brief
Roman
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Kassel, März 1941
Kassel und Umgebung, 75 Jahre später
Montag, 6. Juni
Dienstag, 7. Juni
Mittwoch, 8. Juni
Donnerstag, 9. Juni
Freitag, 10 Juni
Samstag, 11. Juni
Sonntag, 12. Juni
Montag, 13. Juni
Dienstag, 14. Juni
Mittwoch, 15. Juni
Donnerstag, 16. Juni
Freitag, 17. Juni
Samstag, 18. Juni
Sonntag, 19. Juni
Weitere Bücher
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86506-958-0
© 2017 by Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers
Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers
Titelfoto: fotolia spql
Satz: Brendow Web & Print, Moers
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
www.brendow-verlag.de
Prolog
Kassel, März 1941
Daniel schreckt aus dem Schlaf.
Was ist los? Was hat ihn geweckt?
Da ist es wieder – lautes Poltern unten an der Haustür. Rufe, die Daniel aber nicht verstehen kann, weil sein Fenster nicht zur Straße, sondern hinten hinausgeht.
Aber es ist auch nicht nötig, dass er die Rufe versteht. Wenn jemand mitten in der Nacht so laut Einlass verlangt, dann kann es nur die Gestapo sein.
Daniel springt aus dem Bett und beginnt, sich in fliegender Eile anzuziehen.
Jetzt ist er also da, der Augenblick, den er längst erwartet hat. Seine Mutter wollte es ja nicht wahrhaben. Obwohl hinter vorgehaltener Hand oft genug davon gesprochen wurde. Und Joschi aus seiner Klasse, auch ein Jude, ist schon seit Wochen nicht mehr in die Schule gekommen. Niemand weiß, wo er ist.
Als Daniels Vater noch lebte, hat er gemeint, wenn sie der Kirche beiträten, könnte ihnen nichts passieren. Er hatte ihn auch oft zu dessen Freund Hans Droste geschickt, damit er da im evangelischen Pfarrhaus möglichst viel über das Christentum lernen konnte. Er meinte, das würde es glaubwürdiger machen, dass sie nun keine Juden mehr seien. Er wollte nicht begreifen, dass die Nazis nicht an der Religion interessiert waren. Denen ging es um die Abstammung.
„Frau Grüntal?“
Jetzt sind sie offenbar im Haus. Seine Mutter hat sie hereingelassen. Was sie jetzt antwortet, kann Daniel nicht verstehen. Ihre Stimme ist leise und ängstlich.
Hätte seine Mutter nur auf ihn gehört! Aber seit Vaters Tod ist sie so merkwürdig unentschlossen. Immerhin hatte sie zugestimmt, dass Daniel die Wertsachen versteckte, wenigstens die beweglichen, die kostbaren Bilder und den alten wertvollen Schmuck und Vaters Münzsammlung. Aber weiter wollte sie nicht gehen, fliehen wollte sie nicht.
„Ihr Sohn?“, hört Daniel die Männer fragen.
„Ich hole ihn“, sagt seine Mutter, nun etwas lauter. Vielleicht will sie so verhindern, dass die Polizisten selbst hinaufgehen.
Daniel ist mit allem fertig. Angezogen ist er, der Rucksack liegt bereit, und das Seil hat er um den mittleren Holm des Fensters geschlagen.
Er hat es seiner Mutter gesagt: Wenn wir nicht zusammen fliehen, dann fliehe ich alleine. Sie wollte ihm das ausreden. Als ob er noch ein Kind wäre! Aber er ist sechzehn, fast siebzehn!
Damals, als er bei Drostes im Pfarrhaus war und mit seinem Freund Hans romantische Pläne schmiedete, da war er dreizehn, dann vierzehn gewesen. Da wäre so eine Flucht wohl ziemlich aussichtslos gewesen. Spielerei. Aber jetzt …
Seine Mutter kommt herein.
Bleich, mit Tränen in den Augen, steht sie nur da und sagt nichts. Daniel umarmt sie wortlos.
„Sie sind da. Sie … du hattest recht …“, stottert sie.
„Ich weiß, Mutter. Ich bin vorbereitet.“ Er deutet auf das Fenster. „Willst du nicht doch noch schnell …“ Sie schüttelt den Kopf. „Ich soll dich holen.“
„Sag ihnen, ich sei nicht da. Vielleicht noch nicht vom Besuch bei Freunden zurück oder so. Natürlich nehmen sie das nicht einfach hin, sie werden selbst heraufkommen. Aber es verschafft mir etwas Zeit. Ich brauche nur zwei oder drei Minuten.“
Seine Mutter legt die Hand an seine Wange. „Gott mit dir, mein Sohn!“
Während er sich den Rucksack auf den Rücken wirft, sagt er: „Unser alter Gott oder unser neuer?“ Da merkt er, dass das ironisch klingt, aber so hat er es nicht gemeint, und er fügt hinzu: „Ich weiß, es ist wohl derselbe.“
„Gott behüte dich!“
„Und dich auch!“
Von unten ertönt lautes Rufen: „Na, wie denn? Kriegen Sie ihn nicht wach? Oder warum dauert das so lange?“
Daniel schiebt seine Mutter aus dem Zimmer und küsst sie noch einmal auf die Wange.
„Ich versuche sie noch etwas aufzuhalten“, sagt sie. Er schließt die Tür.
Daniel war nur sehr widerwillig zu den Treffen der Hitlerjungen gegangen, als sie dort noch nicht wussten, dass er Jude war. Immer nach dem Motto seines Vaters: Nur nicht auffallen!
Aber immerhin hatte er dort gelernt, wie man sich eine Wand hinunter abseilt.
Unten angekommen, lässt er das Seil hängen. Das offene Fenster würde ihn sowieso verraten.
Den weiteren Fluchtweg hatte er gründlich ausgekundschaftet. Über den Hof auf die Parallelstraße, schnell hundert Meter nach rechts und dann in eine der kleinen dunklen Gassen.
Natürlich würde er gern aus der Ferne beobachten, was sie mit seiner Mutter machen. Aber das würde ihn unnötig in Gefahr bringen. Er hastet weiter und bleibt erst stehen, als mindestens ein Kilometer Luftlinie zwischen ihm und dem Haus liegt. Dann setzt er sich auf den steinernen Pfosten eines niedrigen Gartenzauns.
Eigentlich hat er vorgehabt, zunächst bei seinem Freund Hans Droste Zuflucht zu suchen. Aber jetzt überlegt er – das geht nicht! Die Gestapo weiß ja so ziemlich alles, sie wird auch wissen, dass er oft und lange im Pfarrhaus in Niedernrode war. Dort werden sie nach ihm suchen. Nicht auszudenken, was das auch für Drostes bedeutet, wenn sie ihn dort finden sollten!
Aber wohin dann?
Sein Plan B fällt ihm ein. Eigentlich eher ein Plan Z oder so, nicht besonders gut. Aber er weiß sonst keinen.
Eine halbe Stunde später steht er vor der Haustür von Frau Schultheiß, seiner Lehrerin für Latein und Geschichte. Sie ist so ein freundlicher Mensch, dass Daniel sich nicht vorstellen kann, von ihr abgewiesen zu werden. Sie hat ihn immer genauso behandelt wie die anderen, die in der letzten Zeit mehr und mehr von ihm abgerückt sind. Vielleicht sogar noch freundlicher, um die Unfreundlichkeit der Mitschüler auszugleichen. Außerdem hat Frau Schultheiß den Vorteil, dass sie allein lebt.
Als er geklingelt hat, muss er warten. Natürlich, sie schläft sicher um diese Zeit. Aber er klingelt nicht gleich ein zweites Mal. Er will sie ja nicht ärgerlich machen.
Nach einer Zeit, die ihm wie eine Viertelstunde vorkommt, aber wohl nur zwei oder drei Minuten dauerte, öffnet Frau Schultheiß im ersten Stock ein Fenster und schaut heraus.
„Frau Schultheiß, entschuldigen Sie …“, flüstert er. Sie schneidet ihm mit einer Handbewegung das Wort ab und antwortet nur: „Moment!“
Kurz darauf öffnet sich die Haustür. Seine Lehrerin steht da im Morgenrock. Daniel fällt zum ersten Mal auf, dass sie ziemlich gut genährt aussieht. Was einem alles durch den Kopf geht, wo es doch jetzt viel Wichtigeres gibt!
Frau Schultheiß nickt ihm zu. „Komm rein, Daniel!“ Anscheinend hat sie sofort begriffen, worum es geht.
„Nicht lange, Frau Schultheiß, nur für den Rest der Nacht und morgen. In der nächsten Nacht will ich weiter …“
„Mach einen großen Schritt über die dritte Stufe! Die knarrt so laut.“
Als sie in ihrer Wohnung sind, gehen sie vom Flüstern wieder zu normaler Lautstärke über. „Sie wollten uns holen“, erklärt er. „Ich bin geflohen. Aber sie haben meine Mutter …“
„Es tut mir leid, Daniel. Aber erzähle mir nichts weiter. Besser, ich weiß möglichst wenig. Möchtest du dich noch etwas zum Schlafen aufs Sofa legen?“
„Ich kann jetzt doch nicht schlafen. Aber ich würde gern – hätten Sie bitte ein Blatt Papier und einen Stift für mich?“
„Selbstverständlich.“ Sie holt beides aus einem anderen Raum, nimmt die Zierdecke vom Wohnzimmertisch und legt das Papier darauf. „Da kannst du schreiben.“
„Und würden Sie auch noch … Ich weiß, es ist unverschämt, ich dringe mitten in der Nacht hier ein und …“
„Lass mal! Ich helfe gern. Ich soll den Brief, den du schreibst, abschicken?“
„Ja, bitte. An Hans Droste. Die Adresse haben Sie ja von der Schule. Ich schreibe sie noch mal auf.“
„Das mache ich. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. Du kannst dich nachher aufs Sofa legen. Solltest du morgen noch schlafen, wenn ich in die Schule muss – da ist Brot und was du sonst noch brauchst für ein Frühstück.“
„Ganz herzlichen Dank!“
„Schon gut! Ich wünsche dir … ja, was? Alles Gute? Der Wunsch ist vielleicht zu hoch gegriffen. Gutes Gelingen für deine Pläne wünsche ich dir. Und dass deine Mutter … na, gute Nacht, Daniel!“
Sie tritt auf den Flur hinaus, um ins Schlafzimmer zu gehen, so schnell, dass Daniel sein „gute Nacht“ nur noch zu der verschlossenen Wohnzimmertür sagen kann.
Dann legt er den Rucksack auf den Boden, setzt sich an den Tisch und nimmt den Stift zur Hand.
Kassel und Umgebung, 75 Jahre später
Montag, 6. Juni
„Ah – Mia! Ich freue mich, dass du mich besuchst!“
„Mama hat gesagt, ich soll dich besuchen, Oma.“
„Du sollst mich besuchen? Du tust es aber doch gern, nicht wahr?“
„Klar, Oma! Ich hab dich doch lieb!“
„Ich dich auch. Dann komm mal rein!“
Die Großmutter und ihre Enkelin gehen in die Küche, wo Annette gerade dabei war, Kartoffeln zu schälen. Jetzt nimmt sie die Arbeit wieder auf, und die Enkelin setzt sich auf einen Küchenstuhl. „Können wir was spielen, Oma?“
„Was denn?“
„Ich sehe was, was du nicht siehst.“
„Ach, weißt du, das geht schlecht, wenn ich das Essen vorbereite. Besser, wir unterhalten uns ein bisschen.“
„Ist gut.“
„Hat denn deine Mama was Besonderes vor, dass sie nicht auf dich aufpassen kann und dich hergeschickt hat?“
„Weiß ich nicht.“
„War’s schön im Kindergarten?“
Mia nickt. Nach einer Weile sagt sie: „Du, Oma!“
„Ja?“
„Warum habe ich keinen Papa?“
„Wie kommst du denn darauf? Du hast einen Papa. Jeder hat einen.“
„Das stimmt nicht. Im Kindergarten haben alle einen. Nur ich nicht.“
Frau Droste legt die letzte Kartoffel ins Wasser und das Schälmesser aus der Hand. „Hast du deine Mama danach gefragt?“
„Die hat gesagt, ich soll dich fragen.“
„Gut, ich erkläre es dir.“ Sie setzt sich auch, Mia verlässt ihren Sitzplatz und drängt sich bei Oma auf den Schoß. „Dein Papa ist mein Sohn. Darum bin ich deine Oma. Aber Papa hat deine Mama nicht geheiratet. Und er wohnt auch nicht hier. Er arbeitet ganz weit weg. Darum ist er nicht da, und es sieht so aus, als hättest du keinen Papa.“
„Und warum ist er nicht da?“
„Das ist eine gute Frage, Mia. Aber ich kann sie dir nicht beantworten. Ich habe ihm oft gesagt, er soll doch deine Mama heiraten, damit ihr eine richtige Familie seid. Und hierbleiben. Aber er will nicht auf mich hören.“
Anette Droste fürchtet, ihre Enkelin nun in Probleme gestürzt zu haben, und ist darum angenehm überrascht, als Mia unbefangen das Thema wechselt. „Wo ist denn Melanchton?“
Melanchton ist der Kater der Familie. „Ich habe ihn nicht gern in der Küche, wie du weißt. Aber wir wollen mal eine Ausnahme machen. Er wird drüben sein, du kannst ihn holen.“
Kurz darauf sitzt Mia wieder auf ihrem Stuhl mit dem Kater Melanchton auf dem Schoß. Oma werkelt am Herd.
„Mein Papa ist dein Kind“, rekapituliert das Mädchen. „Und Tante Hannah ist auch dein Kind. Und Onkel Mats.“
„Richtig.“
„Tante Hannah kann nichts sehen. Aber ich hab sie gern.“
„Na klar, wenn jemand blind ist, kann man ihn ja trotzdem gernhaben. Hast du denn auch Mats gern?“
Mia wiegt den Kopf und überlegt. „Ja, aber nicht so wie Tante Hannah“, antwortet sie schließlich.
„Wenn dein Papa hier wäre, würdest du ihn sicher auch liebhaben.“
„Weiß nicht. Ich kenne ihn ja nicht.“
„Du hast ihn aber schon gesehen.“
„Da muss ich aber noch sehr klein gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern.“
„Ja, das stimmt, da warst du noch ziemlich klein. Vielleicht zwei Jahre, oder zweieinhalb. Zu Mats’ Konfirmation war er das letzte Mal hier, und das ist jetzt zwei Jahre her.“
Mia krault den Kater, und der knurrt behaglich.
„Ich helfe Tante Hannah manchmal. Wenn sie was sucht, zum Beispiel. Weil sie’s nicht finden kann.“
„Das ist sehr lieb von dir.“
„Aber gehen kann sie alleine. Mit ihrem Stock, da fühlt sie immer, ob was im Weg ist. Sie kann auch ganz alleine mit dem Bus fahren. Wenn sie von der Arbeit kommt.“
„Ja, sie weiß genau, wo es langgeht und was sie machen muss.“
„Da könnte ich ihr gar nicht helfen. Weil ich nicht weiß, was man machen muss beim Busfahren. Aber sie weiß es.“
Anette mischt Hackfleisch, weil sie Frikadellen braten will.
„Du, Oma.“
„Ja?“
„Tante Hannah heißt Hannah, Mats heißt Mats – und wie heißt mein Papa?“
„Florian heißt er. Er ist das älteste von meinen Kindern. Hat dir das deine Mama noch nicht gesagt?“
„Nein. Sie hat mir nichts von ihm erzählt. Wenn ich sie frage, wird sie immer traurig. Darum frage ich sie nicht.“
„Aber mich kannst du fragen.“
Mia hebt den Kater hoch und drückt die Wange in sein Fell. „Dich hab ich lieb, Oma. Und Melanchton auch.“
„Und deine Mama doch sicher auch?“
„Ja, die auch. Und Tante Hannah. Und ein bisschen auch Mats.“
Der Landwirt August Knabe tuckert mit seinem Traktor über den Acker. Als er aus den Augenwinkeln eine schnelle Bewegung auf der Straße wahrnimmt, blickt er auf. Wer rast denn da so verrückt auf einer schmalen Landstraße, deren Asphalt auch schon ziemlich löchrig ist? Ein gelber Kleinwagen!
Der Rentner Ottfried Lieb bleibt so plötzlich auf seinem Spaziergang stehen, dass sein Stock, den er gerade beim nächsten Schritt aufsetzen wollte, oben bleibt und ziemlich genau auf das gelbe Fahrzeug weist. Das Ding wird ja immer schneller! Das kann doch nicht gutgehen!
Es bleibt ihm fast das Herz stehen, als er sehen muss, wie das Auto mit ungeheurer Wucht gegen den einzelnen Kastanienbaum kracht, der da am Straßenrand steht. Das Fahrzeug knautscht zusammen, einzelne Teile fliegen durch die Luft. Es scheint dem Rentner, als wäre diese Bewegung merkwürdig verlangsamt, so als sollte ein Beobachter die Szene auch richtig auskosten können. Erst einen Augenblick später kommt der Knall bei ihm an.
Ottfried Lieb kann nicht mehr rennen, aber er beschleunigt seinen Schritt und kommt fast gleichzeitig mit dem Bauern Knabe an. Der springt vom Traktor und zieht sein Handy aus der Tasche. Er tippt 110 und spricht.
Ottfried Lieb traut sich nicht näher heran. Man weiß ja, aus Filmen und so, dass solche Unfallautos plötzlich explodieren können. Wenn das auslaufende Benzin sich am heißen Motor entzündet.
Knabe tritt neben ihn. „Das war kein Unfall!“, sagt er.
„Wie?“
„Das war kein Unfall. Das war Selbstmord!“
„Meinen Sie?“
„Wie der gerast ist!“
„Die!“, verbessert Lieb. „Es ist eine Frau.“
Knabe traut sich vorsichtig etwas näher hin. „Wenn sie noch lebt, müssen wir versuchen, sie herauszuholen. Falls der Wagen brennt.“
„Sie lebt sicher nicht mehr! Nach dem Aufprall kann sie nicht mehr leben!“
Knabe geht noch näher ran. „Nein“, bestätigt er, „da ist mit Sicherheit nichts mehr zu retten.“
Er ist jetzt bei dem Auto und reißt an der Tür. Sie bewegt sich nicht. Dann geht er um das Fahrzeug herum und probiert es an der anderen Seite. „Ich helfe!“, ruft der Rentner und kommt auch. Aber auch mit vereinten Kräften können sie die Tür nicht öffnen. Das Auto wackelt nur ein wenig. Das bewirkt, dass der Kopf der eingeklemmten Frau hinter dem Steuer etwas zur Seite fällt.
„Sie war nicht angeschnallt!“, stellt Lieb fest.
„Die kenne ich!“, sagt Bauer Knabe. „Irgendwoher kenne ich die. Ist das nicht die – wie heißt sie? –, die Jenni, die das Kind vom ältesten Drostesohn hat?“
„Ach ja, das kann sein“, murmelt Ottfried Lieb, der Rentner. Da hören sie auch schon die Sirene.
Es sind nur ungefähr dreihundert Schritte von der Bushaltestelle zum Haus. Hannah ist hier schon tausendmal gegangen. Unterwegs grüßen einige Dorfbewohner, und Hannah ist stolz darauf, jede – oder fast jede – Stimme zu erkennen und mit Namen zurückzugrüßen.
Als sie eben die zwei Stufen zur Haustür hinaufgehen will, kommt ihr jemand entgegen. „Guten Tag!“, grüßt eine Frauenstimme, dann entfernen sich die Schritte. Sie ruft „Hallo“ hinterher, steigt die Stufen hinauf und betritt das Haus.
„Mama?“
Mats antwortet aus dem Wohnzimmer: „Sie ist oben. Mit Mia. Es ist was Schlimmes passiert.“
Hannah geht ins Wohnzimmer und setzt sich. „Was? Wer war das eben?“
„Jenni ist tot!“
Hannah zieht erschrocken die Luft ein.
„Sie ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren.“
„Ein Unfall?“
„Die Polizei ist sich noch nicht sicher, ob es ein Unfall war, oder … oder Absicht.“
„So ein Mist!“
„Als ich aus der Schule kam, war die Polizei gerade da. Eine Polizistin ist mit Mia in einen anderen Raum gegangen, damit sie das nicht gleich mitbekommt. Im Moment ist Mama dabei, es ihr zu erklären.“
Eine Weile sagt niemand etwas, dann meint Hannah: „Sie war depressiv. Sag ich mal so, als Laie. Ein Arzt würde es vielleicht anders ausdrücken.“
„Ja, stimmt. Und es hat mit Florian zu tun. Nicht nur, aber auch.“
„Sie hat immer noch darauf gehofft, dass er zurückkommt und sie heiratet.“
„Hast du mit ihr drüber gesprochen?“
„Ein paarmal“, nickt Hannah. „Allerdings ist sie auch schon immer etwas – wie soll ich sagen? – pessimistisch veranlagt.“
„Gewesen.“
„Ja, gewesen. Das war auch mit ein Grund, weshalb Florian nie ernsthaft die Absicht hatte, sie zu heiraten. Ein so fröhlicher Typ wie unser Bruder …“
„Fröhlich? Das klingt jetzt ziemlich positiv!“, knurrt Mats. „Ich würde sagen: oberflächlich. Und egoistisch.“
Hannah macht mit dem Kopf eine Bewegung zur Tür hin. „Wer war die Frau? Auch noch Polizei?“
„Das war jemand vom Jugendamt. Wegen Mia. Mama will, dass sie erst mal bei uns bleibt. Die Frau war auch einverstanden.“
„Hat Mama schon mit Florian telefoniert?“
„Sie hat’s versucht. Er war nicht zu erreichen.“ Mama und Mia kommen herein. Das Kind hat verweinte Augen. Es kommt auf Hannah zu, schmiegt sich an sie und sagt: „Meine Mama ist gestorben.“
Hannah streicht ihr über das Haar. „Ja, das hat mir Mats gerade gesagt. Es tut mir so leid, Mia!“
„Aber sie ist jetzt im Himmel, sagt Oma.“
„Da hat Oma bestimmt recht. Und weißt du, Mia, wenn deine Mama dich jetzt nicht mehr liebhaben kann, werde ich dich doppelt so liebhaben.“
Das Mädchen birgt sein Gesicht in Hannahs Kleid. Seine Oma stellt sich daneben und legt beiden, Tochter und Enkelin, die Hand auf die Schulter. Weil sie mit Hannah keine Blicke tauschen kann, ist sie es gewohnt, sie öfter zu berühren. Jetzt passt das besonders.
Hannah stellt mit erstaunlichem Geschick Teller auf den Tisch.
„Mia, holst du Wurst und Käse aus dem Kühlschrank?“
Mia setzt Kater Melanchton ab und hilft. „Ich lege auch die Messer hin!“, sagt sie, als Hannah tastend nach den richtigen Stellen für das Besteck sucht.
Mats fragt: „Wo ist Mama?“
„Weiß nicht“, antwortet Hannah. „Ist sie nicht im Wohnzimmer?“
„Sie ist oben, glaube ich“, sagt Mia.
Mats geht die Treppe hinauf. „Mama?“ Als er sie nicht findet, ruft er hinunter: „Hier ist sie nicht.“
Da hört er ihre Stimme. „Suchst du mich? Ich bin hier oben auf dem Dachboden!“
Mats steigt die schmale Treppe hinauf. Seine Mutter sitzt auf einer alten Kiste. „Was machst du denn hier?“
Sie schüttelt nur leicht den Kopf, um anzudeuten, dass sie die Frage nicht beantworten will. Für eine Sekunde schießt Mats der Gedanke durch den Kopf, dass dies der ideale Ort wäre, sich mit einem Strick und dem Dachbalken dort das Leben zu nehmen. Vielleicht auch die geeignete Situation. Aber dann verwirft er den Gedanken schnell. Nein, Mama niemals!
„Hannah deckt schon den Abendbrottisch.“
„Ich komme gleich.“
Mats schaut sie schweigend an, da entschließt sie sich, doch noch die Frage zu beantworten. „Ich wollte eure alten Spielsachen suchen. Wenn Mia jetzt bei uns bleibt – vielleicht ist da was für sie dabei. Aber ich habe nichts gefunden. Dann habe ich mich kurz hier hingesetzt, um mich auszuruhen vom Bücken unter der Dachschräge, und da dachte ich: Es ist hier der beste Ort und der beste Zeitpunkt, mit Gott über alles zu reden. Das tut mir gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon hier sitze. Wie spät ist es denn?“
„Kurz nach sechs. Du meinst, du hast gebetet? Hier auf dem staubigen Dachboden?“
„Hier ist es schön ruhig. Und den Staub sehe ich nicht, wenn ich die Augen schließe.“
„Hast du dich bei Gott beschwert?“
„Beschwert?“
„Ja. Hast du dich beschwert über das, was du alles mitmachen musst? Eine blinde Tochter geboren, dann hast du deinen Mann verloren durch diesen sch… Krebs, dann dass dein ältester Sohn – sagen wir: Wege geht, die du nicht gut findest. Und sie sind es ja auch nicht. Und jetzt bringt sich die Mutter deiner Enkelin einfach um. Da kann man schon mal an der Liebe Gottes zweifeln. War es das?“
„Ich habe Gott nicht angeklagt, Mats. Ich habe bei ihm Trost gesucht.“
Mats bläst Staub von der Kiste auf dem Platz neben seiner Mutter und setzt sich. „Und? Hast du welchen gefunden?“
„Die Frage klingt so, als glaubst du nicht, dass man bei Gott Trost finden kann. Doch, kann man. Sicher gibt es Menschen, die das Vertrauen verlieren, wenn sie schwere Dinge erleben. Mich treiben die Schicksalsschläge eher zu ihm hin. Weil ich da … wie soll ich sagen …?“
„Trost finde.“
„Ja. Und ruhig werde. Und geborgen bin.“
Eine Weile schweigen sie beide. Dann fragt Mats: „Hast du Spielsachen gefunden?“
„Nichts für ein kleines Mädchen. Aber ich werde später noch weitersuchen.“
„Was ist denn das da hinten für ein Karton? Da guckt ein Papierdrachen raus. Oder was ist das für ein Ding?“ „Das sind uralte Sachen. Von deinem Opa.“ Mats steht auf und geht in die Ecke mit den ältesten Kisten. In dem Karton findet er Spielsachen aus Holz und Blech, aus einer Zeit, in der es noch keinen Kunststoff gab. Automodelle und eine Dampfmaschine, die offenbar richtig befeuert werden konnte und sich bewegte. Das muss damals echt was Besonderes gewesen sein. Darunter liegen Stapel von verschiedenen Heften und Bücher. Er liest die Titel. „Die Schatzinsel“, „Addi, der Rifleman“, „Wettflug der Nationen“. Obenauf liegt ein noch verschlossener Brief.
Mats nimmt den Umschlag und kommt damit zu seiner Mutter zurück. „Ein ungeöffneter Brief.“
„Ach ja, ich erinnere mich. Wir haben ihn aus Respekt nicht geöffnet. Aber das hätten wir inzwischen natürlich tun können. Haben’s nur vergessen.“
„Herrn Hans Droste“, liest Mats.
„Das war dein Großonkel. Der ältere Bruder deines Großvaters Klaus. Er wurde mit sechzehn Jahren als Luftwaffenhelfer eingezogen, zur Flak. Davon ist er nicht wiedergekommen.“
„Ja, das hat Papa uns erzählt.“
„Kurz nachdem er fort war, ich meine, es wäre schon am Tag danach gewesen, aber so genau weiß ich das nicht …“
„… kam dieser Brief.“
„Kam dieser Brief an ihn. Seitdem liegt er bei den alten Sachen.“
„Absender ist ein L. Schultheiß. Oder eine L. Schultheiß, der Schrift nach könnte es eher eine Frau sein.“
Hannah ruft von unten: „Seid ihr da oben?“
„Ja, wir kommen!“, ruft Anette Droste und steht auf. Mats folgt ihr und sagt: „Ich nehme den Brief mal mit runter. Wir sollten ihn aufmachen. Nach so langer Zeit müssen wir das Postgeheimnis unseres längst verstorbenen Großonkels nicht mehr so ernst nehmen.“
Als sie im Wohnzimmer sitzen und Mats gerade den Brieföffner sucht, kommt Hannah herein. „Ich habe in der Küche gedeckt. Kommt, wir haben schon Hunger, Mia und ich.“
„Sekunde noch“, sagt Mats. „Wir haben einen uralten Brief an unseren Großonkel gefunden, den noch nie jemand gelesen hat.“
„Von wem?“
„L. Schultheiß. Keine Ahnung, wer das ist.“
„Lies mal vor!“
Mats zieht drei Blätter aus dem Umschlag und wirft einen ersten Blick darauf. Komisch – auf zwei Blättern steht nur eine schier endlose Folge von Buchstaben. „Nur Buchstaben. Die beiden Blätter voll. Nur große Buchstaben, ohne Absätze, ohne Satzzeichen.“
„Eine Geheimschrift?“
„Ein richtiger Brief ist auch dabei.“
„Lies ihn mal vor!“, bittet seine Mutter.
„Kassel, den 17. 3. 1941. Lieber Hans Droste. Ihre Adresse habe ich von Ihrem Freund Daniel Grüntal bekommen. Er ist mein Schüler. In der vergangenen Nacht klingelte er bei mir und bat, sich für kurze Zeit hier verstecken zu können. Seine Mutter war gerade verhaftet worden, aber er konnte fliehen. Er schrieb dann bei mir diesen in einem mir unbekannten Code verfassten Brief und bat mich, ihn an Sie zu schicken. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie beide sich diese Geheimschrift aus spielerischen Gründen ausgedacht. Jedenfalls sagte er, Sie könnten den Brief lesen. Er meinte, es sei wichtig, dass jemand, dem er vertraut, einige Dinge wisse. Zum Beispiel, wer seine Mutter schon dauernd bedrängt habe, ihm ihr Haus zu einem Spottpreis zu verkaufen, ehe sie es nicht mehr verkaufen könne. Und auch, wie und wo er mit seiner Mutter die Wertsachen versteckt habe, Bilder, Schmuck und dergleichen. Heute hat Daniel meine Wohnung wieder verlassen. Ich hoffe, dass er diese schwere Zeit überlebt. Er hat mir nicht gesagt, was er vorhat. Vielleicht steht das in diesem Brief. Unbekannterweise grüßt, Klammer auf: In der Annahme, dass ich mir bei Ihnen als einem Freund von Daniel den H. H.-Gruß ersparen kann, Klammer zu, Luise Schultheiß.“
Eine Weile schweigen alle drei, bis Mia kommt. „Essen wir jetzt?“
„Ja, wir essen jetzt“, antwortet ihre Oma, und alle gehen in die Küche.
„Meinst du, wir kriegen den Code geknackt?“, fragt Hannah ihren Bruder.
„Keine Ahnung“, sagt der. „Kann eigentlich nicht so schwer sein. Sie waren schließlich damals noch Kinder, als sie diese Geheimschrift …“
„Auch nicht viel jünger, als du jetzt bist!“
„Stellt euch vor, wir fänden noch die irgendwo versteckten Wertsachen!“
Ihre Mutter sagt nur: „Unsinn!“
„Wieso Unsinn? Ist doch nicht unmöglich.“
„Aber es ist fraglich, wem der Schatz dann gehört.“ Hannah meint: „Lasst uns das besser klären, wenn wir ihn haben.“
Mats überlegt. „Es gibt sicher Programme, mit denen man so einen Code knacken kann.“
„Lass es uns lieber allein versuchen!“, wendet Hannah ein. „Falls da noch Schätze zu heben sind, wäre es gut, wenn kein anderer was davon mitbekommt.“
„Schluss jetzt!“, sagt ihre Mutter energisch.
„Ich habe Hunger.“ Mias Stimme ist ganz leise.
„Ja, wir essen jetzt. Du weißt ja, Mia, wir beginnen immer mit einem Tischgebet.“ Und alle vier senken die Köpfe.
Dienstag, 7. Juni
Es klingelt.
„Das ist für mich“, sagt Hannah. „Jaron, ein IT-Student. Ich kenne ihn von der Uni. Er will mir ein Programm installieren.“