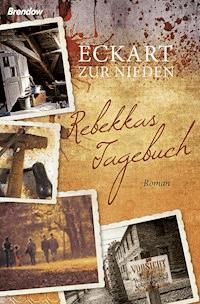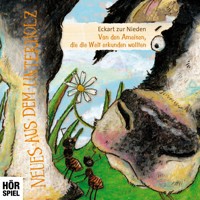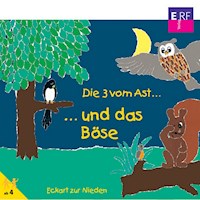Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein alter Tunnel, Kriegsereignisse und eine verborgene Schuld: Der neue Roman des beliebten Autors Eckard zur Nieden führt in ein kleines, fiktives Dörfchen im Hochtaunus - eine Erzählung nach wahren Begebenheiten. 1992 im Hochtaunus: Der 19-jährige Jens Montag begleitet seinen 86-jährigen Großvater auf einer Urlaubsreise. Der alte Mann möchte auf seine letzten Tage unbedingt an den Ort zurückkehren, der ihn während des 2. Weltkriegs so geprägt hat. Für Jens ist die Geschichte seines Großvaters ein großes Geheimnis. Was hat das kleine Dörfchen Erlbruch damit zu tun? Und welche Rolle spielte der alte stillgelegte Tunnel nahe des Dörfchens im Leben seines Großvaters? Nach und nach erfährt Jens die ungeheuerliche Wahrheit, die das Leben mehrerer Generationen in Erlbruch und darüber hinaus beeinflusst hat, und er fragt sich: Wie wird man frei von einer Schuld, die seit Jahrzehnten im Verborgenen gehalten wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eckart zur Nieden
IMSCHATTENDESTUNNELS
Roman
Wenn nicht anders angegeben, sind die Bibelstellen dem Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen entnommen. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
Die Bibelstelle aus Epheser 4,32 wurde der Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart entnommen.
© 2021 Brunnen Verlag GmbH
Lektorat: Carolin Kotthaus
Umschlagfoto: Adobe Stock
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul
Satz: DTP Brunnen
ISBN Buch 978-3-7655-3764-6
ISBN E-Book 978-3-7655-7627-0
www.brunnen-verlag.de
Inhalt
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
EPILOG
PROLOG
IM JUNI 2021
„Es ist schön hier!“ Hanna Montag schaut aus dem Fenster des Schienenbusses, der mit mäßigem Tempo durch den Taunus fährt. Äcker und Wiesen und gelegentlich ein Wäldchen ziehen vorbei.
„Sagte ich doch!“, antwortet ihr Vater Jens, der neben ihr sitzt.
„Trotzdem leuchtet mir noch nicht ein, warum wir in dein Dörfchen fahren müssen. Konntest du mir deine Geschichte nicht auch zu Hause erzählen?“
„Natürlich hätte ich das auch gekonnt. Aber ich denke, wenn du alles siehst, verstehst du es besser. Mit deinen 23 Jahren wird es langsam Zeit, dass du die Wahrheit erfährst über das, was ich als junger Mann erfahren habe.“ Er legt die Hand auf ihren Arm. „Und es wird dir doch kein großes Opfer sein, mal das Wochenende mit deinem Papa auf dem Land zu verbringen, oder?“
„Natürlich nicht!“ Die junge Frau schüttelt den Kopf. „Ich wundere mich nur. Ich habe schon seit einiger Zeit ein paar offene Fragen. Warum wurde ich zum Beispiel in Israel geboren? Natürlich weiß ich, dass ihr damals in einem Freiwilligendienst dort wart …“
„Genau. Und zwar organisiert von der Aktion Sühnezeichen. Es sollte nur ein Jahr sein, aber dann waren wir so drin in der Arbeit –“
„Dass ihr noch viel länger geblieben seid. Oder statt ‚ihr‘ muss ich wohl ‚wir‘ sagen.“ Hanna grinst. „Das alles weiß ich natürlich. Aber ich frage mich: warum? Ich kenne eure christliche Motivation. Aber es muss doch noch mehr dahinterstecken, wenn ein hoch qualifizierter Bauingenieur in einem fremden Land alte Leute betreut – in den besten Jahren seines Lebens …“
Ihr Vater nickt. „Eben deshalb will ich dir nicht nur in wenigen Sätzen antworten, sondern eine Geschichte erzählen.“
„Die hier spielt?“
„Genau. In Erlbruch.“
„Und was hat dieses Ding damit zu tun?“ Sie bückt sich und holt aus ihrer Tasche, die auf dem Boden steht, ein merkwürdiges Drahtgebilde hervor. Es war wohl einmal so groß wie ein Suppenteller, ist jetzt aber verbogen und zusammengedrückt. Reste von Pappe hängen dazwischen.
Jens Montag staunt. „Wo hast du das denn her?“
„Als ich Mama geholfen habe, den alten Koffer aus Israel auszuräumen, lag es unten drin. Doch als ich sie fragte, was es damit auf sich hat, sagte sie, ich solle dich fragen. Das hat dann wohl auch mit deiner Geschichte zu tun?“
„Ja, es spielt darin eine Rolle. Aber es ist nicht nur meine Geschichte, es ist unsere. Deine Mutter war auch dabei.“
Hanna glättet ein Stück Pappe und deutet auf die Schrift darauf. „Man kann es nicht mehr gut lesen, aber ich habe es doch entziffert. ‚Ich bin jeden Tag bei euch‘, steht da. In der Bibel kann man das bestimmt einfacher lesen als auf diesem Fetzen. Hier steht eine Bibelstelle … Oh!“
Es wird plötzlich dunkel und Hanna kann nichts mehr erkennen. Der Zug ist gerade in einen Tunnel gefahren.
„Wenn wir aus dem Tunnel herauskommen, sind wir da“, sagt Jens Montag. „Er ist nur 4,2 Kilometer lang.“
„Du kennst dich aber gut aus!“
„Ich war sogar schon zu Fuß hier drin!“, hört sie ihren Vater aus dem Dunkeln.
„Zu Fuß? Im Tunnel? Aber das ist doch gefährlich! Wenn ein Zug gekommen wäre …“
„Damals fuhren hier keine Züge. Aber gefährlich war es trotzdem.“
Hanna grinst, was ihr Vater natürlich nicht sehen kann. „Ich seh schon, du willst es besonders dramatisch machen und mich auf die Folter spannen, damit dir meine volle Aufmerksamkeit sicher ist, wenn du deine Story endlich loswirst.“
Ihr Vater antwortet nicht.
Nach einer Weile sagt er – leise, sodass Hanna es bei den Fahrtgeräuschen kaum versteht –: „Man spricht ja vom Licht am Ende des Tunnels. Ich habe das damals tatsächlich so erlebt. Bevor ich hierherkam, war es dunkel in meinen Gedanken und Gefühlen, was meine Lebenspläne und den Sinn des Lebens betraf. Aber dann ging mir sozusagen ein Licht auf.“
Jetzt wird es wieder hell. Der Zug verlässt den Tunnel, wird langsamer und hält schließlich an einem schlichten Bahnsteig.
Vater und Tochter nehmen ihr weniges Gepäck und steigen aus. Vor ihnen liegt das Dorf – Erlbruch.
Hanna macht sich mit ihrem Koffer auf den Weg. Zwar kennt sie sich nicht aus, aber es gibt nur diese eine Straße. Da merkt sie plötzlich, dass ihr Vater stehen geblieben ist. Neugierig kommt sie zurück, stellt sich neben ihn und schaut wie er auf eine bronzene Tafel, die an einem Felsen angebracht wurde. Sie überfliegt den Text. Da wird an Zwangsarbeiter erinnert, die im Krieg hier gearbeitet haben.
„Wenn ich es richtig einschätze“, sagt Hanna, „hat diese Tafel auch mit deiner Geschichte zu tun.“
„Ganz genau. Komm, lass uns gehen!“
Zehn Minuten später stehen sie vor dem Landgasthof, in dem sie sich angemeldet haben.
Der Wirt, etwa vierzig Jahre alt, kommt ihnen mit einem Lächeln entgegen. „Hallo Jens!“, ruft er schon aus einiger Entfernung. „Ich darf doch noch Jens sagen?“
„Ja, gern! Ich werde mir auch erlauben, dich Leon zu nennen.“ Sie begrüßen sich mit Handschlag. „Du hast mich also noch erkannt.“
„Das war nicht schwierig, weil ich in den Unterlagen deine Anmeldung gesehen habe. Jens Montag. Und das ist deine Tochter?“
„Ja, meine Tochter Hanna.“ Die beiden begrüßen sich ebenfalls.
„Verzeihung!“, sagt der Wirt. „Eigentlich kommt die Dame zuerst dran. Aber da Ihr Vater und ich alte Bekannte sind … Kommt rein!“
Sie betreten die Gaststube. Wie in vielen Landgaststätten üblich hängen Hirschgeweihe an den Wänden, aber auch Bilder und eine Fahne von irgendeinem Verein, der hier seinen Stammtisch hat. Die Wand gegenüber dem Eingang ist schmucklos, bis auf einen Flugzeug-Propeller, der schräg in der Mitte der Wand angebracht ist.
Jens Montag zeigt darauf. „Ist das der von damals, der aus deinem Zimmer?“
„Ja“, antwortet Leon. „Meine Frau wollte ihn weder im Schlafzimmer noch in der Wohnstube haben. Also habe ich ihn hier angebracht. Sieht doch gut aus, findest du nicht?“
„Ja, durchaus.“
Lächelnd blickt der Wirt vom Propeller zu seinen Gästen. „Kommt, ich zeige euch eure Zimmer.“
Eine knappe Stunde später sitzen Vater und Tochter wieder in der Gaststube und genießen als Abendessen ein Omelett. Plötzlich öffnet sich die Tür und polternd kommen vier Männer in lederner Motorradkluft herein. Sie sehen aus, als seien sie zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt, und reden laut miteinander.
„Guck mal da!“, ruft einer und zeigt auf die Wand. „Ein Propeller! Könnte von einer Me 109 sein oder von einem Stuka.“
„Hier sind wir richtig!“, stellt ein Dicker mit Glatze fest und grinst großspurig. „Hier werden die alten Heldentaten noch in Ehren gehalten.“
„Genau! Kommt, wir setzen uns unter den Propeller!“, beschließt ein Langer in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet. Und schon sitzt er. Die anderen lassen sich neben ihm nieder, ihr Lärm erfüllt den ganzen Raum.
Hanna murmelt ihrem Vater zu: „Wollen wir nicht lieber etwas abrücken? Die Leute sind mir unsympathisch. Und so laut.“
„Lass uns erst mal hierbleiben. Sieht komisch aus, wenn wir jetzt mit unseren halb leeren Tellern umziehen.“
Still essen Hanna und ihr Vater weiter. Sie können gar nicht anders als mitzuhören, was da am Nebentisch gesprochen wird. Die Männer scheinen eine Gruppe von Neonazis zu sein. Sie schwärmen zunächst mindestens zehn Minuten lang von der deutschen Luftwaffe, obwohl sie ihr Wissen ja höchstens aus Büchern haben können. Denn weder sie noch ihre Väter können damals dabei gewesen sein, noch nicht einmal ihre Großväter.
Jens blickt zum Wirt hinüber, der an der Theke steht. Der erwidert seinen Blick und zuckt mit den Schultern. Das soll wohl heißen: Was soll ich machen? Sie sind Gäste.
Die vier Männer trinken Bier und je mehr sie trinken, desto lauter werden ihre Sprüche.
Hanna versucht, ein Gespräch mit ihrem Vater anzufangen, um nicht dem Grölen zuhören zu müssen. Trotzdem dringen Worte wie „Scheißjuden“, „Kanaken“ und „Polaken“ zu ihr durch. Ihr Vater ist gerade dabei, seiner Tochter eine Antwort zu geben, da hören sie einen weiteren abfälligen Spruch. Jens bekommt einen roten Kopf und springt auf.
Hanna ahnt, dass er sich mit den Männern anlegen will, und zupft ihn eindringlich am Jackenärmel. Es erinnert ihren Vater daran, dass er besonnen bleiben soll.
„Meine Herren!“, spricht Jens die grölenden Männer an. Seine Stimme klingt ernst. „Ich weiß nicht, was Sie dazu bringt, so verletzend und von oben herab über andere Leute zu reden, die Sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber ich möchte das Wort Polaken nicht mehr hören. Das ist ein Schimpfwort. Die Leute heißen Polen! Ich habe einen Freund, der Pole ist, und für den spreche ich hier. Er ist ein wertvoller Mensch, der es nicht verdient, dass so über seine Landsleute geredet wird.“
Für eine Sekunde herrscht Schweigen. Dann brechen alle vier in Gelächter aus.
Hanna würde ihren Vater gern zurückrufen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Als sie sich Hilfe suchend umblickt, bemerkt sie, dass der Wirt telefoniert.
Der Lange, der eine Art Wortführer zu sein scheint, ruft nun feixend aus: „Hör sich das einer an! Der Opa verteidigt die Polaken!“
Jens antwortet erstaunlich ruhig: „Ich nehme an, das mit dem Opa soll auch herabwürdigend sein. Aber das ärgert mich nicht. Schließlich wird jeder mal alt, Sie auch. Und vielleicht erleben Sie dann, wie es ist, wenn irgendwelche Leute meinen, Sie fertigmachen zu können, nur weil sie jünger sind. Nein, ein Opa bin ich noch nicht, aber meinetwegen könne Sie mich so nennen. Doch das Wort Polaken oder eins dieser anderen Schimpfwörter will ich nicht mehr hören!“
Der Lange steht auf und starrt ihn an. „Sonst was?“
Hanna stockt der Atem. In was für eine Situation hat sich ihr Vater da hineinmanövriert?!
In diesem Moment tritt Leon dazu. „Ich will keinen Streit in meinem Haus! Beruhigt euch, Leute!“
„He – der Alte hat angefangen!“, behauptet der Lange, und die anderen stimmen ihm lauthals zu. „Wir sind Gäste, die hier nur friedlich ihr Bier trinken!“
„Es ist nicht friedlich, wenn man so über andere Leute herzieht,“ wirft Jens ein. Und Leon ergänzt: „Da gebe ich ihm recht. Ich kenne den Polen auch, von dem er sprach. Aber ganz egal, ob ich einen Polen kenne oder nicht –“
Jens unterbricht: „Kennt ihr denn einen? Oder einen Juden? Habt ihr denn schon schlechte Erfahrungen mit einem gemacht oder plappert ihr nur nach, was in euren Kreisen behauptet wird?“
Jetzt stehen die andern drei auch auf. Sie sind dabei bedrohlich still, nur das Kratzen der zurückgeschobenen Stühle ist zu hören.
„Hört mal, Leute!“, sagt der Wirt. „Ich glaube, es ist das Beste, ihr zahlt jetzt und geht.“
In diesem Moment kommen drei Männer zur Tür herein, alle etwa in Leons Alter. Kräftige Kerle, denen man ansieht, dass sie bei ihrer Arbeit auf dem Feld oder dem Bau oder in der Werkstatt kräftig zupacken können.
Jens wendet sich den dreien zu. „Hallo Louis! Markus, Eric! Lange nicht gesehen!“
„Hallo Jens!“, antwortet Markus. „Hab mich gefreut, als Leon eben am Telefon sagte, dass du hier bist!“
„Bist du immer noch so gut im Fußball?“, fragt Louis und wirft den Unruhestiftern einen wachsamen Blick zu.
Die drei Neuankömmlinge und Leon schütteln sich die Hände.
Mit einem verächtlichen Grinsen legt der Anführer der Motorradfahrer zwei Scheine auf den Tisch und sagt: „Stimmt so. Kommt, Jungs, wir gehen!“ Sie verschwinden knurrend. Kurz darauf hört man, wie sie ihre schweren Maschinen anlassen und davondonnern.
Leon sagt kopfschüttelnd: „Weißt du, Jens, bei uns im Dorf gibt es keine Polizei. Und bis die vom Nachbarort hier ist, ist es vielleicht schon zu spät. Da muss man sich selber helfen. Glücklicherweise habe ich ein paar Freunde, die in der Nähe wohnen.“
Die drei Helfer unterhalten sich noch ein paar Minuten mit Jens und gehen dann wieder. Jens setzt sich zurück zu seiner Tochter an den Tisch.
„Mensch, Papa! Wie kannst du denn nur mit so Leuten Streit anfangen!“
„Ich konnte bei dem Thema einfach nicht schweigen“, sagt Jens und fügt leiser hinzu: „Aber du hast natürlich recht. Es war unüberlegt.“
Hanna schiebt den inzwischen leeren Teller weg und legt ihrem Vater die Hand auf den Arm. „Na ja, es ist ja noch mal gut gegangen. Du scheinst hier eine Menge Freunde zu haben.“
„Nun, sagen wir: Bekannte.“
„Und der Pole, von dem du sprachst, ist doch sicher auch kein wirklicher Freund, oder? Sonst hätte ich doch etwas davon mitbekommen. Oder hast du ihn überhaupt nur erfunden?“
Jens lächelt etwas verlegen. „Das Wort Freund ist wohl etwas übertrieben. Aber immerhin haben wir uns gegenseitig geschätzt.“
„Ich sehe“, lächelt Hanna, „die Geschichte, die du mir morgen erzählen willst, wird ziemlich lang werden.“
„Das wird sie“, nickt ihr Vater. „Und darum sollten wir jetzt auch in unsre Betten steigen.“
Am nächsten Morgen ist es dann endlich so weit. Jens Montag und seine Tochter sitzen auf einer alten Bank auf einem Hügel östlich des Dorfes. Man hat hier einen schönen Überblick. Rechts von ihnen liegt der See, in der Mitte stehen die Häuser um das Kirchlein herum, und links sieht man die Bahnlinie, die im Tunnel verschwindet.
Jens beginnt: „Meine Geschichte – oder besser gesagt die von deinem Urgroßvater und mir – beginnt am 4. Juli 1992 …
1
SAMSTAG, 4. JULI 1992
Es ist jener kurze Augenblick, in dem die aufgehende Sonne auf dem Horizont zu liegen scheint. Man könnte meinen, sie wolle die Spitzen der Bäume nur sanft berührend, den Hügel dort im Osten hinunterrollen.
Das ist ein alberner Gedanke, schießt es Horst Montag durch den Kopf. Nicht weil er ein Physiker im Ruhestand ist – um zu wissen, dass die Sonne nicht einen Berg hinunterrollt, reichen die Kenntnisse eines Fünfjährigen. Sondern weil in der Erhabenheit des Augenblicks für solche Vorstellungen kein Platz ist.
Der 86-jährige schlanke, etwas gebeugt gehende Mann mit noch dichtem grauen Haar wendet sich trotz der Erhabenheit des Augenblicks ab, weil das Licht ihn in seinen empfindlichen Augen schmerzt. Er lehnt sich an den Stamm der Kastanie und folgt mit den Augen dem langen Schatten, den der mächtige Baum über die Terrasse wirft. Links steht das kleine Landhotel, rechts von der gepflasterten Fläche liegt hinter einem schmalen Wiesenstreifen der See.
Das Sonnenlicht fällt noch zu flach auf die Fläche des Wassers, als dass die kleinen Wellen es spiegeln könnten. Der See ist dunkel, hell ist nur die Felswand dahinter. Auch der Wald wirkt schwarz, nur die Sonne scheint golden darüber. Dunkel. Schwarz. So ist auch seine Vergangenheit, denkt der alte Mann. Ob seine Zukunft jemals heller werden wird? Wohl kaum.
Diese Gedanken sind keine nüchternen Überlegungen, eher ein unbestimmtes Gefühl. Es gibt auch keinen rationalen Grund, weshalb sein Leben hell werden könnte. Und doch muntert dieser Sonnenaufgang seine Stimmung auf – denn er ist trotz seiner buchstäblichen Alltäglichkeit und seiner physikalischen Erklärbarkeit ein erhabenes Ereignis.
„Du bist früh wach!“ Horst Montags Enkel Jens tritt neben ihn.
„Guten Morgen!“
Jens ist neunzehn, ein nicht besonders großer, aber breitschultriger junger Mann mit blonder langer Mähne.
„Ich gebe zu, trotz meiner Skepsis von gestern: Es ist schön hier in deinem Taunusdörfchen, wo du unbedingt hinwolltest. Nicht spektakulär, aber schön.“
Sein Großvater nickt mit dem Kopf zum See hin. „Wusstest du, dass das kein natürliches Gewässer ist? Nur ein vollgelaufener ehemaliger Steinbruch.“ Er lächelt und schaut dann seinen Enkel wieder an. „Hast du gut geschlafen?“
Jens lacht. „Das ist eigentlich mein Text. Ich schlafe immer und überall gut. Also ist die Frage überflüssig. Aber du …“
„Ich habe auch gut geschlafen.“
Aus der Hintertür des Hotels tritt die junge Frau heraus, die sie schon gestern Abend bedient hat. Sehr zur Freude von Jens. „Guten Morgen, Herr Montag und Herr Montag!“
Der alte Mann lächelt sie freundlich an. „Guten Morgen, Frau … äh …“
„Lena. Ich bin Lena.“
„Lena – und weiter?“
„Reeber.“
Wenn Lena lächelt, denkt Jens, ist es, als wenn die Sonne aufgeht. Und ihre kupferfarbenen Locken drum herum sind das Morgenrot. Das war ihm bereits aufgefallen, als sie im Hotel eingecheckt hatten.
Lena schiebt mit dem Fuß einen kleinen Napf der Hotelkatze näher zur Hauswand und sagt dabei: „Es ist so ein schöner Morgen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das Frühstück hier auf der Terrasse servieren.“
„Ach ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht …“, erwidert der alte Herr dankbar.
„Kein Problem. Es dauert nur fünf Minuten. Höchstens sechs.“ Sie lächelt und verschwindet im Haus.
Die beiden Männer setzen sich auf zwei weiße Plastikstühle. Jens zieht einen der beiden Tische heran und rückt so lange an ihm herum, bis er steht, ohne zu wackeln.
„Woher weißt du das mit dem See?“
„Das sieht man doch dahinten an der Felswand.“ Jens’ Großvater zeigt über das Wasser und lässt nachdenklich seinen Blick auf der Felswand ruhen. „Aber ich meine, ich hätte das auch mal gehört.“
„Willst du eigentlich lieber in der Sonne sitzen?“
„Nein, nein, schon gut!“
„In wenigen Minuten ist der Schatten des Baumes sowieso weitergewandert. Du müsstest als Wissenschaftler doch ausrechnen können, wie lange das dauert.“
„Das ist mir zu mühsam. Aber ich weiß immerhin, dass der Baum eine Kastanie ist.“
„Aha.“
Lena kommt erneut zu ihnen heraus, legt eine Decke auf das Tischchen und stellt Teller und Tassen darauf.
„Gefällt es Ihnen hier?“
„Sehr!“, antwortet Jens und mustert die junge Frau unauffällig von oben bis unten.
„Ja, sehr“, bestätigt sein Großvater lächelnd, während er die Blicke seines Enkels verfolgt.
„Der See war früher ein Steinbruch“, erklärt Lena. „Aber das ist schon lange her. In den Sechzigerjahren haben sie hier mal einen Wildwestfilm gedreht. Mit Rindenkanus sind sie über das Wasser gefahren, vor den Felsen. Das sah romantisch aus. Und da oben“, Lena deutet auf eine bestimmte Stelle oberhalb der Felswand, „sind sie hochgeklettert. Die Indianer haben die Siedler verfolgt. Einige Leute von hier sollen als Komparsen mitgespielt haben. Die sind heute noch stolz darauf. Aber soweit ich weiß, hat der Film es nie in die Kinos geschafft.“
Der Alte lächelt. „Vielleicht wäre der Film erfolgreicher geworden, wenn Sie die Häuptlingstochter gespielt hätten, Lena.“
Sie grinst verlegen und geht zurück ins Haus, um die Speisen zu holen.
„Das wäre jetzt eigentlich auch dein Text gewesen, Jens.“
„Gut, dass du das selber merkst, Opa! Für einen 86-Jährigen wirkt so ein Spruch etwas unpassend.“
„Es war ja nur ein Kompliment und kein – wie sagt man heute? – keine ‚Anmache‘. Aber warum hast du auch nichts gesagt? Ich erinnere mich, dass du sonst keine Gelegenheit ausgelassen hast, deine Komplimente an hübsche Mädchen zu verteilen.“
Jens antwortet nicht, sondern schaut nur auf den See hinaus.
„Überhaupt“, fährt sein Großvater fort, „hast du dich sehr verändert. Versteh mich nicht falsch – sehr zum Positiven! Aber ich wundere mich.“
„Verändert?“ Jens gibt sich verwundert, aber er ahnt, was sein Großvater meint.
„Auffallend! Nicht nur, dass du kein – wie sagten wir früher? ‚Schürzenjäger‘! –, dass du kein Schürzenjäger mehr zu sein scheinst, jedenfalls soweit ich es beobachten kann. Du bist auch …“, der Großvater scheint zu überlegen, was ihm in letzter Zeit alles aufgefallen war, „… du bist auch nicht mehr so wüst, fluchst nicht mehr so viel, hilfst mir oft, auch ohne Aufforderung, wenn ich wegen meiner Knie nicht so beweglich bin. Und was mich am meisten erstaunt: Du hast gleich zugesagt, mich hierher zu begleiten. Ein 19-Jähriger fährt mit seinem 86-jährigen Opa in Urlaub – wo gibt’s denn so was!“
„Weil du doch alleine nicht so gut zurechtkommst, wegen deiner Beine.“
„Sicher. Aber noch vor einem Jahr hast du nur unwillig geknurrt, als ich dich bat, mich mal zum Arzt zu fahren.“
„Ja, das tut mir leid.“
„Nein, nein, deswegen sage ich das nicht. Ich mache dir keinen Vorwurf wegen damals, ich lobe dich für dieses Mal. Und ich wundere mich. Sehr!“
Jens antwortet nicht. Aber das wäre jetzt auch unpassend, denn Lena betritt in diesem Moment mit einem Tablett die Terrasse. Sie stellt alles auf den Tisch. Was für herrliche Speisen! Die frischen Brötchen duften köstlich.
„Der Kaffee kommt auch gleich.“
Jens bemüht sich, ihr nicht nachzuschauen, als sie wieder ins Haus eilt.
„Willst du mir nicht dein Geheimnis verraten, Jens?“
Jens blickt überlegend unter sich und sieht dann auf, mit einem Lächeln, als wäre ihm eine List eingefallen. „Wenn du mir dein Geheimnis verrätst.“
„Mein Geheimnis?“ Sein Großvater guckt erstaunt.
„Ich bin doch nicht blöd, Opa! Natürlich hast du auch ein Geheimnis. Warum wolltest du unbedingt hier in diesem Kaff eine Woche Urlaub machen? Urlaub macht man am Meer oder in den Bergen. Ja, gut, wenn man wandern will, dann ist das hier vielleicht ganz nett. Aber mehr auch nicht, und du wanderst ja sowieso nicht. Und in dem See baden wirst du vermutlich auch nicht. Der Grund ist doch sicher nicht, dass sie hier mal vor Jahren einen drittklassigen Film gedreht haben. Also – was willst du hier? Was hat dich hierher gezogen? Was ist dein Geheimnis?“
Horst Montag blickt ernst vor sich und zeichnet mit dem Teelöffel gedankenlos Kreise und Achten auf die Tischdecke. „Vielleicht verrate ich dir mein ‚Geheimnis‘ – wenn du es so nennen willst. Aber erst später. Nicht jetzt.“
„Gut, Opa, dann warte ich auch noch etwas, um dir mein Geheimnis zu verraten.“
„Vielleicht am Ende unseres Urlaubs.“
„Abgemacht.“
Lena erscheint wieder an ihrem Tisch und bringt den Kaffee.
„Sagen Sie, Lena“, fragt Horst Montag, „sind wir die einzigen Gäste?“
„Nein. Es gibt noch zwei Ehepaare, die von hier aus den Taunus erwandern wollen. Die schlafen aber anscheinend noch. Manchmal kommen reisende Geschäftsleute hier unter, aber dann immer nur für eine Nacht. Oder Leute auf Montage. Gestern waren drei Männer hier wegen des alten Tunnels. Die haben irgendetwas ausgemessen oder so. Und für nächsten Dienstag hat sich eine Gruppe Radfahrer angemeldet, sieben Leute.“
„Ihr Haus ist also nicht überlaufen.“
Die junge Frau lacht und für Jens geht wieder die Sonne auf. „Nein, aber Herr Theißen, mein Chef, macht sich keine allzu großen Sorgen. Wenn in einer Woche Heimatfest ist, dann werden wir voll ausgebucht sein. Da kommen viele Gäste, die ihre Wurzeln hier in Erlbruch haben. Kann ich noch etwas für Sie tun?“
„Danke, nein“, erwidert der Alte. „Oder doch – Sie könnten, wenn Sie so freundlich sein wollen, mir ein Telefonbuch für diese Gegend besorgen. Nachher, nach dem Frühstück.“
„Mache ich gerne.“
Als sie gegangen ist, blickt Jens ihn neugierig an: „Wen willst du denn anrufen?“
Doch sein Großvater winkt nur ab und trinkt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse.
„Ach so, das ist wohl auch ein Teil deines Geheimnisses?“ Jens grinst und leckt sich einen Klecks Marmelade von seinem Finger. „Kannst du das Telefonbuch denn lesen? Ich meine, wegen deiner Augen.“
„Ich habe meine Leselupe mit. Du brauchst übrigens bei deiner Urlaubsgestaltung auf mich keine Rücksicht zu nehmen, Jens. Irgendwann in den nächsten Tagen kannst du mich mal ein bisschen herumfahren. Aber heute und morgen, am Sonntag, will ich nur hierbleiben und zur Ruhe kommen.“
„Und telefonieren.“
„Vielleicht auch das. Und ein paar Schritte am See entlanggehen. Das schaffe ich. Du kannst machen, was du willst. Wenn ich deine Hilfe brauche, melde ich mich.“
„Lena?“
Die junge Frau steht hinter der Theke und sieht dem ebenso jungen Gast entgegen, der auf sie zukommt. Sie ist gerade dabei, die Papierservietten so zu falten, dass sie an Kardinalshüte erinnern. Eine Reihe steht schon vor ihr. Es sieht aus, als fände ein Puppenkonzil statt.
„Was kann ich für Sie tun, Herr Montag?“
„Zunächst einmal könnten wir ‚Du‘ zueinander sagen, ja? Ich bin Jens.“
Sie lächelt. „Mein Chef wäre dagegen. Aber ich bin mutig und wage es mal. Ich bin …“
„Lena, ich weiß.“
„Lena Reeber.“
„Und dann habe ich noch eine Frage. Morgen ist Sonntag. Gibt es hier irgendwo einen Gottesdienst?“
Sie schaut überrascht auf und schüttelt dann den Kopf. „Morgen nicht. In unsrer alten Dorfkirche ist nur jeden dritten Sonntag Gottesdienst. Der Pfarrer ist für sieben Dörfer zuständig.“
„Hm. Schade.“
Sie antwortet so eifrig, dass sie ganz vergisst, ihre Servietten zu falten. „Ich könnte mich erkundigen, in welchem Nachbardorf morgen …“
„Nein, nein, danke! Ist schon gut. Aber gibt es vielleicht sonst irgendwelche christlichen Aktivitäten?“
„Gibt es. Aber das wird Sie nicht –“
„Du!“, grinst Jens.
„Wie? Ach so, ja, also das wird dich aber wahrscheinlich nicht interessieren. Mein Bruder hält Jungscharstunden. Für Jungen bis zwölf etwa. Immer samstags um drei. Also auch heute.“
Jens blickt sie erfreut an. „Doch, das interessiert mich. Wo findet das denn statt?“
„Im Gemeindehaus neben der Kirche. Die findest du ja leicht, der Turm ist nicht zu übersehen. Vielleicht treffen sie sich aber bei dem schönen Wetter auch irgendwo draußen. Zum Beispiel auf dem Fußballplatz.“
„Danke. Ich werde sie sicher finden.“
Jetzt müsste Jens eigentlich gehen. Was er fragen wollte, ist geklärt. Aber es gefällt ihm, hier zu stehen und Lena zuzuschauen. Also verwickelt er sie in ein unverfängliches Gespräch. Erst als Herr Theißen, der Wirt, in den Raum kommt, nickt er ihr zu und geht.
2
„Hört mal her, Jungs!“, ruft Alexander Reeber laut. Eine Bande von fünfzehn Jungen sammelt sich um den Jungscharleiter. Alexander ist sechsundzwanzig Jahre alt, lang und dünn, und hat ein immer fröhlich strahlendes Gesicht, das auch beim größten Lärm der ihm anvertrauten Bande eine große Gelassenheit ausstrahlt.
„Dieser Kerl hier“, er deutet auf Jens, der neben ihm steht, „heißt Jens. Und er möchte gern Fußball spielen. Ich weiß, dass er etwas älter ist als ihr. Seid ihr trotzdem einverstanden, dass wir ihn mitspielen lassen?“
Allgemein zustimmendes Gemurmel. Nur ein paar wenige sind offenbar noch etwas skeptisch.
„Damit es gerecht zugeht, schlage ich vor, dass er bei der einen Mannschaft im Tor steht und ich bei der anderen.“
Einige Jungen nicken. Jemand ruft: „Okay“, ein anderer: „Kann der das denn?“
Alexander grinst. „Das werden wir ja gleich sehen.“
Ein etwa Elfjähriger sagt: „Du wohnst bei uns, stimmt’s?“
Alex dreht sich erklärend zu Jens: „Das ist Leon Theißen. Seinem Vater gehört der Landgasthof.“
Jens lächelt nickend zu Leon hinüber und dann geht es auch schon los – das Spiel beginnt.
Beine und Arme wirbeln durcheinander, Schreie gellen durch die Luft:
„Foul!“
„Gib doch ab, du Blödmann!“
„Aua!“
Grasboden wird von Schuhen losgerissen, Staub wirbelt in braunen Wolken auf, Triumphgeschrei mischt sich mit Schimpfwörtern, ein Ball wird mit Füßen und Köpfen hin und her gejagt, und einige Male fliegt der Neue mit den langen blonden Haaren spektakulär durch die Luft.
Nachdem sich alle ziemlich verausgabt haben, ruft Alexander die Jungen zusammen. Schwitzend und immer noch außer Atem setzen sich alle in einen Kreis am Rand des Spielfeldes.
„Nur zwanzig Minuten?“, fragt Jens erstaunt und auch ein wenig enttäuscht.
„Das war nur die erste Halbzeit“, erklärt Alexander. „Jetzt kommt die Andacht und dann geht es weiter.“
„Was? Eine Andacht zwischen den Halbzeiten?“
„Das ist Taktik“, raunt Alexander Jens zu. „Wenn ich die Andacht vor dem Spiel mache, kommen einige erst später. Wenn ich sie hinterher mache, müssen einige eilig weg. Darum ist das so die beste Lösung.“
Jens grinst und lässt sich ins Gras fallen. Sofort setzen sich einige Jungen direkt neben ihn. Der lange Stefan sagt zu dem kleinen Ralf: „Ey, da wollte ich gerade hin!“
„Jetzt sitze ich aber hier.“
Da zwängt sich Stefan zwischen Ralf und Jens. Dadurch wird es ziemlich eng, allen ist warm vom Spiel.
Alex beugt sich rüber und sagt leise zu Jens: „Das ging aber schnell!“
„Was?“
„Innerhalb von zwanzig Minuten haben dich die Kids ins Herz geschlossen. Ich dagegen musste mir die Zuneigung der Bengel in langer mühseliger Kleinarbeit erkämpfen. Ich könnte dich fast beneiden – aber als Christ lass ich das mal lieber.“
Ein Junge wird ungeduldig. Fordernd ruft er: „Leg los, Alex, damit wir weiterspielen können!“
„Ja, gut.“ Alexander Reeber hebt die Stimme, damit alle ihn gut hören können.
„Ich habe vorhin etwas Schönes gesehen. Eric hat Markus aus Versehen getreten. Und dann –“
„Was war denn daran schön?“, ruft Markus dazwischen.
„Warte, das kommt jetzt. Dann hat Eric Markus aufgeholfen und sich bei ihm entschuldigt. Andere würden in so einem Fall sagen: Es war doch gar nichts! So was passiert eben beim Fußball. Der soll sich nicht so anstellen! Ich hab doch nichts verkehrt gemacht.“`
Die Jungen schauen zu Eric und Markus.
„Das erinnert mich an etwas, das ich neulich in der Bibel gelesen habe. Da steht: ‚Wenn wir behaupten ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst.‘ Wie ist das bei euch: Wollt ihr euch selbst betrügen?“
Alex blickt in die Runde. Alle Jungs schütteln ihre Köpfe.
„Ihr macht euch aber selbst etwas vor, wenn ihr meint, ihr hättet euch nie etwas zuschulden kommen lassen. Jeder hat Dreck am Stecken. Und ich meine nicht nur gegenüber anderen Menschen, sondern erst recht vor Gott. Wenn wir aber zu unseren Fehlern stehen, kann alles in Ordnung kommen. Der Vers aus der Bibel geht so weiter: ‚Wenn wir unsre Sünden bekennen, vergibt Gott sie uns.‘ Also, was ich jedem von euch sagen will, ist Folgendes: Versteck nicht das, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist! Sondern bekenne es ehrlich vor Gott und vor dir selbst. Vielleicht sogar vor einem Menschen, der dir dabei helfen kann, die Vergebung von Gott zu verstehen und anzunehmen.“
Der 10-jährige Louis ruft: „Willst du etwa sagen, wenn ich Scheiße gebaut habe, sollen das alle wissen?“
„Nein, nicht alle, Louis. Du musst es nicht an die große Glocke hängen. Aber vielleicht kannst du es einem, dem du vertraust, erzählen. Vor allem aber sag es Jesus!“
Jens mischt sich ein. „Denn der weiß es ja sowieso schon, vor ihm kann man nichts verheimlichen.“
Grübelnd erwidert Tilo: „Aber dann brauch ich es ihm ja auch nicht zu sagen!“
„Doch“, antwortet Alex, „denn dabei wird klar, dass es dir leidtut. Und dann vergibt Jesus dir und du bist wieder mit ihm im Reinen. Und auch mit dir selbst.“
„Okay, verstanden“, sagt Louis. „Aber jetzt wollen wir endlich weiterspielen. Können wir nicht mal den Torwart tauschen? Dass Jens bei uns spielt und du bei den anderen?“
Jens und Alex grinsen sich an. „Wie schon erwähnt“, meint Letzterer, „ist Neid keine gute Eigenschaft. Darum …“ Alex bricht ab und schüttelt den Kopf. Dann setzt er erneut an: „Nein, wir sollen uns ja nicht selbst betrügen.“