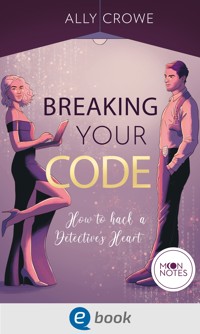
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie man das Herz eines Detectives hackt Scarlett zeigt den Mächtigen dieser Welt, dass sie nicht unantastbar sind. Als Hackerin bringt sie unter dem Decknamen Diamond die schmutzigen Geheimnisse großer Firmen ans Licht. Jedoch ahnt sie nicht, wie nahe ihr das Gesetz bereits auf den Fersen ist: Der unterkühlte NYPD Detective Kieran Bale ist seit Monaten hinter Diamond her, um dessen kriminellen Machenschaften ein Ende zu setzen. Als ein Führungswechsel bei einem dubiosen Pharmakonzern ansteht, sieht Scarlett ihr nächstes Opfer. Und Kieran die Chance, endlich an Diamond heranzukommen, indem er sich selbst als neuer CEO ausgibt. Zwischen den beiden entbrennt nicht nur ein knisterndes Katz-und-Maus-Spiel, sondern auch Gefühle, die sie nicht mehr aus ihren Systemen bekommen. Breaking Your Code: Ein turbulentes Enemies to Lovers-Buch mit einer morally-grey-Hackerin - Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel: Knisternde Romance zwischen einer Hackerin und einem NYPD-Detective, der sie zur Strecke bringen soll. - Starke Frauen in MINT-Berufen: Die IT-Expertin Scarlett leakt unter dem Pseudonym Diamond die Geheimnisse großer Konzerne. - Gefühle im System: Während Kieran Scarlett jagt, entwickelt sich zwischen den beiden eine prickelnde Liebesgeschichte. - Voll im Trend: Das spicy Buch begeistert mit den beliebten Tropes "Enemies to Lovers", "Grumpy x Sunshine", "Morally grey Characters" und "Hidden Identity". - Über Pflicht und Moral: Ally Crowes aufregendes Romance-Buch im New-York-Setting ist ein Muss für New Adult-Leser*innen und alle Fans von Ali Hazelwood.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Scarlett zeigt den Mächtigen dieser Welt, dass sie nicht unantastbar sind. Als Hackerin bringt sie unter dem Decknamen Diamond die schmutzigen Geheimnisse großer Firmen ans Licht. Jedoch ahnt sie nicht, wie nahe ihr das Gesetz bereits auf den Fersen ist: Der unterkühlte NYPD Detective Kieran Bale ist seit Monaten hinter Diamond her, um dessen kriminellen Machenschaften ein Ende zu setzen. Als ein Führungswechsel bei einem dubiosen Pharmakonzern ansteht, sieht Scarlett ihr nächstes Opfer. Und Kieran die Chance, endlich an Diamond heranzukommen, indem er sich selbst als neuer CEO ausgibt. Zwischen den beiden entbrennt nicht nur ein knisterndes Katz-und-Maus-Spiel, sondern auch Gefühle, die sie nicht mehr aus ihren Systemen bekommen.
Ally Crowe
Breaking your Code
Liebe Leserin, lieber Leser, wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
In diesem Buch spielen folgende Themen eine Rolle:
sexuell übergriffiges Verhalten
Folgende Themen werden erwähnt:
Stalking
Missbrauch von Tieren
toxisches Eltern-Kind-Verhältnis
Klaustrophobie
Panikattacken
Für Ayleen, Ilka und Rebekka ♥
Kapitel 1 – Kieran
Ich war nur wenige Sekunden davon entfernt, den Rechner durch das geschlossene Fenster zu werfen. Und mit jeder weiteren Fallakte, die mir Miller auf den Tisch knallte, wurde der Gedanke daran immer verlockender.
Seit drei Wochen verbrachte ich den kompletten Tag damit, diese verdammten Dinger anzulegen, zu kategorisieren und mit zig Schlagwörtern zu versehen. Drei Wochen, in denen ich dazu verdammt war, Fälle zu organisieren.
»Klemmt deine Tastatur?«
Ich stieß ein kurzes, abgehacktes Schnauben aus, ehe ich den Mund für ein knappes »Nein« öffnete. Mehr als das brachte ich gerade nicht fertig, ohne ihn anzuschnauzen.
Millers Gesicht tauchte über dem Rand seines Monitors auf, während ich weiterhin auf meinen eigenen starrte. An den meisten Tagen war ich mir nicht sicher, was ich mehr hasste – diese Arbeit oder die Tatsache, dass ich mit ihm in einem Büro sitzen musste. Ständig wollte er sich mit mir unterhalten. Kieran, wie findest du meine Krawatte? Kieran, magst du lieber Steak oder Burger? Kieran …
»Wieso hämmerst du dann darauf herum?«
Augenblicklich hielt ich inne und betrachtete für einen Moment meine Hände, die über den Tasten verharrten. Auf einmal war Millers lautes Atmen überdeutlich zu hören, ebenso wie die Gespräche auf dem Flur und in den Nachbarräumen, die ich bisher nicht wahrgenommen hatte.
»Geh ein bisschen pfleglicher mit ihr um. Du weißt doch, wie das hier mit neuer Hardware ist«, sagte er munter und hob seine Tasse in die Höhe, bei der ich mir zu fünfundneunzig Prozent sicher war, dass sie zu Dreiviertel mit Baileys und einem Schuss Kaffee gefüllt war. Vermutlich, um den Geruch des Baileys zu überdecken. Anders konnte ich mir nicht erklären, wieso Miller jeden Tag so scheiße gut gelaunt war. Schließlich war dieser ganze Orga-Kram sein Hauptjob.
Ich gab einen brummenden Laut von mir, weil ich leider wusste, dass er recht hatte, und lehnte mich in dem Bürosessel zurück. Auf der Suche nach irgendeinem Fixpunkt blieb mein Blick an der Lampe direkt über den Tischen hängen, die gelegentlich flackerte. Nicht genug, um die Birne auszutauschen, aber ausreichend, um meine ohnehin schon miese Laune ein Stück mehr in Richtung Keller zu befördern. Entnervt sah ich wieder auf den Monitor und somit auch zu Miller, der mir immer noch seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte.
»Ich geh mittagessen. Kommst du mit?«, fragte er und stand auf, das ächzende Geräusch seines Stuhls ertönte.
»Nein«, wiederholte ich tonlos. Der Alkohol musste langsam sein Gehirn zerfressen, sonst würde er mir diese beschissene Frage nicht jeden Tag stellen.
»Wie du willst.« Er zuckte mit den Schultern und verließ den beengten Raum, ging links den Flur hinunter in Richtung des Pausenraums, in dem vermutlich ein Teil meines Teams saß. Wie Mel und Dustin, die währenddessen Schach spielten. Oder Nick, der zwar immer anwesend war, doch in den letzten neun Monaten, die ich ihn kannte, hatte er noch nie irgendetwas auf dem Revier gegessen. Dafür ernährte er sich von ungefähr zwei Litern Kaffee am Tag. Das war ziemlich sicher nicht gesund, aber solange er seinen Job erledigte, konnte er auch Fotosynthese betreiben.
Und Easton …
Ich stieß erneut einen Seufzer aus und versuchte, meine Aufmerksamkeit wieder der Fallakte zu widmen, statt meinem Partner.
Meinem ehemaligen Partner, der mich jeden verdammten Tag dazu überreden wollte, mich zu ihnen zu setzen. Eher würde ich mir beide Hände abhacken und meine Dienstmarke abgeben, ehe ich so tat, als wäre nie etwas passiert. Ihre mitleidigen Blicke waren das Letzte, was ich wollte. Ihre Gesellschaft hatte ich einfach nicht mehr verdient.
Und solange meine Aufgabe nur aus diesem Organisationskram bestand, anstatt sie wirklich zu unterstützen, blieb ich, wo ich war. Bis mir Marshall Ross mitteilte, was mit mir passieren würde. Ob ich wieder Teil des Investigationsteams werden durfte. Oder ob ich mit einem Fehler alles verloren hatte.
»Klopf, klopf. Jemand zu Hause?«
»Nein«, antwortete ich beim Anblick von Easton, der im Türrahmen lehnte und grinste. Mel und Dustin waren nicht die Einzigen mit einem Routinezwang.
Eastons blondes Haar stand in alle Richtungen ab, als wäre er durch einen Sturm gelaufen, was wahrscheinlich war, schließlich war es Herbst. Und sowohl die Lederjacke als auch die Subway-Tüte, die er triumphierend in die Höhe hielt, waren ein Indiz dafür, dass er draußen gewesen war. Nicht einmal das schlechte Wetter konnte ihm die Laune ruinieren.
»Du bist ja wieder super drauf, Sonnenschein«, bemerkte er fröhlich und ließ sich auf Millers Schreibtischstuhl fallen, mit dem er neben mich rollte. »Aber dafür bin ich ja hier.«
»Die Mühe kannst du dir sparen«, brummte ich zur Erwiderung und versuchte, von ihm wegzurücken. Ohne Erfolg, denn rechts von mir war eine Wand.
»Für meinen lieben Partner ist mir nichts zu schwierig.« Großmütig winkte er ab, öffnete die Papiertüte und hielt mir eines der eingewickelten Sandwiches hin. Auf dem Papier stand ein leicht verwischtes K, um sie auseinanderhalten zu können. Denn im Gegensatz zu mir mochte er so etwas Seltsames wie Tomaten.
»Mir fällt gleich der Arm ab«, sagte er, während ich immer noch auf das Sandwich starrte, das er mit einer Hand umklammerte. »Und ich hab Hunger. Wäre also super, wenn du dich in den nächsten drei Sekunden entscheiden könntest, ob du es haben willst, oder nicht.«
Eigentlich wollte ich, dass er verschwand. Dennoch griff ich schließlich danach, strich über meinen Anfangsbuchstaben, der noch ein wenig mehr verwischte.
»Kommst du wenigstens heute mit rüber? Nicholas hat Geburtstag und gibt zur Feier des Tages eine Runde Filterkaffee aus.« Er hielt kurz inne. »Also er lässt uns welchen übrig.«
Keine Ahnung, ob das stimmte oder ob es nur ein vorgeschobener Grund von Easton war, mich in den Pausenraum zu locken. Doch gerade brachte ich es nicht einmal fertig, genervt die Augen zu verdrehen. Stattdessen presste ich meine Kiefer schmerzhaft aufeinander und schüttelte den Kopf.
Easton seufzte. »Die anderen würden sich echt freuen, dich mal für länger als ein Meeting zu Gesicht zu bekommen.«
Gerade er und Mel hatten mehrfach versucht, mich abzufangen und mir Gespräche aufzuzwingen, die ich nicht führen wollte. Ich hatte sie angefahren. Auch wenn es nichts gab, was ich tun konnte, damit Easton mich in Ruhe ließ, hatte Mel danach aufgehört, es zu versuchen.
Ein Grund mehr, nicht bei ihnen aufzutauchen.
Vage gestikulierte ich zu den Akten, die sich auf der Seite meines Tisches stapelten, dann wieder zum Monitor. »Ich habe Arbeit.«
Eine billige Ausrede, das wussten wir beide, weil es dieselbe war, die ich seit drei Wochen brachte.
Easton betrachtete mich einen Moment ungewohnt ernst, schüttelte dann mit einem lang gezogenen Seufzen den Kopf. Das leise Quietschen von Millers Schreibtischstuhl erklang erneut, als er aufstand und ohne ein weiteres Wort den Raum verließ. Ich legte das eingewickelte Sandwich auf den Tisch und atmete tief ein.
Wir arbeiteten seit knapp drei Jahren zusammen und wenn ich etwas über Easton gelernt hatte, dann, dass er nicht eher Ruhe gab, bis er bekommen hatte, was er wollte.
Das hier war noch nicht das Ende. Deswegen überraschte es mich nicht, als er fünf Minuten später wieder hereinspazierte, mit seinem eigenen Essen in der Hand und ohne Jacke. Erneut quietschte Millers Stuhl, als er sich setzte. Ehe ich weiter darüber nachdachte, meinen Rechner durchs Fenster zu werfen, sollte ich mit dem Ding anfangen.
Eine unangenehme Stille breitete sich zwischen uns aus. Normalerweise mochte ich sie, weil es bedeutete, dass alle anderen Menschen den Mund hielten. Aber seit drei Wochen fiel es mir immer schwerer, sie zu ignorieren, denn in Wirklichkeit wartete ich nur darauf, dass sie jemand plötzlich mit Vorwürfen durchbrechen würde. Also wandte ich mich wieder meiner Arbeit zu, auch wenn mir klar war, dass sich Easton davon nicht stören ließ. Er wickelte sein Sandwich aus, holte sein Handy aus der Hosentasche und lehnte sich gemütlich zurück.
»Gibt waf Neufes zum vermifften Mädchen«, murmelte er plötzlich undeutlich zwischen zwei Bissen, ohne aufzusehen. »Du weifft schon, hat sich mit irgendeinem Typen aus dem Internet treffen wollen. Hat ’ne Nachricht an ihre beste Freundin geschickt.«
»Was stand drin?«, fragte ich, weil ich die Akte kannte. Bisher hatten sie kaum etwas herausgefunden – und ich konnte ihnen nicht einmal bei den Ermittlungen helfen. Das Mädchen war erst fünfzehn Jahre alt. Easton hatte ihre Social-Media-Profile und ihre E-Mail-Konten prüfen lassen, aber das hatte genauso wenig gebracht wie die Gespräche mit ihren Eltern, Freunden oder Lehrern.
»Easton?«, wiederholte ich, da er nach zwanzig Sekunden nicht reagiert hatte und stattdessen grinsend auf sein Handy starrte. »Gibt es etwas Neues?«
»Hm?«, machte er und sah von dem Display auf. Falls er ein Gespräch mit mir führen wollte, war das echt ein beschissener Versuch. »Such nicht nach mir. Zwei Tage nachdem sie verschwunden war.«
»Habt ihr die IP-Adresse der Nachricht ihrer Freundin gecheckt?«, fragte ich langsam, während ich gedanklich die Infos durchging, an die ich mich erinnern konnte. In der Akte hatte nichts davon gestanden, aber vermutlich hatte Easton auch nicht daran gedacht. Doch anstatt mir zu antworten, lachte er nur laut auf. Irritiert sah ich ihn an.
»Diamonds neuste Enthüllungen sind wieder auf der Titelseite jeder Klatschzeitung gelandet«, sagte er mit Blick auf sein Handy und in mir zog sich alles zusammen. Natürlich musste er das ansprechen. »Bartholomeus Tilton, Sohn des Immobilienmoguls Richard Tilton, feiert regelmäßig wilde Sex-Partys. Insider liefert exklusive Einblicke in das Leben des Erben.«
Seine Stimme dröhnte so laut durch den kleinen, stickigen Raum, dass ihn jeder im gesamten Bezirk gehört haben musste. Als ob ich die Artikel und Bilder nicht kennen würde, die allesamt an einer beliebigen Stelle mit einem kleinen schwarzen Diamant-Symbol versehen waren. Unverkennbar seine Handschrift. Ich hatte heute Früh einige überflogen, um mir das Ausmaß des Schadens anzusehen.
»Ich frag mich, wie viel Geld er dieses Mal bekommen hat.« Easton stieß einen anerkennenden Pfiff aus, der dafür sorgte, dass sich mein Körper anspannte. Ich ballte die Hände zu einer Faust, öffnete sie wieder und schloss sie erneut, um die aufkommende Wut zu vertreiben. Natürlich dachte Easton an die Kohle und nicht an die schmutzigen Methoden, mit denen sich Diamond Zugang zu den privatesten Informationen, Bildern und Videos von Menschen verschaffte. »Zieh doch nicht so ein Gesicht. Selbst du musst zugeben, dass das schon ein bisschen lustig ist.« Er drehte sein Handy zu mir. Das Bild hatte ich bereits heute Früh sehen müssen, auf dem ein stark betrunkener Typ halb nackt ein Schaf belästigte.
»Ich muss gar nichts«, erwiderte ich bemüht ruhig und wandte meinen Blick wieder zum Monitor.
»Ach, komm.« Er zog das Handy mit einem langen Seufzen zurück. »Ich habe nur versucht, dich aufzumuntern.«
»Ich muss nicht aufgemuntert werden.«
Erst recht nicht so. Da hätte er mir gleich einen Eimer Salz in eine offene Wunde reiben können. Ich verstand nicht, wieso es ihm absolut nichts auszumachen schien, dass wir es nicht geschafft hatten, Tilton zu schützen. Und das, obwohl wir wussten, dass er das Ziel war. Denn Diamond hatte ihm eine Warnung geschickt. Das tat er jedes Mal, auf die ein oder andere Weise.
»Doch, das musst du. Du bist seit drei Wochen schlecht gelaunt.«
Ich machte mir nicht die Mühe, ihn darauf hinzuweisen, woran das lag, denn er war live dabei gewesen, als mich eine falsche Entscheidung vermutlich alles gekostet hatte.
Easton betrachtete mich noch für einen Moment und verdrehte dramatisch die Augen, als ich nicht antwortete. »Vielleicht sollte ich ihm meine Hilfe anbieten. Springt bestimmt ein bisschen was raus.«
Hitze schoss durch meinen Körper.
»Hast du sie noch alle?«, fuhr ich ihn an, unfähig, mich zurückzuhalten. »Du bist ein Detective, verdammt.«
Easton lehnte sich mit einem breiten Grinsen langsam zurück, während ich keine Ahnung hatte, was er so lustig fand. »Ach, komm, Kieran. Das war ein Witz.«
»Haha«, machte ich tonlos und schüttelte den Kopf. Das, was Diamond tat, zerstörte Leben. Er agierte ohne Rücksicht auf Verluste, und das alles nur für Geld.
Seit sechs Monaten lag der Fall bei uns, weil Austin, unser Sergeant, ihn unbedingt hatte übernehmen wollen. Denn wenn wir Diamond schnappten, stand seiner Beförderung zum Captain nichts mehr im Wege. Doch seit sechs Monaten waren wir keinen Schritt weitergekommen.
Natürlich hatten wir versucht, über die Zeitungen an ihn heranzukommen, aber die wussten selbst nicht, wer er war. Nicht dass sie sich darum bemüht hatten, uns zu helfen, immerhin waren Diamonds Informationen ein Garant für viele Verkäufe und hohe Klickzahlen. Sie bezahlten – so, dass es nicht nachverfolgbar war. Ganz egal, ob es Kryptowährungen, Offshore-Konten oder Escrow-Dienste waren. Es gab nichts, was er nicht nutzte.
All das führte mir vor Augen, dass bei vielen Menschen die Moral an zweiter Stelle stand, wenn es um Geld ging. Sowohl bei Diamond als auch bei den Leuten, die seine Geschichten kauften. Aber auch bei denen, die sie konsumierten.
Wieso interessierten sich Menschen so für das Leben von anderen? Wieso glaubten sie, dass es ihnen zustand, eine Meinung dazu zu haben, obwohl sie nie die ganze Geschichte kannten? Wieso …?
»Haust du mir gleich eine rein?«
Easton riss mich aus meinen Gedanken, und ich sah ihn für einen Moment irritiert an. Erst dann bemerkte ich, dass sein Blick auf meiner Hand lag, die ich erneut zu einer Faust geballt hatte.
»Nein«, erwiderte ich und atmete tief ein. »Trotzdem solltest du so etwas nicht sagen.«
»Hach, ich vermisse deine Moralaposteleinstellung wirklich«, sagte er mit einem spottenden Unterton und legte sich eine Hand auf die Brust. »Die Oberschicht wird gerührt davon sein, dass du dich so für sie einsetzt.«
»Gesetze gelten für alle.«
Er schnaubte. »Das sind Menschen, die das ganze Revier kaufen könnten, wenn ihnen danach ist. Ich finde, ein bisschen Schadenfreude können sie uns dann schon gönnen.«
»Jetzt bin ich doch kurz davor, dir eine reinzuhauen.«
»Bitte nicht. Meine Freundin wird traurig sein, wenn du mein hübsches Gesicht verunstaltest.«
Es hatte keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren, wenn ich nicht wusste, was er ernst meinte und was nicht. Natürlich ließ sich nicht leugnen, dass es Menschen gab, die die Macht hatten, Gesetze zu ihren Gunsten zu biegen. Doch das war ein Problem des Systems, das wir lösen mussten. Und es gab Diamond nicht das Recht, in das Leben anderer einzudringen und ihre privaten Geheimnisse an die Öffentlichkeit zu zerren.
So etwas konnte Menschen zerstören – das wusste niemand besser als ich.
Kapitel 2 – Scarlett
Schock! Bartholomeus Tiltons heiße Liebesnacht … mit einem Schaf?!
Ich schürzte die Lippen und tippte auf den Link zum Artikel. Die Überschrift suggerierte ein bisschen zu sehr, dass das Schaf ein Mitspracherecht bei der Sache gehabt hatte. Da gefiel mir »Sohn von Immobilienmogul Tilton ist zoophil – die ganze schockierende Wahrheit!« deutlich besser.
Mit zusammengepressten Lippen überflog ich einige weitere Artikel, die meisten von ihnen zeigten nur einen Teil der Bilder, die ich den Pressehäusern geschickt hatte. Und nahezu alle hatten sie zensiert. Barthy-Boys nackter Oberkörper war noch halbwegs scharf zu erkennen, sein Unterkörper und das arme Tier waren großflächig verpixelt worden. Aber es war mehr als eindeutig, was da passierte.
Wie konnte ein Kerl nur so etwas Abscheuliches tun? Von sämtlichen Sachen, Affären über Steuerschulden, illegale Geschäfte und fragwürdige Patentgeschäfte, war das das Schlimmste, was ich bisher ausgegraben hatte.
Nicht, dass ich überrascht gewesen war.
Immerhin war Barthy ein konservativer Arsch, der auf Social Media versuchte, sich als Lifestyle-Coach zu etablieren, und dabei nicht allzu nett über Frauen sprach. Insbesondere nicht über – wie er es nannte – »feministische Schlampen«. Es war schon fast langweilig offensichtlich gewesen, dass er einen Zweitaccount besaß, mit dem er Nacktmodels anschrieb. Männer wie er waren die größten Heuchler. Doch dass er auch noch Tiere so misshandelte … Das hatte selbst ich nicht erwartet.
Was es umso befriedigender machte, ihn bloßzustellen.
Ich ließ den Blick über die Stadt schweifen. Nebel hing zwischen den hohen Gebäuden und die grauen Wolken verdeckten jedes bisschen Sonnenlicht. Wenn ich in drei Wochen nicht aussehen wollte wie ein Geist, dann war allmählich wieder die Zeit für Selbstbräuner gekommen.
Meine Nägel klackerten auf dem Display meines Tablets, um einige andere Artikel anzuwählen, ehe ich nach dem lauwarmen Chai Latte griff, der auf dem Tisch vor mir stand. Und den ich schon wieder vergessen hatte. Ein feiner Geruch von Zimt stieg in meine Nase, als ich einen Schluck nahm.
Die Aufnahmen von Barthy-Boy waren wirklich eine Goldgrube gewesen, insbesondere weil sein Vater gerade dabei war, für das Amt des Gouverneurs anzutreten.
Tja. Was für ein ungünstiges Timing.
Und wenn sich die Sache ein wenig gelegt hatte, dann würden die unverpixelten Bilder auftauchen – falls das bis dahin nicht schon passiert war, immerhin hatten meine Kontakte die Originale. Doch der beste Gedanke war, dass es egal war, wie viel Geld er seinen Anwälten zahlte, wie viele Zeitungen er versuchen würde, zu verklagen – diese Bilder würden nie wieder aus dem Netz verschwinden.
Dafür würde ich im Zweifelsfall persönlich sorgen.
Voller Genugtuung scrollte ich durch die Kommentarspalten einiger News-Seiten. »So ein kranker Wichser« gehörte neben »Bestimmt fickt er auch andere Tiere« und »Liegt das in der Familie?« zu den netteren Sachen. Auf Social Media brannte mittlerweile ein schönes Feuer, das diverse Content Creators immer weiter anfachten. Die meisten Menschen liebten es, sich mit den Fehlern anderer zu beschäftigen, um sich von ihren eigenen Problemen abzulenken. Gerade dann, wenn es um Personen ging, die so unangreifbar schienen. »Ich bin arm und hässlich, aber wenigstens nicht so gestört«, war ebenfalls eine Perle eines Kommentars.
Das würde Daddy Tilton auf jeden Fall nicht gefallen. Also, dass es nun überall bekannt war. Denn aus einer sicheren Quelle – alias ich – wusste ich, dass er die Vorlieben seines Sohnes kannte. Auch etwas, das die Artikel nicht ausgelassen hatten.
Tja. Das war es wohl mit der Politik. Zumindest so lange, bis der nächste Skandal kam. So groß war die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Leute nicht, um sich alles zu merken.
Mit einem leisen Klackern stellte ich die leere Tasse zurück auf den Esstisch, legte das Tablet daneben und streckte mich auf dem Stuhl aus.
Mit dem Geld für das Material konnte ich entspannt unsere hübsche Wohnung und Nolans Studiengebühren bezahlen. Was bedeutete, dass ich mich nicht gleich in den nächsten menschlichen Abgrund stürzen musste.
Zumindest nicht für das Geld.
Ich stand auf und schlenderte zu der riesigen Fensterfront, legte eine Hand auf die Scheibe und ließ meinen Blick über die Straße unter mir schweifen. Über die Menschen, die so unbedeutend klein aussahen.
In einem Moment fühlte ich mich unbesiegbar, wenn ich hier oben stand. Unantastbar. Doch ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das Gefühl verschwand. Bis ich gierig wurde und es erneut spüren wollte.
Langsam lehnte ich mich vor, neigte den Kopf, bis meine Stirn das kühle Glas berührte, und schloss die Augen.
Ich hatte schon einmal hilflos dort unten gestanden, während die Welt über mir zusammengebrochen war. Und ich würde alles dafür tun, um das nie wieder zu erleben. Ganz gleich, was ich dafür in Kauf nehmen musste.
»Du blöder Wichser! Du bist der lebendige Beweis dafür, dass man auch ohne Gehirn überleben kann«, dröhnte eine äußerst wütend klingende Stimme durch die Wohnung.
Ich stieß einen langen Seufzer aus und richtete mich wieder auf. So viel zu meinem inneren Bösewicht-Monolog am Morgen. So viel zu meinem ruhigen Morgen überhaupt, der mit einer entspannten Gesichtsmaske und Haarkur angefangen hatte.
Ich hatte gehofft, Nolan würde noch mindestens drei Stunden schlafen, doch ganz offensichtlich war er wach. Weitere Flüche hallten durch die Wohnung und wurden immer lauter.
Mit schnellen Schritten durchquerte ich das Wohnzimmer und riss die Tür zu seinem Zimmer auf, die vom angrenzenden Flur abging. Ein Schwall stickiger Luft umhüllte mich, als ich eintrat, während sich die Härchen auf meinen Armen aufstellten. Nolan glaubte nicht daran, Räume zu heizen, was der Grund war, wieso ich sein Zimmer die meiste Zeit über mied. Ganz davon abgesehen, dass ich den Geruch von der Acryl-Farbe nur schlecht ertrug, der immer in der Luft lag. Neben Herumschreien liebte Nolan es, Figuren zu bemalen und sie dann zu den hundert anderen ins Regal zu stellen.
Monster mit riesigen Krallen, Mäulern, unzähligen Armen, Beinen oder Flügeln. Ich konnte damit nichts anfangen. Sie sahen zu sehr danach aus, als wären sie böse.
Viel spannender waren doch die Monster in Menschengestalt.
»Halb New York hat dich mittlerweile verstanden«, fauchte ich meinen Bruder an und verpasste ihm einen weniger sanften Schlag gegen die Schulter. Denn ich hatte definitiv keine Lust, die nächste mit viel zu vielen Ausrufezeichen bestückte Nachricht unseres Nachbars an der Tür kleben zu haben, weil Nolan das halbe Haus mit seinen Tiraden zusammenschrie.
»Was?«, blaffte er verärgert zurück, nahm das Headset vom Ohr und wandte den Kopf in meine Richtung, während ich den Arm nach der zugezogenen Gardine direkt hinter seinem Monitor ausstreckte und sie aufriss. Ein leises Stöhnen erklang, und Nolan vergrub sein Gesicht in den Händen, als hätte ich ihm mit der Kraft von zehntausend Lumen in die Augen geleuchtet.
»Hast du sie noch alle? Ich bin in einem Match.«
»Hast du in den letzten drei Tagen Sonnenlicht gesehen?«, fragte ich stattdessen mit hochgezogener Braue und lehnte mich mit verschränkten Armen gegen seinen Schreibtisch. »Oder wenigstens diese Woche?«
Nolan nahm die Hände weg und blinzelte mich mit zusammengekniffenen Augen an. Ich war schon blass, aber mein allerliebster Bruder machte den Eindruck, als ob er jeden Moment zu Staub zerfallen würde.
»Nein, und bei deinem Anblick kann ich gut drauf verzichten. Willst du zum Mars auswandern?«
»Nein, aber ich schieße dich bald zum Mond, wenn du nicht aufhörst, die Nachbarschaft zu unterhalten«, erwiderte ich zuckersüß und betastete vorsichtig die Gelmaske auf meinem Gesicht. Sie war mittlerweile durchgetrocknet und spannte leicht auf der Haut, andernfalls hätte sie sonst einen wunderschönen grünen Fleck auf der Scheibe hinterlassen. Wurde Zeit, dass ich sie abwusch.
»Da schaffe ich es nicht mehr hin, wenn ich vorher einen Herzinfarkt von deinem Alien-Look bekomme.« Nolan nahm die Kopfhörer ganz ab und legte sie auf den Tisch, ehe er sich durch die hellblonden Haare fuhr, die ohnehin in alle Richtungen abstanden.
»Sagt der Kerl, der mit so was«, ich gestikulierte zu den Regalbrettern, auf dem seine Figuren standen, »in einem Raum schläft?«
Seine Mundwinkel zuckten, auch wenn er sich alle Mühe gab, seine neutrale Miene beizubehalten. »Du bist eindeutig furchteinflößender.«
»Du armer Kerl. Fast hätte ich Mitleid mit dir«, erwiderte ich und konnte nicht mehr verhindern, dass ich grinsen musste. »Aber dann erinnere ich mich daran, wer mich jeden Tag achtzig Prozent meiner Nerven kostet.«
Er verzog leidend das Gesicht, dass sich seine Nase kräuselte, und erinnerte mich damit an den niedlichen Zehnjährigen, der er schon lange nicht mehr war. »Ist nicht so, als wärst du die einfachste Mitbewohnerin. Ich bin gestern Nacht über mindestens drei deiner Schuhe gestolpert.«
Das erklärte, wieso sie heute Morgen nicht da gelegen hatten, wo ich sie zurückgelassen hatte. Und warum mein rechter Louboutin-Pump eine Delle an der Spitze hatte.
Wenn ich Nolans Gerede glauben würde, konnte man meinen, er lebte das schwerste Leben, das ein College-Student jemals gehabt hatte. Es musste schrecklich sein, in einer hübschen Drei-Zimmer-Wohnung in einem der besseren Stadtteile von New York zu wohnen und sich um nichts Gedanken machen zu müssen.
Aber das konnte ich ihm kaum vorwerfen. Nicht, wenn ich alles dafür tat, dass es genau so blieb.
»In unserer Wohnung gibt es Lichtschalter.«
»In unserer Wohnung gibt es auch ein Schuhregal.«
»Touché«, erwiderte ich und grinste. Nolan stieß ein Lachen aus und zuckte auf diese ironisch überhebliche Art mit den Schultern, als wollte er sagen: »Natürlich habe ich recht.«
So mit ihm zu streiten, fühlte sich normal an – nach zu Hause. Unbeschwert und leicht.
»Kann ich weiterzocken? Möglichst ohne Unterbrechung?«, fragte er schließlich und deutete zu seinem Bildschirm, auf dem irgendwelche Gestalten mit riesigen Waffen zu sehen waren. »Oder wolltest du noch was?«
»Nur, dass du die Klappe hältst«, antwortete ich und schnippte ihm liebevoll mit einem rot lackierten Fingernagel gegen den Oberarm.
Er schnaubte, was mehr nach einem zurückgehaltenen Lachen klang. »Schon verstanden.«
Ich war nicht überzeugt. Doch wenn er nicht leiser war, konnte ich ihn immer noch aus dem WLAN schmeißen, das Passwort ändern und aus der Wohnung flüchten. Nolan wedelte wegwerfend mit der Hand, ehe er die Gardinen zuzog und seinen Raum wieder in das Reich der Schatten verwandelte.
»Ich gehe gleich zur Arbeit«, sagte ich und tätschelte ihm die Stelle, die vorhin den Schlag abbekommen hatte. Zumindest so lange, bis er meine Hand sanft beiseiteschob. »Unser Kühlschrank ist ziemlich leer, also bestell dir einfach was, wenn du Hunger hast.«
»Oder ich gehe einkaufen und koche was.«
Ich stieß ein Lachen aus, weil der Gedanke so absurd war. »Sicher.«
»Warum denn nicht?«
»Bestell mir lieber irgendwas mit, ich esse es dann später.«
Wieso sollte er sich die Mühe machen, zu kochen, wenn wir mitten in New York mit drei Klicks alles bekommen konnten?
»Okay«, antwortete er etwas tonlos und griff nach dem Headset. »Und jetzt verschwinde.«
Ich durchquerte den Raum, wandte mich um und warf ihm einen Luftkuss zu, doch er starrte bereits wieder auf den Bildschirm. »Ich hab dich auch lieb.«
Nachdem ich die Tür hinter mir zugezogen hatte, verharrte ich einen Moment dahinter und lauschte seiner gedämpften Stimme. Ich konnte nur hoffen, dass er unseren Nachbarn nicht noch mehr Grund für eine Mahnung wegen Lärmbelästigung gab. Es war schon erstaunlich, dass ich für diesen Menschen eine Niere hergeben würde und dennoch das ständige Bedürfnis hatte, ihn zu erwürgen.
Im Badezimmer wusch ich das mittlerweile getrocknete Gel von der Haut und anschließend die Kur aus meinen Haaren, ehe ich gefühlt hundert Pflegeprodukte auftrug, um meine Locken zu bändigen. Nolan schlug mir regelmäßig vor, mir eine Glatze zu rasieren, weil das weniger Aufwand wäre, als jeden zweiten Tag diese Routine durchzumachen. Aber er verstand nicht, dass ich sie brauchte. Dass ich nicht anders konnte.
Missmutig zupfte ich an einer Locke. Der hellblonde Ansatz ragte hervor und erinnerte mich daran, dass ich ihn wieder weißgrau bleichen musste.
Exakt fünfzig Minuten später war ich gestylt und nutzte die verbleibenden zehn Minuten dafür, meine Utensilien zusammenzupacken, die kreuz und quer in der Wohnung verteilt waren. Auch wenn es für Nolan absolut willkürlich aussehen mochte – ich wusste, wo ich meine Sachen fand. Egal, ob es die Pinsel in der dunkelgrauen Keramikschale links neben dem Fernseher waren oder die Lidschattenpaletten im Bücherregal. Und es machte mich rasend, wenn Nolan anfing, alles woanders hin zu räumen, nur weil er der Meinung war, dass die Sachen dort nicht hingehörten.
Ich atmete tief ein und aus, bis sich der Knoten wieder löste. Es war alles gut. Ich hatte alles unter Kontrolle. Barthys Ruf war zerstört, ich hatte Geld, Nolan hatte keine Sorgen. Es war alles so, wie es sein sollte. Das Klackern meiner Absätze ertönte im Flur und echote zurück, bis ich den Aufzug erreichte.
Heute würde ich mich bedeckt halten und nicht versuchen, erneut ein Leben zu ruinieren.
Kapitel 3 – Scarlett
Mit einer winzigen Verspätung von fünfzehn Minuten stand ich nun vor der Tür meines Kunden. Der Verkehr um diese Uhrzeit war schlichtweg die Hölle.
Mein Blick glitt über die verzierte Fassade des hellen, dreistöckigen Hauses nach oben zu den einzelnen Fenstern. Sämtliche Vorhänge waren nur halb geöffnet, was dafür sprach, dass Mrs Charleston den ganzen Tag nicht zu Hause gewesen war. Spitze Eisenstangen ragten rechts und links der Treppe in die Höhe, um die winzige Grünfläche dahinter zu schützen. Im Sommer blühten hier wirklich bezaubernde hellblaue Hortensien.
Ich ging die Treppe hinauf und drückte auf die goldene Klingel, machte dann einen Schritt zurück, schließlich war ich kein Paparazzo, der einen Überraschungsschnappschuss landen wollte.
Ich war schlimmer und meine Methoden so viel eleganter. Und gerade spielte ich keine Rolle, sondern war einfach nur Scarlett Archer, eine Make-up-Artistin. Und mich als Scarlett jemandem zu nähern, den ich verkaufen wollte, verstieß gegen alle Prinzipien, die ich hatte.
Es dauerte einen Moment, bis sich die Tür öffnete. Ein Mann, der mit seiner Glatze fast den Türrahmen berührte, starrte mich grimmig an. Er verschränkte die Arme vor der Brust, das weiße Hemd spannte ein wenig unter seinem schwarzen Jackett, und machte sehr deutlich, dass ich definitiv nicht mit ihm kämpfen wollte. Was nicht zuletzt an der Glock G19 lag, die er darunter versteckt hielt.
Wortlos hob ich meine Hände in die Höhe, um ihm zu zeigen, dass ich im Gegensatz zu ihm unbewaffnet war. Das übliche Prozedere. Erst als er nickte und einen Schritt zurückging, trat ich ein. Mrs Charleston hatte schon die ein oder andere weniger nette Nachricht erhalten und ich fand es nur fair, auch als potenzielle Gefahr gesehen zu werden. Durch diverse Foren wusste ich, dass mindestens neunzig Prozent aller Leute davon ausgingen, dass Diamond ein Kerl war. Die restlichen zehn glaubten, Diamond wäre ein Kollektiv, eine lose Gruppierung aus Hackern. Ähnlich wie Anonymous. Primär bestehend aus Männern. Und auch wenn ich kein Interesse daran hatte, das richtigzustellen, wurmte es mich. Warum traute die Gesellschaft so etwas nicht auch einer Frau zu? Wenn jemand Grund hatte, rachsüchtig zu sein, dann ja wohl wir.
»Tasche«, brummte der Mann und streckte seine Hände nach der Umhängetasche aus, in die ich Make-up und Pinsel gepackt hatte.
»Bitte sehr«, erwiderte ich freundlich und reichte sie ihm. Er öffnete den Reißverschluss und wühlte im Inneren herum, ruinierte damit meine ganze Ordnung. Mir lag jedes Mal auf der Zunge, zu fragen, ob er mich für so blöd hielt, irgendwelche gefährlichen Gegenstände in genau die Tasche zu packen, von der ich sicher wusste, dass er sie durchsuchen würde. Aber darauf würde ich kaum eine nette Antwort bekommen.
Wortlos reichte er sie mir zurück, nun, da er den Inhalt vollkommen durcheinandergebracht hatte.
»Danke, Connor.«
Er nickte nur, seine bedrohliche Miene unverändert, während ich mir Mühe gab, zumindest ein klein wenig eingeschüchtert zu wirken. Und nicht wie jemand, die wusste, dass er für seine vierjährige Tochter auch mal ein bezauberndes Tutu samt blonder Perücke und Krone anzog. Allem Anschein nach hatte er sich wirklich Mühe gegeben, nicht auf Facebook-Bildern zu landen, doch seine Schwester war da deutlich … freigiebiger, was persönliche Infos anging. Umso besser für mich. Aber ehrlich gesagt respektierte ich Connor seitdem nur noch mehr. Am Ende spielte er eine Rolle, genauso wie ich.
Ich betrat das helle Foyer, an dessen linker Seite eine Treppe in die Galerie des zweiten Stocks führte. Ein wunderschöner weißer Teppich mit hellblauen Mustern erstreckte sich nahezu über die gesamte Länge und verbarg einen Großteil des dunklen Holzbodens. Gemälde – Originale – zierten die hohen Wände. Irgendwann, wenn ich mein Gewissen über Bord geworfen und mich vollkommen den kriminellen Machenschaften hingegeben hatte, würden Nolan und ich auch so leben. Dann würde ich allerdings nicht besser sein als die Leute, die ich vorführte.
Die Tür zum Wohnzimmer, das direkt geradeaus lag, war einen Spaltbreit geöffnet und eine aufgeregte Stimme drang an mein Ohr, doch sie war zu leise, um den Inhalt der gemurmelten Worte zu verstehen.
»Warten Sie oben. Mrs Charleston ist gleich bei Ihnen«, wies mich Connor an und nickte in Richtung Treppe.
»Oh«, machte ich überrascht, überging ihn völlig und deutete stattdessen auf eines der Gemälde – ein Mädchen mit einer Katze auf dem Schoß. »Ist das neu?«
Ehe er reagieren konnte, ging ich einen Schritt darauf zu, näher zum Wohnzimmer, und legte entzückt beide Handflächen aneinander. »Es ist bezaubernd.«
In dem Moment, den Connor brauchte, um zu antworten, fiel das Wort »Nachfolge« in dem anderen Raum mehr als deutlich. Das versprach, interessant zu werden.
»Das hängt hier schon eine Weile«, sagte er schließlich und seine Augenbrauen zogen sich zusammen. »Würden Sie oben warten?«
Auch wenn er es wie eine Frage formulierte, wussten wir beide, dass es keine war. Und dass er mich eher rauswerfen würde, als zuzulassen, dass ich noch länger an der geöffneten Tür stand.
So ein Spielverderber.
»Wirklich?«, erwiderte ich, schritt langsam zur Treppe und legte die Stirn in Falten, als würde ich versuchen, mich daran zu erinnern. »Es ist mir nie aufgefallen. Wer hat es gemalt? Ich konnte keine Signatur erkennen.«
Plötzlich das Interesse zu verlieren, wäre zu auffällig. Und zu meinem Glück hatte tatsächlich kein Name auf dem Bild gestanden.
»Ich finde es heraus.«
Ich nickte und schritt die Stufen nach oben, wobei der Teppich das Klackern meiner Pumps dämpfte. Hinter mir ertönte das schwere Stapfen von Connor, der mir folgte. Ganz gleich, wie lange ich schon für Mrs Charleston arbeitete und wie oft ich hier ein und aus ging, er ließ mich nie aus den Augen.
Was nur zeigte, was für ein kluger Mann er doch war.
»Ms Lester ist bereits da«, sagte er, auf der letzten Stufe verharrend, während ich eine Hand auf die goldene Klinke der richtigen Tür gelegt hatte. »Mrs Charleston wird in zehn Minuten bei Ihnen sein.«
»Wunderbar. Sagen Sie Nancy bitte, dass ich unbedingt ein Wasser und einen doppelten Espresso brauche.«
Connor nickte und zog sein Handy aus der Hosentasche, auf dem er – zumindest vermutete ich das – eine kurze Nachricht an Mrs Charlestons Hausdame schickte.
»Vielen Dank«, flötete ich, drückte die Klinke nach unten und betrat den Raum. Ein kleiner Rest warmen Lichts drang durch die riesigen Fenster in das Zimmer, direkt auf Kara, die auf einer roten Couch saß und nun von ihrem Handy aufsah. An ihrer linken Hand funkelte etwas, als sie über eine Strähne strich, die sich aus ihrem Dutt gelöst hatte.
»Scarlett«, begrüßte sie mich erfreut, schob das Telefon zurück in ihre Hosentasche und kam auf mich zu, um mich zu umarmen. Viel zu fest und viel zu lang, dafür, dass wir uns nur in unregelmäßigen Abständen sahen und in meinen Augen kaum mehr als Bekannte waren. Zwar wusste ich von ihren Lieblingsbars über ihre Hobbys und ihre Wohnung – inklusive Wohnort – nahezu alles, während sie glaubte, dass ich drei Geschwister und ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Niemals hätte ich jemandem, der so viel so bereitwillig auf Social Media preisgab, mehr erzählt als meinen echten Namen.
»Schön, dich zu sehen, Kara«, sagte ich betont euphorisch und löste mich von ihr. »Wie geht es dir?«
»Gut, gut«, antwortete sie mit einem Lächeln, das ein klein wenig zu breit wirkte. Ein klein wenig zu nervös. »Ich bin verlobt.«
Sie hielt ihre Hand in die Höhe, sodass ich den Ring aus der Nähe betrachten konnte. Der mittlere Stein in einem hübschen Rot – auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es kein echter Edelstein war – sah an ihrem zierlichen Finger riesig aus. Auch gepaart mit all den anderen weißen Steinchen wurde der Eindruck nicht besser. Ich hatte Kara nie Ringe tragen sehen, erst recht keine, die ihr mindestens eine Größe zu groß waren. Ziemlich sicher hatte ihr Verlobter auf irgendeinen Ring gezeigt, ohne zu überlegen, ob er Kara gefallen würde. Geschweige denn, ob er passte.
Und bestätigte damit das Bild, das ich dank Social Media von ihm hatte. Egozentrisch, arrogant, stets darauf bedacht, dass er selbst am besten zur Geltung kam.
»Bezaubernd«, erwiderte ich gespielt entzückt, und Karas Lächeln wirkte fast erleichtert.
»Danke. Markus hat ihn selbst ausgesucht. Rot ist seine Lieblingsfarbe.«
Natürlich. Seine. Nicht ihre. Ich gab mir Mühe, dass meine Mimik nicht verrutschte. Wieso tat sie so etwas? Wieso wollte sie ihr Leben mit einem Kerl verbringen, dem sie absolut egal zu sein schien? Der in ihr keine gleichberechtigte Partnerin sah, sondern ein nettes Accessoire?
Aber ich verbot es mir, mich einzumischen. Ich wollte kein Teil ihres Lebens werden, weil das unweigerlich bedeutete, dass meines nur komplizierter wurde. Und das konnte ich mir nicht leisten.
Doch eine Erwiderung darauf blieb mir erspart, als es an der Tür klopfte und Nancy eintrat, auf ihrer linken Hand ein Tablett mit meinem Wasser und dem Espresso. Bei meinem Anblick presste sie die Lippen zusammen, und der verkniffene Ausdruck ließ sie mindestens zehn Jahre älter aussehen. Aus unerfindlichen Gründen wirkte mein Charme bei ihr nicht. Möglicherweise nahm sie mir immer noch übel, dass ich bei meinem zweiten Besuch hier den Espresso über einem der Teppiche verschüttet hatte. Nachdem sie mir gesagt hatte, wie schön es sein musste, nicht richtig arbeiten zu müssen.
Aber natürlich war das nur ein kleines Missgeschick gewesen. Von einer ungeschickten jungen Frau, die nichts anderes konnte, als Menschen ein bisschen Farbe ins Gesicht zu pinseln. Sie konnte froh sein, dass keine Zeitung der Welt zahlen würde, um etwas über ihre Geheimnisse zu erfahren.
»Sie sind ein Schatz«, erwiderte ich freundlich und lächelte sie an, während sie das Glas und die Tasse auf einem kleinen Tisch abstellte, der direkt am Fenster stand.
Sie sah mich nicht an, starrte stattdessen stur geradeaus auf den noch leeren Stuhl. »Mrs Charleston ist in zwei Minuten bei Ihnen.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand sie wieder, und ich sah zu Kara. »Ich fürchte, wir müssen uns an die Arbeit machen. Aber erzähl mir unbedingt später von Markus’ Antrag.«
Ihre Augen leuchteten auf und verpassten mir den Hauch eines schlechten Gewissens. Kara war zu nett für diese Welt. »Gern.«
Während Kara ihre unzähligen Bürsten, Spangen und Lockenwickler aufreihte, blies ich in die winzige Tasse. Ein himmlisch dunkler, vollmundiger Duft stieg in meine Nase. So wenig Nancy mich mochte, verbot es ihr ihre Berufsehre, mir einen ungenießbaren Espresso zu servieren. Ich leerte die Tasse in einem Schluck, trank etwas Wasser und stellte schließlich das Make-up sowie Pinsel und Paletten auf dem Schminktisch ab.
Im Flur erklangen gleichmäßige, prägnante Schritte und kaum einen Moment später wurde die Tür aufgestoßen, die dumpf an der Wand anschlug. Hätte Samantha Charleston nicht als Vorstandsmitglied eines fragwürdigen Pharmakonzerns gearbeitet, dann wäre sie in einem anderen Leben eine hervorragende Miranda Priestly aus Der Teufel trägt Prada. Sie hatte immer diesen harten Ausdruck in den Augen, ebenso die leicht geschürzten Lippen, als würde sie in ihrem Kopf alle Personen um sich herum verurteilen.
Ohne eine Begrüßung stolzierte sie an uns vorbei, der unverwechselbare Duft von Chanel No. 5 folgte ihr, und ließ sich auf dem Stuhl nieder. Sofort zog sie ihr Handy hervor und tippte hastig darauf herum.
Worum auch immer es vorhin gegangen war – sie hatte definitiv keine gute Laune. Nicht, dass sie sonst viel mit uns sprach, aber meist begrüßte sie uns zumindest mit einem kurzen Nicken. Wenn die Quartalszahlen besonders vielversprechend waren, ehrte sie uns mit einem »Guten Tag«.
Doch heute nahm sie nicht einmal unsere Anwesenheit wahr, was bedeutete, dass wir nur dann etwas sagen sollten, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ. Kara und ich tauschten einen kurzen Blick aus und an ihren schreckgeweiteten Augen und der Art, wie sie kaum merklich nickte, wusste ich, dass sie ebenfalls zu dieser Schlussfolgerung gekommen war.
»Ist das Ihr Outfit?«, fragte ich ihr Spiegelbild und deutete auf den beneidenswert schönen dunkelgrünen Hosenanzug mit der weißen Bluse, den sie trug. Durch Nancy, die leider mit mir die Termine koordinierte, wusste ich, dass Mrs Charleston heute mit ihrem Mann im Nobelrestaurant The Star zu Abend essen wollte.
Sie sah kurz auf und nickte, ihre Lippen immer noch angestrengt zusammengepresst.
Ich betrachtete sie einen Moment, während sie ihre Aufmerksamkeit schon wieder ihrem Handy gewidmet hatte. Nach meinen Recherchen stammte sie aus einer Familie, die ihr Geld mit Immobilien erwirtschaftet hatte, was mich zu dem Schluss führte, dass es genetisch vererbt sein musste, dass sie sich für etwas Besseres hielt. Gelassen legte ich ihr einen Umhang um, damit ihr sündhaft teures Outfit keine Flecken bekam, und erhaschte dabei einen Blick auf das Display. Sie tauschte Nachrichten mit Nicholas Stilt aus, der ebenfalls Vorstandsmitglied bei Lincoln Pharmacy war. Und ganz offensichtlich eine Vorliebe für unnatürlich viele Ausrufezeichen hatte. Auch er schien wütend zu sein, konnte irgendetwas nicht glauben …
Ob sie vorhin mit ihm telefoniert hatte?
Ich wandte den Blick ab und suchte nach einer Lidschattenpalette, die die richtigen Farben hatte.
In dem Raum herrschte Totenstille, abgesehen von dem nahezu sekündlichen Vibrieren ihres Handys. Und dem abfälligen Schnauben, das Mrs Charleston hin und wieder ausstieß.
»Würden Sie Ihre Augen bitte schließen?«, bat ich freundlich, weil ich sonst den Lidschatten schlecht auftragen konnte. Zu meiner Freude ruhte das Handy in ihrem Schoß, mit dem Display nach oben.
Wie praktisch es war, von ihr nicht wahrgenommen zu werden. Andernfalls wäre ihr vielleicht aufgefallen, dass die Infos in ihren Nachrichten nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.
Lincoln Pharmacy hatte ohnehin schon einen fragwürdigen Ruf, seit sie die Rezeptur mehrerer Medikamente hatten patentieren lassen, um sie für einen viel zu hohen Preis zu verkaufen. Was leider häufig vorkam, doch Lincoln Pharmacy hatte wirklich absolut kein Gewissen, was ihre Preispolitik bei Medikamenten für seltene Erkrankungen anging.
Wieder und wieder vibrierte das Telefon. Ein Name erschien auf dem Display. Emmett.
»Hören Sie auf«, sagte Mrs Charleston plötzlich, während ich ein sanftes Braun auf ihrem Lid verblendete. Gehorsam zog ich den Pinsel weg und wartete, bis sie Mr Stilt eine Antwort geschrieben hatte.
Wer soll das sein?
»Weitermachen.« Bei ihrem Tonfall hätte ich fast salutiert. Innerhalb der nächsten zehn Minuten wies sie mich noch mindestens sechs Mal an, zu stoppen, um ihre Unterhaltung fortzusetzen. Gern hätte ich sie darauf hingewiesen, dass es schneller gegangen wäre, mich meine Arbeit fertigmachen zu lassen, aber heute war das kein Kampf, den ich führen wollte.
»Augen bitte öffnen«, murmelte ich leise, was dafür sorgte, dass sie noch mehr auf ihr Display sah und ich mir alle Mühe gab, ihr die Wimperntusche nicht ins Auge zu stechen.
Plötzlich klingelte ihr Handy, und ohne mir eine halbe Sekunde zu geben, meine Hand wegzuziehen, schlug sie sie unsanft beiseite und ging dran. Dabei streiften ihre langen, spitzen Fingernägel grob über meine Haut und hinterließen für einen Moment helle Striemen. Ich atmete tief ein, behielt das immer freundliche Lächeln auf meinen Lippen, als wäre es dort festgetackert.
»Was hat das zu bedeuten, Nicholas?«, fragte sie, und auch wenn sie sich Mühe gab, ruhig zu klingen, zitterte ihre Stimme. Anstatt sitzen zu bleiben, stand sie auf und zog nun Kreise durch das Zimmer. Sie war nervös.
Menschen wie sie hatten es verdient, zu lernen, was Demut war. Und wäre sie nicht so verdammt nützlich, dann wäre sie die Nächste auf meiner Liste gewesen.
»Alles in Ordnung?«, wisperte Kara und lenkte meine Aufmerksamkeit für einen Moment von Mrs Charleston ab.
»Natürlich«, erwiderte ich gelassen und lockerte die Hand, die ich unbewusst um den Pinsel zu einer Faust geballt hatte.
»Ich habe keine Ahnung, Samantha. Er hat gesagt, dass sein Sohn sein Nachfolger wird.«
Die Stimme von Mr Stilt tönte aus ihrem Handy, obwohl sie ihr Ohr dagegen presste.
»Er hat keinen Sohn«, zischte Mrs Charleston scharf und schien ausgeblendet zu haben, dass Kara und ich im Raum waren.
Es lief eindeutig etwas nicht nach Plan, und ich spürte, dass mein Lächeln immer breiter wurde. Vorfreude, Schadenfreude und vor allem Neugier vermischten sich, wurden eins und brachten mein Inneres zum Kribbeln. Besser als jeder Tag im Spa.
»Dann hat er einen aus dem Hut gezaubert«, kam prompt die hörbar erregte Erwiderung eines sehr wütenden Mannes – wütend und einflussreich. Ich hatte keine Ahnung von Klassik oder Musik, doch in meinen Ohren gab es keine Melodie, die schöner klang als das.
»Und dieser Emmett soll nun meinen Posten bekommen. Auf der Benefiz-Gala wird er vorgestellt.«
Diese Anspruchshaltung war schon bemerkenswert. Menschen wie diese beiden hatten alles und wollten immer mehr. Ganz egal um welchen Preis.
»Wir müssen uns treffen, Samantha. In einer Stunde bei mir zu Hause. Ich gebe den anderen Bescheid.«
Den anderen Mitgliedern des Vorstands? Oder den anderen, die auf ihrer Seite waren?
Mrs Charleston gab ein genervtes Stöhnen von sich, kam wieder zu uns und setzte sich. »Gut. Bis gleich.«
Dann legte sie auf. »Es gab eine Planänderung. Beeilung, ich muss in einer Viertelstunde los.«
In ihrem zweiten Satz schwang ein Vorwurf mit, so als wäre das unsere Schuld. Doch ohne eine Erwiderung tuschte ich ihre Wimpern fertig und trug anschließend einen dezenten Lippenstift auf, während Karas Lockenwickler auskühlten.
Gerade hätte sie auch wild tobend mit Pinseln nach mir werfen können, nicht einmal das hätte mir meine gute Laune verdorben.
Bei Lincoln Pharmacy gab es Geheimnisse. Einen mysteriösen Nachfolger namens Emmett. Jemand, der Mr Stilts und Mrs Charlestons Plänen im Weg stand, die Kontrolle über das Unternehmen zu bekommen. Jemand, der eine Verbindung zum aktuellen CEO haben musste.
Ich wusste, dass ich mich zurückhalten sollte, aber … Wie konnte eine Frau widerstehen, wenn ihr so eine Chance auf dem Silbertablett serviert wurde?
Kapitel 4 – Kieran
Das Gefühl von Frustration hatte mich auch dann nicht verlassen, als ich endlich meine Wohnung erreichte und die schweren Einkäufe in die Küche räumte. Tylers und mein Kühlschrank war seit über einer Woche so leer, dass wir ihn als WG-Zimmer hätten untervermieten können. Doch allmählich wurde mir beim Gedanken an Asia Nudeln, Pizza und Burger schlecht, deswegen hatte ich es nicht länger aufschieben können.
Und wenn ich ehrlich war, wollte ich wenigstens das Gefühl haben, dass ich einen Aspekt meines Lebens unter Kontrolle hatte.
Nachdem ich alles verstaut hatte, kehrte ich in den Flur zurück, in dem der Anrufbeantworter des Telefons blinkte, und drückte auf das Nachrichtensymbol. Eine weibliche Roboterstimme sagte mir, dass jemand heute Nachmittag versucht hatte, mich zu erreichen. Nicht, dass ich überrascht war.
»Hallo, mein Engel«, trällerte Grandmas fröhliche Stimme durch den kaum möblierten Flur und augenblicklich schlich sich ein angenehmes Gefühl der Ruhe ein. »Ich wollte dich nur daran erinnern, dass du Esther füttern musst. Und ich hoffe, du gießt meine Calathea nicht zu oft. Tschüssi.«
Mit einem widerwilligen Grinsen verdrehte ich die Augen, griff nach dem Telefon und ging ins Wohnzimmer, wo die Calathea auf einem Sideboard nahe des Fensters stand. Natürlich nicht zu nah, da sie bei geöffnetem Fenster keinen Zug abbekommen durfte, jedoch nah genug, um genug Sonnenlicht aufzunehmen. Diese war eine der Pflanzen, bei der ein falscher Blick reichte, damit sie eingingen.
Ich wählte Grandmas Nummer und klemmte das Telefon zwischen Ohr und Schulter, um nach Esther zu sehen. Kaum dass ich vor dem Terrarium stand, nahm Grandma ab.
»Ja?«, ertönte ihre Stimme, warm und hell. Und dieses winzige Wort reichte aus, damit ich ihr Lächeln deutlich vor mir sah.
Ich konnte mich kaum an Momente erinnern, in denen sie nicht fröhlich gewesen war. Selbst in der Nacht, als sie ihre einzige Tochter verloren hatte, hatte sie gelächelt. Für mich. Damit wir nicht beide in der Trauer ertranken.
»Hallo, Grandma«, begrüßte ich sie und öffnete eine Tür des Schranks, auf dem das Terrarium stand, um Esthers Lieblingssnack herauszuholen. Mehlwürmer.
»Kieran, mein Schatz, wie schön, dass du anrufst«, antwortete sie mit einem herzhaften Lachen, das ich prompt erwiderte. Obwohl ich heute eigentlich noch vorgehabt hatte, in Selbstmitleid zu versinken. »Hast du Esther gefüttert?«
»Bin gerade dabei«, erwiderte ich belustigt und warf einige Mehlwürmer in Esthers Reich. Flink schoss sie auf die Landmasse zu und schlang die Würmer hinunter, als hätte ich sie die letzten Tage hungern lassen. »Meine große Schwester richtet ihre Grüße aus.«
Ein Insider zwischen uns, und so merkwürdig ich es fand, dieses schwarze Loch auf vier Beinen so zu nennen, brachte es Grandma zum Lachen. Schließlich hatte sie sich dreißig Jahre lang um Esther gekümmert, die auch noch drei Jahre älter war als ich. Den Großteil unserer Leben hatten wir bei Grandma verbracht. Und ich wusste genau, wer von uns beiden das Lieblingskind war.
»Mein kleines Baby«, sagte Grandma, denn ganz gleich, wie alt Esther war, sie würde immer Grandmas kleines Baby bleiben. Sie stieß ein leises Seufzen aus und versetzte meinem Herz einen Stich. Nachdem ich ausgezogen und zur Police Academy gegangen war, war Esther alles, was Grandma gehabt hatte. Sie nicht mit in das Seniorenheim nehmen zu können, in dem sie seit einem Jahr lebte, setzte ihr zu. Mehr, als sie zugeben wollte. Sie an jemand Fremden abzugeben, hätte ihr das Herz gebrochen. Und unabhängig davon, dass ich ebenfalls an diesem verfressenen Biest hing, hätte ich das niemals zugelassen.
Also hatte ich sie zu Tyler und mir geholt. Ebenso wie ihre unzähligen zickigen Pflanzen.
»Ich bringe dir am Sonntag ein paar neue Bilder und Videos mit«, erwiderte ich und warf noch mehr Mehlwürmer hinein, die Esther munter verschlang.
»Ich freue mich darauf. Ich muss jetzt auch los, wir spielen gleich Karten.«
Mein Blick wanderte von Esther zu der Uhr, die über dem Esstisch hing. Es war kurz vor acht.
»Viel Spaß«, verabschiedete ich mich. Es fühlte sich merkwürdig an, von meiner eigenen Grandma abgewürgt zu werden, die ein regeres Sozialleben hatte als ich. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich dieses Sozialleben gerade unterbringen sollte. Nicht, dass ich ein Bedürfnis nach menschlichen Kontakten hatte. Mir reichte schon der, den ich aus verschiedenen Gründen nicht vermeiden konnte.
Nachdem ich den Status jeder einzelnen Pflanze gecheckt und sie nach Bedarf gegossen hatte, ging ich zurück in die Küche. Wenn ich nicht in den nächsten zwanzig Minuten irgendetwas zu essen bekam, würde ich mich ziemlich sicher über Esthers Würmer hermachen.
Ich schnitt einiges Gemüse klein und warf es achtlos in die Pfanne, die leise zischend ihrer Arbeit nachging. Allein mit der Stille schlich sich die Leere wieder ein, die ich Abend für Abend spürte, sobald ich zu Hause war. Noch bis vor drei Wochen hatte ich nicht gewusst, dass es möglich war, sich so zu fühlen.
Niedergeschlagen oder frustriert? Oft. Wenn ich in einem Fall nicht weiterkam oder die Beweislage nicht für eine Festnahme ausreichte.
Aber leer? So, als hätte ich absolut nichts erreicht? Nichts geleistet? Das war neu.
Doch vermutlich sollte ich mich besser daran gewöhnen, denn es konnte noch monatelang so weitergehen.
Ein wenig fester als beabsichtigt stopfte ich eine mit Reis gefüllte Schüssel in die Mikrowelle, die mit einem dumpfen Schlag an der Innenwand anstieß. Eine Weile sah ich ihr zu, wie sie sich drehte, rührte hin und wieder in der Pfanne herum, ohne zu registrieren, wie lang ich hier eigentlich stand.
Es fühlte sich auch nicht wichtig an.
Erst das Geräusch eines Schlüssels, der im Schloss herumgedreht wurde, riss mich aus meiner Apathie. Da war er, einer dieser Sozialkontakte, die ich nicht vermeiden konnte. Gut, dass ich genug Essen gekocht hatte, um zusätzlich einen kleinen Bären sattzubekommen.
»Ich bekomme echt die Krise«, rief Tyler quer durch die Wohnung, gefolgt von einigen französischen Schimpfwörtern, die er wild um sich warf. Dann verstummten die raschelnden Geräusche ebenso wie seine Stimme. »Kochst du?«
»Ja«, erwiderte ich so neutral wie möglich. Ein Poltern erklang, ehe Tyler in der Tür stand, mit der linken Hand auf seinem Herzen.
»Ich dachte, du liebst mich.«
»Nicht genug, um mit dir mein Essen zu teilen.«
»Du hast sogar dein Bett mit mir geteilt.«
»Du hast dich besoffen zu mir gelegt und ich war zu müde, dich wieder rauszuschmeißen.«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung, als würde er ein unbedeutendes Detail verscheuchen, und rückte seine riesige dunkelrote Brille zurecht. Er hatte Hunderte von den Dingern, in allen Formen und Farben. Nicht weil er schlecht sah, sondern um für jedes Outfit die passende zu haben. »Kleinigkeiten. Und ich bin am Verhungern.«
Ich verdrehte die Augen. »Und das ist mein Problem, weil …?«
»Weil ich der beste Mitbewohner der Welt bin und du keinen Bock hast, dir einen neuen zu suchen?«
Ich hielt einen Moment inne. »Punkt zwei hat mich überzeugt.«
Tyler machte ein Geräusch, als könnte er sich nicht entscheiden, ob er empört schnauben oder laut lachen wollte. Also klang es nach einer seltsamen Mischung, die mich ein winziges bisschen zum Grinsen brachte.
Doch die gelockerte Stimmung verschwand, als sich sein Schnaublachen in einem langen Seufzer verlor, während er sich auf einen der beiden Plastikküchenstühle fallen ließ.
»Was ist los?«, fragte ich, weil er immer das Gefühl haben wollte, mir damit einen Gefallen zu tun. Das nutzte er dann gern, um Informationen aus mir zu erpressen.
»Irgendwas Komisches läuft bei uns.«
Gespielt irritiert deutete ich zwischen ihm und mir hin und her und Tyler lachte auf.
»Nicht bei uns beiden«, antwortete er und verdrehte dramatisch die Augen. »Auf der Arbeit. Aber mir hat noch keiner gesagt, was los ist.«
Er arbeitete in einem großen Pharmakonzern. Wenn da die Gerüchteküche brodelte, dann bedeutete das in der Regel nichts Gutes. Die Frage war nur, für wen. Angestellte, die entlassen wurden? Neue Preispolitik? Expansion?
»Weil es dich nichts angeht?«, erwiderte ich und erntete ein entrüstetes Schnauben.
»Hallo? Ohne mich wäre der Laden schon lange dichtgemacht worden.«
»Hmmh«, machte ich und holte den Reis aus der Mikrowelle. Dampf stieg mir entgegen, als ich den Deckel des heißen Plastikgefäßes öffnete. »Warum denkst du, dass etwas los ist?«
»Ah«, meinte er zufrieden und verschränkte seine Finger miteinander wie ein Filmbösewicht. »Der Ermittlermodus. Also, Natasha hat gesehen, dass sich Mr Derryl auffällig lang mit Mr Stilt unterhalten hat.«
»Und die sind …?« Die Namen kamen mir beide vage bekannt vor, wahrscheinlich hatte Tyler sie in irgendeinem Zusammenhang mal erwähnt. Doch er zählte auch gefühlt hundert neue Namen jeden Tag auf.
»Mr Derryl ist unser CFO und Mr Stilt ein Typ aus dem Vorstand. Und eine falsche Schlange.«
Bei »falsche Schlange« klingelte es bei mir.
»Und Natasha?« Keine Ahnung, ob das wichtig war, aber wenn, dann wollte ich ein vollständiges Bild. Immerhin hatten schon die scheinbar unbedeutendsten Hinweise zu einer Spur geführt.
»Unsere Empfangsdame und meine Gossip-BFF.«
Notiert. Menschen, die am Empfang arbeiteten, waren meistens die, die mehr wussten als alle anderen.
»Auf jeden Fall bin ich dann zuuuuufällig mit Tracy ins Gespräch gekommen. Du weißt schon, der Sekretärin von Mr Stilt, die mir davon berichtet hat, dass er und einige andere aus dem Vorstand sich wohl außerhalb der Arbeitszeiten spontan getroffen haben. Und …«
»Stopp«, unterbrach ich ihn und hob eine Hand, weil ich einen Moment brauchte, um die Informationen und Namen sinnvoll in meinem Kopf zu ordnen. Sie mit roten Fäden zu verknüpfen, um zu wissen, wer dieser Leute welche Rolle spielte und in welcher Verbindung sie miteinander standen. Wenn ich ihn so weitermachen ließ, hatte ich am Ende nur Kopfschmerzen.
Tylers Mund war weit geöffnet, bereit, in genau der Sekunde weiterzureden, in der ich ihm das Zeichen gab.
Ich ließ meine Hand sinken, und Tyler holte tief Luft.
»Und heute hat Felizitas mitbekommen, dass sich Mr Lincoln mit Mr Stilt ziemlich laut gestritten haben soll. Stilt ist ja schon lange auf Lincolns Posten scharf und wartet nur noch darauf, dass er endlich zurücktritt.«
Wieder hob ich die Hand und augenblicklich verstummte er.
»Mr Lincoln ist der aktuelle CEO, korrekt?« Das war zumindest naheliegend, wenn man bedachte, dass der Laden Lincoln Pharmacy hieß.
Tyler nickte.
»Und will er zurücktreten?«
Tyler verschränkte beide Hände hinter seinem Nacken und sah nach oben an die Decke. »Na ja, der ist mittlerweile über sechzig. Hat sich aber gut gehalten.«
»Das war nicht meine Frage.«
»Also Gerüchten zufolge, ja. Letztes Jahr hat das irgendwann die Runde gemacht, glaube ich.«
Das musste nichts heißen, aber ich notierte es mir ebenfalls gedanklich.
»Und will Mr Lincoln Mr Stilt als Nachfolger?«
»Eben nicht. Die beiden hassen sich. Lincoln würde Stilt am liebsten aus dem Vorstand werfen. Und Stilt Lincoln aus der Firma«, erwiderte Tyler aufgeregt.
»Und ist bekannt, wen Lincoln als seinen Nachfolger ausgesucht hat?«
Tyler strahlte mich an, als hätte ich ein schweres Rätsel gelöst, und klatschte in die Hände. »Das ist das Spannende an der Sache. Seit ein paar Tagen trifft sich Mr Lincoln mit einem Mann in seinem Büro, zu dem Tracy keine Informationen hat. Aber Mr Stilt hat wohl ein Problem mit ihm, meint sie.«
Wenn dem so war, hatte es mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu tun, dass er nun einen unerwarteten Konkurrenten hatte.
Es kribbelte mir in den Fingern, meine Gedanken, die Namen und Informationen aufzuschreiben und übersichtlich an irgendein Board zu hängen, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen.





























