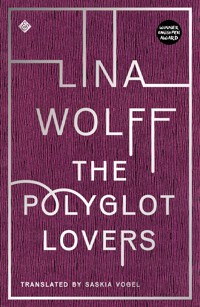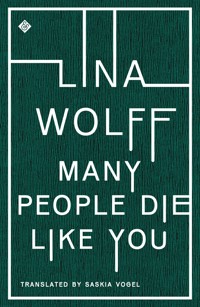10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tempo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Grenzen der Liebe in einer gnadenlosen Welt: In Barcelona kreuzen sich die Wege der exzentrischen Schriftstellerin Alba Cambó und der unerschütterlichen Araceli, die alleine bei ihrer Mutter aufwächst. Wie ein Puzzle setzt Araceli die Biographie der geheimnisvollen, flüchtigen Alba zusammen, ein Strudel aus schillernden Geschichten über Menschen aus ihrer Vergangenheit und einen Hund, den eine Prostituierte auf den Namen Bret Easton Ellis getauft hat. Lina Wolff erzählt von Machtspielen zwischen Müttern und Töchtern, Schriftstellern und Lesern und – immer wieder und vor allem – Männern und Frauen, von Sehnsucht und Begehren, Liebe, Hass, Erotik, geplatzten Träumen und zerstörerischem Alltagstrott. Ein mal beißend komischer, mal poetischer Roman voller schonungsloser Zärtlichkeit, in dem hinter jedem Satz eine Überraschung lauert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lina Wolff
Bret Easton Ellis und die anderen Hunde
Roman
Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat
TEMPO
meat is cut as roses are cut
men die as dogs die
love dies like dogs die,
he said.
Charles Bukowski
Nicht jeder kann sich seinen Tod aussuchen, Alba
»Es war vorletzten Freitag«, begann Valentino, als er mich zur Schule fuhr. »Alba Cambó und ich hatten uns morgens um zehn getroffen und waren mit dem Auto unterwegs. Im Radio lief Vivaldi. Ich hatte das Verdeck heruntergeklappt, es war ein schöner Tag, so ein Tag, an dem der Duft von Feigen, Salzwasser und freundlichen Abgasen in der Luft liegt. Alba saß da, wo du jetzt sitzt, den Kopf zurückgelehnt, und schaute zu den Hausdächern hoch, während wir durch Straßen und Alleen fuhren. Ich kannte das Stück im Radio und summte mit. ›Zu Vivaldi könnte ich niemals Liebe machen‹, sagte Alba. ›Vivaldi ist doch schön‹, sagte ich. ›Eben‹, seufzte sie. ›Stell dir vor, zum Gloria Liebe zu machen. Das können nur Heilige, und Heilige dürfen keinen Sex haben, Heilige sollen heilig sein.‹ Ich stellte mir vor, wie es wäre, sich zu Vivaldi zu lieben. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht war das nichts für Leute wie uns. Manche können das, andere nicht. Aber das spielte in diesem Moment keine Rolle. Ich hatte nicht vor, sie zu bitten, zu Vivaldi mit mir Sex zu haben. Ich wollte sie um etwas ganz anderes bitten und überlegte, wie ich es sagen sollte. Es war etwas so Großes und Wichtiges, doch wie ich es auch zu formulieren versuchte, klang es banal. Als ich dich das erste Mal gesehen habe. Am Strand von San Remo. Das klang banal. San Remo klang banal, San Remo ist eine banale Stadt, und in dieser banalen Stadt hatten wir uns kennengelernt. Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, Alba, hat sich ein Vogel in meinem Herzen eingenistet. Der Vogel der Liebe. Du. Das klang genauso banal, aber manchmal kommt das Banale der Wahrheit am nächsten. Und ich wollte die Wahrheit sagen, auch wenn sie banal war. Dafür war ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich feilte weiter an den Formulierungen. Dachte, jetzt sehe ich ihr in die Augen und sage es einfach. Doch als ich mir endlich ein Herz fasste und mich ihr zuwandte, war sie eingeschlafen.
Ich parkte in der Nähe des Pla Borne. Alba wachte auf, wir gingen los und suchten nach einem Restaurant. Während wie durch die Straßen schlenderten, tanzte Vivaldi in meinen Ohren. Kann man sich dazu lieben?, dachte ich. Vielleicht wenn man sehr alt oder sehr jung ist. Wir gingen in eine Bar und bestellten Drinks. Stießen an und tranken. Der Alkohol durchströmte uns, machte uns fröhlich. Wir wurden albern. Doch dann setzt Alba plötzlich eine ernste Miene auf und fragt: ›Valentino, willst du mich heiraten?‹ Und ich glaube, nicht richtig verstanden zu haben. Verstehe überhaupt nichts mehr. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist doch meine Frage! In meiner Welt fragt der Mann. In meiner Welt fragt der Mann bestimmte Dinge, nicht weil ich altmodisch bin, sondern weil dann alles besser wird. Wer will schon mit einer Feministin ins Bett? Geschweige denn mit einem Feministen! Wenn wir lieben, müssen wir danach streben, jemand anders zu sein. Das ist der einzige Ausweg. Sie hätte das nicht sagen sollen, denke ich, und Vivaldi tanzt weiter in meinen Ohren, hier läuft etwas falsch. ›Also, Alba‹, sage ich. ›Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mir das anders vorgestellt, ganz anders habe ich mir das vorgestellt.‹ ›Ich verstehe‹, antwortet sie. ›Ich bin dir zuvorgekommen. Du wolltest mich fragen.‹ ›Ja‹, antworte ich. ›Du siehst so traurig aus‹, sagt sie, streckt die Hand nach mir aus und streichelt mir über die Wange. Ich denke: Wo bleibt der Champagner?
Wir ziehen weiter. Planlos, lustlos. Auf ihre Frage kommen wir nicht mehr zu sprechen. Als wäre sie nie gestellt worden. Wir streifen durch die Gassen, hier und da klettert Efeu über die Mauern. Wir kommen zu einem kleinen verstaubten Geschäft mit alten Kleidern und Krempel. ›Da gehen wir rein‹, bestimmt Alba. Als wir die Tür öffnen, schlägt uns muffige Luft entgegen. Blumentöpfe, Sockel, Büsten, ausgestopfte Vögel, ein Wildschweinkopf und Stoffe in kräftigen Farben bilden ein heilloses Durcheinander. Hinter der Kasse steht eine alte Frau mit grauem Dutt, die uns misstrauisch beäugt. Als Alba einen Schrank öffnet, quellen Kleider heraus. Sie betrachtet ein Kleidungstück nach dem anderen, bis sie schließlich ein altes Spitzentuch und eine schmal geschnittene kurze Jacke mit Goldverzierungen hochhält. ›Was ist das?‹, fragt sie. ›Aus einem Nachlass‹, erwidert die Alte hinter der Kasse trocken. ›Ich habe die Sachen erst vor einer Stunde reinbekommen und noch keine Zeit gehabt, sie aufzuhängen. Von einem alten Aficionado und seiner Frau.‹ Den letzten Satz fügt sie widerstrebend hinzu, als wären wir dieser Information unwürdig. Sie verschwindet hinter einem Vorhang, und ein paar Sekunden später tönt Nisi Dominus aus den Lautsprechern. Alba schaut mich lächelnd an. ›Hörst du?‹ ›Ja‹, antworte ich. ›Dann wissen wir ja, was wir nicht tun werden‹, sagt sie und wühlt sich weiter durch den Kleiderhaufen. Ich stehe reglos da. Sie winkt mich zu sich. ›Zieh die mal an‹, sagt sie und hält mir die goldbestickte Jacke hin. ›Nie im Leben!‹, antworte ich. ›Ich zieh doch keine Sachen von jemandem an, der gerade gestorben ist.‹ ›Wenn Sie etwas anprobieren möchten, können Sie hinter den Vorhang gehen‹, bemerkt die Alte. ›Ich will nichts anprobieren‹, sage ich bestimmt. Es fühlt sich an, als hingen Spinnweben von der Decke, bis in meine Ohren. Es juckt mich am ganzen Körper. ›Er ist an gebrochenem Herzen gestorben‹, sagt die Alte. ›Was für ein tragischer Tod‹, seufzt Alba. ›Nicht jeder kann sich seinen Tod aussuchen‹, antwortet die Alte. ›Was wollen Sie überhaupt mit den Sachen?‹, frage ich. ›So alt und schäbig, das ist doch unhygienisch.‹ ›Das sind feine Stücke‹, entgegnet die Alte, und ihre Augen blitzen im Halbdunkel auf. ›Haha!‹, lacht Alba. ›Der Donnermann hat gesprochen! Einen Stier könnte er mit bloßen Händen töten, aber vor ein bisschen Ungeziefer fürchtet er sich.‹ Jetzt lacht auch die Alte, und ich sehe, dass sie keine Zähne hat. Ihr Mund ist ein schwarzes Loch, eine Rutschbahn ins Ungewisse. ›Genau, der Donnermann hat gesprochen‹, sage ich und versuche in ihr Gelächter einzustimmen. Alba verschwindet hinter dem Vorhang. Schließlich zieht sie ihn zur Seite, und dann steht sie vor mir, eingehüllt in ein Spitzentuch und mit einem Hut auf dem Kopf. Sie trägt keine Bluse, ihre nackten Brüste sind zu sehen. ›Alba, zieh dir was über!‹ ›Jetzt hör aber auf!‹, sagt sie. ›Stell dich doch nicht so an!‹ Ich spüre, wie etwas meinen Arm berührt, zucke zusammen und sehe die Alte, die sich an meine Seite geschlichen hat. Mir ist, als würde sie einen Geruch von Alter verströmen, und ich trete einen Schritt zur Seite. ›Wundervoll‹, sagt sie mit ihrem breiten, zahnlosen Lächeln, ›das Tuch hat auf eine Frau wie Sie gewartet!‹ Die Alte hält ein Silbertablett in den Händen, auf dem drei Likörgläser mit einer klaren Flüssigkeit stehen. ›Bitte schön‹, sagt sie und hält mir das Tablett hin. ›Nein danke‹, antworte ich. ›Jetzt nehmen Sie schon!‹ Ihr Lächeln ist verschwunden. ›Nimm schon‹, wiederholt Alba, ganz in schwarze Spitze gehüllt. Verfluchtes Weib, denke ich, kippe den Inhalt des Glases hinunter und knalle es aufs Tablett. Verfluchtes, altes, stinkendes Totenweib. ›Komm Alba, wir gehen‹, sage ich. ›Erst ziehst du die Stierkämpferjacke an, stellst dich neben mich, und wir machen ein Foto!‹, antwortet sie und verschränkt trotzig die Arme. Die Alte hält ihr das Tablett hin, und Alba nimmt ein Glas. ›Unter einer Bedingung‹, sage ich. ›Danach verschwinden wir. Und zwar sofort.‹ ›Okay‹, sagt Alba. ›In dieser Luft hält man es ohnehin nicht lange aus.‹ Die Alte nickt mit ihrem alten Kopf und scheint nicht die Spur beleidigt.
Ich ziehe mein Hemd aus und zwänge mich in die Goldjacke. Die Spinnenfrauenfinger der Alten krabbeln auf mir herum und machen sich an den Bändern und Knöpfen zu schaffen. Dann bauen sie und Alba sich vor mir auf und mustern mich kritisch. ›Da fehlt noch etwas‹, sagt die Alte, geht und durchwühlt den Kleiderhaufen. Sie kommt mit einem Umhang zurück, den sie mir über die Schultern legt. Dann zieht sie ein Schwert aus einem Schirmständer und steckt es mir unter den Arm. ›So, jetzt machen wir das Foto.‹ Alba gibt der Alten ihre Kamera und stellt sich neben mich. ›Lächle‹, sagt sie. Ich versuche es. Die Alte drückt auf den Auslöser. Alba nimmt die Kamera wieder an sich, und wir schauen uns das Bild an. Als ich uns sehe, muss ich trotz allem lachen. Und auch heute noch, wenn ich das Bild betrachte, sehe ich die Zuversicht in meinem Blick und die müde Selbstsicherheit in Albas. Ich, der Stierkämpfer, und sie, die Prostituierte. So wollten wir leben. In vollen Zügen, ohne schleifende Bremse. In vollen Zügen, alles andere wäre vergebens. So wollten wir leben, und wenn wir daran stürben. Das begriff ich in diesem Moment. Alba Cambó und ich wollten leben, und wenn wir daran stürben. Ich befreie mich von der Jacke und dem Umhang. Alles riecht muffelig nach altem Mann. Alba reckt sich vor dem Spiegel, die Alte starrt sie mit halb offenem Mund an. Das Tablett hat sie abgestellt, ihre Arme hängen schlaff am Körper herab. ›Komm jetzt‹, sage ich. Alba zieht sich um und plaudert dabei mit der Alten, die ihr einsilbige Antworten gibt und sie weiter eingehend betrachtet. ›Danke, das war sehr nett‹, sagt Alba, schon halb zur Tür hinaus. ›Warten Sie!‹, ruft die Alte. ›Nehmen Sie das Tuch! Ich schenke es Ihnen.‹ Alba schlingt es sich um und schüttelt zum Dank die alte Hand. Als wir auf die Straße hinausgehen, habe ich das Gefühl, die Alte beobachte uns, aber ich will mich nicht umdrehen. Etwas verändert sich, als wir an die frische Luft kommen. Wir werden fröhlicher. Vielleicht ist es der Likör, vielleicht der Sauerstoff, jedenfalls scheint die Tristesse mit einem Mal wie verflogen. Wir schlendern ziellos durch die Straßen, dann nehmen wir noch ein paar Drinks in einer Bar. Wir unterhalten uns über Musik, zu der man sich lieben kann. ›The Verve‹, sagt Alba. ›Kenne ich nicht‹, antworte ich. ›Ich auch nicht. Soll aber sehr zweckdienlich sein, habe ich gehört.‹ Wir lachen. Wir ziehen weiter. Setzen uns in ein Restaurant und bestellen gegrillte Garnelen. Alles scheint perfekt. Es ist weder zu warm noch zu kalt, der Cava rinnt angenehm die Kehle hinunter. Alba hat das schwarze Spitzentuch umgehängt und sagt zusammenhanglos Dinge wie: ›Keine Ahnung, warum Männer so verrückt nach Sex sind‹, oder ›Einmal habe ich einen Totenschädel im Wasser treiben sehen, als ich bei Palmarola im Meer geschwommen bin‹ oder ›Wenn die Leute kein anderes Problem haben als fehlende Leichtigkeit, dann sind sie nicht zu retten‹. Ich sitze da und nicke. Manchmal sage ich: ›Ach?‹ Ihre Bemerkungen zu Sex lasse ich unkommentiert, erzähle ihr aber, dass auch ich einmal einen Totenschädel gesehen habe, auf Sardinien. Allerdings trieb er nicht im Wasser, sondern steckte in einem Felsen. Ich war ein Stück hinausgeschwommen, und als ich mich umdrehte, sah ich ihn. Die schwarzen Augenlöcher starrten mich an. ›Ich kenne es also‹, sage ich, ›dieses ganz besondere Kribbeln in den Zehen, wenn man tausend Kubikmeter Wasser unter sich hat, zum Ufer blickt und einen Totenschädel im Felsen entdeckt.‹ So geht es weiter, wirr und angeheitert, das meiste, was wir sagen, hat weder Zusammenhang noch Bedeutung, aber wir sind wieder fröhlich, und dafür sind wir dankbar. Der Kellner ist freundlich, serviert uns die Garnelen, tischt Brot auf, ringsumher das Gemurmel der Menschen an den anderen Tischen, niemand ist zu laut oder stört. ›Uns geht es verdammt gut‹, bemerke ich, Alba nickt und schiebt sich eine Garnele in den Mund. ›Wir sollten uns schämen, so gut geht’s uns.‹ ›Ja, genau‹, antworte ich. Wir befummeln uns unterm Tisch. Überlegen, ins Kino zu gehen, um eine Weile ungestört rummachen zu können. Ein schlechter Film, letzte Reihe. Wir bestellen Holundersorbets und Daiquiris. Alba zieht einen Joint aus der Tasche, zündet ihn an, den Kellner scheint das nicht zu kümmern. Irgendwann spüre ich, dass jetzt der Moment ist, um auf ihre Frage zurückzukommen. ›Was wird aus der Hochzeit?‹, frage ich. ›Wir heiraten im Mai‹, antwortet Alba verträumt und bläst Rauch aus. ›Wir heiraten im Mai in Albarracín, wenn die Pappeln am Fluss gerade ausgeschlagen sind. Dann hat die Sonne die Erde noch nicht verbrannt. Dann ist es warm und alles voller Erwartung. Dann kann man durch die Schluchten wandern und bis spät in die Nacht draußen sitzen und essen. Und wir können uns in den schwarzen kastilischen Himmelbetten im Parador lieben.‹
Ich bin noch nie in Albarracín gewesen, sehe es aber vor mir. Ein kleines Dorf auf einem Berg. Eine Schlucht, Pappeln, deren Blätter im Wind rascheln, ein weiches Wispern. Schwarze, schwere Betten, schwarzer Samt und geschlossene Fensterläden, schmale Lichtstreifen, die in den hellen Tagesstunden hereinsickern. All das sehe ich vor mir, als wäre ich schon immer dort gewesen, in Albarracín, als wäre ich schon immer auf den Hügeln umhergewandert, den Wind im Gesicht und vor mir diese Aussicht. Keine Tiefebene. Kein träge umherstreifendes Vieh, nur stolze Vögel, die sich in die Lüfte schwingen. ›Ja, das machen wir‹, sage ich mit Tränen in den Augen. ›Ist es erlaubt, so glücklich zu sein?‹ Ich lege meinen Kopf auf ihre Schulter. Sie streichelt meine Wange. ›Bestimmt sperren sie uns gleich in ein Kellerloch‹, sagt sie. ›Wenn man so glücklich ist, dann ruft der innerste Höllenkreis.‹
Ein paar Stunden habe ich in der Überzeugung gelebt, tatsächlich so glücklich zu sein oder es zumindest werden zu können. Aus den Augenwinkeln sah ich sie neben mir gehen. Dachte an das weiche Leder ihrer Stiefel, wie es sich um ihre Fesseln schmiegte. Die Strumpfhose, die ihren Körper bis zum Nabel umschloss. Jede Kurve, jede Vertiefung ihres Körpers tastete ich in Gedanken ab und stellte mir vor, wie wir von nun an jeden Morgen nebeneinander aufwachen würden. Die Welt um uns herum ein ebenso faszinierter wie neidischer Beobachter. Wo wir vorbeizögen, würde die Zeit stillstehen. All das stellte ich mir vor und vergaß für ein paar Stunden die Unmöglichkeit dieser Gleichung. Doch irgendwann schlägt der Tag um, ich kann nicht genau sagen, wann, wahrscheinlich nachdem wir bezahlt haben und bald aufstehen werden, um zu gehen. Da flacht der Tag ab, sinkt platt und plump wie eine angeschossene Krähe zu Boden. Meine Energie versiegt, und Alba stützt sich schwer auf den Tisch. Ich glaube, sogar die Sonne verzieht sich. ›Das war also der angenehme Teil des Abends‹, murmelt sie. ›Vergiss nicht, wir heiraten in Albarracín‹, sage ich. ›Nein, das vergesse ich nicht. Aber wehe, sie spielen Vivaldi!‹ Ich versuche zu lachen und spüre die Weindämpfe in den Mund aufsteigen. Ich stehe auf und gehe zur Toilette. Sie ist dreckig, jemand hat danebengepinkelt. Als ich zurückkomme, ist Alba aufgestanden und wartet mit vorwurfsvoller Miene, als wollte sie fragen, wo ich so lange gesteckt hätte. Wir ziehen weiter. Als ich einen Blick auf die Uhr werfe, ist es Viertel vor fünf. Mit anderen Worten, exakt vier Stunden vor dem Anruf aus dem Krankenhaus. Wie vertreiben wir uns die Zeit? Keine Ahnung. Wir haben gefroren, glaube ich, obwohl es warm war. Ich erinnere mich, dass wir die Straßenseite wechselten, als die Sonne von einem Haus verdeckt wurde, das seinen Schatten über uns warf. Ich glaube, uns waren die Gesprächsthemen ausgegangen, und wir sprachen immer angestrengter, harrten aus. Und vermutlich fragte ich mich, wann der Tag endlich vorüber sein würde, wann wir nach Hause gehen, uns hinlegen und das Licht ausmachen könnten.
Als der Anruf kommt, ist es Abend. Wir haben noch einmal gegessen, in einem anderen Restaurant, diesmal bloß eine Suppe, ein wenig Obst, dazu eine Flasche Wasser. Ihr Telefon klingelt, sie wirft einen Blick auf das Display, steht auf und geht hinaus. Ich frage mich, wer das sein kann, mit dem sie nicht in meiner Anwesenheit sprechen will. Wo wir doch bald alles teilen werden. Von unserem Fenstertisch aus sehe ich ihren Rücken. Sie steht im Eingang, und die Kellner huschen mit ihren Tabletts an ihr vorbei. Völlig reglos steht sie da. Ich spiele mit Aschenbecher und Zahnstochern. Die aufgequollenen Reiskörner im Salzstreuer sehen aus wie Maden. Sie kommt zurück, setzt sich mir gegenüber und sagt: ›Das Krankenhaus hat angerufen. Meine Untersuchungsergebnisse sind da, er scheint bösartig zu sein.‹ ›Was? Wer?‹, frage ich. ›Der Tumor‹, antwortet sie. ›Du hast nichts von einem Tumor erzählt.‹ ›Nein? Ich dachte, das hätte ich.‹ ›Nein, hast du nicht.‹ ›Na, so was. Jedenfalls hat er gestreut, sie sagen, für eine Operation sei es zu spät.‹ Ich lache, halte das Ganze für einen Scherz. Um diese Uhrzeit ruft doch niemand aus dem Krankenhaus an. Abends. Um am Telefon so eine Nachricht zu überbringen. Wenn zwei Menschen gerade so glücklich sind. ›Doch‹, sagt Alba. ›Erst wollten sie nicht damit rausrücken, aber dann habe ich gesagt, ich sei im Ausland und käme erst in vier Wochen zurück.‹ Ihr Gesicht wirkt wie aus weißem Stein gehauen. Ihr Kiefer zittert. ›Aber‹, sage ich. ›Aber.‹ Ich weiß nicht, was man sagt. ›Wir wollten doch. Albarracín. Die Pappeln und die Schlucht. Die stillstehende Zeit.‹ Ich sehe ein Zahnrad vor mir, das ein Stück Fleisch zu fassen bekommt und es zermalmt. Ich versuche, an etwas anderes zu denken. Die Zukunft. Die Pappeln. Blätter, die im Licht flirren. Kellner eilen vorbei. Einer öffnet ein Fenster, und von der Straße wehen Geräusche herein. Ich höre einen Mann, der mit einem Kind schimpft, es duftet nach Röstkastanien. Eine Frau lacht laut auf. Kirchenglocken läuten. Ich sitze da und denke: der Duft von Röstkastanien, ein Mann, der mit einem Kind schimpft, die Glocken, die neun Uhr schlagen. Ja, so ist es. Es ist neun Uhr, und nichts sagt, dass ich aufhören muss, sie zu lieben.
Valentinos Geschichte war natürlich nicht das Erste, was ich über Alba Cambó hörte. Das Bild, das meine Mutter und ich uns von ihr machten, gründete sich vor allem auf die Texte, die wir in der Zeitschrift Semejanzas gelesen hatten. An dem Tag, als Alba Cambó in die Wohnung unter uns zog (dass jemand gekommen war, um zu bleiben, schlossen wir daraus, dass die zerbrochenen Blumentöpfe und die Brechstange, die seit einer halben Ewigkeit auf der Terrasse gelegen hatten, plötzlich verschwunden waren, und stattdessen saßen dort zwei Personen und unterhielten sich, während der Duft exotischen Essens zu uns heraufwehte), ging meine Mutter zum Markt, um sich ein wenig umzuhören. Die Leute wussten nicht viel mehr, als dass am Vortag ein Umzugswagen vor unserem Haus gestanden hatte, dass Sachen ausgeladen worden waren und eine Frau, wahrscheinlich Alba Cambó, die Umzugsmänner mit kritischer Miene beim Schleppen der Kisten beobachtet hatte. Damit wollte meine Mutter sich nicht zufriedengeben, und am nächsten Tag ging sie noch einmal zum Markt. Ein paar Stunden später kam sie mit der neuesten Nummer der Semejanzas zurück, für die sie den ganzen Weg bis zu FNAC an der Plaça de Catalunya auf sich genommen hatte. Wir blätterten durch die hochglänzenden Seiten. Zuerst kam eine Reportage über einen Mann, der illegaler Muschelfischerei in der Ría de Vigo nachging, anschließend ein Interview mit einem berühmten Schriftsteller aus Madrid, dessen Namen ich nicht mehr weiß, aber dafür hat sich mir das Bild eingeprägt, wegen eines kleinen Details im Hintergrund, einer aus einem Bücherregal hervorblitzenden Pistolenmündung. Dann kam er, der Text unserer neuen Nachbarin. Auch von ihr war ein Foto abgedruckt, auf dem sie jemanden außerhalb des Bildausschnitts anlächelte. Ja, das war sie, kein Zweifel. Meine Mutter las die Geschichte laut vor. Sie war neunzehn Seiten lang und handelte von einem sehr einsamen Mann, der im Stadtteil Poblenou lebte. Der Mann wurde in der gesamten Geschichte nie beim Namen, sondern nur »der Mann« genannt und als ziemlich klein, mit schütterem Haar und großen, starrenden und vor allem traurigen Augen beschrieben. Vor lauter Einsamkeit hatte er langsam, aber sicher eine soziale Phobie entwickelt, die sich anfangs in einer leichten Abneigung gegen andere Menschen geäußert hatte. Er drückte sich vor Verabredungen und Familienfesten, doch schon bald wurde die Abneigung zu etwas Größerem, das sich nicht mehr herunterspielen und sein Leben enger werden ließ. Der deutlichste Beleg dafür, dass aus der ganz allgemeinen, alltäglichen Abneigung gegen sein Umfeld eine echte Phobie geworden war, bestand darin, dass er in der Gegenwart anderer Menschen nicht mehr unbefangen essen konnte. Seine Hand begann zu zittern, bis das Essen von der Gabel fiel, und manchmal entglitt ihm auch die Gabel, um mit einem in seiner Wahrnehmung ohrenbetäubenden Scheppern auf den Teller zu fallen. Seine Verlegenheit ließ sich sofort an der Farbe seines Gesichts ablesen. Der Mann konnte wie aus heiterem Himmel erröten, völlig grundlos, womit er die Blicke der Leute erst recht auf sich zog, was die Situation und die Phobie nur noch schlimmer machte. Die Menschen in seinem Umfeld sorgten sich um ihn. Als sein sechzigster Geburtstag bevorstand, fand seine Tochter, das sei ein guter Anlass, Freunde und Familie zu versammeln. Vielleicht würde so eine soziale Zusammenkunft die Phobie ihres Vaters ja ein wenig mildern? Sie hatte nämlich gehört, die Konfrontation mit den angstauslösenden Reizen habe immer einen positiven Effekt. Es gelang ihr, etwa vierzig Personen zusammenzutrommeln, und eines Abends standen sie alle versammelt im dunklen Flur der Wohnung des Mannes in Poblenou, als er von der Arbeit nach Hause kam. Er öffnete die Tür so langsam und umständlich wie immer. Drinnen hörten die Leute, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde, wie der Mann seine Aktentasche im Flur abstellte und wie er die Tür hinter sich zuzog. Dann war es für einen Augenblick mucksmäuschenstill. Man hätte dort im Dunkeln eine Stecknadel fallen hören können, sollte die Tochter ein paar Seiten später sagen. Mit angehaltenem Atem warteten die Gäste auf das Zeichen, in eine tosende Gratulation auszubrechen, getaucht ins Licht der mit buntem Papier verkleideten Deckenlampe, und mit Luftschlangen und Konfetti, die sie hoch in die Luft werfen sollten, um sie auf den Mann herabregnen zu lassen. Aber dann, plötzlich, kurz bevor die Tochter das Zeichen geben kann, lässt der Mann mit der sozialen Phobie seine Anspannung entweichen. Er löst den Druck in seinem Bauch, der sich den ganzen Tag über in ihm angestaut hat, in dem farblosen Büro, in dem er arbeitet, Alba Cambó beschreibt diesen Druck als eine Art unterschwellige, unterdrückte Auflehnung gegen haferschleimfarbene Wände und kreidebleiche, leicht schweißglänzende Gesichter, wie sie typisch sind für sehr fettleibige Menschen, Menschen, die niemals an die frische Luft kommen, und Menschen, die sich ausschließlich von Würsten ernähren, falls es solche Menschen überhaupt gibt. Dem Mann entfleucht ein langgezogener Laut. Er hallt zwischen den Wänden wider, dehnt sich aus zu einer Art Klagen, das in das abendliche Krächzen eines Vogels an einem einsamen Bergsee übergeht und schließlich in einem erleichterten Seufzer verklingt. Die Tochter ist wie gelähmt. Alles gerät aus den Fugen. Es kommt kein Signal, auch wenn die Gratulation das Körpergeräusch in sich ertränken könnte. Im Flur breitet sich ein fauliger Abwassergeruch aus. Erst nach ein paar zähen Augenblicken (eine Zeit, die Cambó wie eine Ewigkeit erscheinen lässt) gibt die Tochter das Zeichen, und die Gäste legen los mit ihrer kunterbunten Gratulation. Doch die Glückwünsche sind halbherzig, verkümmert, voller Scham, Verlegenheit und Mitleid. Die jüngsten Mädchen der Verwandtschaft kichern unverhohlen, und die Gäste wissen nicht, wohin mit dem Blick. Es entsteht ein Gewirr aus verunsicherten Stimmen. Mit hochrotem Kopf steht der Mann an der Türschwelle, die Aktentasche wie einen Schutzschild vor die Brust gehalten. Er bittet seine Tochter, die Gäste sofort wegzuschicken, er wolle niemanden sehen, dann verschwindet er rasch ins Badezimmer, verriegelt die Tür und bleibt reglos auf dem Toilettendeckel sitzen, bis er die Wohnungstür hinter dem letzten Gast ins Schloss fallen hört. Die Geschichte endet damit, dass die Tochter eine Woche später den Leichnam des Mannes entdeckt. Er hängt an einem Dachbalken im Wohnzimmer, tot und steif, aber mit frisch polierten Schuhen, eine ziemlich idiotische letzte Mühe.
In der Zeitschrift stand, Alba Cambó habe für die Geschichte einen Preis bekommen, und in der Begründung der Jury sei von »Scham«, »Einsamkeit« und der »Befindlichkeit des modernen Menschen« die Rede gewesen. Die Preissumme habe sich auf tausend Euro belaufen, und in einem Interview erklärte Cambó, sie wolle mit dem Geld einen Garten anlegen, ein Vorhaben, das sie offensichtlich auf die lange Bank geschoben hatte, denn in den kommenden Monaten konnten wir auf ihrer Terrasse weder einen Garten noch eine erhöhte Anzahl an Blumentöpfen entdecken.
Ein paar Wochen nachdem wir die Geschichte über den einsamen Mann gelesen hatten, veröffentlichte die Semejanzas eine weitere Erzählung von Alba Cambó, und meine Mutter besorgte auch die neue Nummer. Diesmal ging es um die Entführung eines kleinen Jungen in Majadahonda, einem wohlsituierten Stadtteil von Madrid. Tage und Wochen wurde erfolglos nach dem Jungen gesucht, bis die Eltern schließlich einen Anruf von dem Entführer erhielten. Er verlangte ein Lösegeld. Eine Woche später wurde der Täter in einem Müllsack gefunden, brutal ermordet. Aus dem Obduktionsbericht ging hervor, dass man ihm bei lebendigem Leib die Arme abgetrennt hatte, außerdem zeigte die Leiche Anzeichen sexueller Gewalt. Der Junge wurde nie gefunden. Es war eine eigenartige Geschichte mit vielen losen Enden – warum hatte der Täter sich zu erkennen gegeben, und warum wurde dem Leser suggeriert, dass der Junge den Mann ermordet hatte, wo es doch genauso gut einen weiteren Täter gegeben haben konnte? War der Junge überhaupt noch am Leben? Auch auf diese Kurzgeschichte folgte ein Interview mit Alba Cambó. Sie sagte, der Unterhaltungswert eines geschändeten Frauenkörpers gelte in der Literatur als grenzenlos und unerschöpflich, und indem sie über geschändete Männerkörper schrieb, wolle sie deren Unterhaltungswert untersuchen. Etwas unbesonnen kam sie dem Journalisten mit der rhetorischen Frage zuvor, was denn falsch daran sei, über geschändete Männerkörper zu schreiben, wenn die Literatur sich andauernd über weibliche Körper hermache? Einige Schriftsteller, sagte sie, schrieben wie träge masturbierende Affen in überhitzten Käfigen. Sie schrieben, als hätten sie jeden Geschmack für echte Aromen verloren und müssten jede Menge Salz und Schweinefett ins Essen kippen, damit es überhaupt nach irgendetwas schmeckte. Vergewaltigte und ermordete Frauen, wohin man nur sah, als wäre das die einzige Möglichkeit, den Leser bei der Stange zu halten.
Der Herausgeber der Zeitschrift schien sich an der Sache mit den masturbierenden Affen festgebissen zu haben, denn über Albas Bild stand in fetten Buchstaben: Alba Cambó über träge masturbierende Affen. Es war kein besonders vorteilhaftes Foto. Man sah sie schräg von vorn und mit leicht geöffnetem Mund, was ihr einen beinahe zurückgebliebenen Ausdruck verlieh, obwohl Alba Cambó in Wirklichkeit keine hässliche Frau war. Meine Mutter meinte, weder das Bild noch der Text seien gelungen und Cambó sei mit ihren Aussagen übers Ziel hinausgeschossen. Wir einigten uns darauf, dass uns die erste Erzählung besser gefallen hatte. Meine Mutter verstaute beide Zeitschriften in einer Schublade in ihrem Schlafzimmer, in der sie Zeitungsausschnitte aufbewahrte, Todesanzeigen und andere Dinge, von denen sie meinte, sie würden uns etwas angehen.
Abgesehen von den Geschichten und Interviews schien Alba Cambó auf den ersten Blick nicht besonders interessant. Sie fügte sich nahtlos in die für unser Viertel typische Alltäglichkeit ein. Ihr Haar war verblichen und etwas spröde, sie war nicht mehr ganz jung und hatte meist zu viel Lidschatten aufgelegt. Ihre Stimme klang heiser, vermutlich vom Alkohol oder vom Rauchen, glaubte jedenfalls meine Mutter. Sie war nicht besonders freundlich und nie zu einem Gespräch aufgelegt. Sie brachte immer wieder andere Männer mit nach Hause. Einer von ihnen war groß und dunkelhaarig, und begegnete man ihm im Treppenhaus, grüßte er immer höflich. Ansonsten war auch er ziemlich einsilbig. Deshalb fiel es uns zunächst schwer, uns eine Meinung über Alba Cambó zu bilden. Doch da ihre Zimmerdecke unser Fußboden war, lag zwischen ihrem und unserem Leben lediglich eine wenige Dezimeter dicke Balkenlage. In der Zeit, nachdem wir die ersten beiden Geschichten gelesen hatten, sagte meine Mutter das oft. »Zwischen ihrem und unserem Leben liegen immerhin nur drei Dezimeter!«, platzte sie am Telefon heraus oder bei einem Glas Wein am Abend. Wenn Alba Cambó die Toilettenspülung betätigte, hörten wir es in den Rohren rauschen, und wenn sie etwas trank, bekamen wir mit, wie sie ihr Glas geräuschvoll in der Küche abstellte. Ich bin mir ziemlich sicher, meine Mutter machte sich noch mehr Gedanken über Alba Cambó, aber die vertraute sie mir nicht an, denn obwohl ich die beiden Kurzgeschichten gelesen hatte, eignete ich mich nicht in allen Angelegenheiten als Gesprächspartnerin. Dafür schien sie mit einigen ihrer Männerbekanntschaften über Alba zu sprechen, denn wenn hin und wieder einer von ihnen zum Abendessen vorbeikam, wurde es ganz still am Tisch, wenn das Klacken von Albas Absätzen zu uns heraufdrang. Meine Mutter und ihr Bekannter drehten sich dann zum Balkongeländer, wo ihr Blick hängenblieb, als würden sie sich Alba Cambó vorstellen, jeder auf seine Weise, und sich ausmalen, was sie dort unten wohl treiben mochte.
Das Haus, in dem wir damals wohnten und in dem ich auch jetzt noch schreibe, liegt in der Calle de Joaquín Costa unweit der U-Bahn-Station Universitat. Es hat zwei Etagen, ist irgendwann in den Vierzigern erbaut und seitdem nie saniert worden. Draußen auf der Straße stehen Platanen mit Stämmen in verschiedenen Grautönen, die aussehen, als hätten sie die Krätze gehabt. Die Kronen hingegen sind gesund, und das Laub ist im Frühling hellgrün, im Sommer wird es dunkler, und im Herbst changiert es in verschiedenen warmen Farben. In den Wintermonaten sind die Platanen kahl, aber da die Winter in Barcelona kurz und mild sind, färben die Baumkronen sich schon bald wieder hellgrün. Die Blätter wiegen sich im Wind, der morgens vom Meer heranweht und nach Seetang und Salz riecht. An manchen Tagen liegt auch ein leichter Ölgeruch in der Luft, der vermutlich vom Hafen kommt. Schon damals ist unser Balkon wie eine Oase für uns gewesen, und meine Mutter verbrachte jeden freien Vormittag und Abend dort. Sie hatte dort einen Sprossenstuhl und einen kleinen runden Tisch, auf dem sie, wenn sie rauchte, ihr Weinglas abstellte. Von dort oben konnten wir auf die Terrasse im Erdgeschoss herabblicken, die unter unserem Balkon ein Stück hervorragte.
Unsere Wohnung war von außen schöner als von innen. Im Schlafzimmer meiner Mutter war die Decke von Feuchtigkeitsflecken übersät. Mein Zimmer war klein, und die hohen Wände gaben einem das Gefühl, in einer Konservendose zu schlafen. Das einzige Fenster ging zum winzigen Innenhof hinaus, der im Grunde nur als Abstellplatz für die Mülltonnen und als Lichtschacht diente und dessen Mauern noch nie einen frischen Anstrich bekommen hatten. Meine Aussicht bestand also aus einer ebenen aschgrauen Fläche, die an Klebegummi oder zerkautes Papier erinnerte. Im ganzen Haus hing ein Geruch, von dem ich damals dachte, er sei Häusern eben zu eigen, bis mir aufging, dass er vom Schimmel kam. Obwohl der Müll jeden Abend abgeholt und der Innenhof regelmäßig desinfiziert wurde, ließ das Ungeziefer sich nie so richtig vertreiben. Es gab mehrere Zentimeter lange rote Küchenschaben, die mit ihren Flügeln halbherzig in der Luft herumschwirrten. Putzte man sich im Bad die Zähne, konnten sie urplötzlich auf dem Türrahmen landen, wo sie sich in aller Ruhe die langen rotbraunen Fühler säuberten. Am schlimmsten war die Schaben-Invasion im Hochsommer, zum Herbst hin ebbte sie allmählich ab. Einmal erzählte meine Mutter von einem baskischen Schriftsteller, bei dem sie gelesen hatte, man könne die Schaben nicht mehr töten, sobald man ihnen einen Namen gab. Sie versuchte es und taufte eine Schabe José Maria. Tatsächlich brachte sie es danach nicht übers Herz, ihn totzutrampeln, und schon bald krochen in den warmen Sommernächten Dutzende José Marias durch unsere Wohnung. Einmal, als ich nachts zur Toilette musste, trat ich auf einen. Angewidert vom Gefühl des zappelnden Körpers unter meiner Fußsohle, beschloss ich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Als meine Mutter über Nacht bei einem ihrer Freunde war, ging ich zum Angriff über, mit einem Insektenspray, das ich mir beim Chinesen an der Ecke besorgt hatte. Ich knipste das Licht an, rückte das Sofa ein Stück ab und sprühte drauflos. Dann beobachtete ich, wie die Schaben auf dem Fußboden lagen und starben, die Beine wie schwarze Windmühlenflügel von sich gestreckt. Als ich die Kadaver zusammenkehrte, spürte ich den Anflug eines schlechten Gewissens, da vermutlich irgendwo dazwischen auch José Maria lag. Doch es kamen neue José Marias, wie aus einer nie versiegenden Quelle, sodass meine Mutter ihren toten Freund nicht vermissen musste.
Es gab auch Maden im Haus, doch die bekamen keine Namen von meiner Mutter. Gegen Maden könne man so gut wie nichts ausrichten, meinte unser Hausmeister, weil sie ihre Eier direkt ins Mauerwerk legten. Sie waren überall, und wir fanden ihre Puppenhüllen in Mehl- und Reispackungen und bei den Brotresten. Mit der Zeit verwandelten sie sich in mottenartige Tierchen, die vom Licht angezogen wurden. Manchmal waren sie eine ganze Weile verschwunden, aber dann, wenn wir gerade auf dem Balkon oder im Wohnzimmer beim Abendessen saßen und uns angeregt unterhielten, oder meine Mutter vielleicht mit jemandem eine Flasche Wein trank, kam plötzlich eins der Flügeltierchen durch die Luft geschwirrt, als wollte es uns daran erinnern, dass das Madennest wohlauf war und der Müllverschlag nie wirklich sauber werden würde.
Wenn einer der Freunde meiner Mutter den Zustand unserer Wohnung kommentierte (sie meinten zum Beispiel, die Wohnung sei zwar schön, aber ziemlich, wenn nicht sogar dringend, renovierungsbedürftig), verglich meine Mutter sie mit einem sinkenden Schiff. Kaum hatte man das eine Leck abgedichtet, tat sich auch schon das nächste auf.
»Und eines schönen Tages«, sagte sie dann, »wird alles überflutet, und dann sinken wir.«
Manchmal machte sie auch Witze über den schlechten Zustand unserer Wohnung und nannte sie »unsere Burg, unser Grab und vielleicht auch unser Mausoleum«. Die Männer lachten dann ungläubig. Wahrscheinlich dachten sie, meine Mutter hätte trotz allem einen Plan in der Hinterhand und jeden Moment würden ein paar Handwerker vorbeikommen, den Putz abklopfen, den Fußboden aufreißen und die feuchten Decken bearbeiten. Und wahrscheinlich dachten sie im Stillen, meine Mutter bräuchte dringend einen Mann, und vielleicht malten sie sich dann einen Moment lang aus, wie es wäre, mit uns zusammenzuleben, wie lange sie von unserer Wohnung zur Arbeit bräuchten, wo sie ihren Computer und ihre Regale hinstellen würden, was eine vorzeitige Kündigung ihrer Hypothek kosten würde und ob sie hier vielleicht endlich das Buch schreiben könnten, das sie schon immer hatten schreiben wollen, im Austausch gegen eine helfende Hand und ein bisschen maskulines Flair – Gedanken, die kurz vorbeiflackerten, um sich schon im nächsten Moment in Luft aufzulösen. Aber keiner von ihnen ergriff je die Initiative, und ich glaube, sie taten gut daran, sich von uns fernzuhalten. Ging es einem um finanzielle Sicherheit, waren wir eine schlechte Partie. Mit dem Verwaltungsjob meiner Mutter kamen wir gerade mal so über die Runden. Wir ernährten uns von Suppen aus Karotten, Kartoffeln und Kichererbsen. Fleisch gab es – wie früher in den Arbeiterfamilien – immer nur sonntags. Meine Mutter ließ ihre Suppen und Eintöpfe meist über Stunden vor sich hin köcheln, weil in ihren alten Kochbüchern stand, selbst die einfachsten Zutaten ergäben eine schmackhafte Mahlzeit, wenn man sie nur lange genug kochen ließ. Der Essensgeruch kroch bis in die hinterste Ecke unserer Wohnung, aber am schlimmsten war, dass er sich auch in unserer Kleidung festsetzte. Wenn ich draußen unterwegs war, stieg mir manchmal der Geruch verkochten Essens in die Nase. Woher kommt dieser Mief?, dachte ich dann, das stinkt wie eine alte moderige Decke!, bis ich verstand, dass der Gestank von mir ausging. Aber trotz allem lag auch ein gewisser Stolz darin, auszuharren, sein Kreuz zu tragen, sich vorzustellen, man wäre die Larve in der Puppe, im Moment noch eingesperrt, aber irgendwann, eines schönen Tages!, würde man die Flügel ausbreiten und davonfliegen, und alles würde ganz anders werden. Wie genau, konnte man sich vielleicht noch nicht vorstellen, aber das war egal – Hauptsache, anders, das war das Wichtigste. Und bis dahin versuchte man, das Beste aus dem zu machen, was man hatte. Und hatte man nichts, machte man auch daraus das Beste.
Wir waren weiterhin neugierig auf Alba Cambó, die noch mehr Geschichten in der Semejanzas veröffentlichte. Ein paar waren richtig brutal, und meist ging es um Gewalt, die von Frauen und Kindern gegen Männer ausgeübt wurde. Ein Freund meiner Mutter, ein Psychologe, der an der Complutense in Madrid unterrichtete, meinte, Alba Cambós Erzählungen seien naturwidrig und gründeten auf falschen Annahmen über die menschliche Psyche im Allgemeinen und die männliche Psyche im Besonderen. Das mit der Psyche konnten wir nicht beurteilen. Wir kauften jedenfalls jede neue Nummer und verwahrten sie in der Schublade mit den Zeitungsausschnitten. Ich glaube, Cambó bekam noch mehr Preise, die wiederum zu ausgelassenen Festen auf ihrer Terrasse führten, wo gekifft, gesungen und gelacht wurde, während wir lauschend im Halbdunkel unseres Balkons saßen. Albas ausschweifendes Leben setzte sich bis spätnachts fort, sie kam erst im Morgengrauen nach Hause und schlief immer lange.
»Eine richtige Frau mit einem richtigen Leben«, sagte meine Mutter einmal, und in ihrer Stimme schwang unüberhörbar ein Anflug von Neid mit.
Dass Alba Cambó nicht allein in der Wohnung unter uns lebte, begriffen wir erst ein paar Tage nach ihrem Einzug. Auf ihrem Namensschild am Briefkasten im Hausflur stand nun: Alba Cambó Altamira und Blosom Gutierrez Gafas. Noch am selben Abend sahen wir Blosom zum ersten Mal. Sie hatte schöne schwarze Haut, war ziemlich groß und wirkte reserviert. Meine Mutter meinte, Blosom kümmere sich wahrscheinlich um Albas Haushalt, denn ihrem Akzent nach zu urteilen, kam sie aus Zentralamerika. Blosom war genauso einsilbig wie Alba Cambó. Begegnete man ihr auf der Straße, grüßte sie nicht. Stattdessen marschierte sie an einem vorbei, und ihr Gesichtsausdruck schien zu sagen: »Ich sehe dich, aber ich denke gar nicht daran, dich zu grüßen, wir kennen uns doch überhaupt nicht.« Wegen ihrer erhabenen, aufrechten Haltung (meine Mutter fand, Blosom stolziere wie ein Pfau daher) traute man sich nicht, den ersten Schritt zu machen und sie anzusprechen. Doch eines Tages kam meine Mutter beim Gemüsehändler mit ihr ins Gespräch. Ich wusste nicht, worüber sie gesprochen hatten, doch als meine Mutter zurückkam, war nicht mehr Alba das Objekt ihrer Neugierde, sondern Blosom. Während sie in der Küche die Espressokanne zusammenschraubte und Tassen und Zucker aus dem Schrank holte, erklärte sie, Alba zu beobachten sei uninteressant, sie sitze ja nur mit Stift, Papier und gerunzelter Stirn auf ihrer Terrasse herum. Ihre einzige – und für einen potenziellen Beobachter ziemlich unspektakuläre Aktivität – bestehe darin, hin und wieder ihre Kaffeetasse anzuheben und einen Schluck zu trinken. Blosom hingegen hatte immer etwas zu tun. Sie summte, deckte den Tisch, kümmerte sich um die Topfpflanzen und lachte über Dinge, die sie aus dem Radio oder Fernseher im Wohnzimmer aufschnappte. Langsam und gemächlich schleppte sie ihren Körper durch die Hitze, befreite Albas Pflanzen von verwelkten Blättern und wässerte sie mit dem Gartenschlauch, aber erst nach Sonnenuntergang, damit sie – wie die Frauen unseres Viertels immer sagten – in den heißen Tagesstunden nicht vom Wasser verbrannt wurden. Manchmal hantierte sie mit einer Gartenschere herum, sie verrückte Albas Blumentöpfe, brachte leere Weingläser in die Küche und füllte Wasser in den kleinen Brunnen, den Alba an einer Mauer angebracht hatte. Meine Mutter meinte, Blosom habe sich angewöhnt, im Vorbeigehen rasch die Finger in den Brunnen zu tauchen und sich dann zu bekreuzigen – eine über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte einstudierte Geste, wie ein Reflex, und wir fragten uns, welcher Religion Blosom eigentlich angehörte. Die Art, wie sie sich bekreuzigte, wirkte irgendwie steif, so steif wie ein antrainiertes Bewegungsmuster, das nicht richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Tagsüber lauschte meinte Mutter manchmal, wenn Blosom sich beim Wäscheaufhängen mit Alba unterhielt. Sie wirkten dann wie zwei miteinander plaudernde Freundinnen oder Schwestern, und mit geschlossenen Augen konnte man nicht sagen, wer die Chefin und wer die Hausangestellte war. Wenn meine Mutter näher ans Geländer heranschlich, sah sie, wie Blosom sich über den Wäschekorb beugte, ein Kleidungsstück oder ein Bettlaken herausnahm, sich wieder aufrichtete und es an der Wäscheleine befestigte. Beugte sie sich dann wieder hinab, spannte ihr von Schweiß ganz feuchter Rock über dem großen runden, weichen Po. »So einen Hintern hab ich im Leben noch nicht gesehen!«, sagte meine Mutter. Manchmal stellte sie sich vor, der Stoff würde jeden Moment aufreißen und Blosoms Pobacken würden herausquellen. Sie konnte es förmlich vor sich sehen, Blosoms riesige, durch die Risse quellenden Pobacken, doch wie um sich zu verteidigen, erklärte meine Mutter, das sei keine schamlose Phantasie, sondern der einzige Gedanke, der einem Betrachter dieser Szenerie durch den Kopf gehen konnte. Beim Anblick einer so phantastischen, formvollendeten Körperlichkeit.
Die echten Begegnungen zwischen meiner Mutter und Blosom sollten sich schon bald in die Nächte verlagern – wenn man überhaupt von echten Begegnungen sprechen konnte. Sobald die Tür hinter Alba ins Schloss gefallen war, kümmerte Blosom sich um das dreckige Geschirr vom Abendessen. Sie ging dann zwischen Terrasse und Küche hin und her, und man hörte sie Teller und Schüsseln ineinanderstapeln. Wenn sie damit fertig war, kam sie wieder nach draußen und setzte sich mit einem Glas Wein auf die Terrasse. Zuerst rieb sie sich mit einem feuchten Handtuch den Nacken und die Arme und keuchte, als hätte sie eine lange Strecke zurückgelegt. Dann entspannte sie sich. Ihre kräftigen Arme hingen ihr am Körper herab, ihr Bauch wölbte sich, und ihr Blick verlor sich in den Fenstern im Haus gegenüber. Meine Mutter konnte von ihrem Stuhl aus erkennen, wie nur wenige Meter unter ihr Blosoms zerzauste schwarze Haare vom Kopf abstanden. Sie saß dann immer ganz still da, aus Angst, Blosom könnte denken, sie spioniere ihr nach. So ging es dann eine halbe Stunde, eine Stunde, manchmal länger. Meine Mutter überlegte, ob Blosom vielleicht eingeschlafen war. Aber dann stand Blosom ganz unvermittelt auf, griff nach ihrem leeren Glas und ging hinein, was meine Mutter dann ebenfalls tat.
Unsere Kleider kauften wir damals auf dem Markt in Poblenou. Warum wir bis nach Poblenou fahren mussten, weiß ich nicht, bei uns in der Nähe hätten wir auch billige Klamotten gefunden, aber meine Mutter wollte unbedingt nach Poblenou. Wir fuhren frühmorgens los, ehe ich zur Schule und meine Mutter zur Arbeit musste, und drängten uns dann auf der Suche nach Schnäppchen mit den Hausfrauen und Haushälterinnen des Viertels vor den Bergen aus zweitklassiger Unterwäsche, Röcken und Daunenjacken. Hatte man etwas Brauchbares gefunden, musste man an dem Kleidungsstück zerren und den Leuten, die ebenfalls daran zerrten, finstere Blicke zuwerfen. Auf diese Weise wurden auf dem Markt in Poblenou stille Schlachten um beige Schlüpfer und fleischfarbene BHs ausgefochten. Auf dem Rückweg hielten wir manchmal an der Tankstelle unseres Viertels. Meine Mutter machte immer nur den Reservetank voll. Ich glaube, das sagte einiges über unser Leben aus, denn ist ein Reservetank noch ein Reservetank, wenn er der einzige ist, den man hat?
Manchmal sagten wir: Wir sehnen uns fort von hier, weg von diesem Leben und diesem Haus. Wir sind Nomaden und nicht dafür gemacht, zwischen vier Wänden zu hausen, eingesperrt zu sein und unser Leben auf neunzig Quadratmetern zu verbringen. Als wir diese Gedanken später mit Alba Cambó teilten, meinte sie, ja, das sei wahr, man müsse sich in Acht nehmen vor Häusern, denn ihre Hauptaufgabe bestehe darin, den Verrottungsprozess ihrer Bewohner intakt zu halten. Deshalb täten die Leute gut dran, rauszugehen und frische Luft zu atmen. Wer sich zwischen vier Wänden einsperren ließe, meinte Cambó, der kultiviere den Schimmel in seinem Innern. »Ja«, sagte meine Mutter dann. »Vielleicht gehen wir eines Tages von hier weg, vielleicht wandern wir aus.« »Worauf wartet ihr dann noch?«, fragte Alba Cambó. »Keine Ahnung«, antwortete meine Mutter, »vielleicht darauf, dass Aracelis Vater zurückkommt.« Cambó lachte. »Unsinn!«, rief sie. »Ihr wartet auf keinen ollen Vater, ihr wartet auf Godot, wie alle anderen auch!«
Kein Vater also, und trotzdem: An stellvertretenden Vätern hat es mir nie gefehlt. Nur dass meine Väter Eintagsväter waren, die plötzlich auftauchten und nach höchstens drei Tagen wieder verschwunden waren. Manche von ihnen hinterließen Spuren, eine militärgrüne Zahnbürste im Badezimmer, einen Inhalator, ein Buch auf einem Nachttisch, und manchmal ließen diese Spuren einen hoffen, die Männer würden eines Tages wiederkommen, und in dem Moment, in dem sie unsere Wohnungstür öffneten, würde ihnen schlagartig klar werden, dass es ein bisschen so war, als kämen sie nach Hause, sie hatten ja alles hier – ein Haus, eine Frau, ein Kind –, sie müssten einfach nur eintreten und anfangen zu leben. Ich schrieb in meinem Tagebuch über die Männer, und weil ich ihre Namen mit der Zeit kaum noch auseinanderhalten konnte (Valerio, Enrique, Alvaro, José María), nannte ich sie stattdessen »der Jogginghosenmann«, »der Gluckskichermann« und »der Tatarmann«, und da hatte ich sofort ihr Bild vor Augen.
Der »Tatarmann« zum Beispiel hatte sich einmal ein Steak Tatar auf unserem Balkon zubereitet. Ich hatte noch nie von so einem Steak Tatar gehört, bis er mit theatralischer Miene erklärte, so etwas äßen die feinen Bohemiens in Paris. Die wahren Gourmets, die ihre Geschmacksknospen noch nicht durch angebranntes Fleisch und Röstzwiebeln verdorben hätten. Er fischte die Zutaten aus einer Tüte und bereitete das Tatar vor unseren Augen zu. Die