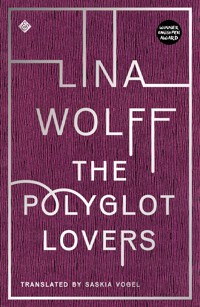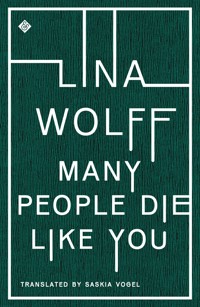10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein hochkomischer und tiefgründiger, wilder und wichtiger Roman." Dagens Nyheter Ein verlassener Mann, der für das gebrochene Herz seiner Frau sein eigenes Herz opfern soll. Eine eigensinnige Nonne, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, alle verratenen Frauen zu rächen. Und eine Schriftstellerin mit Schreibblockade auf der Suche nach Sinn – und einer guten Geschichte. In "Das neue Herz", in Schweden als "Post-metoo-Roman" gefeiert, nimmt Lina Wolff das Patriarchat und den Feminismus gleichermaßen aufs Korn und stellt unsere Vorstellungen von Liebe und Macht, Schuld und Vergebung auf den Kopf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lina Wolff
Das neue Herz
Roman
Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat
Hoffmann und Campe
Wenn ihr jenes in euch hervorgebracht habt, wird euch das, was ihr habt, retten. Wenn ihr jenes nicht in euch habt, wird das, was ihr nicht in euch habt, euch umbringen.
Evangelium nach Thomas
Mercuro
Die Maschine geht in den Sinkflug über, und sie blickt hinaus über sandfarbene Hochhäuser und das hügelige Hinterland, das staubtrocken ist, karg wie eine Mondlandschaft. Sie kommt nicht zum ersten Mal her. Vor vielen Jahren hat sie lang genug in der Stadt gelebt, um etwas über deren Seele zu lernen. Die Stadt ist wie ein gezähmtes Raubtier, wie eine vor sich hin schwelende Glut. Man sollte stets auf der Hut sein und beim Schlafen ein Auge offen halten. Für das Geld hätte man ihr genauso gut ein Aufenthaltsstipendium für Barcelona, San Sebastián oder Valencia geben können, am Meer wären die Sommermonate erträglicher. Aber wie heißt es so schön? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Außerdem ist man selbst ja gewissermaßen auch ein geschenkter Gaul.
Über den Lautsprecher verkündet der Flugbegleiter den Landeanflug auf Madrid, die Temperaturen lägen bei neunundzwanzig Grad. Sie zurrt den Sicherheitsgurt fest, lehnt sich zurück und schließt die Augen, bis die Maschine endlich auf dem Boden aufsetzt.
Das Apartment, in dem sie wohnen wird, liegt im Barrio de Goya. Fünf Räume, an einer Seite eines schlauchförmigen Flurs aufgereiht, das Zimmer gleich am Eingang könnte sie für Gäste benutzen, dahinter folgen Küche, Bad, Wohn- und zuletzt das Schlafzimmer. Sie trägt ihren Koffer hinein und inspiziert alles, während die Eigentümerin wartet und ungeduldig mit den Fingern auf den Türrahmen trommelt.
»Die Nachbarn sind sehr empfindlich, ich wäre Ihnen dankbar, wenn es nicht allzu wild zugeht. Manche Stipendiaten haben hier Partys bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.«
»Keine Sorge. Ich bin fünfundvierzig, solche Partys feiere ich schon lange nicht mehr.«
Nachdem die Formalitäten erledigt sind, geht sie zum nächsten großen Kaufhaus, El Corte Inglés, um eine Flasche Wein zu kaufen. Auf diese Weise läutet sie jeden Spanienaufenthalt ein. Die meisten Touristen zieht es als Allererstes an den Strand oder – wenn sie in Madrid sind – in ein Restaurant oder eine Bar, wo sie sich bei einem Mojito entspannen, die Atmosphäre genießen und irgendwas in ein Moleskine-Notizbuch schreiben – aber sie trinkt lieber Wein und sieht fern. Mit einem Glas in der Hand versinkt sie zwischen den weichen Kissen auf dem Sofa. So verbringt sie den Rest des Abends. Leicht dösig zurückgelehnt, während aus dem Fernseher ein Strom von Stimmen auf sie einrieselt, Nachrichten, venezolanische Telenovelas, kunterbunte Klatschprogramme.
Kurz nach Mitternacht weckt sie ein kühler Luftzug, der durchs offene Fenster hereinweht. Sie hält immer noch das Weinglas in der Hand, und im Mund hat sie einen Geschmack von alten Rohren, vermutlich vom Leitungswasser, das sie getrunken hat. Das Stimmengewirr, das aus den umliegenden Bars heraufdringt, ist jetzt lauter als zuvor. Sie steht auf, geht zum Fenster und lässt den Blick über die Plaza schweifen. Da unten ist es, denkt sie. Das Leben. Sie beschließt auszugehen, und als sie auf die Straße tritt, schlägt ihr das Pulsieren der Madrider Nacht entgegen.
Sie weiß noch gut, wie es damals war, vor fast zwanzig Jahren, als sie hier studiert hat und an einem Tagesrhythmus teilhatte, der vorsah, nie vor zehn zu Abend zu essen und anschließend unbedingt auszugehen. Wann schlief sie eigentlich? Sie kann sich nicht daran erinnern, in Madrid je geschlafen zu haben, aber müde war sie trotzdem nie.
Sie betritt ein Lokal mit Buntglasfenstern und dunklem Holzmobiliar, setzt sich an die Bar und bestellt ein Glas Cava. Nach einer Weile bemerkt sie einen Mann am anderen Ende der Theke. Er fällt ihr aus mehrerlei Gründen auf. Zum einen ist er allein und schielt nervös zu den anderen Gästen hinüber, und zum anderen scheint er trotz voll aufgedrehter Klimaanlage übermäßig zu schwitzen. Sie muss ihn einen Moment zu lang angesehen haben, denn plötzlich bleibt sein Blick an ihr hängen. Unwillkürlich senkt sie den Kopf. Sie ist keine, die in eine Bar geht, um Kerle aufzureißen, und wenn sie es doch tun würde, dann sicher nicht einen Typen wie ihn. Aber der Stein ist längst ins Rollen gebracht, der Mann steht auf, nimmt sein Glas und kommt auf sie zu. Ihr ist klar, dass sie sich nicht mehr unauffällig davonstehlen kann. Als er bei ihr ankommt, fragt er, ob er sich setzen dürfe, seine Stimme klingt halb erstickt, wie bei jemandem, der nur selten spricht. Sie antwortet nicht, aber er zieht bereits einen Hocker zurück und nimmt darauf Platz. Dann dreht er sich zu ihr und streckt ihr seine Hand entgegen.
»Mercuro Cano«, stellt er sich vor.
Sie sagt ihren Namen. Dann sitzen sie erst einmal schweigend da. Nach einer Weile beschließt sie, sich doch lieber eine andere Bar zu suchen. Aber als sie aufstehen will, fragt der Mann:
»Sie gehen schon? Wir haben uns doch noch gar nicht richtig unterhalten.«
In seinem Tonfall schwingt aufrichtige Verwunderung mit, zutiefst menschliche Fassungslosigkeit, sodass sie auf den Hocker zurücksinkt. Aus dem Augenwinkel registriert sie, wie er ein Taschentuch hervorangelt und sich die Stirn abtupft.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt sie.
»Nein. Ehrlich gesagt ist gar nichts in Ordnung.«
Er reibt sich mit dem Finger unter der Nase, als wollte er eingetrockneten Rasierschaum entfernen oder Pulverreste, die sich dort verfangen haben.
»Ich müsste mich einfach mal ein bisschen mit jemandem unterhalten«, sagt er. »So tun, als wäre in meinem Leben noch irgendwas normal. Und wenn’s nur ein paar Minuten sind.«
Na schön, denkt sie. Schließlich hat sie sich vorgenommen, den Aufenthalt auch dafür zu nutzen, ein paar Leute kennenzulernen. Sie darf sich nicht verschließen, sobald jemand auf sie zugeht.
»Okay«, sagt sie.
Der Mann nickt erleichtert.
»Was machen Sie beruflich?«, fragt er.
»Ich schreibe.«
»Ah, Sie schreiben. Und was?«
»Artikel und Kolumnen, für eine Lokalzeitung.«
»Wohnen Sie hier in Madrid?«
»Ich bin mit einem Aufenthaltsstipendium hier«, antwortet sie. »Drei Monate mit allem Drum und Dran, nur für die Verpflegung muss ich selber sorgen.«
»Meine Gratulation.«
Es gebe nichts zu gratulieren, erklärt sie. Hätte man sie gefragt, hätte sie sich für eine andere Stadt entschieden. Sie habe mal eine Weile in Madrid gelebt und wisse, welch Irrsinn es sei, zwischen Mai und August herzukommen. Irgendwo im Landesinnern – in Granada? – seien die Temperaturen schon auf zweiundvierzig Grad geklettert. Die Hölle auf Erden. Sie spricht schnell, so wie damals, und freut sich, dass ihr Spanisch nicht eingerostet ist.
»Also, wo kommen Sie her?«, fragt der Mann.
»Aus Schweden.«
Er nimmt einen Schluck von seinem Drink.
»Schweden«, sagt er. »Das Männerhasserinnenland.«
»Wie meinen Sie das?«
»Na, Ihre Heimat scheint voller Männerhasserinnen zu sein.«
»Ich verstehe nicht.«
»Ich hab gelesen, dass –«
Sie bringt ihn mit einer abwehrenden Handbewegung zum Schweigen.
»Also, ich wollte hier eigentlich nur ein Glas Wein trinken und ein bisschen abschalten«, sagt sie. »Wenn Sie mich bitte entschuldigen.«
Sie leert ihr Glas in einem Zug.
»Sind Sie Feministin?«, fragt er.
»Haben Sie mir nicht zugehört?«
»Ehrlich, es interessiert mich.«
»Warum?«
»Weil ich verstehen will, warum ihr da oben eure Männer hasst.«
»Also wirklich –«
»Dieser Hass, diese Erbitterung«, sagt er, »diese Fluten des Zorns … Warum?«
Er funkelt sie grimmig an, aber sie hält seinem Blick stand. Nach kurzer Zeit beginnt seine Hand zu zittern, ein seltsamer Kontrast zu seinem trotzigen Gesichtsausdruck. In der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in seinem Glas klirren die Eiswürfel.
»Was ist los?«, fragt sie. »Warum zittern Sie?«
Er senkt den Blick und umklammert das Glas so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortreten. Als die Eiswürfel nach einer Weile ruhig an der Oberfläche schwimmen, starrt er so leer vor sich hin, als hätte er das Gespräch schon vergessen. Doch gerade als sie aufstehen und sich davonstehlen will, blickt er auf, packt sie am Arm und sagt:
»Tut mir leid.«
»Was?«
»Was ich eben gesagt hab.«
Sie zuckt mit den Schultern, löst ihren Arm aus seinem Griff.
»Verzeihen Sie mir?«, fragt er.
»Was meinen Sie?«, fragt sie. »Ist mir doch egal, was Sie denken. Sie gehen gleich zu sich nach Hause, ich gehe zu mir nach Hause, und dann sehen wir uns nie wieder. So einfach ist das.«
»Aber das ist ja das Problem«, sagt er. »Ich wünschte, es wäre anders.«
»Jetzt komme ich nicht mehr mit«, sagt sie. »Erst beleidigen Sie mich, und jetzt habe ich den Eindruck, Sie kommen gleich mit einer Liebeserklärung um die Ecke.«
»Eine Liebeserklärung?« Er lacht. »Nein, keine Angst. Ich hab in meinem Leben nur eine Frau geliebt – nämlich meine Frau. Soledad Ocampo und keine andere. Ich würde alles dafür tun, sie wieder an meiner Seite zu haben.«
»Aha. Und warum sitzen Sie dann hier und quatschen eine Wildfremde an?«
»Das ist eine lange Geschichte. Es fing mit dem Üblichen an. Ein bisschen Langeweile, ein bisschen Untreue. Same old. Aber als ihre Krankheit schlimmer wurde, haben wir dann diese Therapie angefangen.«
»Was für eine Krankheit?«
»Ein angeborener Herzfehler.«
»Und hat sie geholfen?«
»Wer?«
»Die Therapie?«
»Ob die Therapie geholfen hat?«, sagt er und blickt sie resigniert an. »Nein. Im Gegenteil.«
»Das tut mir leid. Manchmal funktioniert so was ja.«
»Sie verstehen nicht!«, sagt er kopfschüttelnd. »Das war keine normale Paartherapie! Diese Therapie war die Hölle.«
»Die Hölle?«
Jetzt ist ihr Interesse geweckt. Sie liebt solche Geschichten. Davon zu hören, wie andere Menschen Probleme gemeistert haben, an denen sie selbst verzweifelt ist, oder festzustellen, dass es ein paar seltene Situationen gab, in denen sie selbst etwas geschafft hat, woran andere gescheitert sind. Sie will mehr hören, aber der Fremde starrt schon wieder in sein Glas. Vielleicht steckt das Gespräch doch in einer Sackgasse. Sie steht auf.
»¡Adiós!«, sagt sie. »Ich hoffe, Ihre Frau und Sie finden eine Lösung. Alles Gute.«
»Warten Sie!«, sagt er und greift erneut nach ihrem Arm. »Bitte, gehen Sie nicht!«
»Was denn noch?«, fragt sie kühl.
»Ich brauche Hilfe.«
»Hilfe? Womit?«
»Ich brauche für ein paar Tage ein Dach überm Kopf.«
»Ein Dach überm Kopf? Für ein paar Tage? Bei mir? Verarschen Sie mich jetzt?«
Sie kann das Lachen nicht unterdrücken. Er feuchtet die Lippen an und wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagt er. »Sie lassen mich ein paar Tage bei sich wohnen. Und im Gegenzug erzähle ich Ihnen von besagter Paartherapie und der Frau, die mein Leben ruiniert hat. Nennen wir sie die Feministin. Bestimmt ist das eine spannende Geschichte für jemanden wie Sie.«
Sie versteht nicht, wie er das meint.
»Wer soll das sein? Diese ›Feministin‹?«
»Schwester Lucia.«
»Schwester Lucia? Eine Nonne?«
»Eine Nonne!«, ruft er. »Genau! Stellen Sie sich eine Frau vor, die stark wie ein Zuchtbulle und niederträchtig wie Hitler ist. Fügen Sie dann noch einen guten Schuss Männerhass und ein paar Tropfen destillierte weibliche Bitterkeit hinzu et voilà – Schwester Lucia.«
Sie versucht, seine Beschreibung zu visualisieren.
»Sie ist klein und zierlich«, fährt er fort, »wie ein Kind. Aber steinalt. Es gibt nichts, was sie nicht gesehen oder getan hat, und sie weiß genau, wie … Ach, und ihre Hand ist verstümmelt. Angeblich wurde sie von einem Schwein angegriffen.«
Sie starrt ihn ungläubig an. Die Beschreibung ist grotesk. Andererseits, denkt sie, weiß jeder schreibende Mensch, dass an der Floskel »die Wirklichkeit übertrifft die Dichtung« durchaus etwas dran ist. Eine bösartige Nonne mit verstümmelter Hand – so eine Geschichte könnte interessant werden.
»Verstecken Sie mich!«, fleht der Mann. »Nur für ein paar Tage. Sie werden es bestimmt nicht bereuen.«
Im ersten Moment erscheint ihr der Plan völlig verrückt. Aber letztlich ist auch der verrückteste Plan ein Plan, und vielleicht kann sie seine Geschichte in einer Kolumne verwerten. Sie erklärt, sie werde eine Nacht über die Sache schlafen und ihm morgen ihre Entscheidung mitteilen. Darauf gibt er ihr seine Nummer. Schließlich geht sie nach Hause und schläft bei offenem Fenster. Draußen lauert die Nacht. Sie hat wirre Träume von fremden Männern in Bars und Nonnen mit gummibesohlten Halbschuhen, die zur Wolfsstunde durch Madrid pirschen und nach etwas suchen, aber wonach, lassen die Träume im Ungewissen.
Am Morgen wird sie vom Licht geweckt. Sie hat vergessen, die Fensterläden zu schließen, und da die Wohnung keine Klimaanlage hat, ist ihr Bettlaken nassgeschwitzt. Sie steht auf und geht kalt duschen. Tagsüber wird sie es in der Wohnung nicht aushalten können, das wird ihr jetzt klar. Sie sollte sich ein schattiges Plätzchen im Freien suchen, vielleicht an einem Pool. Nicht dass sie sonst solche Angewohnheiten hätte. Aber in Spanien ist eben alles etwas anders. In der Küche findet sie eine Kaffeedose und einen Espressokocher, und als sie sich mit einer Tasse an den Küchentisch setzt, lässt sie den gestrigen Abend Revue passieren. Bei Tageslicht nimmt alles neue Formen an, erscheint surreal. Saß sie wirklich mit einem Mann in einer Bar, der behauptete, er werde von einer Nonne gejagt? Sie schüttelt den Kopf. Spanien, denkt sie. Alles verschiebt sich, das muss an der Hitze liegen. Sie packt ihre Badetasche und macht sich auf den Weg zu einem club social im Viertel Arturo Soria. Für einen Liegestuhl im Schatten blättert sie zwanzig Euro hin. Dann liegt sie da und wartet darauf, dass sich ein Gefühl der Freude einstellt. Ein Gefühl, das davon zeugt, dass der endlose schwedische Winter sie nicht endgültig aufgezehrt hat. Die Freude am Neuen. An der Sonne. Vielleicht sogar am Schreiben. Die Freude daran, an einem anderen Ort zu sein, in eine andere Sprache einzutauchen, die Freude an den Gerüchen aus der Restaurantküche, am Wasserplätschern – die Freude an irgendetwas. Aber sie empfindet keine Freude, dort auf dem Liegestuhl, sie fühlt sich wie ein tropfnasses Wollknäuel, das nicht mal in der prallen Sonne trocknet.
Nach einer Weile horcht sie auf, als Sonnenliegen geräuschvoll über den Steinboden gezerrt werden. Gleich neben ihr räumt ein Grüppchen Platz für einen Rollstuhl frei. Eine Frau um die sechzig kommandiert zwei Männer herum, die wie Bodybuilder aussehen und den Anweisungen folgen. In dem Rollstuhl sitzt ein Mann, der im selben Alter wie die Frau sein dürfte. Er wirkt abwesend und starrt mit offenem Mund vor sich hin. Von seinem Kinn baumelt ein Speichelfaden herab, und die Frau wendet sich immer wieder zu ihm um und wischt den Speichel weg. Eine Geste wie ein über viele Jahre hinweg verinnerlichter Reflex. Die Frau schiebt ihm einen Tisch unter die Füße, wischt Speichel weg, dirigiert die Bodybuilder, dreht sich um, wischt erneut Speichel weg. Schließlich heben die Bodybuilder den Mann aus dem Rollstuhl und hieven ihn auf die Liege. Dann bittet die Frau sie, den Rollstuhl außer Sichtweite zu schieben und für Santiago und sich zwei Tassen Kaffee zu besorgen. Santiago heißt der Mann also. Die Bodybuilder machen sich auf den Weg, während die Frau eine Flasche Sonnenmilch aus der Tasche holt und anfängt, ihren Mann und sich damit einzucremen. Kokosduft vermischt sich mit der warmen Brise, die über die Poolanlage hinwegweht. Die Frau plaudert in einem fort auf ihren Mann ein, und als die Bodybuilder mit dem Kaffee zurückkommen, hilft sie ihm beim Trinken, sie winkelt die Tasse an und hält ihm eine Serviette unters Kinn. Auch diese Bewegung scheint routiniert, die Serviette bleibt blütenweiß. Danach gibt die Frau ein paar weitere Kommandos, und die Bodybuilder erwidern: »Natürlich, Miranda.«
Irgendwann nickt sie ein, und als sie aufwacht, ist rundherum alles still. Sie hebt den Kopf, sieht nach, ob das Paar noch da ist. Tatsächlich. Auch sie schlummern auf ihren Sonnenliegen. Der Mann mit einer Handtuchrolle zwischen Brust und Kinn. Die Frau hält seine Hand, und die warme Brise streicht beiden durchs Haar. Ein schöner Anblick, so schön, dass es ihr den Hals zuschnürt. Vielleicht ist das der Moment, in dem sich zum ersten Mal eine Art Neid in ihr bemerkbar macht. Die Frau und der kranke Mann sind etwas Seltenes, zwei Menschen, die untrennbar miteinander verbunden sind, durch großes Leid und durch großes Glück. So etwas zu erreichen kostet außergewöhnlich viel Kraft, das ist ihr bewusst. Sie denkt an ihre Freundinnen zu Hause. Eine ist seit Ewigkeiten von ihrem Mann getrennt, und obwohl sie ihn hasst, kann sie nicht aufhören, von ihm zu reden. Eine andere nennt ihren Mann nur »das Hausschwein«, und eine dritte terrorisiert ihren Ex seit der Scheidung in einem fort mit belanglosen Nachrichten, nur um das Glück mit seiner Neuen zu torpedieren. Eine vierte ist der Meinung, eine Frau, die auf ihre Figur achte, unterwerfe sich dem männlichen Blick, weshalb sie einer so ungehemmten wie stetigen Expansion ihrer Körpermitte freie Bahn lässt.
Und in ihrem eigenen Leben sieht es auch nicht viel besser aus, im Gegenteil: Ein Eldorado der Misserfolge, ein Labyrinth aus gescheiterten Beziehungen, und egal welche Richtung sie einschlägt, sie findet keinen Ausweg. Die Frau auf der Sonnenliege neben ihr hat eine ganz andere Klasse, sie ist älter und mit einem schwerkranken Mann verheiratet, und trotzdem scheint sie mit ihrem Schicksal im Reinen zu sein. Es mag banal klingen, aber das ist es nicht.
Nach einer Weile kommt ein Kellner und fragt Miranda, ob sie etwas bestellen wolle. In seiner Stimme schwingt der an Ehrfurcht grenzende Respekt mit, der einem in Spanien entgegengebracht wird, wenn man sich für ein Familienmitglied aufopfert. Als er wieder verschwunden ist, knöpft Miranda ihre Strandtunika auf und cremt sich den tadellos flachen Bauch ein.
Mirandas Anblick versetzt ihr einen Stich. So ergeht es vermutlich jeder Frau, die einsehen muss, dass eine andere zwar älter, aber auch deutlich attraktiver ist als sie selbst. Mirandas Haut ist bronzefarben und leicht fleckig, wie kostbares Pergament. Die blonden Haare trägt sie kurz geschnitten, und ihr Gesicht ist mit Sommersprossen gesprenkelt, vielleicht hat sich auch der eine oder andere Altersfleck daruntergemischt. Plötzlich steht Miranda auf, läuft zum Pool und springt mit der Anmut einer Zwanzigjährigen hinein. Sie schwimmt hin und her, prustend und lachend, und winkt Santiago zu.
»Santi!«, ruft sie. »Santi, Santi, hallo! Siehst du mich? Hallo!«
Aus Santiagos Mund dringt ein Laut, der wie eine Mischung aus gequältem Stöhnen und fröhlichem Lachen klingt. Als er seiner Frau zulächelt, trieft ihm Speichel von der Unterlippe. Alle ringsum beobachten das Paar mit stummer Bewunderung. Sogar die Kellner halten mit ihren Tabletts inne und verfolgen die Szene. Irgendwann klettert Miranda mit Schwung aus dem Pool, geht mit schnellen Schritten zu dem kleinen Tisch neben ihrem Liegestuhl, greift nach dem Taschentuch und wischt ihrem Mann den Speichel weg.
Die Stunden vergehen. Ihre Gedanken wandern zu dem Mann aus der Bar. Wahrscheinlich liegt es an dem Paar neben ihr, an den Ereignissen des Tages, jedenfalls kommt es ihr plötzlich gar nicht mal absurd vor, ihm zu helfen. Fest steht: Sie hat ein freies Zimmer. Was spricht dagegen, einem Mann in Not für ein paar Tage Unterschlupf zu gewähren? Außerdem hat er versprochen, ihr von dieser Paartherapie und der Feministin zu erzählen. Vielleicht ist es ja eine interessante Geschichte? Auf der anderen Seite: einen Wildfremden aufnehmen? Wäre das nicht geradezu kriminell naiv? Sie sollte sich auf ihre Intuition verlassen, denkt sie. Also ruft sie sich das Bild von dem Mann in der Bar ins Gedächtnis, das Glas in seiner Hand, die aneinanderklirrenden Eiswürfel. Plötzlich erscheint er ihr vollkommen harmlos. Und was, wenn sie sich täuscht? Dann muss sie die Konsequenzen eben in Kauf nehmen. Wer nichts wagt, der nichts erlebt. Sie zieht ihr Handy aus der Tasche und textet ihm ihre Adresse, um acht solle er vorbeikommen, schreibt sie. Wenige Minuten später kommt seine Antwort, er wisse gar nicht, wie er ihr danken könne, sie werde ihre Großzügigkeit bestimmt nicht bereuen.
Sie döst weiter vor sich hin. Inzwischen ist es kurz vor zwei. Sie lauscht dem Wasserplätschern, dem Klirren von Löffeln gegen Tassen, dem Stimmengewirr. Bis die Frau namens Miranda anfängt zu telefonieren.
Nicht dass sie Leute belauschen würde, aber die Liegen stehen so dicht beieinander, dass sie gar nicht umhinkommt mitzuhören. Miranda spricht mit jemandem über Haushaltshilfen. Sie hat eine Stellenanzeige aufgegeben, ist aber mit keiner der Bewerberinnen zufrieden. »Ich kann sie mir einfach nicht mit ihm vorstellen«, sagt Miranda kopfschüttelnd, »das ist das Problem, ich kann mir keine mit ihm vorstellen … Ich würde es mir nie verzeihen, wenn sie sich nicht richtig um ihn kümmert, wenn ihm irgendwas zustößt … Man hört doch so viele Geschichten. Und vielleicht kann Santi bald überhaupt nicht mehr sprechen, woher weiß ich dann, dass alles in Ordnung ist? Am besten vergesse ich das Ganze und kümmere mich weiter selbst um ihn.«
Dann legt Miranda auf.
Die Idee kommt spontan, fühlt sich aber ganz selbstverständlich an. Ohne nachzudenken, setzt sie sich auf, streckt Miranda die Hand entgegen und stellt sich vor. Zögerlich erwidert die andere den Gruß.
»Miranda«, sagt sie. »Miranda Reyes.«
»Entschuldigen Sie, aber ich habe gerade Ihr Gespräch mitbekommen. Die Sache ist die: Ich bin auf der Suche nach genau so einer Beschäftigung.«
Warum sagt sie das? Sie weiß es selbst nicht, aber als die Wörter aus ihr heraussprudeln, kommen sie ihr trotzdem wahr vor. Sie sucht eine Beschäftigung, die ihrem Leben einen Sinn gibt. Eine Arbeit, bei der sie sich nützlich macht und nicht allein ist. Was gäbe es Besseres, als einem kranken Menschen zu helfen und einen zweiten zu entlasten?
Miranda Reyes mustert sie skeptisch.
»Sie kommen nicht aus Spanien.«
»Nein, ich bin hier, um zu schreiben«, erklärt sie. »Aber manchmal brauche ich eine Pause, eine Ablenkung. Und als ich gerade Ihr Gespräch mitbekam, dachte ich, das wäre doch genau das Richtige. Ein paar Stunden am Tag, zwischen dem einen oder anderen Artikel, wenn Sie verstehen?«
Miranda mustert sie lange, ihre Tasche und Schuhe und die Kleidungsstücke, die sie in die Speichen des Sonnenschirms gehängt hat.
»Wie alt sind Sie?«, fragt Miranda.
»Fünfundvierzig.«
»Haben Sie sich schon mal um einen Alzheimerpatienten gekümmert?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Nein, aber das kann ich lernen. Ganz bestimmt. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.«
»Nicht immer«, sagt Miranda.
»Geben Sie mir wenigstens eine Chance«, sagt sie, »vielleicht klappt ja alles ganz wunderbar.«
»Wunderbar«, wiederholt Miranda und verzieht das Gesicht, als hätte sie in eine bittere Frucht gebissen. »Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal etwas ganz wunderbar geklappt hat.«
Dann wendet sie sich ab, richtet das Handtuch unter Santiagos Kinn und wischt ihm den Speichel weg.
»Aber was soll’s, warum eigentlich nicht? Solange er schläft, können wir uns ein bisschen unterhalten.«
Dann löchert Miranda sie mit Fragen. Wo sie wohne, ob sie mit Geschwistern aufgewachsen sei, welche Fächer sie studiert habe, ob sie leicht die Geduld verliere, ob sie Kraft in den Armen habe, ob sie kochen könne, was sie über dieses und jenes Medikament wisse. Ob sie sich schnell ekele, ob sie schon mal einem Erwachsenen die Windeln gewechselt habe, ob sie pünktlich sei. Dann bittet Miranda Reyes darum, sich ihre Handtasche und Schuhe genauer ansehen zu dürfen. Das Bewerbungsgespräch ist kaum vorbei, da wacht Santiago auf.
»Unterhalten Sie sich mit ihm«, sagt Miranda. »Heitern Sie ihn ein bisschen auf.«
Sie gibt sich Mühe, aber es fällt ihr nicht leicht, mit einem Fremden zu sprechen und dabei von einer Frau wie Miranda Reyes beobachtet zu werden. Santiago scheint nicht viel zu verstehen, lächelt ihr aber während der gesamten Prüfung zu. Als ihr nichts mehr einfällt, sitzt sie nur schweigend da und lächelt ihn an. Plötzlich nimmt Santiago ihre Hand und drückt sie.
»Welches Gehalt stellen Sie sich vor?«, fragt Miranda Reyes.
Obwohl ihre Reisekasse alles andere als unerschöpflich ist, steht für sie fest, dass sie keinen Lohn annehmen wird. Sie will helfen. Sie hat ihren Aufenthalt gründlich durchgeplant und für die kommenden Wochen keine zusätzlichen Einkünfte einkalkuliert. Das Stipendium deckt das Gröbste ab, und sie hat keine kostspieligen Angewohnheiten. Irgendwo hat sie gehört, dass man nicht glücklich wird, wenn man nur von anderen nimmt. Man muss auch etwas geben. Das sagt sie Miranda, und als sich deren Augen mit Tränen füllen, durchströmt sie ein wohliger, wenn auch beinahe lächerlicher Rausch der Güte.
»Danke«, sagt Miranda leise. »Ich habe früher als Sekretärin bei der Stadtverwaltung gearbeitet, aber den Job an den Nagel gehängt, um mich um Santi zu kümmern. Ich will nicht jammern, ich komme klar. Wir kommen klar. Aber Sie schickt der Himmel.«
Sie schickt der Himmel. Das hat ihr noch niemand gesagt. Sie weiß nicht, was sie antworten soll, und mit einem Kloß im Hals entschuldigt sie sich und verschwindet zur Toilette. Als sie zurückkommt, hat sich auch Miranda wieder gefangen, lädt sie für den nächsten Tag um zehn zu sich nach Hause ein und diktiert ihr die Adresse.
»Was schreiben Sie eigentlich?«, fragt Miranda dann. »Ich finde, es gibt keinen romantischeren Beruf als die Schriftstellerei!«
Sie nickt, aber innerlich fühlt sie sich leer.
Dann geht sie nach Hause. Ein paar Stunden später steht der Mann aus der Bar vor ihrer Tür. Mercuro Cano. Blass, angespannt und einsilbig betritt er die Wohnung. Sie erkennt ihn kaum wieder, zeigt ihm aber sein Zimmer und sucht ihm Bettzeug und Handtücher heraus. Dann fragt sie, ob er hungrig sei, was er verneint. Er lächelt nur höflich und zieht die Tür hinter sich zu. Also geht sie in die Küche und kocht für sich allein. Den Rest des Abends verbringt sie auf dem Sofa und schaut Telenovelas, von dem Gefühl erfüllt, dass in ihrem Innern etwas auftaut, dass jetzt vielleicht alles anders wird.
Als sie am nächsten Morgen Mirandas und Santiagos blitzblanke Wohnung in der sechzehnten Etage eines Hochhauses am Stadtrand von Madrid betritt, kommt es ihr unvorstellbar vor, dass hier ein Paar wohnt, das von einer langen schweren Krankheit heimgesucht wurde. Die Luft ist frisch und riecht dezent nach Putzmitteln, und Miranda sieht mit ihren kurzen Locken, die leicht feucht und vermutlich frisch gewaschen sind, geradezu unverschämt attraktiv aus. Santiago sitzt vor dem eingeschalteten Fernseher auf dem Sofa, proper gekleidet und ordentlich gekämmt. Durch die offene Balkontür hinter ihm weht eine laue Brise herein und bringt die Gardine zum Flattern. Der Balkon ist mit katalanischen Mosaikfliesen ausgelegt, die Motive sind von alten Volkssagen inspiriert. Ein Tisch und zwei Stühle stehen dort draußen. Sie stellt sich vor, wie Miranda Santiago hinaushilft, damit sie vor dem Abendessen ein Bier an der frischen Luft trinken und dazu Pistazien essen können, so als wären sie frisch verheiratet, als gäbe es keine Krankheit.
Schließlich wird sie von Miranda, die offensichtlich großen Wert auf strenge Routinen und deren gewissenhafte Ausführung legt, in ihre Aufgaben eingewiesen. Jeden Morgen soll sie Santiago duschen, rasieren und kämmen, ihm ein frisch gebügeltes Hemd und eine saubere Hose anziehen, seine Wangen mit Rasierwasser betupfen und seine Hände mit Feuchtigkeitscreme einreiben. Anschließend soll sie ihn an den Esstisch setzen, wo er Kaffee und geröstete Brotscheiben mit Olivenöl, Tomate und Salz bekommt – das frühstücke er schon immer, erklärt Miranda –, ihm aber unbedingt eine Serviette in den Kragen stecken, damit das Hemd sauber bleibt. Den restlichen Vormittag verbringt Santiago für gewöhnlich auf dem Sofa. Währenddessen soll sie beim Hausputz und der Wäsche helfen und Santiago zwischendurch aus der Zeitung vorlesen. Miranda wird die freie Zeit nutzen, um sich selbst im Bad fertig zu machen und das Mittagessen vorzubereiten. Nachmittags wird Santiago immer für ein paar Stunden in eine Tagesklinik für Alzheimerkranke gebracht, zwecks Gruppenstimulation.
»Die Klinik schickt einen Wagen. Sobald Santiago abgeholt wurde, können Sie gehen.«
Anschließend zeigt Miranda ihr den Rest der Wohnung. Das Schlafzimmer ist ein Traum in Hellblau, mit Satinkissen, reichlich Spitze und blütenweißem Teppichboden. Vor dem Bett steht ein Paar zierliche Pantoffeln mit Absatz und schneeweißen Plüschbommeln. Das Bett ist in spanischer Manier gemacht, der Überwurf vollkommen faltenfrei.
Nach dem Mittagessen erzählt Miranda bei einer Tasse Kaffee, sie habe gerade für Santiago und sich ein Hotelzimmer in Katalonien gebucht.
»Sie wollen mit ihm verreisen?«
»Ja, nach Salou«, erklärt Miranda stolz. »Ein Zimmer mit Meerblick, vor vierzig Jahren haben wir unsere Flitterwochen dort verbracht. Seitdem fahren wir jeden Sommer dorthin. Nachts können wir die Fenster offen lassen und zum Meeresrauschen einschlafen.«
»Aber wie kommen Sie mit Santiago dorthin?«
Miranda Reyes berichtet von zahllosen Vorbereitungen, die seit einigen Jahren nötig sind, um die Reise zu bewerkstelligen. Von Madrid aus geht es mit dem Zug nach Barcelona, ihr Schwiegersohn holt sie am Bahnhof ab und fährt sie nach Salou. Während des Urlaubs helfen ihre Töchter ihr abwechselnd mit Santi. Damit er jeden Tag im Meer baden kann, rekrutiert sie drei Männer aus dem örtlichen Fitnessstudio, die ihn vom Hotel zum Strand tragen. In einem spezialangefertigten Schwimmring kann er dann im Wasser treiben. Die ganze Familie versammelt sich dort draußen im Meer. Sie und Santi, ihre Töchter und Schwiegersöhne. Sie schwimmen, lachen und spielen.
»Das sind die glücklichsten Momente. Man vergisst die Krankheit, und Santi kann in seinem Schwimmring treiben und in den Himmel schauen. Er hat das Meer immer so geliebt, und solange ich lebe, soll er jeden Sommer darin baden können«, sagt Miranda mit einem Anflug von Trotz in der Stimme.
Sie ist beeindruckt von Mirandas Stärke und möchte ihr ein Kompliment machen, aber da werden sie unterbrochen – Santiago schlägt plötzlich mit der flachen Hand auf den Tisch und sagt:
»Eines schönen Tages bringe ich euch alle um!«
»Ach was, Liebling!«, sagt Miranda lachend. »Wirst du nicht, was redest du denn da?«
Miranda scheint die Situation entschärfen zu wollen, aber da fegt Santiago einen Salzstreuer vom Tisch. Als Miranda sich vorbeugt, um ihn aufzuheben, versetzt Santiago ihr einen festen Schlag auf den schmalen Rücken.
Sie sitzt stumm da und beobachtet die Szene. Fühlt sich befangen und weiß nicht, was sie tun, wie sie Miranda helfen soll. Plötzlich ist Santiago wie ausgewechselt. Auf dem Sprossenstuhl sitzt kein gebrechlicher alter Mann mehr, sondern ein kraftstrotzendes Ungeheuer. Seine Augen sind finster, die Lippen zusammengekniffen.
»Nichts passiert«, sagt Miranda und richtet sich auf. »Nichts passiert.«
»Alles okay mit Ihnen?«
»Man darf das nicht persönlich nehmen. Das ist die Krankheit. Er ist dann nicht er selbst.«
Miranda reißt ein Stück Haushaltspapier ab und wischt Santiago über den Mund. Dann wendet sie sich um, streckt den Rücken durch und sagt mit fester Stimme:
»Sie können dann gehen.«
Erschöpft betritt sie die Wohnung in Goya. Bratwurstgeruch schlägt ihr entgegen, und sie hört Topfscheppern. Für einen Moment erwägt sie, einfach in die Küche zu gehen, sich hinzusetzen und dem Mann aus der Bar von ihrem Tag zu erzählen. Als er im nächsten Moment in den dämmrigen Flur tritt und sie begrüßt, erlischt der Impuls. Er ist so bleich, dass sie das Gefühl hat, seine Konturen verwischten, als wäre er im Begriff, sich in einen Schatten zu verwandeln. Wenn sich hier jemand etwas von der Seele reden muss, dann wohl er, denkt sie. Sie essen schweigend zu Abend. Dann nehmen sie den Wein mit ins Wohnzimmer und setzen sich einander gegenüber auf die zwei Sofas. Der Besuch bei Miranda und Santiago erscheint ihr weit weg. Während durch das angelehnte Fenster die Geräusche der Stadt hereindringen, lauscht sie seiner Geschichte.
Meiner Frau und mir war durchaus bewusst, was für eine Show das war, ich kann also nicht den Unwissenden spielen. Trotzdem denkt man, dass es eine Grenze gibt, eine Art Sicherheitsnetz, wenn eine Nonne hinter dem Ganzen steckt. Nicht dass ich gläubig wäre. Mit der Kirche hab ich nichts am Hut. Aber ein Unternehmen hat immer etwas zu verlieren – nicht zuletzt den guten Ruf –, und deshalb war ich überzeugt, die Macher der Show würden über einen bestimmten Punkt nicht hinausgehen. Wir hatten beide gehört, dass Schwester Lucia Wunder vollbringen könne. Ich glaube zwar nicht an Wunder, aber Soledad meinte, dass wir genau das bräuchten, ein großes, unglaubliches, überwältigendes Wunder. Eigentlich waren wir schon getrennt, gingen aber trotzdem noch zur Paartherapie, um weiter an uns zu arbeiten. Und ich war dankbar dafür, immerhin war ich der Schwerenöter, der mit seiner ungezügelten Lust den Karren in den Dreck gefahren hatte. Als Soledad uns noch eine allerletzte Chance geben wollte, nahm ich das Angebot ohne Zögern an, und nicht nur das, ich betrachtete es als eine Art Segen. Ich wusste, wie erschöpft Soledad war und dass ihr Herz immer schwächer wurde. Sie brauchte dringend ein Spenderherz, aber das bekommt man nicht so einfach.
Angesichts der endlosen Warteliste blieb uns nichts anderes übrig, als zu hoffen. Und währenddessen wollten wir dafür kämpfen, wieder zueinanderzufinden. Im Glücksfall bekäme Soledad ein neues Herz und unsere Ehe eine zweite Chance. Ich malte mir unser neues Leben als Himmel auf Erden aus, und für dieses Paradies wollte ich alle Mühen in Kauf nehmen, egal wie kräftezehrend und erniedrigend sie auch sein würden.
Als wir uns als Kandidaten für die Show bewarben, kam es mir vor, als nähme ich an einer Lotterie mit extrem hohem Einsatz teil oder einer Partie russisches Roulette. Das potenzielle Risiko übte eine unerwartet belebende Wirkung auf mich aus, es war, als wären meine Sinne geschärft. Die Welt kam mir mit einem Mal klarer, ja, interessanter vor – als hätte jemand ein Fenster in meinem Innern geputzt. Wenn ich durch den Park ging und hochschaute, konnte ich die Baumkronen zum ersten Mal richtig sehen. All diese Blätter, all diese Details, dachte ich. Wie lange war ich dafür blind gewesen? Wie lange hatte die Natur mich mit einem Reichtum überschüttet, den ich nicht wertgeschätzt hatte? Wie lange war so viel Schönheit an meine tote Seele verschwendet worden? Eines Morgens kam ich auf dem Weg zur Arbeit an einem kleinen Teich vorbei, in dem schwarzen Wasser schwamm ein Karpfen, dessen orangefarbene Schuppen in der Sonne glitzerten. Ich hielt inne, beobachtete den Fisch, und mir war, als würde er meinen Blick erwidern. Ich stand so lange da, dass ich schließlich zu spät zur Arbeit kam. Aber niemand hatte etwas gemerkt. Niemand hatte mein Fehlen registriert. Das schleichende Verschwinden eines ungeliebten Menschen. Ja, tatsächlich kam es mir manchmal vor, als löste ich mich nach und nach in Luft auf.
Anders als Glücksspiele wie russisches Roulette verlangte die Show einen relativ geringen Einsatz von den Kandidaten – dachte ich jedenfalls. Und davon abgesehen: Wie hätte mein Leben noch schlimmer werden können? Die Frau, die ich liebte, hatte ich bereits so gut wie verloren, und ohne sie hatte mein Leben keinen Sinn mehr. Aber wenn die Show mir tatsächlich dabei helfen würde, alles ins Lot zu bringen, könnte ich endlich wieder ein heiler Mensch werden, dachte ich und ließ mir die Worte auf der Zunge zergehen. Sie schmeckten herrlich, das finde ich übrigens immer noch. Ein heiler Mensch. Ein heiler Mensch. Gibt es überhaupt noch heile Menschen? Ich hatte in der Vergangenheit Dinge getan, die ich nicht hätte tun dürfen, und in dieser Lage darf man nicht zimperlich sein. Wer Dinge getan hat, die er nicht hätte tun dürfen, muss nach jeder helfenden Hand greifen, die ihm entgegengestreckt wird.
Meine Frau und ich mussten getrennt voneinander einen Bewerbungsbogen ausfüllen, und ich ging dabei sehr sorgfältig vor. Ich nahm mir ausreichend Zeit und las mir mein Motivationsschreiben mehrfach durch, ehe ich auf Absenden klickte. Anschließend ging ich einkaufen, in der Nähe vom Busbahnhof Méndez Álvaro, und meine Schritte kamen mir ungewohnt leicht vor, als wären meine Füße von Bleigewichten befreit worden. Für den Hin- und Rückweg benötigte ich zwanzig Minuten, und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Spur von dem Gefühl, das mich seit der Teilnahme an der Show quält – das Gefühl, dass die Menschen so tun, als sähen sie mich nicht, obwohl sie mich aus dem Augenwinkel beobachten. Unsere Bewerbungen wurden zügig bearbeitet, und nach nur einer Woche kam die Antwort: Wir waren als Kandidaten für die Show ausgewählt worden. Meine Sinne wurden noch mal schärfer. Ich hatte es in der Vergangenheit nicht leicht gehabt, Menschsein ist nie leicht, weil man ständig falsche Entscheidungen trifft, aber manchmal geschehen auch Wunder, und man bekommt die Chance auf einen Neuanfang geboten. In der Mail stand, Soledad und ich müssten an verschiedenen Tagen ins Studio kommen, meine Aufzeichnung würde erst in gut einem Monat stattfinden. Bis dahin dürfe ich mir die Show unter keinen Umständen mehr anschauen. Man habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass Kandidaten in spe nach dem Ansehen gewisser Folgen kalte Füße bekommen hätten und in letzter Sekunde abgesprungen seien. Das habe »Krater in die Programmplanung geschlagen« stand da, und deshalb fordere man nun alle zukünftigen Kandidaten auf, bis zur Aufzeichnung abstinent zu bleiben. Das leuchtete mir sofort ein. Ich habe beruflich selbst mit Projektplanung zu tun gehabt und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie wichtig klare Regeln sind. Andererseits war mir sofort klar, dass es mir schwerfallen würde, die Show fortan zu meiden. Ehrlich gesagt war ich regelrecht süchtig nach dieser Show, und sobald ich eine Folge verpasst hatte, quälte mich das Gefühl, der ganze Tag hätte seinen Sinn verloren. Als ich noch eine Arbeit hatte, durchlief mich kurz vor Feierabend immer ein Schauder der Vorfreude, wenn ich daran dachte, dass das nächste Ereignis auf dem Rosenkranz, den die Ereignisse eines Tages bilden, darin bestand, mich zu Hause aufs Sofa zu fläzen, die Show einzuschalten und Miss Pink und Mister Blue auf dem Bildschirm zu verfolgen. Schwester Lucia trat nur selten selbst in Erscheinung. Wenn sie etwas mitzuteilen hatte, sprach meistens die bezaubernde Miss Pink für sie. Die Show, das war für mich eine Stunde Glück und pures Leben. Eine Stunde, in der ich den Qualen des Alltags entfliehen durfte. Seit ich meinen Job verloren hatte, war das Gefühl stärker denn je. Wenn ich um sieben Uhr morgens aufwachte, wie ich es immer getan hatte, konnte ich an manchen Tagen an nichts anderes denken als an den Beginn der Show am Abend. Der Tag lag vor mir wie ein endloser Ozean oder besser gesagt wie eine Steppe, die ich mit vor Durst brennendem Hals durchqueren musste. Alles, was ich den Tag über machte – oder nicht machte –, setzte ich ins Verhältnis zur Show am Abend. Noch ein Nachmittag, noch ein halber Nachmittag – das Warten schuf neue Zeiteinheiten.