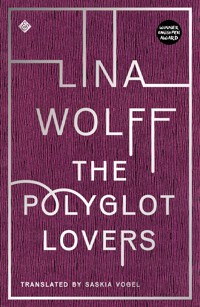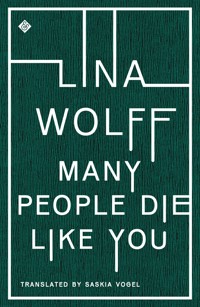21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Grandios, wie es Lina Wolff gelingt, ihre Leser:innen zu hypnotisieren, sie in dieses teuflisch konstruierte Beziehungslabyrinth hineinzuziehen.» Le Monde «Lina Wolff gehört in den Kanon zeitgenössischer feministischer Literatur und ergänzt ihn auf coole, intelligente und streitbare Weise.» The Guardian Schonungslos,schillernd und mit tiefschwarzem Humor schildert Lina Wolff die dämonischen Abgründe einer Beziehung und bringt dabei die Realität ins Wanken. Der Teufelsgriff ist ein Buch für unsere Zeit. Eine Frau entflieht ihrem Alltag und zieht nach Florenz. In der südlichen Stadt wirkt alles fremd und verlockend zugleich, die Ziegeldächer, die Kirchtürme, die Liebespaare, der Mann, den sie kurz nach ihrer Ankunft kennenlernt. Sie denkt, dass sie selbst aus einer kargen Gegend kommt, dass sie viel zu lernen hat und dass er derjenige sein könnte, der den gefrorenen Boden in ihr auftaut. Im Gegenzug hat auch sie ihm etwas beizubringen. Der Roman ist die Geschichte der beiden, ihrer Körper und ihrer Seelen. Über ihren Griff nach ihm und seinen immer festeren Griff nach ihr. Den Teufelsgriff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lina Wolff
Der Teufelsgriff
Roman
Über dieses Buch
Eine Frau entflieht ihrem Alltag und zieht nach Florenz. In der südlichen Stadt wirkt alles fremd und verlockend zugleich, die Ziegeldächer, die Kirchtürme, die Liebespaare, der Mann, den sie kurz nach ihrer Ankunft kennenlernt. Sie denkt, dass sie selbst aus einer kargen Gegend kommt, dass sie viel zu lernen hat und dass er derjenige sein könnte, der den gefrorenen Boden in ihr auftaut. Im Gegenzug hat auch sie ihm etwas beizubringen. Der Roman ist die Geschichte der beiden, ihrer Körper und ihrer Seelen. Über ihren Griff nach ihm und seinen immer festeren Griff nach ihr. Den Teufelsgriff.
Schonungslos, schillernd und mit ureigenem, tiefschwarzem Humor schildert Lina Wolff die dämonischen Abgründe einer Beziehung und bringt dabei die Realität ins Wanken. Der Teufelsgriff ist ein Buch für unsere Zeit.
Vita
Lina Wolff, geboren 1973, hat lange in Italien und Spanien gelebt. Für ihr Werk wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so erhielt sie für ihren zweiten Roman Die polyglotten Liebhaber 2016 den Augustpris, den wichtigsten schwedischen Literaturpreis. Ihr dritter Roman Das neue Herz wurde 2020 mit dem Aftonbladet litteraturpris ausgezeichnet. Neben dem Schreiben ist Wolff als Übersetzerin tätig und überträgt Werke von Autor:innen wie Samantha Schweblin, Roberto Bolaño und Gabriel José García Márquez ins Schwedische. Wolff lebt in Lund.
Stefan Pluschkat, geboren 1982 in Essen, studierte Komparatistik und Philosophie in Bochum und Göteborg. Er übersetzt Romane, Kinder- und Sachbücher aus dem Schwedischen und Norwegischen und erhielt 2018 den Hamburger Förderpreis für Übersetzung.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Djävulsgreppet bei Albert Bonniers förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
« Djävulsgreppet» Copyright © 2022 by Lina Wolff
Der Verlag dankt dem Swedish Arts Council für die Förderung der Übersetzung. ((LOGO: https://www.kulturradet.se/om-oss/media/logotype/))
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Jesse Mockrin
ISBN 978-3-644-01736-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Welcome to my house. Come freely. Go safely; and leave something of the happiness you bring!
Bram Stoker
I
Als sie nach Florenz kommt, ist sie als Erstes von all den Liebespaaren überwältigt. Sie schlendern durch Arkaden im Stadtzentrum, und über ihren Köpfen verläuft dunkles verwittertes Gebälk. Alles ist heiß, bombastisch und ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat, als ihr Zug vor vielen Jahren eine Weile am Bahnhof feststeckte. Damals rieselten dicke Schneeflocken auf die scheinbar zerbrechliche, kalte, schlafende Stadt herab. Aber jetzt: Liebespaare in der Hitze. Man hört sie durch die offenen Fenster und in seiner Wohnung durch die Wände. Frauenschreie, Gemurmel, kurz darauf Lachen.
«Haben hier alle so Sex?», fragt sie. «Und die ganze Zeit?»
«Ja», antwortet er. «Findest du das seltsam?»
«Nein», sagt sie, «gar nicht.»
Sie denkt daran, dass sie aus der Provinz kommt. Daran, dass sie noch eine Menge zu lernen hat und dass der Mann an ihrer Seite vielleicht derjenige sein wird, der ihr in dieses Neue hineinhilft. Rings um die Dachterrasse erstrecken sich ockerfarbene Ziegeldächer, und von hier oben erscheint Florenz als die Stadt des zweiten Chakras. Das zweite Chakra sitzt im Unterleib und ist orange. Orange, ocker, die Farben gehören zu dieser Stadt. Alles stimmt, denkt sie, alles fügt sich zusammen, endlich fügt sich alles zusammen.
Der Schweißfilm wird zur zweiten Haut. Sie mag seinen Körpergeruch. Sie mag alles an ihm, obwohl er so hässlich ist. Seine dunklen Haare sind lang, zottelig und hängen in sein Gesicht, als wollte er es dahinter verbergen. Doch ein Gesicht wie das seine lässt sich nicht verbergen, also streicht sie ihm die Zotteln hinter die Ohren. Er schäme sich, sagt er. Er müsse sich nicht schämen, sagt sie, sein Gesicht verleihe seiner Männlichkeit nur mehr Tiefe und bilde einen reizvollen, rauen Kontrast zum femininen Charme der Stadt. Er lächelt skeptisch, schüchtern fast. Die Leute schauen erst ihn an, dann sie, dann wieder ihn. So etwas sei ihm noch nie passiert, sagt er.
«Die Leute starren, weil sie nicht begreifen, wie jemand wie du mit jemandem wie mir zusammen sein kann», sagt er.
Doch manche Frauen verstehen es, verstehen es nur zu gut. Sie bekunden ihr Interesse auf typisch südeuropäische Weise. Einmal, sie sitzen gerade auf einer Bank im Park, nähert sich eine Frau, um aus einem Brunnen zu trinken. Sie stellt sich neben ihn und beugt sich vor, ihr Po vielleicht einen halben Meter von seinem Gesicht entfernt. Er lächelt selig.
«Weil ich mit dir zusammen bin», sagt er. «Bis jetzt haben sie mich nicht mal bemerkt.»
Natürlich zieht sie schon zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit in Betracht, dass er ihr dreist ins Gesicht lügt, doch sie verscheucht den Gedanken. Schließlich sitzt er hier, an ihrer Seite, lässig zurückgelehnt, die Arme auf der Lehne und riecht nach Achselschweiß. Kein Grund zur Sorge. Er ist harmlos, abstoßend, für alle, nur nicht für sie. Ein harmloser kleiner Fettklops. Erst später wird sie (nicht ohne Bitterkeit) denken: So was wie einen harmlosen kleinen Fettklops gibt es nicht.
Die Frauen schenken ihm immer mehr Beachtung. Sie sieht ihm seine Freude an und muss unweigerlich lächeln. Sie ist der Ursprung seiner Verwandlung, die treibende Kraft. Sie wirft seine verwaschenen grauen T-Shirts weg. Sieht zu, dass er sich Leinenhemden in hellen Farben besorgt, Deo, neue Jeans.
«Jeans können einen Körper schaffen», sagt sie, «und sie können ihn vernichten.»
Stonewashed-Jeans zum Beispiel dürfe er niemals zu schicken schwarzen, leicht glänzenden Schuhen tragen, deren Sohlen über den Steinboden klackern.
«Sonst siehst du aus wie ein Verkäufer für Lkw-Steuerungssysteme.»
«Aber das bin ich ja fast», erwidert er.
Sie kichert verlegen.
«Stimmt, das bist du ja fast. Aber das sollte dich nicht daran hindern, die schwarzen Sonntagsschuhe für die nächste Beerdigung aufzuheben und unter der Woche Sneaker zu tragen.»
Er lauscht, er lernt. Im Einkaufszentrum dackelt er hinter ihr her und kauft, was sie ihm aussucht. Sie schlägt vor, er solle sich die Haare abrasieren oder sie wenigstens stutzen, zu einer stoppeligen dunklen Matte wie Shane in The Walking Dead. Er googelt und nickt.
«Aber mein Gesicht?», fragt er. «Die Leute kriegen doch Angst vor mir.»
«Ich glaube, du wirst ganz anders aussehen», sagt sie. «Als hättest du nichts zu verstecken, als wärst du stolz auf deine unbehagliche Seite.»
Er folgt ihrem Rat. Morgens, ehe die Hitze sich über die Stadt legt, schleppt sie ihn zum Joggen in den Park. Sein Bauchspeck schwindet. Sie nimmt ihn mit zum Sport, und während ihrer Bauchübungen auf der Matte trainiert er vor dem Spiegel seinen Bizeps.
«Ohne Haare sehe ich aus wie un cazzone, wie ein Riesenpimmel, der Liegestütze macht», sagt er.
Sie lacht. Sie liebt es, wenn er so ist, vulgär und verschwitzt, sie mag Menschen, die sich nicht allzu ernst nehmen. Die Verwandlung schreitet voran. Abends Salat, morgens Obst. Obendrein jede Menge Sex, und wenn er die Wohnung verlässt, strömt ihm die Männlichkeit aus jeder Pore. Morgens steht sie am Fenster und beobachtet zufrieden (aber naiv), wie ihr Wunderwerk in die Welt hinausstiefelt.
Praktische Dinge müssen geklärt werden. Am besten schnellstmöglich, damit sie wissen, woran sie sind.
«Sicher», sagt er. «Schieß los.»
Punkt eins: Sie sei mit einem One-Way-Ticket hier. Nein, kein Rückflug. Schließlich habe sie nicht wissen können, wie die Dinge sich hier entwickeln würden. «Und die Arbeit?», entgegnet er, sie habe doch sicher einen Job? Nein, den habe sie gekündigt. Es musste sein. Die Arbeit sei ihr zuwider gewesen, habe an ihr gezehrt und jeden Tag einen Bissen von ihrer Seele genommen. Das Fass sei voll gewesen.
«Du hast gekündigt?», fragt er.
«Ja, genau.» Sie habe Nägel mit Köpfen gemacht, sei eines Morgens ins Büro ihres Vorgesetzten marschiert und habe ihm erklärt, dass sie die Nase voll habe vom Bürotrott, den fleischfarbenen Teppichen und braun gebeizten Fensterrahmen, sie kündige.
«Und wovon willst du leben?», fragt er nervös.
«Von dir», antwortet sie.
Für einen Moment blickt er sie genauso entsetzt an, wie sie es sich erhofft hat.
«Von mir?», fragt er.
«Oder bist du etwa arm? Ich dachte, auf einen Mann wie dich ist Verlass.»
Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben.
«Nein, bin ich nicht, aber …»
Sie lacht, er brauche sich keine Sorgen zu machen. Sie habe genug Geld.
«Wie viel?», fragt er.
«Genug, dass du mich nicht für Sex bezahlen musst.»
Er hüstelt nervös. Sie mache nur Witze, sagt sie. Sie habe jedenfalls genug Geld, vermutlich werde eher er sich von ihr aushalten lassen. Er habe sich noch nie aushalten lassen, protestiert er. Noch nie einer Frau Geld abgeluchst, nie einen Job gekündigt, nie «einfach so» Geld auf dem Konto gehabt. Sie zuckt die Achseln. Die Menschen seien eben verschieden. Er komme aus einer Bauernfamilie, erklärt er, in der es undenkbar wäre, einen Job einfach so hinzuwerfen, ohne einen neuen in Aussicht zu haben. Wieder zuckt sie die Achseln. Wie gesagt, die Menschen seien eben verschieden. Wenn sie länger bleibe, werde sie sich eine Beschäftigung suchen, vielleicht einen Kurs belegen oder Gebrauchsanweisungen übersetzen. Sie habe sich immer für Simultandolmetschen interessiert, und hier in Florenz gebe es zwei Schulen. Na dann, sagt er. Einverstanden. Fürs Erste könne sie bei ihm wohnen, dann spare sie die Miete. Also, wenn sie wirklich in Italien bleiben wolle und bei ihm. Sie könne sich ja ums Abendessen kümmern, dann seien sie quitt.
Sie streift durch seine Dachgeschosswohnung, die ihr vorkommt wie ein Himmelreich. Zwei Bäder, jeweils mit Dusche. Die Ziegeldächer, die Kuppel der Cattedrale di Santa Maria del Fiore, die sich über die Stadt erhebt, unten im Hof summt jemand eine Melodie, die Blumenkästen des Nachbarn sind üppig bepflanzt. Der Weißwein ist kalt gestellt. Die Pinien im Innenhof zeichnen sich vor dem Himmel ab, und in der Dämmerung weht durch die offenen Fenster der Duft sonnenverbrannten Harzes ins Schlafzimmer.
Anfangs ist sie die meiste Zeit von einer tiefen inneren Zufriedenheit erfüllt. Wie Gott den Menschen schuf, so schafft sie den Mann. Vielleicht ist das der Grund, warum die Dinge außer Kontrolle geraten: weil sie glaubt, sie lebe nach einem Mythos, den es nie gab. Frauen schaffen Männer nicht, solche historischen Narrative, solche Legenden existieren nicht. Schon bald zeigt sich, dass seine Verwandlung neue Türen aufstößt. Beim Abendessen erzählt er ihr vergnügt von den Frauen, die ihn im Verlauf des Tages umschmeichelt haben. Eine Kollegin habe sich Kaffee am Automaten vor seinem Büro geholt und ihm ihren sagenhaften Po vor die Nase gehalten – wie solle man da in Ruhe arbeiten? Er lacht gemütlich, denn noch ist er so dick, dass sein Lachen gemütlich wirkt. Sie weiß, dass er sich wünscht, sie würde mitlachen. Aber das tut sie nicht. Also fährt er fort. Wenn sie sich nur für diese Wendung seines Lebens mitfreuen könnte. Er zeigt ihr ein Video, wie er Faustliegestütze macht, einen nach dem anderen, ein breites Lächeln im Gesicht.
«Wer hat dich dabei gefilmt?», fragt sie.
«Giorgio.»
«Das glaube ich dir nicht.»
«Doch, es war Giorgio», beharrt er.
«Eine Frau hat dich gefilmt.»
«Woher willst du das wissen?»
«Das sieht man an deinem Lächeln, du gockelst. Einen Mann hättest du nicht so angelächelt.»
«Du bist paranoid», sagt er, nachdem er sie eine Weile angestarrt hat. «Ich dachte, du stehst über den Dingen, wie eine Rose, die aus einem Meer von Disteln ragt. Aber in Wahrheit bist du diejenige, an der man sich sticht.»
«Sag einfach die Wahrheit. Außerdem haben auch Rosen Dornen. Raus mit der Sprache, wer hat dich gefilmt?»
Die Wahrheit tröpfelt ans Licht. Ein Frauenname.
«Und wie soll ich jetzt ruhig bleiben, wenn du zur Arbeit gehst?», ruft sie.
Sie sieht die Verwunderung in seinem Blick, aber auch die Antwort auf ihre Frage. Die Antwort ist simpel. Ob sie Ruhe bewahrt, zählt nicht. Was zählt, ist seine Lust und zu welch ungeahnten Höhen sie ihn treibt.
Trotz der Schmerzen, die er ihr schon jetzt zufügt, gestaltet sich das Zusammenleben durchaus angenehm. Er ist reinlich, duscht gewissenhaft morgens und abends und bringt die neuen Hemden in die Wäscherei, damit sie stets tadellos sauber und gebügelt sind. Er benutzt ein teures Parfüm und cremt sich die Kopfhaut mit einer spanischen Unisex-Bodylotion ein. Er wird «der Reinliche». Sie beobachtet ihn und findet kaum etwas, was ihr nicht gefällt. Sie beobachtet ihn, und er beobachtet sie. Sie sei so still, sagt er. Still wie eine Maus, und er habe sich schon immer eine mäuschenstille Frau gewünscht, eine Minnie Maus, die nicht stört.
«Eine Minnie Maus?»
«Genau. Der Name passt zu dir. Darf ich dich Minnie nennen?»
Sie zuckt mit den Schultern.
«Wenn ich Minnie bin, bist du aber Mickey.»
Er betrachtet sich im Spiegel.
«Mickey …? Da lässt sich doch was Passenderes finden.»
«Zum Beispiel?»
«Il toro? Il toro divino?»
Sie lachen.
«Mickey passt perfekt», sagt sie. «Aber was meinst du mit ‹die nicht stört›?»
Na, das sei doch einer ihrer Vorzüge, sie spreche leise und sei in der Wohnung kaum zu hören. Selbst wenn sie Türen und Schränke öffne oder schließe. Lärm sei ihr zuwider, erklärt sie. Lärm und laute Menschen jagten ihr Angst ein.
«Prinzessin Zimperlich», sagt er.
«Ich bin keine Prinzessin Zimperlich. Ich kann mit einer Bohrmaschine umgehen und rückwärts mit Anhänger fahren. Sag so was nicht, das kränkt mich.»
«Aber, Minnie, bei mir darfst du ruhig ein bisschen schwach sein. Starke Frauen rauben uns Männern die Kraft. Wenn wir nicht die Starken sein dürfen, wohin dann mit unserer ganzen Männlichkeit?»
Sie lässt die Worte sacken.
«Na, meinetwegen», sagt sie dann. «Ich bin gern mal ein bisschen schwach. Jetzt, wo du es sagst: Ich sehne mich schon lange danach, mal ein bisschen schwach zu sein.»
«Du bist perfekt», sagt er. «Perfekt für mich.»
Sie ist glücklich, fasst seine Worte als Kompliment auf, als verheißungsvolles Kompliment. Sie überhört die Warnung darin. Die Warnung, dass sie auch weiterhin perfekt für ihn sein muss und die vermeintliche Perfektion unter keinen Umständen – wenn sich die Gelegenheit bietet – gefährden darf. Stattdessen überlegt sie, wie sie ihre Unzulänglichkeiten am besten kaschieren kann, um die Frau zu sein, die er für perfekt hält. Tief im Innern weiß sie natürlich – genauso gut wie er –, dass die Perfektion eine Chimäre ist. Müsste sie all ihre Mängel und Macken aufzählen, wüsste sie nicht, wo sie anfangen sollte. Auf ihr Äußeres will sie gar nicht näher eingehen, doch sobald sie zunimmt, wird ihr Körper weich und blass, und das Fett sammelt sich rund um ihre Taille, sodass ihre Silhouette einem Zylinder gleicht oder einem Marshmallow. Hält sie sich zu lange in der Sonne auf, schwillt ihr Gesicht an, und rote Flecken sprenkeln Nase und Wangen. Ihr Haar war schon immer dicht und widerspenstig, eher Ross- als Menschenhaar. Und das ist nur der Anfang. Hinzu kommt ihre Sozialphobie, die sich in gewissen Situationen bemerkbar macht. Sie passt nicht in ihre Heimat und erst recht nicht hierher, in den Süden, wo das Sozialleben die Arena der Geschehnisse bildet, wo man Mut fassen und die Bühne erklimmen, die Stimme erheben und das Schauspiel um sich selbst eröffnen muss. Er soll nicht merken, wie leicht es ihr fällt, sich von der Welt abzuwenden, in sich selbst zurückzuziehen. In ihrer Heimat geht sie oft tagelang nicht vor die Tür, sie kann sich nicht überwinden, und wenn doch, dann nur zu Tageszeiten, zu denen niemand sonst auf der Straße ist. Warum? Sie weiß es nicht. Ein weiterer Spleen: Seit sie während des Übersetzungsstudiums anfing, hin und wieder zu dolmetschen, gibt sie in Stresssituationen alles, was ihr durch den Kopf geht, in verschiedenen Sprachen wieder. Wenn es ihr nicht gelingt, wenn ihr ein Wort entfallen ist, gerät sie ins Stocken und kann an nichts anderes mehr denken. Sie ist wie paralysiert, denn würde sie weitermachen, ohne das entfallene Wort gefunden zu haben, könnte ein Fluch entfesselt werden. Wer das entschieden hat? Auch das weiß sie nicht, nur dass es so ist und dass manchmal aus dem bloßen Gedanken an eine Sache eine Miniaturwirklichkeit erwächst, die sich allmählich ausdehnt und die eigene Wirklichkeit überlagert. Dass sie an Dinge glaubt, die nicht mit der Vernunft erklärbar sind, würde dem Reinlichen nicht gefallen. Nicht dass sie sich ständig über diese Themen den Kopf zerbrechen würde, aber wenn sie ehrlich ist, glaubt sie tief im Innern an Phänomene, die nicht mit der Vernunft erklärbar sind. Was die Sozialphobie und den möglichen Wörterfluch betrifft, hat sie mehr als genug Psychoratgeber gelesen, um zu wissen, dass diese Muster als Neurosen klassifiziert werden könnten. Oft bleiben Neurosen unbemerkt, die meisten Menschen leiden an der einen oder anderen Neurose, wirklich brenzlig wird es erst dann, wenn es den Betroffenen schwerfällt, mit den Neurosen zu leben, wenn sie den Alltag beeinträchtigen. Ob ihr Alltag beeinträchtigt wird, lässt sich schwer sagen. Wahrscheinlich nicht. Schließlich lebt sie und meistert das meiste, was sie sich vornimmt. Trotzdem bereiten die Neurosen ihr immer wieder starkes Unbehagen, unterhöhlen sie. Schon öfter hat sie eine Therapie in Erwägung gezogen. Doch dann musste sie an all die Menschen mit echten Problemen denken. Menschen, die vor einem Krieg geflohen sind oder in extremer Armut leben. Es ist, als hätte sie keinen Anspruch auf eine Neurose, als wären Leiden dieser Art zimperlichen Prinzessinnen vorbehalten, und sie möchte keine zimperliche Prinzessin sein. Sie kommt sich ertappt vor, überprivilegiert, überempfindlich, und sie verabscheut dieses Gefühl, fühlt sich besudelt. Besudelt von Wohlstand und einem bizarren Zeitgeist, Privilegien und Wahnsinn. Normalerweise hilft ihr die Natur. Bäume saugen die Schwermut auf, zersetzen sie. Doch in Florenz gibt es keine Natur. Nur kahle Hügel, umzäunte Weinhänge, private Jagdgründe, Stadt. Die Zypressen in der Ferne sind Privateigentum. Man kann nicht einfach hinfahren, um zwischen den Bäumen zu spazieren, den Duft einzuatmen, die Stämme zu berühren. Sie stehen nur da, als Kulisse, wie ein Gemälde, erhaben, unerreichbar. Sie weiß nicht, wie sie sich auf Dauer in Florenz zurechtfinden soll, ohne echte Natur, die ihre Leiden absorbieren könnte. Andererseits hat sie den Reinlichen, und dieser Umstand eröffnet ihr Möglichkeiten, die sie ausschöpfen muss.
Anfangs unternehmen sie ab und zu abendliche Spritztouren. Sie liebt es, im Auto neben ihm zu sitzen. Sie fahren durch Bergtunnel, aus der Toskana heraus, in die Emilia-Romagna hinein, vorbei an Feldern und alten verlassenen Gehöften. Hübsche ockerfarbene Gebäude, Olivenhaine, Feigenbäume, massive Holztische in den Gärten. Balkons mit Blick auf die jeweilige Ortschaft.
«Warum kauft niemand die Häuser und renoviert sie?», fragt sie.
Er weiß es nicht. Warum eine Ruine kaufen, wenn es schlüsselfertige, komfortable Wohnungen gibt? Mit Pool, Tiefgarage, Klimaanlage. Aber diese Häuser seien doch so schön gelegen. Ein bisschen weitab vom Schuss, findet er. Er macht Musik an, dreht die Lautstärke auf, öffnet das Schiebedach und lässt den warmen Wind herein.
An einem dieser Abende fahren sie in ein Industriegebiet vor Bologna. Sie lacht in sich hinein. Noch nie ist sie zum Vergnügen in ein Industriegebiet gefahren. Auf die Idee wäre sie nie gekommen. Der Reinliche aber schon. Er nimmt Kurs auf einen Gebäudeklotz, hält auf dem Parkplatz, schaltet den Motor aus. Sie sieht, wie die untergehende Sonne das Schild auf dem Dach erleuchtet. FIAT steht dort, in großen gelben Lettern vor dem orangen Abendhimmel.
«Stell dir vor, ich dürfte hier arbeiten», sagt der Reinliche.
«Was meinst du?», fragt sie.
«Stell dir vor, ich dürfte hier arbeiten», wiederholt er.
Sie lässt den Blick über das Gelände schweifen.
«Ich weiß ja nicht, ob das so reizvoll ist», sagt sie. «Eher ein ziemlicher … Albtraum.»
«Ein Albtraum?» Er blickt sie entgeistert an. «Ist dir klar, wie viele sich die Hand abhacken würden, um hier zu arbeiten?»
Nein, das ist ihr nicht klar.
«Hier, in so einer Halle?»
«In welcher Welt lebst du eigentlich?», fragt er.
Sie verstummt. Betrachtet sein Profil, während er den Blick zum Fiat-Schild hinaufwandern lässt, es wahrnimmt. Als bewundere er etwas Unvorstellbares. Sie sieht zu dem Schild hoch, versucht, dieselbe Schönheit zu finden wie er. Sich eine Schönheit vorzustellen, die sie noch nicht kennt, die jedoch existiert und sich entdecken lässt, wenn man nur empfänglich für sie ist.
«Stell dir vor, ich dürfte hier arbeiten», fährt der Reinliche verträumt fort, «dann würde ich einen BMW fahren.»
«Wer bei Fiat arbeitet, fährt doch wohl eher einen Fiat?»
Sie meint es als Scherz, zumal sie sich den Reinlichen kaum in einem Fiat vorstellen kann, man müsste ihn hineinpressen, hineinstopfen, es sähe grotesk aus, ein derart großer Mann in einem derart winzigen Auto. Doch der Reinliche versteht keinen Spaß.
«Alle Chefs fahren einen BMW», sagt er und lässt den Motor an, «das ist ein Naturgesetz.»
So ein Naturgesetz, wie sämtliche Mitarbeiterinnen zu vögeln?, will sie schreien, denn genau das machst du doch, ja, das machst du! Aber sie schreit nicht. Sie sitzt nur stumm auf dem Beifahrersitz, beißt die Zähne zusammen und sieht im Rückspiegel, wie das Fiat-Schild von der Dämmerung verschluckt wird.
Es gibt ein Vor und ein Nach der Manipulation. Das Misstrauen kommt schleichend, wie Feuchtigkeit in eine verputzte Wand kriecht, im Lauf der Nacht reißt die Fassade auf, wenn die Tropfen sich zu Eis ausdehnen. Sie muss ihn um jeden Preis dazu bringen, sich krankzumelden oder wenigstens zu Hause zu arbeiten. Also versucht sie, die Wohnung so behaglich wie möglich herzurichten. In der Küche schrubbt sie die dicken, speckigen Staubschichten weg und serviert ihm mittags liebevoll zubereitete Speisen. Doch nach jeder Mahlzeit entschuldigt er sich, er müsse los, nein, das lasse sich nicht von hier aus lösen. Sie merkt, wie sich langsam eine schwere Krankheit in ihr breitmacht. Die Krankheit bemächtigt sich ihres Körpers, quält sie, doch wenn sie sich ins Bett legt, um sich auszuruhen, packt sie im Dämmerzustand die Neugier. Es ist, als müsste sie die Krankheit ergründen. Sie kennenlernen, mit ihr kommunizieren. Solange der Reinliche fort ist, liegt sie reglos da und spürt in sich hinein. Dass es nicht gesund ist, weiß sie. Doch sie kann nicht anders. Der Krankheit zu begegnen, ist, wie die kalten Finger durch warmen Schlamm zu ziehen. Die Krankheit ist lieblich und bestialisch zugleich, dolce e bestiale allo stesso tempo, dulce y feroz al mismo tiempo. Ein süß schmeckendes Gift, das einen von innen verätzt. Mit der Zeit bleibt sie auch liegen, wenn er schon zu Hause ist. Das Essen steht nicht mehr fertig auf dem Tisch, sowie er über die Schwelle tritt. Sie verbringt so viel Zeit im Liegen, dass sie den Appetit verliert. Es gefällt ihm nicht. Sie müsse etwas essen. Eine seiner Schwestern habe als junges Mädchen an Anorexie gelitten, das habe ihn geprägt, die Erinnerungen würden ihn bis heute belasten. Sie lächelt matt. Hat sein Panzer womöglich einen Riss, eine Öffnung, durch die etwas hindurchdringen könnte?
«Aha», sagt sie. «Erzähl mir davon.»
Er sitzt auf der Bettkante und schüttelt den Glatzkopf. Er will nicht. Ihm kommen die Tränen. Er hat noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Sie liegt schweigend da und betrachtet ihn.
«Du musst darüber sprechen», sagt sie schließlich, «in dir hat sich etwas angestaut, es frisst dich auf.»
Er nickt.
«Ich will ja», sagt er. «Ich will ja, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.»
«Sah deine Schwester dir ähnlich?»
«Nein, überhaupt nicht. Sie war schön. Bevor sie krank wurde, war sie die Schönste im Viertel, vielleicht in ganz Bari. Alle waren verliebt in sie, die Zeit blieb stehen, wo sie vorbeiging. Dann magerte sie ab. Anfangs wurde ihre Anziehungskraft dadurch noch verstärkt. Sie wirkte zarter, zerbrechlicher, man wollte sie in den Arm nehmen, sie beschützen. Aber dann, plötzlich …»
«Ja?»
«… sah man die Leiche in ihr.»
Wieder bekommt der Reinliche feuchte Augen. Und dann weint er. Einzelne dicke Tränen rinnen ihm über die Wangen.
«Eine Leiche mit dunklen Augenhöhlen, starrem Blick, verfärbtem Augenweiß. Ihr ganzer Körper wirkte so leblos, grau und knorpelig. Ihre weichen, runden Hüften waren plötzlich knochig, und ihre prallen Pobacken verwandelten sich in schlaffe Säcke. Ihr Mund war nur noch ein dunkles Loch wie ein stummer Hilfeschrei in einem nicht enden wollenden Todesmoment. Ihre langen, dunklen, glänzenden Haare verfilzten, waren jetzt stumpf und aschfarben. Sie sah grässlich aus. Grässlich, Minnie. Als wäre eine Tote aus dem Grab geklettert, um durch die Straßen von Bari zu wandeln.»
Er muss innehalten, die Wörter gerinnen in seiner Kehle zu Brei. Auch sie ist gerührt. Selten hat sie Männer weinen sehen, und nie im Leben hätte sie erwartet, dass ausgerechnet er, der Reinliche, Il cazzone, einmal dazugehören würde.
«Ich habe eine Erinnerung an sie», fährt er verzweifelt fort, «aber sie ist unheimlich und beschämend.»
«Erzähl weiter», sagt sie.
Er schüttelt den Kopf.
«Ich kann nicht», sagt er. «Es tut zu weh. Ich schäme mich so.»
«Wenn man absolut aufrichtig von etwas erzählt, verschwindet die Scham. Sie ist wie ein Schimmelfilm, mit dem die Seele umhüllt, was wir in uns verschließen, obwohl es an der Luft heilen müsste.»
Sie legt ihm eine Hand auf den Arm. Sein Arm ist kräftig. Ein sonnengebräunter Männerarm mit hübscher Uhr, aufgekrempeltem Ärmel, schwarzer Behaarung. Ob sie die erste Frau ist, die diesen Arm heute berührt? Sie fragt ihn nicht. Er schluckt den Kloß in seinem Hals hinunter, räuspert sich.
«Na gut», sagt er. «Na gut, ich will es versuchen.»
«Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Ich mag es, dir zuzuhören.»
«Okay, Minnie, Folgendes: Damals war ich Leibwächter für einen Lokalpolitiker, der im Sommer ins Ausland reiste, und der gesamte Stab hatte ein paar Wochen frei. Am ersten Sonntag fuhr ich mit meinen Kollegen ans Meer. Fünf junge Männer am Strand, du kannst dir denken, dass wir uns gewisse Hoffnungen machten, ein paar Mädels aufzureißen. Meine Schwester war damals schon schwer krank, aber seit Kurzem in Therapie. Später wurde mir klar, dass die Psychologin sie ermuntert hatte, ihre Scham abzulegen, sich trotz der Krankheit zur Schau zu stellen. Damals war es offenbar in Mode, Störungen wie ihre auf diese Art zu behandeln. Wir liegen also im Sand. Meine Kollegen und ich. Und auf einmal kommt sie. Ich erkenne sie schon von Weitem, wie ein dunkler Schatten geht sie die Promenade entlang, aber ich tue so, als ob ich sie nicht sehe, ich will nicht, dass sie zu mir und den Jungs kommt, schließlich sind wir für gesunde Mädels hier. Meine Kollegen sollen nicht erfahren, dass so eine Krankheit in unserer Familie liegt, ich will nicht, dass sie ab jetzt an meine Schwester denken, wenn sie mich sehen, psychische Krankheiten vertragen sich nicht mit einem Job, der Reaktionsvermögen, Kraft und Mut erfordert. Meine Schwester steht jedenfalls oben auf der Promenade und blickt über den Strand. Aus den Augenwinkeln beobachte ich sie und presse mich ganz flach auf mein Badetuch, damit sie mich nicht sieht. Dann höre ich, wie sie mich ruft. Laut und vernehmlich ruft sie meinen Namen. Ich schließe die Augen und stelle mich schlafend. Die anderen scheinen sie nicht zu hören, das Wellenrauschen verschluckt ihre Stimme. Sie verstummt. Ich blinzle vorsichtig und sehe, wie sie losgeht. Ich fürchte, sie könnte meine Richtung einschlagen, aber das tut sie nicht. Sie geht in Richtung Wasser, bleibt vielleicht fünfzig, sechzig Meter von uns stehen. Rollt ihre Strandmatte aus. Dann streift sie ihre Strandtunika ab. Im Stehen, obwohl sie sich genauso gut setzen könnte. Wieso machst du das, du dummer, kranker Mensch?, denke ich. Da steht sie, in der Sonne, in der Meeresbrise, und streift ihre Tunika ab. Der Anblick ist brutal. Das Leichenweiß strahlt regelrecht aus ihr heraus. Man sieht sie ihr an, die Leiche, der Tod strömt aus jeder einzelnen Pore. Ihre Augen starren aus dem Totenschädel. Sie sieht sich um, und als sie merkt, wie die Leute sie anstarren, lächelt sie ihnen ins Gesicht. Hast du gehört? Sie lächelt. Wer so aussieht, darf doch nicht lächeln! Lächelnde Leichen gibt es nicht! Wobei, es ist kein wirkliches Lächeln, eher ein Todesgrinsen. Alles verstummt, nichts ist mehr zu hören außer dem ewigen Meeresrauschen. Sie fingert an den Bikinischnüren über ihren nicht vorhandenen Hüften herum, zieht die Schleifen mit ihren knochigen Fingern straff. Bitte, leg dich hin, denke ich, bitte bereite dem Spektakel ein Ende. Aber als ob. Anstatt sich hinzulegen, geht sie los. Verstehst du, Minnie?, sie geht los, geht den Strand hinunter, und als ihre Fußspitzen das Wasser berühren, macht sie eine Viertelumdrehung und spaziert am Ufer entlang, setzt sich den Blicken der Leute aus, die sie schockiert anstarren. Das muss eine absurde Aufgabe ihrer Psychologin sein, denke ich und will nur noch im Erdboden versinken. Auch meine Kollegen haben sich aufgesetzt und glotzen meine Schwester an, obwohl sie natürlich nicht wissen, dass sie meine Schwester ist. ‹Was zum Henker …?›, sagt einer. ‹Ekelhaft›, sagt ein anderer. Und ein Dritter: ‹Eine lebende Tote, una morta viva, cazzo, porca puttana.› Ich liege da, eine Wange in den heißen Sand gedrückt. In der Hitze brennt die Scham noch schmerzhafter. Verdammt, geh nach Hause. Geh nach Hause, geh einfach nur nach Hause, kranke, todkranke Menschen sollten nicht den Strand entlangspazieren, wo die Leute sich sonnen und die Seele baumeln lassen. Aber sie denkt nicht dran. Als sie ein paarmal hin und her gelaufen ist, die Blicke der Leute wie an ihr festgenagelt, sucht sie einen neuen Platz für ihre Matte. Sie – meine Schwester –, aber auch die Leiche in ihr, nähern sich einer Familie. Sie lässt sich im Sand nieder, nur wenige Meter entfernt von einer Mutter, die gerade ihr Baby unter einem Sonnenschirm stillt. Bei ihr sitzen zwei Kinder, vielleicht fünf Jahre alt, und ein Mann, wahrscheinlich ihr Partner. Meine Schwester sitzt also im Sand und betrachtet lächelnd die stillende Frau. Als ich sie so sehe, begreife ich, dass ihr nicht bewusst sein kann, wie grotesk sie auf andere wirkt. Ein typisches Symptom ihrer Krankheit. Man wird blind dafür, wie man wirklich aussieht, blind für den eigenen Todesschatten. Die stillende Frau scheint in der Hitze festgefroren. Eine Weile starrt sie meine Schwester an. Dann richtet sie sich abrupt auf, das Baby noch an der Brust. ‹Weg mit dir!›, schreit sie. ‹Weg mit dir, weg von meinen Kindern, weg von meiner Familie!› Der Mann springt auf, stürzt zu seiner Frau, legt ihr einen Arm um die Schultern und zieht sie zurück, als wollte er eine Art Mauer zwischen seiner Frau und meiner Schwester bilden. Als wäre meine Schwester mit dem Tod infiziert und hoch ansteckend. ‹Bitte, gehen Sie›, sagt der Mann. ‹Ich verstehe, dass Sie krank sind, aber bitte gehen Sie weg. Dahinten ist doch genug Platz, Sie müssen nicht hier sein, in der Nähe von Kindern.› Aus dem Gesicht meiner Schwester verschwindet das Lächeln. Der Totenschädel starrt den Vater an. ‹Ich habe ein Recht darauf, hier zu sitzen›, sagt sie dann. ‹Vielleicht bin ich krank, aber trotzdem darf ich hier sitzen. Ich kann niemanden anstecken. Was ich habe, ist nicht ansteckend.› Der Mann nickt. Dann geht er zu seiner Frau und den Kindern und klappt den Sonnenschirm zu. Er faltet die Badetücher zusammen und sammelt Klamotten und Spielzeug ein. Die Frau sieht ihm zu, das Baby weiter an die Brust gedrückt. Sie verschwinden ans äußerste Strandende. Andere tun es ihnen gleich. Nach einer Weile hat sich rund um meine Schwester ein leerer Kreis gebildet. Ein leerer Kreis, mit einem Radius von vielleicht fünf Metern. Sie sitzt einsam in der Mitte und blickt aufs Meer hinaus. Mir steckt ein Eisenklumpen im Hals. Nach einer Weile stehe ich auf und gehe nach Hause. Ich glaube, meine Schwester steht in ihrem leeren Kreis und schaut mir nach, aber ich drehe mich nicht um.»
Jetzt weint er ohne jede Hemmung. Die Scham strömt aus ihm hinaus und spült den Schimmel fort. Darunter zeigt sich der pure Schmerz, sodass sie die Möglichkeit hat, sich um ihn zu kümmern, ihm zu helfen, ihm näherzukommen. Sie will diesen Moment mit ihm teilen, ein Mensch neben einem anderen sein, das Gleiche fühlen wie er, seinen Schmerz lindern. Sie spürt es so deutlich. Wie die Erinnerung an seine Schwester ihn innerlich zerreißt. Doch sosehr sie sich auch anstrengt, sie findet keinen Zugang zu ihrem Mitleid, als wäre die Fähigkeit getrübt von ihrem eigenen Schmerz. Der Reinliche ist zu stark und sie zu schwach, nicht einmal für einen kurzen Augenblick kann sie vergessen, welche Macht er über sie hat, wie mühelos er sie verletzen kann, jederzeit. Statt Mitgefühl zu empfinden, stellt sie sachlich und strategisch fest, dass der Reinliche also doch einen wunden Punkt hat, den er gerade vor ihr entblößt. Sie sieht genau, wo der wunde Punkt sich befindet, sie könnte mit dem Finger darin herumstochern, könnte den Reinlichen lenken, indem sie an seine Wunde rührt. Ein verwerflicher, manipulativer Gedanke. Anderseits verspürt sie eine bittersüße Überlegenheit. Sie vergisst zu fragen, wo die Schwester heute lebt, ob sie geheilt ist.
Der Reinliche sammelt sich. Ihm ist bewusst, was hier vor sich geht. Er trocknet die Tränen und sagt: «Ich will nie wieder darüber reden. Danke, dass du mir zugehört hast, aber ich will nie wieder darüber reden.»
Sie will ihm ins Gesicht schreien, sie könne so ein