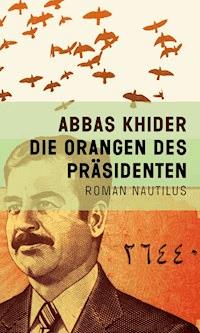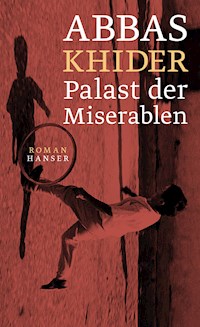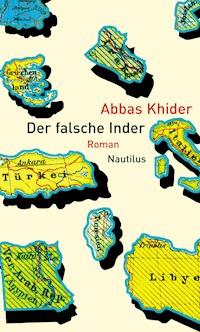Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oktober 1999 - im Irak herrscht Saddam Hussein, in Libyen Gaddafi, in Ägypten Mubarak, in Syrien Hafiz al-Assad und in Jordanien König Abdullah II bin Hussein. Die arabische Facebook und Twitter-Revolution gegen die Despoten ist noch fernste Zukunft. Einen Brief an der Zensur vorbeizuschicken, ist ein langwieriges und gefährliches Abenteuer. Das nach dem Golfkrieg verhängte Handelsembargo treibt die irakische Bevölkerung ins Elend - einzig Auberginen gibt es im Überfluss, sodass die Iraker ihrem Land den Beinamen "Auberginenrepublik " verpasst haben. Salim, ein ehemaliger Student, schlägt sich im libyschen Exil als Bauarbeiter durch. Er war wegen des Besitzes verbotener Bücher verhaftet worden. Über seinen Onkel ist ihm die Flucht aus dem Irak gelungen, doch er hat nie wieder von seiner Familie, seinen Freunden und vor allem von seiner Geliebten Samia gehört, deren Namen er auch unter Folter nicht preisgegeben hatte. Nun erfährt er in Bengasi von einem die ganze arabische Welt überspannenden Netzwerk von illegalen Briefboten und wagt es, Samia einen Brief mit einem Lebenszeichen zu senden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abbas Khider wurde 1973 in Bagdad geboren. 1996 floh er nach einer Verurteilung aufgrund »politischer Gründe« und nach einer zweijährigen Gefängnisstrafe aus dem Irak. Von 1996 bis 1999 hielt er sich als illegaler Flüchtling in verschiedenen Ländern auf, seit 2000 lebt er in Deutschland, derzeit in Berlin. Sein Debütroman Der falsche Inder (2008) wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis, zuletzt erschien 2011 Die Orangen des Präsidenten.
»Abbas Khider ist ein unglaublich raffinierter Erzähler.« Hubert Spiegel, Deutschlandfunk
»Es ist eine vollkommen schmucklose, schwindelsicher kitschfreie Sprache, die Abbas Khider benutzt und die eher aus der Lakonie ihre Poesie bezieht.« Jens Jessen, Die Zeit
Abbas Khider
Brief in die Auberginenrepublik
Roman
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste Berlin und das Arbeitsstipendium der Robert-Bosch-Stiftung gefördert.
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49a · D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2012
Originalveröffentlichung · Erstausgabe Februar 2013
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Landkarte: Beate Stangl
Druck und Bindung:
Freiburger Graphische Betriebe
1. Auflage
Print ISBN 978-3-89401-770-5
E-Book EPUB ISBN 978-3-86438-130-0
E-Book PDF ISBN 978-3-86438-131-7
Fast ein Jahrzehnt, von den letzten Jahren des 20. bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts, hast Du kaum Briefe von mir erhalten, und ich ebenso wenige von Dir. Für Dich und für die anderen wartenden, traurigen und dennoch hoffnungsvollen Seelen ist dieses Buch.
Tage kommen und gehenalles bleibt wie es istNichts bleibt wie es istes zerbricht wie PorzellanDu bemühst dichdie Scherben zu klebenzu einem Gefäßund weinstweil es nicht glückt
Rose Ausländer
Die Erde ist schon immer oval gewesen, wie ein Ei, und sie steht still, weil sie nicht haltlos in der Leere schwebt, sondern auf die Hörner eines Ochsen gespießt steckt. Die vier Beine des Ochsen stehen fest verankert in der Tiefe des unendlichen Weltalls. Eines seiner Hinterbeine ruht im Paradies, das andere brennt in der Hölle. Von den beiden vorderen Hufen steht einer im Wasser der Schöpfung und einer im Feuer Satans. Die Seite des Erdeneis, die sich dem Wasser der Schöpfung und dem Paradies zuwendet, ist mit Wohlbehagen und Frieden gesegnet und befindet sich in einem Zustand dauerhaften Glücks. Die andere Hälfte hingegen, die über der Hölle und dem Feuer Satans steht, kocht im Fegefeuer von Diktaturen, Krieg und Armut.
Hin und wieder jedoch wechselt der Weltenochse seine Beinstellung, und dies hat fatale Folgen für das Weltenei: Es gerät aus dem Gleichgewicht, und jede Schwankung erzeugt immer wieder neue Zeitalter und Epochen. Aus diesem fiebrigen Zustand des Eis schlüpft die Menschheitsgeschichte, die eine immer wiederkehrende Entwicklung erfährt: Zuerst erlebt die eine Seite der Erde – die Hälfte der Menschheit – Wohlstand, dann aber folgt tiefe Dunkelheit. Es ist, wie Nietzsche sagen würde, eine ewige Wiederkehr des Immergleichen: Die Geschichte verläuft nicht linear, sondern im Teufelskreis einer wechselnden Abfolge angenehmer und unerträglicher Ereignisse.
Dank der Weisheit des Heiligen Ochsen waren jedoch das Lachen und das Weinen in der Welt gerecht unter den Menschen verteilt – bis vor einigen Jahrzehnten der Ochse plötzlich in seiner Beinstellung erstarrte. Seitdem steht die Welt still. Für die Menschen, die zuvor in der Dunkelheit lebten, währt diese weiter fort, während die anderen weiterhin in vollem Licht und Glanz stehen. Und niemand im Universum weiß, warum der Ochse sich nicht mehr bewegt …
Auf der dunklen Seite des Eis beginnt die Geschichte eines Briefes, die ich Euch erzählen will. Sie spielt in Afrika und in Asien. Genauer: in Arabien. Ganz genau gesagt, beginnt sie in Libyen und endet im Irak. Und um mikroskopisch exakt zu sein, spielt sie in diesen armen Ländern in den allerdunkelsten Gegenden: den Stadtvierteln Gaddafi City in Bengasi und Saddam City in Bagdad.
Erstes Kapitel
Salim Al-Kateb, 27 Jahre alt, BauarbeiterFreitag, 1. Oktober 1999Bengasi, Libyen
Das elendige, von armen Einheimischen und Ausländern bevölkerte Viertel Ras Ebeda, das man hier spöttisch »Gaddafi City« nennt, schläft tief unter der Decke der schwülen Hitze. Es ist der 1. Oktober, und dennoch sieht alles aus wie in einem Dampfbad. Als ich die Hauptstraße erreiche, die nur dreihundert Meter von meinem Haus entfernt liegt, sticht mir die Hitze bis in die Knochen. Die Bushaltestelle steht mitten in der Sonne, ohne Mauer oder Dach. Um mich herum gibt es nur leere Straßen und geschlossene Geschäfte. Nichts bewegt sich, allein der Wind lässt den Staub und einige am Straßenrand liegende Zeitungsfetzen, Zettel und Plastiktüten hochfliegen.
Dieses Wetter verwandelt Bengasi zur Zeit der Mittagsruhe in eine Geisterstadt. Fast alle Menschen sitzen daheim in ihren Wohnungen, genießen die kühle Luft der Klimaanlage, halten Mittagsschlaf und glotzen ägyptische und syrische Seifenopern. Seit die Regierung Satelliten erlaubt hat, machen die Leute hier nichts anderes, als die Welt auf dem Bildschirm zu entdecken.
Endlich, ein weiß-blauer Bus taucht auf. Der Fahrer fährt langsam, hält an und ruft: »Stadtmitte, Strandpromenade. Schnell!« Ich steige ein und setze mich auf einen der hinteren Plätze. Außer mir gibt es noch acht weitere Fahrgäste. Die klimatischen Verhältnisse im Inneren des Busses gleichen einer libyschen Bäckerei. Alles riecht nach Fett und nach Schweiß. Die Klimaanlage funktioniert nicht, und ich bin bereits nach kurzer Zeit schweißgebadet. Keiner sagt etwas. Wieso eigentlich? Normalerweise plaudern die Menschen hierzulande gern. Stau gibt es zum Glück keinen. Der Bus fährt trotzdem so langsam, als würde er behutsam auf Eiern rollen. Bis ich die Nasserstraße erreiche, wird es bestimmt ein Weilchen dauern. Doch ich bin nicht weit vom Ziel entfernt.
Unfassbar, dass es nur noch wenige Minuten dauern wird, bis ich den Brief abschicken kann und darf. Zwei Jahre habe ich warten müssen. Seit zwei verdammten Jahren träume ich davon, eine Möglichkeit zu finden, ihn in einen Briefumschlag zu stecken und »Adieu« zu sagen.
Die letzten beiden Tage habe ich ausschließlich damit verbracht, diesen Brief zu verfassen. Ich arbeitete an ihm, und noch gestern überdachte, verbesserte und änderte ich das Geschriebene. Dabei musste ich immer an Samia denken, wollte ihr eine Menge erzählen und konnte doch nur wenig sagen. Auch früher schrieb ich zahlreiche Briefe an sie, die sich im Laufe der Zeit in ein kleines Buch verwandelten, das ich jedoch vernichtete, weil mich die Hoffnungslosigkeit übermannte, alles wäre vergebens und diese Briefe würden niemals abgeschickt werden. Es war und ist mir immer noch unvorstellbar, einen Brief einfach mit einer Briefmarke zu bekleben und loszuschicken. Wenn es so einfach wäre, schriebe ich jede Woche einen langen Brief an Samia.
In den ersten Monaten nach meiner Ankunft in Bengasi ging ich einmal wöchentlich zur Post. Jedes Mal stand ich vor dem Postgebäude und begriff, dass diese Idee nicht besonders gut war. Schnell gab ich auf und kehrte mit dem Brief nach Hause zurück, setzte mich an meinen Schreibtisch und schrieb neue Sätze hinzu. Meine damaligen ägyptischen Mitbewohner, mit denen ich immer noch auf der Baustelle arbeite und anfangs einige Monate im Stadtbezirk Sidi-Hussein zusammengewohnt hatte, bevor ich in meine jetzige Wohnung in der Gaddafi City gezogen bin, lachten mich aus und spotteten, ich sei in eine Postangestellte oder gar in das gesamte Postamt verliebt.
Als ich das erste Mal in der Poststelle ankam, standen Leute in einer langen Warteschlange vor mir. Fast dreißig Minuten musste ich anstehen, bis ich endlich an die Reihe kam. Die unfreundliche Angestellte mit ihrem übertriebenen, stark glänzenden Make-up, fleckig wie ein durstiger Storch, kaute so energisch auf ihrem Kaugummi, dass der Eindruck entstand, sie wolle ihn sogleich auf mich oder die anderen Kunden ausspeien. Ihr gelangweilter Blick streifte mein Gesicht, und dann schleuderte sie ein »Was?« heraus. Ich antwortete nicht, drehte mich einfach um und verschwand umgehend. Vor dem Postschalter und dem bunt bemalten Gesicht dieser Frau war plötzlich die Frage in meinem Kopf aufgetaucht: Was, wenn der Brief in den Händen der Polizei landen und Samia deswegen festgenommen würde? Diese Vorstellung machte mich unendlich traurig und wütend. Wenn ich daran dachte, zitterte ich vor Angst. Ich wusste, die Mörder in Bagdad würden Samias Leben in eine noch qualvollere Hölle verwandeln, sollten sie von den Briefen erfahren, die ich ihr schickte. So schaffte ich es nie, tatsächlich einen der Briefe irgendeinem Postbeamten in die Hände zu drücken. Manchmal kam es mir vor, als würde mich jemand beobachten.
Kein Wunder, dass ich mir solche Sorgen mache! Ich bin politisch verfolgt. Alles geschah im Jahr 1997 für uns unerwartet. Wir waren acht Freunde aus der Bagdader Universität, fünf Jungs und drei Mädchen, die sich jede Woche zum Leseabend getroffen und über ein Buch diskutiert hatten. Und das brachte uns die Anklage ein: Lesen verbotener Bücher. Bis heute ist mir unklar, wie uns die Polizei aufspürte. Alle Männer wurden an einem sonnigen Tag im Mai auf dem Universitätsgelände festgenommen, nicht aber die drei Kommilitoninnen. Warum sie nicht? Mir ist das ein Rätsel! Auch im Verhörzimmer hat keiner von uns – Jungs – die Namen der Mädchen unter Folter verraten.
Sieben Tage meines Lebens verbrachte ich im Kerker, oder genauer in der Schweiz, wie man das Gefängnis im Irak ironisch bezeichnet. Vielleicht, weil das Elektroschock-Gerät »made in Switzerland« ist? Es waren die schrecklichsten sieben Tage meines Lebens. Ich hockte in einer engen Zelle, gefühlt einen guten Meter im Quadrat, mit nichts außer vier Wänden, einer Glühbirne, einem Eimer zum Pinkeln, einem Trinkglas und einer schmutzigen Decke. Ich kam mir vor wie eingesargt, in einem altägyptischen Grab, in dem man nur das Nötigste ins Jenseits mitnehmen darf. Den ganzen Tag herrschte Totenstille. Doch ab und zu öffnete sich die Tür, wenn die Wärter mit dem Essen – einem Stück Fladenbrot – auftauchten oder mich zum Verhör abholten. Eine Woche lang lebte ich zwischen diesem Grab und einer Folterkammer, die man Verhörzimmer nennt.
Weil mein Onkel Mazen es schaffte, die Verhörpolizisten zügig zu bestechen, entließ man mich, noch bevor meine Akte in der Sicherheitszentrale landete. Mein Onkel kennt alle, er ist Unternehmer, einer, der mit vielen wichtigen Männern in der Regierung zusammenarbeitet. Er holte mich ab und sagte zu mir: »Deine Akte wird bald wieder dran sein. Ich habe veranlasst, dass sie für ein paar Tage auf die Seite gelegt wird. Bald sucht man dich wieder. Du solltest sofort ins Ausland gehen. Ich habe alles für deine Flucht organisiert.«
Eine Stunde später nahmen mich zwei kurdische Männer mit. Ich musste mich in ihrem Lastwagen verstecken, fast zwanzig Stunden lang. Solange dauerte die Fahrt gen Norden bis an die Grenze zu Syrien. Mit einem Boot ruderten wir über den Grenzfluss Euphrat, und einige Minuten später befand ich mich nicht mehr im Irak. Auf syrischer Seite empfingen mich Iraker und ein paar syrische Polizisten. Mit einem Jeep fuhren wir bis in die Stadt Kamischli. Dort gaben mir Mitglieder der irakischen Kommunistischen Partei einen gefälschten Pass und schickten mich weiter nach Damaskus. Doch in Syrien wollten sie mich nicht behalten: Ich musste das Land verlassen und bis nach Libyen weiterfahren. Die Leute in Damaskus sagten: »Keiner kommt nach nur einer Woche aus dem Knast. Verschwinde schleunigst nach Libyen! Damaskus wird gefährlich für dich, weil viele einen Maulwurf in dir vermuten werden. Und durch den Ruf deines Onkels bist du hier sowieso nicht willkommen.«
Nichts davon verstand ich. Ich kam mir vor wie ein Ball, der hin und her geworfen wird. Innerhalb weniger Tage hatte sich mein ganzes Leben verändert. Das ist meine Geschichte, sie ist kurz, zugleich aber auch sehr lang. Nur zehn Tage meines Lebens, in denen ich alles verloren habe: meine Familie, meine Heimat, meine Freundin, mein Studium und meinen Ruf. Und jetzt hocke ich in Nordafrika, arbeite auf der Baustelle und versuche zu überleben. Mein Traum ist, eine Möglichkeit zu finden, einen Brief an Samia zu schicken und ihr zu berichten, dass ich kein Verräter bin, noch lebe und sie nicht vergessen habe.
Endlich aber gibt es eine Lösung. Oder es scheint mir zumindest so, als wäre eine Lösung greifbar. Vor einigen Tagen besuchte ich das Café Tigris, in der Nähe des Midan Al-Schajare – des Baum-Platzes – im Zentrum, das einzige Café in Bengasi, dessen Besitzer ein Iraker ist. Hier werden den ganzen Tag traurige südirakische Lieder gespielt, treffen sich viele irakische Arbeiter und trinken den irakischen Tee, der so schwarz und bitter wie das Herz der Politiker unseres Landes ist. Sie beschweren sich rund um die Uhr über die Politik in ihrer Heimat und über das langweilige Leben in Libyen. Mir kam in diesem einzigartigen »Tigris« zu Ohren, es gäbe einen guten neuen Friseur in der Stadt. Er sei auch Iraker, und ich bekam die Idee, mir von ihm die Haare schneiden zu lassen.
Der junge Jafer bestätigte alle Vorurteile über Friseure. Er schwatzte ohne Punkt und Komma, wie ein Radio auf zwei Beinen, ein Wasserfall aus Gerede, Gerüchten und Nachrichten. Als er mich nach dem Befinden meiner Familie in Bagdad fragte, entgegnete ich, dass ich keinerlei Ahnung hätte. Bei meinen Angehörigen gäbe es keinen Festnetzanschluss, und selbst wenn, ich könnte sie nicht anrufen, wegen der Überwachung! Briefe verschicken oder auch empfangen sei ebenso unmöglich. Jafer verstand sofort, schließlich stammte er nicht vom Mars oder aus Luxemburg. Er behauptete, es bestünde eine Möglichkeit, Kontakt mit der Familie im Irak herzustellen.
»Ziemlich kompliziert«, meinte er. »Man erzählt sich, es gibt in der jordanischen Hauptstadt einige irakische Lastwagenfahrer, die ständig zwischen Bagdad und Amman unterwegs sind.« Seit dem Handelsembargo von 1991 sei Amman die einzige Stadt, von der man noch etwas in den Irak transportieren könne. Die Fahrer lieferten illegal auch Briefe der Exilanten von Amman nach Bagdad. Auch Antwortpost der Angehörigen aus Bagdad könne von denselben Fahrern nach Amman mitgenommen werden. »Früher wusste ich auch nicht, wie man an diese Lastwagenfahrer herankommen kann. Sie fürchten sich natürlich auch, von der Sicherheitspolizei erwischt zu werden. Die einzige Möglichkeit ist, jemanden aufzutreiben, der einen dieser Fahrer kennt. Und ich kenne so einen Mann.«
»Amman? Das ist in Jordanien! Wir sind hier in Nordafrika!«
»Im Exil gibt es für jedes Rätsel eine Lösung. Vor kurzem habe ich von einem Libyer in Bengasi namens Malik Gaddaf-A-Dam gehört. Er besitzt im Zentrum ein Reisebüro, das Al-Amel – Hoffnung – heißt. Deine Hoffnung kann nur in diesem Reisebüro erfüllt werden. Malik arbeitet auch als Briefmanager und hat Kontakte zu den Lastwagenfahrern. Die Briefe werden mit Sammeltaxis in ein Reisebüro in Amman transportiert, das Maliks Freund oder Geschäftspartner gehört. Die Lastwagenfahrer geben oder holen die Briefe dort ab. Dieser Freund verlangt aber pro Brief 200 Dollar. Niemals hätte ich gedacht, dass Briefsenden so teuer sein kann.«
»200 Dollar? Fast 600 libysche Dinar? Ich verdiene nicht einmal 400 Dinar im Monat.«
»So sind die Tatsachen.«
»Das heißt, ich muss das Geld ausgeben, das ich in den letzten Monaten gespart habe. Und wie erreiche ich diesen Malik?«, fragte ich Jafer.
»Wenn du möchtest, organisiere ich dir einen Termin mit ihm.«
Zu diesem Treffen bin ich nun unterwegs. Ich hoffe sehr, dass dieser Malik wirklich geschäftstüchtig ist. Was soll ich tun, wenn er von der Sicherheitspolizei oder einer von den Maulwürfen ist? Dann habe ich den Brief und das Geld verloren und obendrein vermutlich die Aufenthaltserlaubnis in Libyen. Vielleicht bekommen die Libyer sogar heraus, dass ich hier mit einem gefälschten Reisepass lebe. Nein, er ist bestimmt ein richtiger Geschäftsmann. Im Exil leben unzählige Kreaturen, die an nichts anderes als an Geschäfte denken. Ohne diese Leute wäre das Exil die Hölle. Diese Figuren aber sind die Fachmänner der Hölle. Ohne die Mafia und solche Geschöpfe kommt ein Exilant nicht aus. Manchmal braucht man sie einfach, die Geldgeilen des Friedhofs, die einem das Leben im Grab erleichtern können.
Was lernst du auf dieser verdammten Erde? Ist es so weit gekommen, dass ich daran glaube, die Mafiosi wären notwendig? Vielleicht sind sie es, nicht im Leben aller, wohl aber im Leben eines Exilanten. Der Brief steckt jetzt in meiner Hosentasche und wird noch heute versendet. Und mir ist vollkommen egal, ob Malik Mafioso, Maulwurf oder der Teufel ist. Für mich ist er einfach ein Postbote.
Obwohl ich mich in diesem Brief an Samia wende, habe ich ihn nicht an sie, sondern eigentlich an mich selbst geschrieben. Ich bin vermutlich derjenige, den Emile Cioran meinte, als er sagte: »Nur der Schriftsteller ohne Leser kann sich den Luxus leisten, aufrichtig zu sein. Er wendet sich an niemanden, höchstens an sich selber.« Und diesen Brief habe ich für mich und das Nichts verfasst, weil er höchstwahrscheinlich seine Empfängerin nicht erreichen wird. Aber warum mache ich mir dann so viele Gedanken darüber? Ich habe doch, seit ich in Bengasi bin, aufgehört, alles begreifen zu wollen. Das sind unschätzbare Vorteile des Exils. Man erreicht eine Stufe völliger Gleichgültigkeit und nimmt die Dinge, wie man sie vorfindet. Das Nicht-Denken, die Gleichgültigkeit und die Leichtigkeit könnten auch ein Ort persönlicher Freiheit sein. Alles kann ein solcher Ort sein, sogar das Schreiben eines Briefes oder auch nur ein einfacher Stuhlgang. Was sagte Mustafa zu mir über die neue Gottheit, die er geschaffen hat? »Die Scheiße ist die einzige Göttin der guten Taten.« Ich erinnere mich immer noch lebhaft an ihn. Dabei bin ich ihm nur ein einziges Mal begegnet. Und auch nur für zwei Stunden. Mehr nicht.
Mustafa traf ich in Bagdad, als ich in der Haftanstalt Rassafa saß. In jener winzigen, halbdunklen, feuchten, schmutzigen, stinkenden Gefängniszelle öffnete sich einmal die Tür, und die Wärter stießen einen Mann hinein. Er stand vor mir, regungslos wie ein 50-Kilo-Mehlsack. Ein brauner, kahlköpfiger Mann. Vermutlich um die dreißig Jahre alt. Unerwartet befand ich mich nicht mehr allein in der Zelle. Es war so gut, in jenem Loch wieder auf einen Menschen zu treffen. Der Ankömmling grinste. Seine großen schwarzen Augen wirkten zugleich fröhlich und verloren, als ob er von einem Dämon besessen wäre. Anfangs vermutete ich, er müsse verrückt sein. Mustafa war Mitglied einer verbotenen islamischen Partei. Mehr wollte er mir nicht mitteilen. Was er mir hingegen gern und ausgiebig erzählte, waren seine Erlebnisse im Verhörbüro wenige Minuten zuvor.