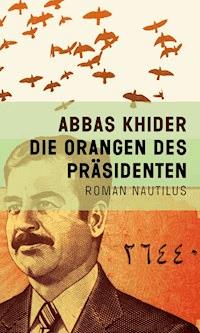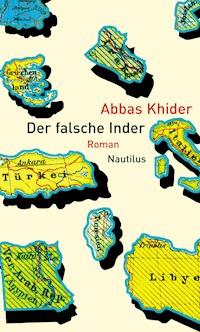
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein geheimnisvolles arabisches Manuskript im ICE Berlin-München, das niemandem zu gehören scheint und worin acht Mal auf verschiedene Weise die Lebensgeschichte desjenigen erzählt wird, der es zufällig findet und liest. Dieses Romandebüt handelt von der Flucht eines jungen Irakers, der unter Saddam Hussein im Gefängnis saß und vor Krieg und Unterdrückung flieht, sich in mehreren Ländern als Hauslehrer, Gelegenheitsarbeiter, Kellner durchschlägt; der vom Unglück verfolgt scheint und doch immer wieder auf wundersame Weise gerettet wird. Auf seiner Reise durch Nordafrika und Europa trifft er viele andere Flüchtlinge aus aller Welt, die wie er auf der Suche nach einem Leben ohne Hunger und Krieg sind und dafür sehr viel opfern. Ihre Stimmen und Schicksale verbinden sich in Khiders Roman zu einem modernen realistischen Märchen. Abbas Khider verbindet das Tragische mit dem Komischen, das Groteske mit dem Alltäglichen, die Exotik des Orients mit den Lebenserfahrungen eines Flüchtlings. Er beeindruckt durch seinen ungeschönten Blick und die Beiläufigkeit, mit der er vom Elend wie von Wundern erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abbas Khider
Der falsche Inder
Roman
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2008Originalveröffentlichung August 2008Umschlaggestaltung: Maja Bechert, www.majabechert.deAutorenporträt hintere Umschlagklappe: Jacob StedenDruck und Bindung: Freiburger Graphische Betriebe4. Auflage April 2011Print · ISBN 978-3-89401-576-3eBook · ISBN 978-3-86438-041-9 (ePub)ISBN 978-3-86438-042-6 (PDF)
Für die, die eine Sekunde vor dem Todnoch von zwei Flügeln träumen.
I
»Intercity Express 1511, Berlin–München, über Leipzig, Bamberg, Nürnberg, Ingolstadt. Planmäßige Abfahrt 12 Uhr 57.« Unangenehm blechern die Stimme aus dem Lautsprecher. Ein kurzer Blick auf die große Uhr am Bahnsteig: 12.30. Eine knappe halbe Stunde noch. Ich deponiere meine Zeitung und den Kaffee-zum-Mitnehmen auf der Bank. Noch ein langer Blick durch den Bahnhof Zoologischer Garten.
Alles leer. Für einen Moment das Gefühl, auf diesem Bahnhof mutterseelenallein zu sein. Die Menschen sind verschwunden, oder genauer, niemals da gewesen. Alles leer. Alles hell und sauber. Keine Züge, keine Reisenden, keine Lautsprecher. Nichts, nur ich und der leere Bahnhof Zoo, das große Nichts um mich herum. Wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Wo sind die anderen? Solche Fragen wirbeln durch meinen Kopf wie Trommeln auf einem afrikanischen Fest. Alles leer wie eine endlose Wüste, nackte Berge oder klares Wasser. Aber auch unheimlich wie der Wald nach einem gewaltigen Gewitter. Und meine Fragen laut und dennoch leise, tönend und dennoch stimmlos.
Dieses Gefühl dauert ein paar Minuten an, oder waren es mehr als nur ein paar Minuten? Nicht das erste Mal, dass ich die Orientierung verloren habe. Seit einigen Jahren schon erlebe ich ab und zu diesen Wahnsinn. Manchmal habe ich Angst, dass ich eines Tages aus solch einer Wüste in meinem Kopf nicht mehr zurückkehre.
Gott sei Dank, die Bahnhofshalle ist noch da und auch die Sprüche an den Wänden: »Mein Spaßvogel ist in seinem Spaß verloren geflogen.« »Simone ist meine Maus.« Auch die Currywurst- und die Hotdogbude sind noch da, die Menschen …
12.40 Uhr. Noch einmal ein Blick über den Bahnhof, aber diesmal ohne Begleitung einer afrikanischen Trommel. Der Bahnsteig voll. Reisende steigen ein oder suchen einen Ausgang. Einige rennen, um den Anschlusszug nicht zu verpassen. Eine Gruppe halbnackter Mädchen und Jungs mit kurzen Hosen und Sonnen-Tops schlendern langsam mit ihren Rucksäcken den Bahnsteig entlang. Beinahe wie eine Schulklasse. Die Mädchen lachen und beleben den Bahnhof mit ihren hellen, lauten Stimmen. Der Gruppe voran ein paar ältere Leute. Wohl die Lehrer. Mit ernsten Gesichtern. Fast alle ziehen schwarze Koffer auf Rollen hinter sich her.
Überall auf dem Bahnhof Tauben. Sie haben sogar ihre Nester unter die Dachschräge der Bahnhofshalle gebaut. Eine männliche Taube verführt gerade eine weibliche. Das Männchen breitet seine Flügel aus, zieht sie hinter sich auf dem Boden her, schwänzelt um das Weibchen herum und flirtet mit ihm: »Bak, bak, bak, buk.« Das Weibchen stolziert vor ihm auf und ab wie eine Königin, mit hoch erhobenem Kopf. Mal bewegt es sich langsam, mal wieder schnell, was das Männchen besonders heiß macht. Nicht weit entfernt von der männlichen Taube versucht einer der Schuljungen, ein Mädchen anzumachen. Die so Umworbene lächelt und er schwänzelt tapfer um sie herum. Sie marschiert geradewegs Richtung Ausgang, er blindlings hinterher. Einer der Lehrer schreit ihm nach: »Lukas, komm zurück!«
12.45 Uhr. Der Zug fährt ein. Ich finde schnell meinen reservierten Platz im Raucherabteil. Verstaue den Rucksack zwischen den Füßen. Lege ein Heft, ein Buch, eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug auf den Tisch und zünde mir eine Zigarette an …
13.02 Uhr. Der Zug setzt sich etwas verspätet in Bewegung. Ich bemerke auf dem Nebensitz einen großen, dicken Umschlag. Anscheinend ein ganzer Stapel Blätter darin. Außen in schnörkeliger Handschrift auf Arabisch: »Erinnerungen«. Mein Platznachbar ist wahrscheinlich kurz auf der Toilette oder im Bordrestaurant. Bestimmt kommt er bald wieder zurück. Ich freue mich schon auf einen arabischen Gesprächspartner. Unter Umständen sogar ein Poet, oder zumindest jemand, der sich fürs Lesen und Schreiben interessiert.
13.30 Uhr. Der Nachbar ist immer noch nicht da. Der kommt sicher bald. Wird seinen Umschlag doch nicht ewig hier liegen lassen. Wo mag er wohl herkommen? Es gibt so viele arabische Staaten. Hoffentlich aus einem Land, das ich gut kenne. Dann haben wir sicher viel zu plaudern.
14.16 Uhr. Der Zug erreicht die nächste Haltestelle. »Nächster Halt Leipzig«, leiert die Stimme aus dem Lautsprecher. Der Umschlag liegt immer noch da. Ein paar Leute steigen aus, andere ein. Ein Mädchen setzt sich mir gegenüber. Den Kopfhörer übergezogen, genießt sie den Lärm ihres MP3-Players. Ein Junge hockt sich neben sie und schaltet sein Notebook ein. Eine Dame mit kurzem, blondem Haar, das Handy am Ohr, schickt sich an, direkt an meiner Seite Platz zu nehmen. Sie greift nach dem Umschlag, schaut mir vorwurfsvoll ins Gesicht, legt mir den Umschlag auf den Schoß, lässt sich lässig in den Sitz fallen und telefoniert in aller Seelenruhe weiter.
Was sollte denn das? So eine Gans! Dieses rücksichtslose Verhalten mancher Leute ist einfach einzigartig. Soll ich ihr sagen, dass mir der Umschlag nicht gehört? Gott! Sie telefoniert immer noch! Sie ist wohl so um die fünfzig. Sieht aus wie viele Damen in diesem Land. Ein Anflug von Lippenstift, Rock, Bluse, eine winzige Minihandtasche, die eher zu einer Bienenkönigin zu passen scheint. Und schwarze, hochhackige Schuhe. Unberechenbar, solche Frauen. Besser ruhig Blut …
14.20 Uhr. Der Zug fährt langsam an. Ich nehme den Umschlag vorsichtig in die Hand, verlasse das Abteil und suche das Zugcafé. Die hübsche junge Kellnerin serviert mir rasch einen großen Kaffee. Vor mir auf dem kleinen Tisch der Umschlag. Eine schwierige Entscheidung. Soll ich ihn als Fundstück beim Zugpersonal abgeben? Aber meine Neugier ist einfach zu groß. Ich beschließe, den Umschlag zu öffnen und zu lesen, bevor ich ihn eventuell weitergebe.
Durch das Fenster des Zugs leuchtet das Flaschengrün der Landschaft in der Sonne. Ich schlürfe langsam meinen Kaffee. Zünde mir eine Zigarette an. Mustere die Kellnerin. Sie ist jung, zwischen achtzehn und zwanzig. Die Haare rot gefärbt, trägt sie die blaue Jacke der Deutschen Bahn, darunter eine Jeans und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift »Sexy Girl«. Unter dem Schriftzug zeichnet sich ein kleiner, fester Busen ab.
Ich nehme meinen Kaffee und den Umschlag und gehe wieder zurück zu meinem Platz im Abteil, wo die Dame immer noch telefoniert, der Junge immer noch auf seinem Notebook herumhackt und das Mädchen sich immer noch von seiner MP3-Musik berieseln lässt.
14.45 Uhr. Der Zug fährt weiter.
Ich mache den Umschlag auf.
Rasul Hamid
Erinnerungen
»Es gibt nur zwei Dinge: die Leereund das gezeichnete Ich.«Gottfried Benn
1
Der falsche Inder
Als Kalif Al-Mansur im Jahr 762 auf der Suche nach Ruhe und Erholung durch die unendlichen Weiten des Orients zog, erblickte er plötzlich vor sich eine idyllisch an zwei Flüssen liegende Landschaft. Ohne zu zögern befahl er seinen Soldaten, um dieses Stück Land herum einen großen Graben auszuheben, mit Holz zu füllen und in der Abenddämmerung ein Feuer anzuzünden. Als es aufloderte, schaute er von einem nahe gelegenen Hügel herab und verkündete: »Hier soll meine Stadt errichtet werden.« Und er gab ihr den Namen Madinat-A’Salam – Stadt des Friedens, die man heute als Bagdad kennt. Seitdem erlebte die Stadt des Friedens keinen Frieden mehr. Wieder und wieder steht ein anderer Herrscher auf dem Hügel und schaut zu, wie sie brennt.
In diesem Feuer, in dieser Stadt bin ich geboren, und möglicherweise hat meine Haut deswegen diese Farbe, die an Kaffee erinnert. Ich wurde sozusagen wie ein Hammel gut über dem Feuer durchgegrillt. Die Gespenster des Feuers waren für mich ständig anwesend, denn mein ganzes Leben hindurch sah ich die Stadt immer wieder brennen. Ein Krieg umarmt den anderen, eine Katastrophe jagt die andere. Jedes Mal brannten Bagdad oder Himmel und Erde im ganzen Irak: 1980 bis 1988 im ersten Golfkrieg, 1988 bis 1989 im Krieg des Al-Baath-Regimes gegen die irakischen Kurden, im zweiten Golfkrieg 1991, im selben Jahr im irakischen Aufstand, 2003 im dritten Golfkrieg und jeweils dazwischen in Hunderten von kleinen Bränden, Kämpfen, Aufständen und Scharmützeln. Das Feuer ist das Schicksal dieses Landes, gegen das selbst die Wasser der beiden großen Flüsse Euphrat und Tigris machtlos sind.
Auch die Sonne Bagdads ist mit den Feuergespenstern befreundet. Im Sommer will sie nicht untergehen. Gewaltig wälzt sie sich durch Bagdad, als sei sie eine Kutsche aus Eisen und Feuer, zerreißt das Gesicht des Horizonts und schiebt sich ziellos durch die Straßen und Häuser. Möglicherweise ist diese unbarmherzige Sonne der Grund für mein verbranntes und staubiges Aussehen. Doch mein Geburtstag ist der 3. März und somit weit entfernt vom bis zu fünfzig Grad heißen Bagdader Sommer. Daher glaube ich, dass eher die Hitze der Küche die Schuld an meiner dunklen Farbe trägt. Wenn ich meiner Mutter – wie sie selbst immer behauptete – tatsächlich in der Küche aus dem Bauch gefallen sein sollte, muss ich wohl schon als Neugeborener viele Stunden dort verbracht haben, unmittelbar neben dem Gasherd, wo oft schwarze Bohnen und Auberginen gekocht wurden. Ich vermute auch, dass der Steinofen, in dem meine Mutter unser Brot buk, das Seinige dazu beigetragen hat. Wie gern schaute ich doch, als ich noch klein war, meiner Mutter dabei zu, wie sie das fertige Brot aus dem Ofen holte und die frischen Fladen in einen großen Teller aus Palmblättern warf, der neben ihren Füßen stand. Jedes Mal schlich ich mich wieder an das heiße Brot heran. Jedes Mal wieder verspürte ich den zwanghaften Drang es anzufassen, um gleich darauf loszuheulen, weil ich mir wieder die Finger verbrannt hatte. Und jedes Mal wieder blieb ich ganz nah an diesem faszinierenden Steinofenfeuer sitzen.
Somit habe ich mehrere mögliche Erklärungen für meine dunkle Hautfarbe: Das Feuer der Herrscher und die Bagdader Sonne, die Hitze der Küche und die Glut des Steinofens. Sie sind entscheidend dafür, dass ich mit brauner Haut, tiefschwarzen Haaren und dunklen Augen durchs Leben gehe.
Wenn aber wirklich diese vier Faktoren die Ursache für mein Äußeres darstellen, müssten dann nicht auch die meisten anderen Bewohner des Zweistromlands ähnlich aussehen? Bei vielen ist das auch so, aber ich sehe so anders aus, dass man an meiner irakischen Herkunft zweifelte. In Bagdad sprachen mich mehrere Male die Fahrkartenverkäufer im Bus auf Englisch an. Dann lachte ich meistens und antwortete in südirakischer Umgangssprache, woraufhin sie mich verdutzt anstarrten, als wäre ich ein Geist. Dasselbe widerfuhr mir hin und wieder bei Polizeikontrollen. Jedes Mal musste ich lange Listen von Fragen beantworten, Fragen wie: Was isst ein Iraker gern? Welche Kinderlieder singen die Iraker? Nennen Sie einige Namen der bekannten irakischen Stämme! Erst wenn ich alles richtig beantwortet hatte und meine irakische Herkunft als erwiesen angesehen wurde, durfte ich wieder meiner Wege gehen. Die Jungen meines Viertels riefen mich »Indianer«, weil ich aussah wie die Indianer in amerikanischen Cowboy-Filmen. In der Mittelschule nannten mich die Arabischlehrerin und meine Mitschüler den »Inder« oder »Amitabh Bachchan«, nach einem bekannten indischen Schauspieler, dem ich tatsächlich ein bisschen ähnlich sehe: ein langer, dünner, brauner Kerl.
Mein Vater war der Einzige, der eine völlig andere Erklärung für mein Aussehen parat hatte. Er behauptete etwas ganz Aufregendes. Eines Tages, ich muss ungefähr fünfzehn gewesen sein, nahm er mich beiseite: »Mein Sohn!«, sagte er, »deine richtige Mutter ist eine Zigeunerin. Deswegen siehst du auch nicht so aus wie deine Brüder!« Er erzählte nur wenig, aber soviel ich verstand, war er vor geraumer Zeit mit einer Zigeunerin zusammen gewesen. Es war nur eine Affäre. Sie hieß Selwa. »Sie war eine der schönsten Frauen der Welt!«, behauptete er stolz. »Wenn sich ein Schmetterling auf ihrem Körper niedergelassen hätte, wäre er auf Grund ihrer Schönheit verwelkt.« Die Geschichte begann in Bagdad, im Viertel Al-Kamaliya, das in der Nähe des unseren lag. Sie war eine Tänzerin und eine Frau der Nacht. Und mein Vater war ihr bester Kunde. Sie hatte ihn geliebt und wollte ein Kind von ihm, und sie bekam es. Mein Vater aber wollte nicht, dass eine Zigeunerin die Mutter eines seiner Kinder wäre. Also beschloss er zusammen mit den Männern unseres Stammes, sie und ihre ganze Familie aus unserem Bezirk zu vertreiben und ihr das Baby wegzunehmen. Gesagt, getan! Ich wurde in den Stamm aufgenommen und die Zigeuner wurden verjagt. Später ging das Gerücht, die Zigeunerin sei mit ihrer Sippe in den Nordirak gezogen, habe dann aber ihre Familie verlassen, um allein in die Türkei und weiter nach Griechenland auszuwandern. Sie habe dort in einem Tanzklub bei einem Ägypter gearbeitet, bis sie sich schließlich umbrachte. Meine Stiefmutter sprach nie darüber. Sie erzog mich, als ob ich ihr eigenes Kind gewesen wäre.
Das Lustige an dieser Geschichte aber ist, dass meine beiden Mütter denselben Namen tragen: Meine Zigeunermutter hieß Selwa und meine Nicht-Zigeunermutter heißt auch Selwa. Meine Nicht-Zigeuner-Selwa behauptete, mein Vater sei ein Lügner und ich ihr leibliches Kind. Einmal brachte sie sogar eine alte Dame zu uns nach Hause, die bezeugte, sie sei bei meiner Geburt dabei gewesen. Sie schwor bei allen Heiligen, ich sei tatsächlich von meiner Nicht-Zigeuner-Selwa in der Küche geboren worden. Die Zigeunergeschichte hörte ich nur von meinem Vater. Ich bin sogar einmal ins Al-Kamaliya-Viertel gegangen, das man auch das »Viertel der Huren und Zuhälter« nannte und in dem es tatsächlich jede Menge Freudenhäuser gab. Ich fragte dort nach der Zigeunerin Selwa und ihren Leuten, aber niemand hatte auch nur die leiseste Ahnung. Und darum bezweifle ich, dass an dieser Geschichte überhaupt etwas dran ist. Ich vermute, mein Vater wollte mich damit nur bestrafen, weil ich ihn nicht ausstehen konnte.
Aber ich empfand diese Geschichte gar nicht als Strafe. Wieso sollte ich? Was war denn schon Schlimmes an den Zigeunern? Schöne Frauen, voller Feuer und Leidenschaft, die von allen Männern begehrt werden. Früher, als ich noch ein Kind war, prügelten sich die Jungen darum, sie anschauen zu dürfen, wenn sie mit ihren spärlichen bunten Kleidern halbnackt auf Hochzeiten und Festen tanzten. Ich erinnere mich, wie alle Männer sie mit hungrigen, verklärten Augen verschlangen. Auch die männlichen Zigeuner waren so hübsch, dass sich die Männer unseres Viertels genötigt sahen, die Haustüren abzusperren, damit ihre Frauen die Zigeunermänner nicht anlächeln konnten. Ich glaube, immer, wenn die Zigeuner auf einer Hochzeit bei uns gewesen waren, schwelgten die Frauen unseres Viertels noch wochenlang in der Erinnerung an diese schwarzen Haare, die tiefen, großen Stieraugen, die harten Muskeln und braunen Körper, die unter dem gleißenden Scheinwerferlicht der Hochzeitsfeier vor Schweiß glänzten; und sie wünschten sich, sie des Nachts heimlich unter ihrer Bettdecke zu spüren, während sie mit den Händen diese unerfüllte Sehnsucht zu stillen suchten. Und bei den Männern wird es kaum anders gewesen sein, wenn sie an diese vor Temperament strotzenden Zigeunerfrauen dachten.
Ich war tatsächlich einer der schönsten Jungen unseres Viertels. Möglicherweise hatte ich meine Schönheit von meiner Zigeunermutter geerbt. Und möglicherweise auch meine Hautfarbe, meine langen, dunklen, lockigen Haare und meine großen schwarzen und sanften Augen. Schließlich liebte ich die Zigeuner und ihre Lieder. In meiner Hosentasche steckte sogar lange Zeit das Bild einer tanzenden Zigeunerin. Trotzdem entschied ich mich, meine Nicht-Zigeunermutter als meine »richtige Mutter« anzunehmen. Sie war mein Schutzengel. Mich liebte sie mehr als alle meine Geschwister, ihre leiblichen Kinder.
Die Frage, ob die Zigeuner tatsächlich aus Indien stammen, wie einige Wissenschaftler behaupten, interessierte mich schon immer brennend. Ich hoffte insgeheim, diese These sei wahr. Dann nämlich könnte ich mich selbst als indisch-irakischen Zigeuner aus der Taufe heben. Und Schluss mit den Existenzfragen! Wenn nicht, dann müsste es eine andere konkrete Beziehung zwischen mir und Indien geben, denn das Land hat mich pausenlos verfolgt und immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt.
Als die Schiiten nach dem zweiten Golfkrieg im März 1991 gegen das Regime revoltierten, behauptete die irakische Regierung in ihrer Presse, diese seien gar keine echten Iraker, sondern indische Einwanderer. Im achtzehnten Jahrhundert seien sie in den Irak gekommen und geblieben. Das Problem war, dass diese These von allen namhaften Historikern abgelehnt wurde, weil es keinerlei wissenschaftliche Hinweise dafür zu geben schien. Aber sie kannten ja auch mich nicht, den lebenden Beweis dafür, dass die Schiiten vielleicht doch aus Indien gekommen sein könnten.
In den ersten Jahren meines dritten Lebensjahrzehnts floh ich vor dem unendlichen Feuer der Herrscher und vor der erbarmungslosen Bagdader Sonne. Mein Weg führte mich durch verschiedene Länder. Ich lebte einige Zeit in Afrika, hauptsächlich in Libyen, so dass sich viele Wörter der libyschen Umgangssprache mit meinen irakischen vermischten. Und das brachte auch schon das nächste Problem mit sich: Ich hielt mich eine Weile in Tripolis auf, wo ich einige Iraker in einem Café an der Strandpromenade traf. Als ich mich vorstellte, erwiderten sie empört: »Du willst uns wohl für dumm verkaufen? Du bist kein Iraker! Dein Aussehen passt nicht und deine Art zu reden auch nicht!« Als ich dann später nach Tunesien kam, war das ganz anders. In der Hauptstadt merkte ich vom ersten Tag an, dass mir die Frauen folgten wie Fliegen dem Marmeladenbrot. Im Zentrum, in der Bourguiba-Straße, schauten mir eine Menge Mädels kokett nach und riefen sich ungeniert zu: »Hey, schaut euch diesen hübschen Inder an!« Einen Monat lang hatte ich mit den schönsten Frauen in den Straßen von Tunis einen Riesenspaß. Ich gab mich als indischer Tourist aus, der einen Stadtführer suchte. So kam ich auch für eine Weile zu einer kurzen Liebe. Sie hieß Iman und betrachtete meine Haare als das achte Weltwunder.
In Afrika hatte niemand ein Problem mit meinem Aussehen. Ich war nicht blond, und die Kinder kreisten nicht um mich herum und klatschten, wie bei europäischen Touristen. In Afrika war meine Hautfarbe ein Vorteil. Im Vergleich zu den Einheimischen betrachteten mich einige sogar als Weißen. Doch alles andere, das ganze Leben an sich, das war überhaupt nicht einfach, weshalb ich bald an eine große Reise Richtung Europa dachte. Die war jedoch nur auf illegalen Wegen möglich.
In Europa aber brachte mir mein Aussehen wieder mehr Schwierigkeiten ein. Es fing in Athen an. Zunächst hatte ich dort glücklicherweise noch keine großen Probleme. Ich musste kaum Angst haben, von der Polizei festgenommen zu werden. Es gab so viele Flüchtlinge im Land, dass man eine Unzahl von Gefängnissen benötigt hätte, um alle einzusperren. Trotzdem sammelte die Polizei ab und zu einige von ihnen ein, wohl um wenigstens den Anschein zu erwecken, das Flüchtlingsproblem in den Griff bekommen zu wollen. Einmal hatten sie dabei auch mich erwischt. Ich hockte ein paar Tage im Gefängnis, bis sie für mich einen Flüchtlingsausweis ausgestellt hatten.
Doch am letzten Tag passierte etwas Tragisches: Ich musste aufs Klo. Ein Polizist begleitete mich dorthin. Als ich den Toilettenraum wieder verlassen wollte, versperrte er mir den Weg und begann, voller Wut auf mich einzudreschen. Ich begriff nicht, was los war, und fing aus Leibeskräften an zu schreien. Von diesem Lärm angezogen, rannten ein paar andere Polizisten herbei und retteten mich vor den Schlägen meines wild gewordenen Begleiters. Einige schimpften und stritten mit ihm. Es war ein Geschrei nach griechischer Art. Ich verstand zwar kein Wort, vermutete aber, sie seien zornig auf ihn, weil er auf mich losgegangen war. Plötzlich kauerte sich der wütende Polizist, der mich verprügelt hatte, auf den Boden, begann sich selbst ins Gesicht zu schlagen und wie ein Schlosshund zu heulen. Mir kam das alles absurd vor, und ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Ein blonder Polizist brachte mich in meine Zelle zurück. Dort saß ich nun, fertig mit der Welt und maßlos enttäuscht und traurig. Ich konnte nicht glauben, dass man auch in Europa grundlos von der Polizei getreten und geschlagen wurde. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Was für eine böse Überraschung! Am Abend öffnete sich die Tür und ein Offizier in schmucker Uniform betrat meine Zelle. Er hatte massenweise Sterne und sonstige Abzeichen auf Brust und Schultern. Er sprach Englisch und erklärte, der wütende Polizist sei so außer sich geraten, weil er mich für einen pakistanischen Drogendealer gehalten habe, den die griechische Polizei seit längerer Zeit suchte. Der wütende Polizist habe seinen jüngeren Bruder verloren – Überdosis. Und weil er mich für diesen Drogendealer gehalten habe, sei die Wut in ihm hochgekommen, so dass er jegliche Kontrolle über sich verloren habe. Der Offizier zeigte mir das Foto des Dealers. Unglaublich! Das war wirklich kaum zu fassen! Er sah mir tatsächlich so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Ich war selbst verwirrt.
Nach einer halben Stunde kehrte der inzwischen nicht mehr wütende Polizist zurück und zeigte mit dem Finger auf mich.
»Are you from Iraq?«
»Yes!«
»Sorry!«
Er schloss die Tür und ging. Nach fünfzehn Minuten kam ein anderer Polizist, gab mir einen Ausweis, begleitete mich zur Haupttür und sagte: »Go!«
Ich verließ Griechenland mitsamt seiner Polizei und floh nach Deutschland. Aber in Deutschland ging es genauso weiter wie in Griechenland, nur auf andere Art und Weise. Aufgrund der übereifrigen Dienstbeflissenheit der deutschen Polizei nahm meine illegale Reise ein jähes Ende. Und zwar mitten in Bayern. Eigentlich wollte ich weiter nach Schweden. Ich hatte von vielen Flüchtlingen gehört, man bekäme in Schweden eine staatliche Unterstützung, damit man die schwedische Sprache lernen und weiter an der Universität studieren könne. So etwas gebe es in Deutschland nicht. Als ich mit der Bahn von München nach Hamburg wollte und von dort über Dänemark nach Schweden, hielt der Zug im Bahnhof einer kleinen Stadt namens Ansbach, wo zwei bayerische Polizisten einstiegen. Sie fragten keinen der vielen blonden Reisenden nach ihrem Ausweis, sondern kamen direkt zu mir. Lag es an meiner indischen Erscheinung?
»Passport!«
Ich: »No!«
Sie nahmen mich fest. Im Polizeirevier verursachte mein Aussehen wieder ein Drama. Die Beamten glaubten mir einfach nicht, dass ich ein Iraker sei. Sie hielten mich für einen Inder oder Pakistaner, der sich als Iraker ausgab, um sich eine Asylberechtigung zu erschleichen. Sozusagen ein Betrüger. Die Iraker hatten damals wegen der Diktatur in ihrer Heimat in Deutschland das Recht auf Asyl. Viele Bürger anderer Staaten aber nicht, wie zum Beispiel Inder oder Pakistaner. Es dauerte lange, bis ein Übersetzer und ein Nürnberger Richter zu mir kamen, um mich durch die verschiedensten Fragen zu testen. So wollten sie unter anderem von mir wissen, wie viele Kinos es im Bagdader Zentrum gäbe, und ich musste einige davon namentlich aufzählen. Die Antwort war für mich natürlich ein Kinderspiel, und meine irakische Herkunft konnte schnell bestätigt werden. Mein Ziel Schweden musste ich schließlich aber aufgeben. Die deutsche Polizei hatte meine Fingerabdrücke genommen und erklärte mir, diese würden nun an alle Asylländer weitergeleitet. Deshalb könne ich nun nirgendwo anders Asyl beantragen. Nur in Deutschland. Jeder Versuch, Deutschland zu verlassen, sei eine Straftat. Seitdem hocke ich also hier.
Wenn es nur bei solchen Dingen bliebe, wäre das Leben wirklich erträglich. Es kam aber viel schlimmer. Viele Leute hier hatten einfach nur Angst vor mir. Ja, Angst! Ich habe niemanden verprügelt, noch habe ich mich über Nacht der Al-Qaida oder gar der CIA angeschlossen. Es begann mit dem 11. September 2001. Den in Europa lebenden Arabern verging nach diesem Tag das Lachen. Die Medien sprachen über nichts anderes als die Bösen aus Arabien. In dieser heißen Zeit flog ich für ein paar Tage von München nach Berlin. Die alte Dame auf dem Nebensitz, deren Akzent man unschwer entnehmen konnte, dass sie aus Bayern stammte, lächelte mich an:
»Sind Sie Inder?«
Ebenfalls lächelnd antwortete ich:
»Nein, ich komme aus dem Irak.«
Das Lächeln auf ihren Lippen erstarrte und verwandelte sich in eine angstverzerrte Grimasse. Dann wandte sie hastig ihren Blick von mir ab. Die gesamte restliche Flugzeit klebte sie farb- und tonlos neben mir im Sitz. Es schien, als hätte sie gerade den Leibhaftigen gesehen. Ein weiterer Ton von mir, und sie hätte wohl augenblicklich einen Herzinfarkt erlitten!
Wenn ich mich nun daran zurückerinnere, welche Namen man mir zwischen Ost und West wegen meines Aussehens nachgerufen hat, dann scheint das irgendwie alles mit Indien zu tun zu haben. Indien, wo ich in meinem ganzen Leben noch nie war und das ich überhaupt nicht kenne. Die Araber nannten mich den »irakischen Inder«, die Europäer nur »Inder«. Es ist sicherlich erträglich, Zigeuner, Iraker, Inder oder gar ein Außerirdischer zu sein, wieso auch nicht! Aber es ist unerträglich, dass ich bis heute nicht genau weiß, wer ich wirklich bin. Ich weiß nur, ich bin »von vielen Sonnen der Erde gebrannt und gesalzen«, wie meine bayerische Geliebte Sara immer behauptet, und ich glaube ihr.
Inzwischen ist mir aber eingefallen, dass es doch eine konkrete Beziehung zwischen mir und Indien geben könnte, nämlich meine Großmutter. Und das hat einen historischen Hintergrund: Als die Engländer zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in den Irak kamen, waren sie gleichzeitig Besatzungsmacht in Indien. Demzufolge brachten sie eine Menge indischer Soldaten mit, die im Süden unseres Landes mit seinen ausgedehnten Palmenwäldern ihr Lager aufschlugen. Wer weiß, vielleicht ist meine aus dem Südirak stammende Großmutter einst einem solchen Soldaten im Wald begegnet. Und demzufolge bin ich vielleicht das Produkt der Vereinigung zweier englischer Kolonien.