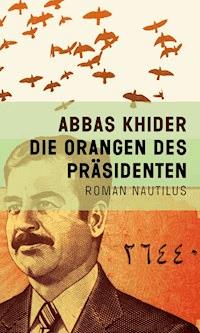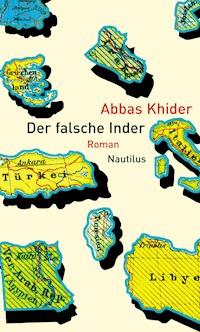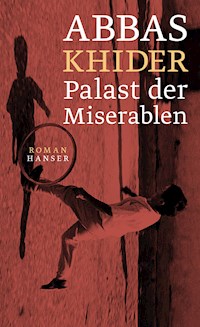
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines Jungen aus den Slums von Bagdad: "Überraschend nüchtern, mit schonungslosen Blick und voller Humor, der halb befreiend, halb bitter ist. (Abbas Khiders) mitreißender neuer Roman." Julia Encke, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Shams Hussein ist ein normaler Junge mit ganz normalen Träumen. In der Hoffnung auf ein friedlicheres Leben ziehen seine Eltern mit ihm und seiner Schwester aus dem Süden des Irak nach Bagdad. Doch aus dem Streben nach einer besseren Zukunft wird in dem von Saddam Hussein beherrschten Land schnell ein Leben in existenzieller Not. Die Familie wohnt neben einem riesigen Müllberg, Shams arbeitet als Plastiktütenverkäufer, als Busfahrergehilfe, als Lastenträger. Und er liebt Bücher. In einer Zeit jedoch, in der ein falsches Wort den Tod bedeuten kann, begibt er sich damit in eine Welt, deren Gefahren er nicht kommen sieht. Ein persönlicher, höchst lebendiger Roman voll unvergesslicher Figuren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Abbas Khiders Figuren sind Entwurzelte, Träumer und Beobachter.« (F.A.Z.) — In seinem neuen Roman erzählt er die Geschichte eines Jungen aus den Slums von Bagdad.Shams Hussein ist ein normaler Junge mit ganz normalen Träumen. In der Hoffnung auf ein friedlicheres Leben ziehen seine Eltern mit ihm und seiner Schwester aus dem Süden des Irak nach Bagdad. Doch aus dem Streben nach einer besseren Zukunft wird in dem von Saddam Hussein beherrschten Land schnell ein Leben in existenzieller Not. Die Familie wohnt neben einem riesigen Müllberg, Shams arbeitet als Plastiktütenverkäufer, als Busfahrergehilfe, als Lastenträger. Und er liebt Bücher. In einer Zeit jedoch, in der ein falsches Wort den Tod bedeuten kann, begibt er sich damit in eine Welt, deren Gefahren er nicht kommen sieht. Ein persönlicher, höchst lebendiger Roman voll unvergesslicher Figuren.
ABBAS KHIDER
Palast der Miserablen
Roman
Carl Hanser Verlag
»Die Götter nur wohnen dort ewig bei Šamaš.«
Gilgamesch-Epos
MEIN AUFSEHER IST in einen tiefen Schlaf gefallen. Ich habe ihn beobachtet, wie er die Augen schloss, sie dann öffnete, mich kurz anschaute und sie wieder schloss. Sein Kopf kippte nach vorne. Es sah so aus, als trüge eine Welle den Kerl immer wieder vom Wachsein in den Schlaf und zurück. Er hob die Schulter, sein Körper geriet in Schräglage. Dann fand er eine bequemere Position, legte einen Arm auf die Stuhllehne, drückte seine Waffe mit der rechten Hand an den Oberkörper, sodass der Gewehrlauf ihn stützte. Die linke Hand schaukelt jetzt vor den Stuhlbeinen. Sein Mund steht offen, er schnarcht ganz leise.
Er ist noch relativ jung, vielleicht ein paar Jahre älter als ich. Sein Schnurrbart ist schwarz wie die Haare auf seinem Kopf, keine Falten im Gesicht. Friedlich, fast niedlich sieht er gerade aus. Heute Morgen noch war er weit davon entfernt. Wie ein Hirtenhund hat er meine Schritte beobachtet, mich mit sich gezogen, mich durch die Türen des Krankenhauses geschoben, aus seinem Mund war immer wieder derselbe Befehl zu hören: »Beweg dich, Dummkopf!«
Die Handschelle sitzt nicht besonders fest an der rechten Hand. Meine Linke ist frei. Und genau auf dieser Seite schläft er auf seinem Stuhl. Was soll ich jetzt tun? Soll ich abwarten, bis er in den Tiefschlaf sinkt — und dann? Was dann? Fliehen. Aber wie? Zuerst muss ich meine rechte Hand befreien. Das würde ich hinbekommen. Ich würde sie mit Spucke nass machen, sie dann langsam aus der Schelle ziehen. Ein paar Kratzer, ein bisschen Blut, kein Drama. Dann? Die Waffe muss ich ergattern, meinem Aufseher mit dem Kolben auf den Kopf schlagen. Ist das machbar? Es muss machbar sein, denke ich, sonst verbringe ich mein restliches Leben in diesem unendlichen Schatten.
Das ist meine Chance. Ich muss es hinter mich bringen und möglichst schnell abhauen. Aber wohin? Mit einem grauweiß gestreiften Häftlingspyjama. Mit einem blassen, kadmiumgelben Gesicht, mit einem schwachen, ausgehungerten Körper. Wie soll ich es aus dem Krankenhaus schaffen? Und selbst wenn mir das gelingt, wie soll ich ohne Ausweis den Kontrollen in der Stadt entgehen?
Und die wichtigste Frage: Wohin soll ich? Zu meinen Eltern? Zu meiner Schwester? Zu gefährlich. Das wären die ersten Orte, an denen die Polizei nach mir suchen würde. Das wäre Selbstmord. Zu meinen Freunden? Zu welchen? Ich habe sie alle verraten. Vermutlich sind sie auf der Flucht, in einem Kerker oder im Jenseits. Und wenn sie noch da wären und ich sie finden würde, wer von ihnen wäre bereit, mich zu verstecken? Keiner. Hundertprozentig keiner. Alle haben Angst in diesem Land der unterirdischen Kerker.
EINS
Lufternte
In meiner Familie war keiner von uns Jüngeren ein wilder Kerl. Der Einzige, der diese Bezeichnung verdiente, war unser Großvater. Er besaß die unschöne Eigenschaft, einfach jedem ohne Zögern und geradeheraus seine Meinung ins Gesicht zu speien. Es war ihm absolut gleichgültig, ob die Leute seine Worte zur Kenntnis nahmen, was sie über ihn dachten oder wie sie sich im Nachhinein fühlten. Er hatte mit seinen ätzenden Kommentaren und bösartigen Bemerkungen gestandene Männer zum Brüllen gebracht und wütende Witwen ihre Teppiche so hart ausschlagen lassen, dass diese Löcher bekamen. Nach jeder neuen Hasstirade ließ er sich gern selbstzufrieden auf seine Matratze im Wohnzimmer fallen und starrte stur die Decke oder Wand an.
Wenn sein einziger Sohn, mein Vater, erfuhr, dass Großvater erneut die Leute beleidigt hatte, versuchte er sich bei den Betroffenen für das »unangemessene Verhalten« des Greises zu entschuldigen. Normalerweise übernehmen Eltern die Verantwortung, wenn ihre Kinder ungezogen sind, aber in unserer Familie war es umgekehrt. Notgedrungen schob Vater es auf das fortschreitende Alter, dabei war Großvater schon als Kind ein Schreihals und so unberechenbar gewesen, dass er seine ganze Familie und die Nachbarschaft zur Verzweiflung gebracht hatte. Darüber kursierten auch achtzig Jahre später noch immer Anekdoten in unserem Dorf. Es hieß, selbst die Wildhunde hätten vor Schmerzen geheult und Großvater habe eigenhändig die Engländer aus den Stammesgebieten vertrieben, die sie zu einem Land vereinigt hatten, dem Irak. Manche behaupteten, die Zunge meines Großvaters sei so giftig und aggressiv wie die Zähne der Schwarzen Kobra, die nachts in den Büschen, Felsspalten und Erdhöhlen des Irak lauert.
Großvater galt bei den Leuten tatsächlich als heimtückische Giftnatter. Sobald man sein Zischen hörte, musste man die Flucht ergreifen. Leider konnte man meinen Großvater nicht einfach mit einem Säbel köpfen und das Problem auf diese Weise leicht beseitigen. Er war ein gebrechlicher, dürrer Mann, den die Last der Jahre tief gebeugt hatte. Sein Gesicht war so voller Falten wie die uralte Decke, die er ständig um die spitzen Schultern trug. Wenn ich Geschichten über seine Kindheit hörte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er einmal ein junger Mensch gewesen war. Ich kannte ihn nur faltig und grauhaarig. Wenn ich im Radio das Lied der libanesischen Sängerin Fairuz hörte, in dem sie das Antlitz der Stadt Beirut als »altes Matrosengesicht« bezeichnet, dachte ich immer, das würde auch sehr gut Großvater beschreiben.
Ihre Lieder hörten wir im Radio, sie gehörte zu jedem Morgen wie die ersten Sonnenstrahlen oder das Waschen des Gesichts. In anderen Gegenden gab es Hähne, welche mit ihrem Ruf die Menschen weckten. Bei uns war es Fairuz’ Lerchengesang. Das Morgenprogramm des staatlichen Radiosenders fing immer mit einigen Versen aus dem Koran an. Fünfzehn lange Minuten, dann endlich sang Fairuz für eine halbe Stunde, bis wieder die allgegenwärtigen Nachrichten über unseren Präsidenten dran waren. Die Stimme von Fairuz war so zauberhaft, dass man ihr einen Platz zwischen den Worten Allahs und denjenigen Saddams gewährte.
Großvater liebte ihre Lieder über alles. Im Teehaus des Dorfes spielte der Wirt immer eine Fairuz-Kassette ab, sobald er meinen Großvater sah. Er tat das nicht, weil er seinen Stammgast besonders mochte, sondern, weil der alte Quälgeist zumeist selig schwieg, solange er der libanesischen Schönheit lauschen konnte. Sie hatte auf ihn dieselbe hypnotische Wirkung wie die Flöte eines Schlangenbeschwörers auf seine Tiere. »Wenn Fairuz singt, schweigt Marzoq«, scherzte einst auch meine Mutter. »Nur sie bekommt das hin.«
Großvater Marzoq war so steif wie die Holzpuppen meiner Schwester und benutzte immer seinen Spazierstock oder einen Menschen als Stütze. Er ging langsam und wackelig wie ein Kind, das gerade erst gehen gelernt hat. Die meiste Zeit verbrachte er draußen auf dem Boden vor der Haustür oder im Teehaus. Sonst saß er auf seiner Matratze im Wohnzimmer und freute sich riesig, wenn meine Schwester und ich mit ihm spielen wollten. Denn für uns Enkelkinder war er ein Held. Qamer und ich hielten ihn wirklich für den besten Großvater der Welt, wir kannten nun einmal keinen anderen. So biestig er sich sonst auch gab, uns gegenüber war er handzahm. Wir tollten auf ihm herum, zogen an seinem langen Bart oder seinen riesigen Ohrläppchen und boxten ihn in den Bauch. Lange konnte er bei unserem wilden Treiben nicht mithalten, denn er war schnell erschöpft. Selbst bei ruhigen Spielen kam es vor, dass er mittendrin und urplötzlich einschlief. Sein Kopf sackte nach vorne auf die Brust, der Kiefer klappte runter und gab den Blick auf seine Zahnstummel frei. Dann schmatzte er noch mehrmals, seine Augäpfel bewegten sich unter den geschlossenen Lidern, und er begann, tief zu atmen. Gerade hatte er noch im Sand Bilder mit uns gemalt, eine mitreißende Geschichte erzählt oder mit einem Stock gegen mich gefochten, aber von jetzt auf gleich war er wie weggetreten.
Seine Lieblingsbeschäftigung blieb jedoch zweifelsohne das Reden. Wenn er einmal damit anfing, schien es, als wollte er sämtliche Wörter, die es im Arabischen gab, auf einen Schlag loswerden. Aus einer kleinen Anekdote machte er problemlos das Gilgamesch-Epos. Wir lauschten aufmerksam, und seine Stimme entführte uns ein ums andere Mal in magische Märchenwelten. Uns Kindern gefielen die Legenden sehr, aber mein Vater hasste sie regelrecht.
Die beiden sprachen kaum miteinander. Vater war es leid, ständig die Scherben aufkehren zu müssen, die der Alte in der Dorfgemeinschaft hinterließ. Und Großvater zerschlug reichlich Porzellan. Darüber hatten sie sich mehr und mehr entfremdet. Vater sah es nicht gerne, dass Großvater so viel Zeit mit uns verbrachte. Es fühlte sich für ihn wahrscheinlich wie Verrat an, dass Großvater sich uns gegenüber ganz anders verhielt, als mein Vater selbst es als Kind erlebt hatte. Er hatte bestimmt öfter die Faust gesehen als eine streichelnde Hand auf der Wange gespürt. Statt gemeinsam Fußball zu spielen, hatte es Tritte gegeben, wenn er ungezogen gewesen war. Außerdem hatte Vater unsägliche Angst, dass die Parteispitzel im Dorf Großvater irgendwann bei der Polizei anschwärzen würden, wenn er sein loses Mundwerk zu leichtsinnig gebrauchte. Denn es gab tatsächlich kaum einen Tag, an dem sich Großvater nicht über unseren Präsidenten und die Regierung lustig machte. Zum Glück hielten die meisten im Dorf meinen Großvater für einen Narren und nahmen ihn deshalb nie ernst. Vater war froh, wenn Großvater Marzoq schlief oder im Teehaus saß, dem Gesang von Fairuz lauschte und schwieg.
Die Stille zwischen beiden war für die restliche Familie oftmals unerträglich. Immer lag eine Anspannung in der Luft. Stumm saßen sie jeden Freitag zusammen auf dem Boden und aßen ihr Lieblingsgericht: gegrillten Fisch mit Brot aus Reismehl. Vater entfernte die Gräten und legte Großvater den Fisch auf den Teller, ohne ihn eines Blickes zu würdigen oder etwas zu sagen. Seit Jahren schon hatten sie kein einziges Wort mehr miteinander gewechselt.
Das alles änderte sich, als Großvater krank wurde. Das war im siebten Jahr des Irak-Iran-Krieges. Zu jener Zeit kam eines Tages unser Stammesführer, dessen Haus sich dicht an der Grenze zu Iran befand, mit einigen unserer Verwandten in unser Dorf und zu uns nach Hause. Großvater Marzoq sollte als der Stammesälteste seine Meinung äußern und seinen Rat geben.
Mein Vater war an jenem Morgen sehr aufgeregt. Die Männer hatten sich nicht angekündigt. Sie waren einfach da.
»Zahraa, koch bitte Tee für die Männer!«, sagte Vater in der Küche zu Mutter.
»Soll ich mich auch um das Mittagessen kümmern? Wie viele sind es?«
»Nur vier Männer.«
»Gut.«
Vater flüsterte nun: »Würden sie unsere Kinder nach ihrer Meinung fragen, bekämen sie vermutlich eine vernünftigere Antwort als von meinem Vater.«
»Sei nicht so! Auch wenn er schwierig ist, er hat viel erlebt. Marzoq ist weiser, als du denkst. Die Ältesten des Stammes wissen das.«
Bald darauf waren alle im Wohnzimmer versammelt. Die Männer saßen in einem Kreis auf dem Boden um meinen Großvater. Ich kauerte draußen vor der offenen Tür, tat so, als würde ich mit Steinen spielen, und lauschte dem Gespräch. Drei der Männer kannte ich, sie waren die Cousins meiner Eltern. Der vierte Mann war unser Stammesführer. Er sah jung aus im Vergleich zum Rest der anwesenden Männer, trug einen dünnen schwarzen Schnurrbart. Ein edler brauner Turban war um seinen Kopf gebunden, kurz geschorenes Haar schaute an den Seiten hervor, seine weiße Dishdasha, unser traditionelles Männergewand, bestand ganz aus Seide. Er saß meinem Großvater gegenüber. Vor ihm auf dem Teppich lagen eine Schachtel Rothmans-Zigaretten und eine Packung Streichhölzer. Daneben befanden sich ein kleines Glas schwarzen Tees und ein überquellender Aschenbecher. Er rauchte nervös eine Zigarette nach der anderen und ließ dabei eine Misbaha aus Edelsteinen durch die freie Hand gleiten.
»Die Sicherheitspolizei will eine Liste aller Jungen des Stammes, die von der Front abgehauen sind.«
Jetzt herrschte eine schneidende Stille.
Der Stammesführer sprach nach einer kurzen Pause weiter in die Runde: »Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns in einer solch ausweglosen Situation befinden. Die letzten Jahre haben einen hohen Blutzoll gefordert. Das wissen wir alle. Dieses Mal aber ist es anders. Es gibt momentan keine Amnestie für Fahnenflüchtige. Verraten wir ihre Namen, schicken wir sie in den sicheren Tod. Ich könnte damit leben, wenn die Jungs einfach zurück in den Krieg geschickt werden würden. Dann hätten sie wenigstens eine kleine Chance, zu überleben. Aber man wird sie töten.«
Wieder erfüllte Stille den Raum.
Mittlerweile hatte sich meine Schwester zu mir gesellt. Vor der Zimmertür hockten wir zwischen den Schuhen und Sandalen der Männer und versuchten zu verstehen, worüber sie sprachen. Ich konnte nicht allem folgen. Doch ich spürte die Besorgnis und Unruhe. Die Gesichter der Erwachsenen hatten denselben dunklen Ausdruck, den ich sonst nur an Trauertagen bemerkte, wenn die Menschen ihre Toten beklagten.
Die Männer schauten weiter in ihre Teegläser oder auf den Teppich, als versteckte sich dort die Antwort. Der Stammesführer wandte sich nun hilfesuchend an Großvater Marzoq.
»Abu Hussein, du bist unser Ältester. Hast du keinen Rat? Nach sieben Kriegsjahren sind alle müde, vielleicht haben wir auch Glück, und die Beamten der Staatsmacht sind nicht mehr so gewissenhaft. Was sollen wir tun?«
Großvater schwieg für einige Sekunden, als sammelte er sich. Seine halb weißen, schwachen Augen schauten seltsam entrückt in die Runde. Er hatte bislang nur das Webmuster im Teppich betrachtet. Jetzt hob er seinen Kopf und blickte zur Decke.
»Es war einmal ein mächtiger Sultan …«, setzte er an.
»Allah, steh uns bei!«, murmelte mein Vater für alle hörbar und verdrehte die Augen, aber keiner reagierte darauf. Auch Großvater ignorierte seinen Sohn. Er tat wie sehr oft einfach so, als hätte er nichts gehört, und redete weiter.
»Dieser Sultan bestrafte sein Volk, weil einige Mutige gegen ihn rebellierten. Der Herrscher ließ sie von seinen Soldaten verhaften und zwang diese Männer und Frauen daraufhin, eine Woche lang wie Tiere im Freien zu leben und für ihn zu arbeiten. Er befahl ihnen, Luft zu ernten. Jeder, der sich weigerte, wurde sofort geköpft. Die anderen wurden auf einen freien Platz vor dem Palast geführt, und jeder bekam eine kleine Sichel in die Hand gedrückt. Dazu mussten alle einen Korb auf dem Rücken tragen. Die Gefangenen spielten beim grausamen Spiel des Sultans mit. Sie fuchtelten mit den Sicheln in der Luft, als schnitten sie Getreide auf dem Feld, griffen beidhändig ins Leere und taten so, als sammelten sie etwas Unsichtbares in ihren Behältern. Sieben lange Tage mussten die Männer und Frauen draußen arbeiten, ohne Ausnahme, ohne Pause. Am letzten Tag erschien der Sultan, um sich sein Werk anzuschauen.«
Die vier Männer hatten sich aufgeregt vorgebeugt und hingen an Großvaters Lippen. Nur Vater pulte sich gelangweilt den Dreck unter den Fingernägeln hervor und atmete immer wieder schnaubend aus, als strengte ihn das Zuhören ebenso an wie das Lufternten die Bestraften aus der Erzählung.
»Unter den Menschen sah der Sultan eine nackte Frau, die wie alle eine kleine Sichel trug und Luft erntete. Sie zeigte keinerlei Scham, als wäre sie allein. Der Sultan näherte sich ihr. Als sie ihn sah, versuchte sie schnell, sich mit den Händen zu bedecken. ›Oh, ein Mann hier!‹, sagte sie. Der Sultan war verblüfft, er fragte sie: ›Es gibt viele Menschen hier. Sie schämen sich nicht vor ihnen, aber vor mir schon?‹ Sie antwortete: ›Menschen?‹ Sie drehte sich um und schaute verächtlich in die Menge. ›Sie meinen diese Vogelscheuchen, die kein Spatz fürchtet? Das sind keine Menschen, mein verehrter Sultan, es sind nur Schatten von Menschen, sie tragen Sicheln in der Hand, tun damit nichts Vernünftiges, sondern ernten Luft. Sie sind, mein Herr, der einzig wirkliche Mensch im ganzen Land. Sie haben es geschafft, alle anderen dazu zu bringen, die Luft zu ernten.‹«
Großvater schwieg nun und machte eine lange Pause, um das Gesagte auf die Anwesenden wirken zu lassen.
»Irgendwann«, sagte Großvater nun, »werden uns unsere eigenen Kinder nicht mehr respektieren. Sie werden uns auslachen. Wir machen uns zum Gespött unserer Nachkommen. In hundert Jahren wird man über uns als die ›Fußabtreter Saddams‹ sprechen. Früher einmal waren wir eine Nation voller Stolz. Und nun seht euch an: ein Haufen ängstlicher Schlappschwänze, die bis in alle Ewigkeit Luft ernten. Wenn wir alles mitmachen, wird es immer schlimmer werden. Dieser aus dem Bauchnabel des Teufels genährte Saddam macht uns lächerlich. Der Tod ist besser als das hier, sein ewiges Gefängnis.«
»Du hast gut reden, wenn du schon mit einem Bein im Grab stehst«, warf der Stammesführer ein. Er sah ziemlich genervt aus.
Großvater hob sein Gewand an und zeigte eine zackige, blutrote Narbe auf seinem Bauch.
»Die hat mir ein englischer Soldat verpasst. Hat mir das Bajonett in den Wanst gestoßen. Mit bloßen Händen habe ich gegen ihn gekämpft. Habe so lange die Waffe heruntergedrückt, bis er müde wurde und ich ihm mit einem Faustschlag die Kehle zertrümmern konnte. Trotz meiner Verwundung. Ich habe dem englischen Soldaten beim Sterben zugesehen. Wir waren in der Unterzahl damals, mit schlechter Ausrüstung. Aber wir waren stolz und wir kannten keine Furcht. Wir haben den Tod begrüßt, weil er bedeutete, dass wir uns zur Wehr setzten, statt wie ein Hund getreten zu werden. Auch heute ist es eine Frage von Selbstverteidigung. Wie wir damals die Engländer verjagt haben, so können wir Saddam und die Baathisten verjagen. Mit dem größenwahnsinnigen Krieg gegen unsere Nachbarn hat es der Mistkerl übertrieben. Ein sinnloses Abschlachten, das keiner gewinnen wird. Jetzt greift er nach dem Rest unserer Kinder wie der leibhaftige Tod. Und wir sitzen hier wie Kaninchen in ihrem Bau und diskutieren über eine Frage, deren Antwort wir alle längst kennen. Es gibt keine Alternative — die Zukunft unseres Stammes ist ohnehin düster. Sei es, weil die nächste Generation an der Front stirbt, wir von den Soldaten hier vor Ort als Verräter hingerichtet werden oder wir so lange von Saddams Stiefel in den Sand gedrückt werden, bis wir sowieso ersticken. Jeder, der jetzt nicht kämpft, ist ein Feigling!«
Der Stammesführer sprang auf und sah aus, als wollte er Großvater Marzoq ins Gesicht spucken. »Du alter Narr, welche Chance haben wir denn? Du musst ja nicht mehr kämpfen, sondern wir, wenn es so weit kommt. Es ist leicht, General zu spielen, wenn man gemütlich im Schaukelstuhl sitzt. Dein Sohn war nie richtig an der Front, er dient hier in der Gegend als Soldat. Die Sorgen des Stammes um seine Kinder verstehst du nicht. Und du verstehst auch nicht, was es bedeutet, Waffen zu tragen, und was das alles für Folgen für unseren Stamm und unsere Familien haben könnte. Das wäre Selbstmord.«
Minutenlang ging es wild durcheinander. Kurz darauf verließen die Männer das Zimmer. Vater versuchte, sie davon abzuhalten und alles wieder in Ordnung zu bringen, aber er scheiterte. Auch Mutter, die vieles von der Küche aus mitbekommen hatte, rannte hinter dem Stammesführer und den Cousins her, konnte sie aber nicht davon überzeugen, doch wenigstens das Mittagessen zu probieren.
Als keiner der Gäste mehr da war, ging mein Vater zurück ins Wohnzimmer zu Großvater Marzoq und begann ihn anzuschreien. Es war nur Vaters Stimme zu hören, als ob er mit sich selbst reden würde. »Willst du mein Leben zerstören und mich im Stamm lächerlich machen? Du kannst den Stammesführer und deine Neffen doch nicht als Angsthasen hinstellen und irgendwelche Kriegsgeschichten von anno dazumal auspacken! Das ist keine leichte Sache und keine leichte Entscheidung. Die muss mit Vernunft gefällt werden.«
Das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass mein Vater mit meinem Großvater sprach. Aber von Großvater Marzoq war nichts zu hören, er antwortete nicht und drückte die Lippen aufeinander.
Die Männer des Stammes kamen auch tatsächlich nicht mehr zu uns, bis Großvater starb. Das war im darauffolgenden Jahr, als der Iran-Krieg endete.
An seinen letzten Tagen litt Großvater sehr. Er konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Auch das Essen, das Mutter in seinen Mund schob, spuckte er gleich wieder aus. Der Alte wurde trotz seiner Falten plötzlich zu einem hilfsbedürftigen Baby, das vor Schmerzen schrie. Seine Organe begannen eines nach dem anderen zu versagen.
Die letzten Minuten seines Lebens durfte Großvater mit seinem Sohn verbringen. Es war sein letzter, kraftloser Wunsch, noch einmal mit seinem Kind allein zu sein. Ob sie etwas miteinander geredet haben, wissen wir nicht, denn mein Vater hat nie darüber gesprochen. Wir sahen nur, wie er mit gesenktem Haupt aus dem Wohnzimmer zu uns in die Küche kam. Er weinte. Mutter stand sofort auf und nahm ihn in den Arm. Dann kamen meine Schwester und ich hinzu, und wir waren eine Vierergruppe aus Heulsusen. Meine Familie.
Qamer und ich durften uns nicht von unserem Großvater verabschieden, nicht den Leichnam sehen. Meine Schwester sollte als die Ältere darauf Acht geben, dass ich nicht ins Totenzimmer ging. Sie sollte die Tür bewachen und auch selbst nicht hineinsehen. Während unsere Eltern das Haus verließen, um alles für die Bestattung zu organisieren, stand Qamer wie ein Soldat vor dem Durchgang. Ich durfte nicht an ihr vorbei.
»Kinder dürfen keine Leichen sehen.«
»Aber Opa ist keine Leiche. Es ist Opa.«
»Nein, Shams, nein!«
»Bitte!«
»Nein, habe ich gesagt!«
Sie packte mich unsanft am Arm und riss mich zurück. Es war nichts zu machen. Ich ging vor das Haus und wartete auf die Eltern. Ab und zu sah ich nach meiner Schwester, ob sie noch da war. Pflichtbewusst versperrte sie breitbeinig und mit verschränkten Armen den Weg zum Toten. Sie rührte sich keinen Millimeter. Irgendwann jedoch drehte sie die Füße leicht nach innen und stand x-beinig da. Sie verzog das Gesicht und hielt die Hände jetzt auf Höhe ihres Unterbauches. »Verdammt«, rief sie und huschte dann schnell ins Bad. Sobald sie die Tür geschlossen hatte, lief ich ins Wohnzimmer.
Großvater lag auf seiner Matratze, auf ihm mehrere Decken. Ich näherte mich und hatte überhaupt keine Angst. Ich zog die Decken von seinem Gesicht, sah ihn mir genau an. Seine Haut war sehr bleich, die Wangen wirkten noch eingefallener als sonst. Seine Augen waren geschlossen. Er wirkte friedlich, ja sogar zufrieden. Ich küsste ihn schnell auf die Wange, die ziemlich hart und fest wie Leder war. Aber seine Nase, an die ich ungewollt stieß, war ganz weich und gab nach. Vielleicht ist das so, vielleicht wird die Nase weich, wenn man stirbt, dachte ich und zog die Decken wieder über Großvaters Gesicht.
*
Unser Dorf trug früher den Namen Helle, was »herzlich« bedeutet. Diesen haben ihm, so erzählten es die Ältesten, die Osmanen während ihrer Herrschaft gegeben. Einst soll hier ein riesiges befestigtes Lager existiert haben, wo die Landesherren mit ihren Streitkräften logierten, wenn sie sich bei uns im Südirak aufhielten. Doch als die Engländer mit ihrer Armee aufmarschierten und die Türken verjagten, fanden sie unter dem Fort ein abscheuliches Gefängnis, in dem sich Hinrichtungsräume und Folterkammern befanden. In der Umgebung stießen sie auch auf mehrere Massengräber. Die Engländer tauften den Ort daraufhin auf den Namen Hell, »Hölle«, und das Verlies wurde in ein Heeresdepot umgewandelt. Später dann, nach der Gründung des Königreichs Irak, waren die Beamten uneinig darüber, welchen Ortsnamen man denn nun übernehmen sollte: »Herzlich« der Osmanen oder »Hölle« der Engländer? Die Iraker entschieden sich nach langem Kopfzerbrechen für eine Zwischenlösung, und so erhielt unser Dorf offiziell den Namen Ahlan Dschahannam, »Herzliche Hölle«.
Nach der Entscheidung stellte man ein grünes Schild an der Landstraße auf, auf dem dieser Name in weißer Schrift geschrieben stand. Zuletzt befestigte man einen Pfeil daran, welcher in unsere Richtung zeigte.
Vom ehemaligen Fort war in meiner Kindheit fast nichts mehr erhalten. Nur ein einzelner, frei stehender Raum aus brüchigen Mauern ohne Dach stand noch. Überall lag Schutt, und wir Kinder spielten oft zwischen den Steinen und Holzbalken. Der gruselige Keller war längst zugeschüttet worden und nicht mehr zu betreten. Dieser Spielplatz lag ungefähr einen Kilometer vom Dorf entfernt. Es stand sogar ein Schild vor der Ruine mit dem Hinweis, dass es sich um eine historische Stätte der Osmanen handle. Doch trotz ihrer geschichtlichen Bedeutung kümmerte sich niemand darum. Zwischenzeitlich hieß es sogar, man wolle direkt daneben eine Tankstelle errichten, aber daraus wurde offenbar nichts. Letztlich wurde das Zimmer von Reisenden oftmals als Scheißhaus verwendet. Ein Scheißhaus mit Blick in den Sternenhimmel.
Unser Dorf war relativ groß und bestand aus ungefähr zweihundert einstöckigen Häusern, die dicht an dicht gebaut waren. Einfache Bauten aus sonnengetrockneten Lehmziegeln mit Flachdächern. Das Nachbardorf Al-Hindi war doppelt so groß wie unseres. Es bildete jedoch keine wirkliche Einheit, da sich die Häuser ohne jede Ordnung im Umland verteilten. Zum Teil lag ein viertelstündiger Fußmarsch dazwischen. Früher hatten beide Dörfer sogar einmal zusammengehört. Während der englischen Besatzung wurden die Dorfgemeinschaften getrennt, und jede bekam ihren eigenen Namen. Unser Schwesterdorf wurde nach einem britischen Soldaten benannt, der ursprünglich aus Indien stammte. Deshalb hieß es Al-Hindi.
Die Engländer waren schon immer sehr fleißig beim Erobern und haben im Verlauf ihrer Geschichte viele Länder angegriffen. Unter diesen war auch Indien, dessen Einwohner fortan als Soldaten in der britischen Armee dienen mussten. So kam also ein Inder in unsere Gegend. Er blieb für einige Jahre, war ein Muslim und sprach sogar ein paar Brocken Arabisch. Wie er tatsächlich mit vollem Namen hieß, wusste keiner — oder zumindest konnte sich niemand seinen komplizierten indischen Namen merken. Man nannte ihn deshalb einfach Al-Hindi, »den Inder«. Er war damals wohl so etwas wie ein Ortsvorsteher. Der Soldat kümmerte sich um alle Angelegenheiten zwischen den Engländern und uns Ureinwohnern. Sein geräumiges Wohnhaus wurde später mein Schulgebäude, in dem sich die »Al-Hindi-Schule« befand. Die Bewohner haben Al-Hindi angeblich geliebt und die Obrigkeit ihrerseits davon überzeugt, das Dorf nach ihm zu benennen. Er selbst kehrte nach seiner Dienstzeit in seine Heimat zurück und die Engländer ins Vereinigte Königreich. Der Name blieb.
All diese historischen Ereignisse schienen für die älteren Bewohner unserer Gegend sehr wichtig zu sein. Sie erzählten ihren Kindern und Kindeskindern wieder und wieder dieselben Anekdoten beim abendlichen Kerzenschein oder vor dem Lagerfeuer. Mit großen Gesten beschworen sie die alten Zeiten herauf, als lägen diese Ereignisse erst wenige Tage zurück.
Außer unserer Geschichte und diesen Erzählungen besaßen wir in Herzliche Hölle und im Inder-Dorf auch nicht wirklich viel. Die nächsten Städte waren kilometerweit entfernt, und im Vergleich zu uns schwelgten sie im Überfluss. Strom oder fließendes Wasser, wie im Städtchen Amara, das einen Zwei-Tages-Marsch entfernt in Richtung Osten lag, gab es bei uns nicht. Sobald es dunkel wurde, flackerten Fackeln und Kerzen in den Häusern. Zum Trinken und Waschen hatten wir einige Brunnen, die beide Dörfer versorgten. Täglich gingen die Frauen zu ihnen. Sie balancierten große Tontöpfe auf dem Kopf und wiegten zugleich ihre Säuglinge auf dem Arm. Außerdem gab es einen Mann, der für die besser verdienenden Familien der Gegend das Wasser beschaffte und sich für die beschwerliche Arbeit bezahlen ließ. Der Saqa, »Wasserträger«. Jeder, der ihn sah, verstand sofort, wieso man bei uns, wenn man schlechtes Wetter beschrieb, gern sagte: »Es ist kalt und nass wie der Po eines Wasserträgers.« Das Wasser schwappte aus den Behältern, die der Saqa auf seinem Rücken schleppte, und floss an ihm hinab. Er hatte immer einen nassen Hintern.
Der unserem Haus am nächsten gelegene Brunnen lag zwischen beiden Dörfern in einem kleinen Palmenhain. Der Platz war wie eine winzige Oase. Nur Frauen und wir Kinder durften uns dort aufhalten. Für alle Männer, bis auf den Saqa, war dieser Ort verboten — ein ungeschriebenes Gesetz. Und der Wasserträger tauchte erst auf, wenn alle anderen weg waren. Denn keiner durfte die Frauen und Mädchen dabei stören, wenn sie dort mit den Kindern ihre Arbeit verrichteten. Geschirr und Kleidung wurde gewaschen, und der Nachwuchs spielte im Matsch oder tollte umher. Die Frauen wirkten an diesem Ort entspannt und frei. Sie plauderten stundenlang miteinander, redeten lautstark über die Vorzüge und Nachteile ihrer Ehemänner, träumten gemeinsam von einem besseren Leben und tauschten leckere Rezepte aus. Ich liebte es dort. Die Frauen wirkten so selbstbewusst, schön und charmant in diesen Stunden.
Ich hatte viele Freunde in den beiden Dörfern und kannte die Gegend wie meine Schultasche. Überall gab es Tiere, mit denen ich spielen konnte: blökende Schafe, meckernde Ziegen, gackernde Hühner, gurrende Tauben, muhende Kühe und bockige Esel. Die Frauen kümmerten sich beflissen um den Haushalt, erzogen die Kinder und versorgten zugleich die Tiere. Ein paar von ihnen gingen zusätzlich noch arbeiten, wie meine Mutter. Sie putzte täglich die Moschee im Nachbardorf und verdiente so unseren Lebensunterhalt. Fast alle Männer hingegen waren wie mein Vater Soldaten, nur Staatsbeamte nicht, wie Lehrer, Ärzte oder Behördenmitarbeiter. Einzig die Senioren hatten halbwegs ihre Ruhe und verkauften irgendetwas Nützliches vor ihren Haustüren wie Süßigkeiten, Sandalen, Zigaretten, Batterien oder Puppen, die sie aus der Stadt mitbrachten und hier zu überhöhten Preisen anboten. Manche besaßen auch einen Eselskarren und chauffierten Menschen, Tiere oder Gegenstände zwischen den Dörfern hin und her. Doch ein Mann zu sein bedeutete bei uns, dass man jederzeit in den Einsatz berufen und an die Front geschickt werden konnte. Wer die Nachricht zum Ausrücken bekam und wer nicht, das folgte keiner Logik, sondern schien völlig willkürlich zu geschehen. Wenn unsere Armee Gebiete an der Grenze verlor, war klar: Bald würden einige einberufen werden. Die Männerwelt der Dörfer war so löchrig wie ausgetretene Kampfstiefel, niemals wurden alle zeitgleich eingezogen. Manche waren Veteranen und hatten bereits gedient, anderen hatte man im Grunde gerade erst das Khaki angelegt. Den Umgang mit Waffen und stramm zu stehen lernten wir kleinen Männer bereits in der Schule. Von der ersten bis zur sechsten Schulklasse hieß unser Trupp Thlaa al-Baath, die »Pioniere der Wiedererweckung«. Ab der siebten Klasse nannte man die mittelgroßen Männer dann »Jugend der Wiedererweckung«. Und alle weiteren Bürger, inklusive Frauen, Babys und Katzen, seien auch »Baathisten«, »Wiedererweckende«, wie unser Präsident mehrmals betont hatte, selbst dann, wenn sie keine Mitglieder der Partei waren.
Ich gehörte zu den Pionieren und freute mich jedes Mal, die hellblaue Camouflage-Uniform tragen zu dürfen. Wir standen dann, Lehrkräfte in Khaki-Uniform gekleidet und Schüler in Camouflage-Uniform, geordnet in Reih und Glied. Drei Pioniere transportierten die Flagge im Gleichschritt über den Schulhof bis zum Mast. Wenn die Fahne wehte, feuerte unser Schuldirektor aus seinem Gewehr ein paar Schüsse in den Himmel ab, und wir sangen gemeinsam unsere Nationalhymne. Das Hissen der Flagge fand jeden Morgen statt, in Uniform jedoch nur zu irgendwelchen Feierlichkeiten und Festtagen. Unser Klassenlehrer fragte uns, und wir antworteten im Chor.
»Wer seid ihr?«
»Wir sind Pioniere Saddams und der Wiedererweckung.«
»Eure Parole?«
»Ehrenamtliches Engagement im Heimatdienst!«
»Eure Ziele?«
»Die Heimat, die Ordnung und die Arbeit!«
An solchen Tagen wurde in der Schule nur gefeiert. Später holten uns bewaffnete Mitglieder der Partei ab, und wir marschierten gemeinsam durch unsere Dörfer, riefen im Rhythmus: »Wir sind Pioniere. Gott, Heimat und Führer. Wir sind Pioniere. Mit ganzer Seele und unserem Blut opfern wir uns für dich, oh Saddam. Wir sind Pioniere.«
*
Herzliche Hölle war unser Zuhause, und ich hatte den Eindruck, dass wir im Grunde alle zufrieden waren mit dem wenigen, was wir hatten. Nur meine Schwester nicht, die bald dreizehn Jahre alt werden sollte. Sie begann, unaufhörlich zu jammern, fand plötzlich alles und jeden blöd und wollte gern in Amara oder irgendeiner anderen Stadt wohnen. Qamer fühlte sich eingeengt und wie in Ketten gelegt. Herzliche Hölle und Al-Hindi waren zu klein für die Träume eines pubertierenden Teenagers. Sie regte sich auf, wenn die Ältesten uns wieder einmal erklärten, wie viel Glück wir doch hätten, hier zu leben. In den letzten Jahrzehnten hatten die Menschen des Südens schließlich viele schreckliche Ereignisse überlebt, allen voran den achtjährigen Irak-Iran-Krieg. Obwohl die iranische Grenze und damit die Front gar nicht allzu weit von uns entfernt lagen, bemerkten wir hier kaum etwas vom Krieg.
Manchmal konnte ich entfernt Detonationen hören, die auch ein aufziehendes Gewitter hätten sein können, oder Kampfflugzeuge sehen, die über unsere Köpfe rasten. Ich stand dann draußen mit den anderen und schaute die Himmelsschlachten an. Aber nach einer Weile beachtete ich die Flugzeuge gar nicht mehr, als wären sie ein Schwarm Tauben. Wir gewöhnten uns an den fernen Krieg. Nur einmal in jenen Jahren wurde die Gegend von einigen Raketen getroffen. Absurderweise wurden sie nicht von iranischen Angreifern abgefeuert, sondern von unseren eigenen Leuten.
Immer wieder erzählten die Dorfbewohner davon, wie die Iraner es im ersten Kriegsjahr geschafft hatten, bis zu uns vorzudringen. An der Seite des persischen Trupps waren auch manche unserer Landsleute in unser Dorf einmarschiert, Oppositionelle, die sich gegen Saddam stellten und dem Feind gegen den Feind halfen. Die Soldaten behandelten die Bewohner damals sehr gut, verwöhnten die Kinder mit Schokolade und schenkten jeder Familie ein arabisches Buch mit Bittgebeten, das Schlüssel zum Paradies hieß. Eine seltsame Mischung. »Krieg wird normalerweise nicht mit Schokolade und Büchern, sondern mit Gewehren und Bomben geführt«, scherzte man im Nachhinein. Als es hieß, Fremde hätten die Grenze übertreten und näherten sich dem Dorf, brach Panik aus. Jeder verschanzte sich in seinem Haus, verbarrikadierte die Türen mit aufgetürmten Möbelstücken. Selbst die Frauen hielten Küchenmesser stoßbereit in Händen und die Männer, was immer sie finden konnten, von uralten Pistolen bis hin zu Knüppeln. Zu allem bereit, erwarteten beide Dörfer die Ankunft der Soldaten. Doch es gab kein Blutvergießen. Die Iraner gaben den Leuten schnell zu verstehen, dass sie in friedlicher Absicht kämen. Nur die wenigen Regierungstreuen wurden festgenommen und weggebracht.
Das Ganze dauerte keine zwei Tage. Denn die irakische Armee rückte schnell vor, sodass sich die Iraner direkt wieder zurückziehen mussten. Unser Präsident hatte befohlen, anzugreifen. Irakische Panzer rasten durch den Wüstensand und feuerten ihre Geschosse in Richtung mancher Siedlung, darauf folgten Bombardements der Flugstaffeln.
Einige Häuser in Al-Hindi wurden zerstört und mehrere Bewohner verletzt. In Herzliche Hölle löschte eine verirrte Rakete eine Familie aus. Von diesem einen Zwischenfall abgesehen bemerkten die Bewohner den Krieg fast gar nicht, und ohne die Durchhalteparolen im Radio und die aggressive Rhetorik hätten sie beinah vergessen, in welcher Situation sich das Land befand. Nur die leeren Plätze beim Essen machten einigen Familien jeden Morgen, Mittag und Abend bewusst, dass manche an der Front und andere verstorben waren.
Der Krieg zog sich acht lange Jahre hin, und irgendwann wurde er normal. Alle freuten sich dennoch unendlich über sein abruptes Ende. Wir gingen nach draußen und feierten stundenlang. Einige feuerten mit ihren Pistolen in den Himmel, denn keiner unserer Männer musste mehr an der Front dienen. Unsere gute Stimmung endete, als wir in den nächsten Tagen im Radio hörten, dass dies einer der verlustreichsten Kriege in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen sei, dass während des Krieges ungefähr eine Million Menschen ihr Leben verloren hätten. Trotz einzelner Verluste im Dorf erschien uns diese Zahl unglaublich, so hoch, als wäre der Irak um die Hälfte dezimiert worden.
Danach betonte mein Vater noch häufiger als sonst, wie viel Glück er doch als Soldat gehabt habe. Ich wusste nicht, ob er jemals als etwas anderes gearbeitet hatte. Denn ich war erst ein Jahr alt gewesen, als der Krieg begonnen hatte, und somit kannte ich meinen Vater nur in khakifarbener Uniform. Er hatte seine Waffe in den acht Jahren des Krieges jedoch kein einziges Mal benutzt. Das hatte er stets mit Stolz erzählt, wobei das wirklich pures Glück gewesen war. Normalerweise durfte ein Soldat nur für eine Woche im Monat nach Hause, aber Vater tauchte mehrmals wöchentlich bei uns auf und verbrachte die Nächte in den Armen meiner Mutter. Seine Stellung lag weniger als zwei Kilometer von unserem Dorf entfernt, und wenn er nicht Wache halten musste, rannte er einfach schnell nach Hause. Das hatte er mit seinem Kameraden Nasir ausgemacht. Einer blieb stets in der Stellung, und der andere ging zu seiner Familie. Niemand kontrollierte die beiden. Eigentlich hätten sie auch ganz zu Hause bleiben können, da der Außenposten winzig war und völlig unbedeutend für den Kriegsverlauf. Sie hatten einfach überhaupt nichts zu tun und mussten nur in ihrem Büro an der Landstraße sitzen, allenfalls hier und da etwas Schriftverkehr erledigen und sich vornehmlich selbst verwalten. Ihr Wachposten sah wie eine kleine Wohnung aus, bestand aus zwei Zimmern und einer kleinen Küche. Er lag nur einen Katzensprung von dem historischen Scheißhaus der Osmanen entfernt, in dem sie, genau wie die Reisenden, ihre Notdurft verrichteten. Einmal monatlich gab es etwas Abwechslung. Wachdienst und Schreibkram waren keineswegs die wichtigsten Aufgaben der beiden, sondern: der Transport. Sie hatten Lieferungen mit dem Lastwagen zu fahren. Dann übernahmen zwei Waffenbrüder aus der Volksarmee ihre Aufgaben in der Stellung. Ihre Reisen mit dem Lastwagen dauerten oft eine Woche oder sogar länger. Sie fuhren Waren nach Kuwait, in aller Regel Datteln, und kamen mit Säcken voller Mehl, Zucker und Reis zurück. Jedes Mal freuten wir uns riesig, wenn Vater auf große Reise ging. Wir wussten, dass er wieder etwas Spannendes mitbringen würde: Spielzeug oder »imperialistische Getränke« wie Pepsi und Coca-Cola, die eigentlich streng verboten waren.
Weil Vater diese Fahrten machte, kannte ich, anders als die anderen Jungs im Dorf, nicht nur unsere Grush-Cola. Bis ich das Original aus den USA kannte, hatte ich sie für lecker gehalten. Aber nun hatte ich die roten Cola- und blauen Pepsi-Dosen, die mit arabischen und lateinischen Buchstaben beschrieben waren. Stolz gab ich vor meinen Dorffreunden damit an und wurde von allen neidisch bewundert. Ich war so gierig nach diesem Getränk, dass ich nie etwas teilen mochte. Nicht mal einen Tropfen gönnte ich den durstigen Kehlen meiner Freunde. Ich stürzte die Dose zumeist so schnell herunter, dass ich selbst nicht viel davon hatte. Außer zahlreiche Rülpser. In Kuwait, erzählte Vater, gebe es überall Pepsi und Coca-Cola, aber Grush-Cola habe er dort nie gesehen. Im Irak gab es überall Grush-Cola, bei der man nicht wusste, woher sie stammte, aber sie war eine erlaubte Cola und somit nicht imperialistisch.
Seitdem der Krieg vorbei war, verbrachte Vater die meiste Zeit mit uns zu Hause. Er half sogar Mutter im Haushalt. Das war für uns ein höchst seltener Anblick und überhaupt nicht üblich. Es herrschte eine ausdauernde Ruhe und Gelassenheit. Auch meine immer leicht nervöse Mutter war mit einem Mal tiefenentspannt und wirkte regelrecht gelöst.
UM MICH HERUM sind nur weiße Wände und eine graue Eisentür, und durch das Gitter vor dem Fenster erkenne ich nichts, nur eine gähnende Leere, ein blauer Himmel und eine Dattelpalme blicken auf mich herab. Ich höre absolut nichts. Es ist ungeheuer schön, die Sonne zu sehen. In den letzten zwei Jahren im Kerker sah ich sie nur für eine halbe Stunde wöchentlich. Immer donnerstags gegen Mittag kamen die Wärter, um die Häftlinge aus den Zellen zu holen, dann ließen sie uns alle in einem Hof zusammenstehen. Nackte Männer. Um uns herum hohe, kahle, dicke Mauern. Die Sonne über uns wie eine mächtige Göttin. »Der Platz unter der Sonne« nannten die Wärter diesen Ort. Immer wieder sah ich, wie manche von ihnen uns beobachteten und grinsten. Einige ekelten sich vielleicht. Nicht jeder findet nackte Vogelscheuchen ansehnlich. Wir waren alle abgemagert, waren nur noch Haut und Knochen, ausgehungerte Zombies.
Diese verdammte Sonne! Am Morgen erst hatte ich gedacht, ich würde sie niemals wieder erblicken, ich hatte gezittert vor Kälte, meine Mitgefangenen hatten gedacht, ich würde die Augen tatsächlich für immer schließen. Die ganze Nacht über war ich am Ende meiner Kräfte gewesen. Ich hatte unendliche Bauchschmerzen. Zu Beginn war es, als würde ein Dolch tief in mich eindringen und als würde sich die Klinge im Kreis drehen; am Ende fühlte es sich an wie eine Bohrmaschine, die unkontrolliert durch meinen Bauch schlug. Die Muskeln meines Körpers wurden hart. Ich war ein einziger Krampf. Mehrmals riefen meine Kameraden nach Hilfe. Irgendwann tauchte ein Wärter auf und fragte: »Was ist los?«
»Der hier stirbt gerade!«, antwortete jemand.
Dann wurde alles dunkel. Ich wachte erst wieder in diesem Krankenhaus auf, mit drei Wärtern in Khaki-Kluft, die auf mich aufpassten. Es war ein Operationsraum. Eine kleine, rundliche Ärztin meinte, dass ich an einer Blinddarmentzündung leide und schnellstens operiert werden müsse; es dauere nur noch wenige Minuten. Die Operationspfleger bereiteten die seltsamen, scharfen Geräte vor. Ich schloss die Augen und versuchte, an nichts zu denken. Noch bevor man mich betäubte und meinen Bauch mit dem Messer aufschnitt, kam jedoch ein weiterer Arzt hinzu und ließ die Operationsvorbereitungen abbrechen. »Die Bauchkrämpfe sind nicht körperlich«, sagte er, »sondern vermutlich Ausdruck einer psychischen Störung. Er muss im Krankenhaus bleiben, wir beobachten seinen Zustand.« Die Seele hat mehrere Erscheinungsformen, auch im Bauch ist sie spürbar, auch dort lauert sie, weint und schreit. Schließlich brachten die drei Wärter mich in dieses leere Zimmer, ließen mich mit dem nun Schlafenden allein zurück, nachdem sie meine rechte Hand mit der Schelle am Bettpfosten festgemacht hatten.
Ich vernehme jetzt Schritte auf dem Flur, die immer lauter werden.
»Hey du! Hey! Wach auf! Sie kommen!«
Der Wärter reißt die Augen auf, schaut mich überrascht an und springt auf.
Ein Mann in Zivil tritt ins Zimmer, gefolgt von einem bewaffneten Mann in Uniform.
»Alles gut?«, fragt er.
Der Wärter salutiert. »Ja, Herr. Alles gut!«
ZWEI
Ära der Bananen
Die Ruhe im Lande fand ihr jähes Ende, als die Männer in unserem Teehaus nicht mehr ununterbrochen Domino oder Backgammon spielten, sondern nur noch nervös Zigaretten rauchten und den Nachrichten lauschten. Niemand verstand, was genau passiert war. Die Ereignisse überschlugen sich. Vater war wieder seltener zu Hause und musste mit seinem Kameraden Nasir ständig zwischen dem Irak und Kuwait pendeln. Er hatte vermutlich Angst, uns die Wahrheit darüber zu erzählen, was genau im Land geschah. Vielleicht hatte er es auch selbst noch nicht wirklich begriffen.
Das, was man bald in Erfahrung brachte, war, dass wir anscheinend in Kuwait einmarschiert waren. Einfach so, von jetzt auf gleich und fast ohne Gegenwehr. Im Radio wurde behauptet, es gebe in unserem kleinen Nachbarstaat eine Revolution und das hungernde Volk habe sich gegen die Regierung gestellt und ihr schließlich einen Fußtritt verpasst. Der Widerstand habe daraufhin uns um Unterstützung gebeten. Die irakischen Soldaten seien also nur dort einmarschiert, um dem Land und den Revolutionären freundlicherweise bei einer Neuausrichtung zu helfen.
Der neue Anführer des befreiten Kuwait tauchte immer wieder in den irakischen Medien auf. Er hieß Alaa, und Vater hatte ihn sogar schon leibhaftig gesehen, an einem irakisch-kuwaitischen Grenzposten. Er habe ausgesehen wie ein kuwaitischer Prinz, behauptete mein Vater, er sei auch entsprechend angezogen gewesen, er habe ein wunderbares weißes Gewand aus Seide und einen schwarzen Turban getragen. Dieser Mann bedankte sich bei uns Irakern und unserem selbstlosen Präsidenten. »Klar«, sagte meine Mutter. »Ein guter Nachbar ist besser als viele böse Verwandte. Und die Kuwaiter standen in den letzten Jahren auf unserer Seite, gegen Iran. Jetzt brauchen sie uns, und wir helfen ihnen natürlich.« Kurz darauf verkündete der neue kuwaitische Premierminister Alaa: die neue Regierung werde sich freiwillig auflösen, und das kleine Land solle fortan zum neunzehnten irakischen Gouvernement erklärt werden. Diese Nachricht hörten wir mit unserem batteriebetriebenen Radio zu Hause. Meine Mutter war nun irritiert. »Ich stelle es mir doch sehr komisch vor, wenn die Wand zwischen unserem Haus und dem unseres Nachbarn einstürzen würde und wir dann im selben Haus zusammen wohnen und in derselben Küche kochen müssten.«
Vater hat Mutters Bemerkungen nie kommentiert. Er schüttelte jedes Mal nur wortlos den Kopf.
Nach und nach erfuhren wir, dass es sich in Wirklichkeit um eine Besatzung handelte. Einige hatten schon von Anfang an davon gewusst. Unser Dorf lag ja nicht weit von der Grenze entfernt, und man konnte bei uns viele ausländische Radiosender empfangen, auch wenn das eigentlich verboten war. Natürlich lieferten sie die Informationen, die uns unser irakischer Rundfunk vorenthielt. Radio Iran, Radio Monte-Carlo oder BBC waren unser Tor zur Welt.
Je mehr sich die Lage zuspitzte, desto weniger kommentierte meine Mutter diese Angelegenheiten. Stattdessen begann sie, viel zu beten und von Gott zu verlangen, uns ein Licht in solch dunklen Zeiten zu schicken.
Mir waren die Zusammenhänge nicht vollends klar. Dafür war ich zu jung und unerfahren. Ich verstand nur, dass etwas Schreckliches geschah, dass etwas nicht stimmte. Erst viel später begriff ich, was sich wirklich zu jener Zeit ereignet hatte, und bewunderte rückwirkend meinen Vater dafür, dass er trotz allem immer so ruhig geblieben war.
An einem Abend, nachdem er zuvor für etliche Wochen in Kuwait gewesen war, war er auffallend schweigsam und nachdenklich. Er schaute uns alle lange an, wie um sich unsere Gesichter einzuprägen, und er hörte gar nicht auf damit, Qamer und mich zu drücken und zu küssen. Doch meine Schwester wollte das nicht, denn sie sei jetzt mit dreizehn bereits eine Frau. Vater lachte von Herzen und war ihr nicht böse. Als meine Schwester und ich im Nebenzimmer auf der Matratze lagen und schlafen sollten, war er mit Mutter alleine im Wohnzimmer. Wir versuchten, ihrem Gespräch zu lauschen. Und tatsächlich hörten Qamer und ich an diesem Abend viele Dinge, über die wir nie laut sprechen durften.
»Wir haben das Land erobert. Wir haben sie abgeschlachtet.«
Mutters Stimme zitterte: »Ist das wahr?«
Vater antwortete erst nach einigen Sekunden: »Ich jedenfalls habe keinem wehgetan. Habe nur Waffen transportiert. Dasselbe wie immer, wie im letzten Krieg auch. Nur haben wir ihnen dieses Mal die Waffen einfach gestohlen.«
»Waffen? Ich dachte, du hättest Lebensmittel gefahren.«
»Es waren immer schon Waffen.« Kurze Stille. »Wir haben jetzt alles restlos geplündert. Wenn nun wieder ein neuer Krieg beginnt, werde ich vielleicht kämpfen müssen.«
Weil meine Mutter nichts mehr sagte, wussten wir, dass sie unseren Vater in den Arm genommen hatte und sie sich gegenseitig trösteten.
*