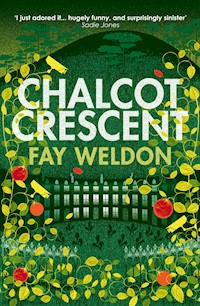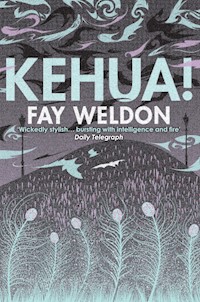9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein humorvoller Briefwechsel über das Schreiben und die Literatur aus weiblicher Perspektive. In Briefe an Alice setzt Fay Weldon auf amüsante Weise Virginia Woolfs Ein Zimmer für sich allein fort und ergründet, wie es begabte Frauen heute mit der Literatur halten. Tante Fay, eine etablierte Schriftstellerin auf Australien-Tournee, berät brieflich ihre Nichte Alice, eine mürrische Literaturstudentin und angehende Autorin. Die Tante rät dem unzivilisierten Gör zum Lesen der Klassiker, insbesondere Jane Austen, und vom dilettantischen Schreiben ab. Doch der Schnellkurs wirkt anders als geplant: Alice fällt durchs Examen – und zimmert ein Romänchen, das erfolgreicher wird als sämtliche Werke der Profi-Tante zusammen. Die Leser profitieren von der misslungenen Belehrung und erfahren Bemerkenswertes über den Unterschied zwischen Literatur und Autobiographie sowie über die Bedingungen, unter denen Frauen seit jeher schreiben. Ein unterhaltsamer philosophischer Briefwechsel, der zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Fay Weldon
Briefe an Alice
oder Wenn du erstmals Jane Austen liest
Aus dem Englischen von Angela Praesent
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Tante Fay – etablierte Schriftstellerin und gerade in Australien auf Tournee – berät brieflich ihre Nichte – Punk-Mädchen, mürrische Literaturstudentin und Möchtegern-Autorin. Die Tante rät dem unzivilisierten Gör zum Lesen der Klassiker (vor allem: Jane Austen) und vom dilettantischen Schreiben ab. Doch der Schnellkurs wirkt anders als geplant: Alice plumpst durchs Examen – und zimmert ein Romänchen, das erfolgreicher wird als sämtliche Werke der Profi-Tante zusammen. Nutznießer der mißlungenen Belehrung sind Fay Weldons Leser: sie hören Bemerkenswertes über den Unterschied zwischen Literatur und Autobiographie und über die Bedingungen, unter denen Frauen seit je schrieben.
Über Fay Weldon
Fay Weldon ist Autorin von Romanen, Drehbüchern und Theaterstücken.
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter (nicht diejenige in diesem Buch, diesem Briefroman; sie nämlich ist ganz und gar erfunden, ebenso wie Alice, Enid und so weiter), der ich an Moral und Weisheit alles verdanke, was ich besitze.
Erster Brief Die Stadt der Erfindung
Cairns, Australien, Oktober
Meine liebe Alice,
es tat gut, Deinen Brief zu bekommen. Ich bin hier sehr weit fort von zu Hause, fast im Exil. Und Du fragst mich um Rat – das wärmt und gibt mir das Gefühl, ich müsse wohl etwas wissen; oder wenigstens mehr als Du. Der Eindruck, man wisse immer weniger, je älter man wird, ist entmutigend. Als ich Dich das letzte Mal sah, warst Du zwei Jahre alt, blond und engelhaft. Nun, höre ich, bist Du achtzehn, färbst Dir die Haare mit Pflanzenfarben schwarz und grün, und Deine Mutter, meine Schwester, ist beunruhigt. Vielleicht bedeutet Dein Brief an mich einen Schritt in Richtung auf eine mögliche Versöhnung zwischen Dir und ihr? Ich werde mich in Euer Verhältnis nicht einmischen; ich werde mich auf die Fragen beschränken, die Du aufwirfst.
Nämlich Jane Austen und ihre Bücher. Du erwähnst nebenbei, daß Du am College englische Literatur belegt hast und Jane Austen lesen mußt; daß Du sie langweilig, unbedeutend und irrelevant findest und Dir nicht vorstellen kannst, was für einen Zweck das haben soll, daß Du sie liest, wo die Welt doch in der Krise steckt und die Zukunft katastrophal aussieht.
Du liebes Kind! Meine liebe hübsche kleine Alice, jetzt mit schwarz-grünem Haar –
Besteht die mindeste Hoffnung, daß ich Dir erklären kann, was LITERATUR ist, die in Großbuchstaben? Gescheit genug bist Du. Du konntest mit vier Jahren lesen. Aber dann hast Du Dich, ganz vernünftig, dem Fernsehen zugewandt und es als Dein Fenster zur Welt benutzt; hast Deinen Hunger auf Information, auf Geschichten mit Anfang, Mitte und Ende mit den leicht verfügbaren, schmackhaften Stoffen aus dem Kasten im Wohnzimmer gestillt, und (wenn meine Erinnerung an Deine Mutter mich nicht trügt) sicher auch in Deinem eigenen Zimmer. Du hast Dich in Schlaf gewiegt mit Bildern von Gewalt und den gröberen Formen menschlichen Agierens und Reagierens; mit Geschichten, in denen es für jede schlichte Handlung ein schlichtes Motiv gibt, in denen nichts unerklärlich ist und sogar Gott auf nicht rätselhafte Weise handelt. Und jetzt wird Dir klar, daß dies nicht genug ist; Du hast den Verdacht, daß es noch mehr gibt, daß Deine eigenen Gefühle und Reaktionen tausendmal komplizierter sind, als die blecherne Tele-Darstellung von Wirklichkeit es je vermuten ließ; Du spürst, das ahne und hoffe ich, etwas von Unendlichkeit, vom Zauber der Schöpfung, vom Wunder der Liebe, vom Glanz des Daseins; Du siehst Dich, erfüllt von Deinem ungezähmten neuen Verständnis, Deiner unerwarteten Vision, nach Gefährten um und triffst auf die gleichen Zombie-Blicke, die gleichen bleichen Gesichter und gefärbten Wattehaare; und schließlich wendest Du Dich der Bildung, der Literatur, den Büchern zu und findest sie Dir verschlossen.
Nicht verzweifeln, kleine Alice. Halt nur durch, und Du wirst sehen, Jane Austen bietet Dir alles. Gerade eben ist eine Kokosnuß vom Baum gefallen und hat knapp den Kopf eines meiner Mitgäste verfehlt, hier in diesem Hotel an einem strahlend blauen tropischen Meer, wo den Seeigeln in der Paarungszeit (die sich nicht klar bestimmen läßt) im flachen Wasser unsichtbare, zehn Meter lange Fäden wachsen, von deren bloßer Berührung ein Kind sterben kann und sicher auch ein leicht schockierbarer Erwachsener. Bleib aus dem Wasser, und die Kokosnüsse erwischen Dich!
Aber auf dem kleinen Bücherregal hier steht ein Exemplar von Jane Austens Emma, mit allen Merkmalen eifrigen Gebrauchs. Die anderen Bücher sind noch zerlesener – Thriller und Schnulzen, wenig haltbare Dinge. Diese Bücher eröffnen ein kleines quadratisches Fenster, durch das Du auf die Welt blicken und die Marionetten beobachten kannst, die sie draußen für Dich tanzen lassen. Sie haben wenig Ähnlichkeit mit Menschen, mit irgend jemandem, der Dir je begegnet ist oder begegnen könnte. Diese Gestalten existieren nur für die Zwecke der Handlung, und die Bücher, in denen sie auftauchen, bedrohen den Leser in keiner Weise; sie legen ihm oder ihr nicht nahe, nachzudenken oder gar sich zu verändern. Aber da sie so sicher sind, bleiben sie natürlich auch ohne Wirkung – sie können niemals Einsichten vermitteln. Und weil sie keine Einsicht hervorbringen, sind sie unbedeutend. (Außer natürlich, es wird an sie geglaubt: dann werden sie gefährlich. Zu glauben, eine Schnulze spiegle das wirkliche Leben wider, heißt, in dauernder Enttäuschung zu leben. Es wird von einem erwartet, daß man ihnen glaubt, solange man sie liest, und keinen Augenblick länger.) Diese Bücher, die abgegriffenen, die Thriller und Schnulzen, sind austauschbar. Sie werden dazu benutzt, die Grillfeuer anzuzünden, wenn die Sonne hinter den wilden Bergen versinkt und Hunger in der Luft liegt – nicht nur nach einem Steak mit Chilisauce, sondern ein echtes menschliches Verlangen nach Lebendigkeit, Sex, Erfahrung, Wandel. Die Seiten lodern auf, werden rot, werden schwarz, verlöschen. Das Steak brutzelt, dank einem Exemplar von Gorki Park. Alle essen.
Aber niemand verbrennt Emma. Niemand würde das wagen. Zu viel ist darin konzentriert: zu viel Geschichte, zu viel Achtung, zu viel vom Wesen der Kultur – und die ist, das muß ich Dir sagen, mit ihrer Literatur verbunden. Mit LITERATUR, die etwas anderes ist als einfach nur Bücher. Natürlich hat Hitler es fertiggebracht, auch Literatur und nicht einfach nur Bücher zu verbrennen und damit die kulturelle Vergangenheit seiner Nation, und keiner hat es je vergeben oder vergessen. Man muß wirklich böse sein, um Literatur verbrennen zu können.
Wie kann ich Dir dieses Phänomen erklären? Wie kann ich Dich von dem Vergnügen an einem guten Buch überzeugen, wenn Du McDonald an der einen Straßenecke und An American Werewolf in London an der nächsten hast? Ich leide selbst an der weit verbreiteten nervösen Furcht vor Literatur. Wenn ich in Ferien fahre, lese ich erst die Thriller, dann die Science-fiction-Bücher, dann die Sachbücher und dann Krieg und Frieden oder welches Buch ich mir gerade zu lesen vorgenommen habe, längst gelesen haben sollte, halb lesen möchte und doch erst ganz lesen möchte, sobald ich angefangen habe. Natürlich fürchtet man sich davor, natürlich ist man davon überwältigt: man sieht mit Vorfreude und Angst der Ohnmacht entgegen, dem fast erotischen Genuß, den eine gute Passage in einem guten Buch vermittelt; wenn etwas Unbenennbares passiert. Ich weiß nicht, was da passiert: ist es die Lust der Begegnung einer Denkweise mit einer andern, unbehindert von den dazugehörigen Körpern? Die Lust daran, daß unsere eigene Erfahrung plötzlich Form und Gestalt anzunehmen beginnt? Aber ja, rufen wir, ja, ja, so ist es! Aber wir müssen stark sein, um wissen zu wollen; wenn plötzlich etwas passiert, wenn wir auf die Idee stoßen und entdecken, daß sie mehr ist als die Summe der Teile, aus denen sie besteht – wenn wir begreifen, daß die Idee mehr ist als die Summe der Erfahrungen. Es kostet Mut zu begreifen, nicht nur was wir sind, sondern warum wir sind.
Vielleicht bekommst Du es in Deinem Seminar über englische Literatur besser erklärt. Ich hoffe es. Ich bezweifle es. An solchen Orten (so kommt es mir wenigstens vor) nehmen die Leute vorne am Pult etwas, das sie nicht ganz verstehen, von dem sie aber vermuten, es sei bemerkenswert, und zerlegen es in seine Bestandteile, in der Hoffnung, so sein wahres Wesen zu entdecken. Genausogut kannst Du eine Fliege zerstückeln und hoffen, daß die Stücke das Geschöpf erklärlich machen. Danach weiß man mehr, versteht aber weniger. Man besitzt mehr Informationen und weniger Weisheit. Ich möchte nicht (unbedingt) die literaturwissenschaftlichen Seminare beleidigen oder auch nur einen Moment lang behaupten, Du wärst außerhalb ihrer Obhut besser dran als unter ihr: ich sage nur, sei vorsichtig. Und ich spreche als eine Autorin, die in (einigen) literaturwissenschaftlichen Seminaren und (vielen) Frauenstudien-Kursen untersucht wird; und ich sage bewußt «als eine Autorin», denn sie erforschen nicht nur meine Romane (auf Werke der schöpferischen Phantasie, wie sie das nennen, darf jeder Jagd machen), sondern sie möchten schließlich am liebsten mir zu Leibe rücken, und ich bin kein tauglicher Forschungsgegenstand.
Ich, als Autorin von Romanen, bin nämlich eine Sache für sich. Was Du von mir liest, ist die letzte von drei oder vier Fassungen, ist Fiktion – und das bedeutet, eine ordentlich formulierte Sicht von der Welt. Aber ich selbst, wie ich lebe, rede, Rat erteile, diesen Brief schreibe, bin nur ein erster Entwurf; bitte vergiß es nicht. Als die Person, die versucht, Dich dazu zu bewegen, mit Genuß Emma und Überredungskunst und Mansfield Park und Die Abtei von Northanger und Stolz und Vorurteil und (bei Gelegenheit) Vernunft und Gefühl und (so oft wie möglich) Lady Susan zu lesen, bin ich jemand ganz anderes. Glaub mir oder laß es bleiben, ganz wie Du willst. Aber hör mir bis zum Ende zu.
Du mußt lesen, Alice, bevor es zu spät ist. Du mußt Deinen Kopf mit den erfundenen Bildern der Vergangenheit füllen, mit je mehr davon, desto besser. Mit den literarischen Bildern aus Beowulf und Chaucers Weib von Bath und Falstaff und Elizabeth Bennet und dem Mädchen mit dem grünen Hut – und mit Hazel aus Unten am Fluß, wenn es sein muß. Diese Bilder werden Dir zumindest helfen, Dir das Einmaleins des Lebens anzueignen, und je mehr Bilder Du im Kopf behältst, desto prächtiger wird der sternenbesetzte Baldachin der Erfahrung, unter dem Du, armes, primitives Geschöpf, das Du bist, Schutz suchst; desto näher kommst Du dem großen, funkelnden Leitstern der Idee, die uns alle beseelt.
Nein? Ein zu üppiges, zu peinliches Bild? Wäre es Dir lieber, wenn ich auf sicherem Grund bliebe und sagte: «Die Literatur steht am Tor der Zivilisation und wehrt Gier, Wut, Mord und Barbarei jeglicher Art ab»? Mir selbst gefällt das nicht sonderlich: ich denke, ich kann heutzutage mit der gleichen Wahrscheinlichkeit innerhalb wie außerhalb der Tore der Zivilisation im Bett vergewaltigt und ermordet werden. Oder womöglich geht die Zivilisation unter, weil die Literatur beiseite getreten ist und wir nur noch Bilder anglotzen? Weil wir fernsehen und nicht lesen und so die Fähigkeit zur Reflektion einbüßen? Dann stünden nur noch die literaturwissenschaftlichen Seminare der Universitäten zwischen uns und dem Untergang!
Nein? Ich merke, daß ich die Literatur durch das zu definieren versuche, was sie tut, nicht durch das, was sie ist. Durch die Erfahrung mit ihr, nicht durch die Idee von ihr.
Versuchen wir es mal anders.
Stell es Dir so vor, wie ein Fernsehkameramann eine Einstellung wählt, mit der er Sue Ellen hübsch in die Bildmitte bekommt. Laß mich Dir die Stadt der Erfindung zeigen, laß sie uns gemeinsam erkunden. Romanautoren tun nämlich nichts anderes (habe ich zum Zweck Deiner Bekehrung beschlossen), als Häuser der Phantasie zu bauen, und wo sich viele Häuser zusammendrängen, da ist eine Stadt. Und was für eine Stadt das ist, Alice! Näher an die himmlische Stadt kommen wir armen Sterblichen nicht heran. Die Stadt der Erfindung glitzert und gluckert vor Leben und Klatsch und Farbe und Hirngespinsten; sie strahlt, sie ist erleuchtet, am Tag von der Sonne der Begeisterung und bei Nacht vom Mond der Inspiration. Sie ist voller Türme und Zinnen, erstreckt sich in achtunggebietende Höhen hinauf und hinab in schwindelerregende Abgründe; es gibt öffentliche Gebäude darin und würdige alte Denkmäler, die manche langweilig und andere großartig finden. Sie hat ihre Zentren und ihre Vorstädte, manche gepflegt, andere verwahrlost, manche sicher, andere bedrohlich. Gegründet, Haus für Haus gebaut haben diese Stadt die Romanciers, die Schriftsteller, die Dichter. Und in diese Stadt kommen die Leser, um zu bewundern, zu lernen, zu staunen und sich umzusehen.
Laß uns die Stadt besichtigen, uns mit ihr vertraut, sie zu unserer ewigen, unsterblichen Heimat machen. Das alles überragende Herz der Stadt ist natürlich die großartige Burg Shakespeare. Man sieht sie, wo man sich auch befindet. Sie reicht hinauf bis in die Wolken, den Himmel, beherrscht alles. Ehrlich gesagt, sie ist ziemlich unregelmäßig gebaut. Manche klagen, sie sei protzig und teilweise schlampig konstruiert, andere murren, sie sei überhaupt nicht von Shakespeare erbaut, und ein paar Leute sagen, man sollte das ganze Ding abreißen, um Platz für Neueres und Wichtigeres zu schaffen, und dieses erstklassige Baugelände für jüngere Talente freigeben. Aber die Burg bleibt ein Jahrhundert nach dem andern hindurch stehen, und wie sehr sich die Architekten auch anstrengen, sie bringen nie etwas ganz so Grandioses zustande; und die Besucher kommen in Scharen, und die Fremdenführer werden immer wieder neu geschult, finden immer neue Weisen, das alte Bauwerk zu erklären. Es ist mehr als ein Lebenswerk.
In dieser Stadt der Erfindung gehen die Leser ein und aus, ohne persönlich eingeladen zu sein, schlendern durch die blätterübersäten Alleen, hasten durch die schauerlichen Slumgegenden, winken einander über die Jahrhunderte hinweg zu, durch die Bogengänge der Jahre. Wenn ich von den «Bogengängen der Jahre» spreche, klingt das für Dich sicher komisch. Aber ich weiß, was ich tue: die sich irrt, bist Du. Geprägt hat diese Wendung Francis Thompson – ein katholischer Dichter, spätes 19. Jahrhundert – in seinem ein bißchen lächerlichen, aber einprägsamen Gedicht «Der Hund des Himmels»:
Ich floh Ihn, durch die Nächte und die Tage
Ich floh Ihn, durch die Bogengänge der Jahre
In diesem Gedicht geht es um Gott, der einer entfliehenden Seele nachjagt, ihr nachspürt wie ein Jagdhund. Er holt sie am Ende ein. Wenn ich die «Bogengänge der Jahre» anführe, dann versuche ich den Gefühlston des Gedichts anklingen zu lassen, die Kraft wie die leichte Absurdität des ganzen Gedichts, die in den vier Wörtern steckt, mit denen ich meinen Satz geschmückt habe. Nenn es Diebstahl, nenn es Kameradschaft unter Schriftstellern, oder nenn es Resonanz (da Du ja jetzt Literaturwissenschaft studierst). Ich glaube nicht, daß es sehr wichtig ist. Auf solche Mittel verließen sich Schriftsteller früher bei ihren Bemühungen, ernstgenommen zu werden, und jetzt können sie es nicht mehr tun. Wir sprechen zu einem Publikum (und ich sage bewußt sprechen und nicht schreiben: heutigen Autoren bleibt kaum noch etwas anderes übrig, als auf Papier aufzuschreiben, was sie auch aussprechen könnten, wenn ihre Zuhörer nur lang genug stehenbleiben würden) und zu einer Generation, die so wenig gelesen hat, daß sie nur die Umgangssprache versteht. Ich glaube nicht, daß es sehr darauf ankommt. Ich glaube daran, daß Schriftsteller sich ändern und anpassen müssen. Es hat keinen Zweck, Vergangenem nachzuweinen: die Menschen heute sind so wertvoll wie die Menschen damals. Du wirst es mir einfach abnehmen müssen, daß auch heute noch die Wörter, die ein Schriftsteller verwendet, tief in der geschriebenen Geschichte wurzeln. Wörter sind nicht einfach Dinge; sie nehmen, wie sie es zu allen Zeiten getan haben, Macht und Bedeutung an.
Ich wette 500 Pfund darauf, daß Du «Der Hund des Himmels» nie gelesen hast.
Aber zurück zu unserer Stadt der Erfindung. Laß es mich so ausdrücken – Schriftsteller schaffen Häuser der Erfindung, von deren Türen aus die Generationen einander grüßen. Stets sind Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen zu vernehmen. Hätte Madame Bovary das Arsen futtern sollen? Hätte sich Anna Karenina vor den Zug geworfen, wenn Tolstoi eine Frau gewesen wäre? Hätte Darcy Elizabeth irgendwo anders als in der Stadt der Erfindung geheiratet? Und so weiter, durch die Jahrhunderte.
Und indem wir so diskutieren und Erfahrungen austauschen, verstehen wir uns selbst und einander, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. In der Literatur – den Romanen, den Phantasien und Fiktionen der Vergangenheit – findest Du die wirkliche Geschichte, nicht in den historischen Lehrbüchern. Thomas Morus’ Utopia erzählt uns ebensoviel über sein eigenes Jahrhundert, seine eigene Welt, wie über diejenige, die er zur Erbauung seiner Zeitgenossen erfand.
Schriftsteller sind bevorzugte Besucher hier in der Stadt der Erfindung; schließlich besitzen sie das eine oder andere Haus am Ort. Vielleicht ein angesehenes und gepflegtes; oder eines, das nie viel galt und nun bis zur Unbewohnbarkeit verfällt. Aber irgendein Haus hier zu haben, selbst wenn es nie über die Planungsphase hinausgekommen ist und in Verzweiflung aufgegeben wurde, bedeutet, daß man das Wunderbare an dieser Stadt klarer begreift und weiß, wie ihre Häuser gebaut sind; daß zwar ein Backstein weitgehend dem andern gleicht und alle Baumeister in ziemlich ähnlicher Weise ihrer Arbeit nachgehen – und dennoch einige Gebäude gut werden, andere schlecht. Und ganz wenige, manchmal solche, von denen man es am wenigsten erwartet hätte, bleiben bestehen und zerbröckeln nicht im Verlauf der Jahrzehnte.
Schriftsteller, Baumeister, gute und schlechte, wissen um diese Dinge Bescheid und sind darum gewöhnlich höflich zueinander, und sehr viel freundlicher als die Leute, die als Außenseiter zu Besuch kommen. Baumeister sind von unterschiedlicher Intelligenz, Zielstrebigkeit, Begabung und Tüchtigkeit; sie bauen mit unterschiedlicher Qualität in den verschiedenen Stadtteilen. Manche bauen, weil sie es müssen, weil sie dafür oder davon leben, weil sie sich dazu berufen fühlen; andere tun es, um etwas zu beweisen oder die Welt zu verändern. Aber man braucht Mut, Ausdauer, Zuversicht und einen Überschuß an Lebenskraft, um überhaupt zu bauen. Die Ganzheit eines Schriftstellers, Alice, wird von der realen Welt nicht aufgenommen. Etwas bleibt übrig: genug, um diese andern, begrenzten Wirklichkeiten bauen zu können.
Jane Austen hatte sehr viel übrig. Das kam daher, könnte man sagen, daß sie sich nicht körperlich damit erschöpfte, in der Welt herumzurennen, einem Mann zu Gefallen zu sein oder Kinder zu versorgen. (Aber das hat sie nicht vor einem frühen, unerfreulichen Tod bewahrt.) Und wenngleich dies bedeutet, daß sie sich einen vielleicht sichereren, eher weltabgewandten Bauplatz für ihre Häuser aussuchte (der sich doch als ein lieblicher, grasbewachsener, wohlgefälliger Hügel herausstellte), als sie ihn unter andern Umständen gewählt hätte, gab sie sich doch durch ihr Schreiben ein weiteres Leben, das länger währte als ihr eigenes; ein literarisches Leben. Ich bin sicher, daß dies nicht ihre Absicht gewesen war. Aber so ist es geschehen. Sie atmete einfach tief hinein in die Quelle ihrer eigenen Kraft, ihres Lebens, und atmete hundert verschiedene Leben aus. Sie besaß genug Energie, um zu bauen. Manche Leute freilich behaupten – und ich neige dazu, ihre Absicht zu teilen –, die dauernd Energie erzeugende Reibung eines mit Haushaltspflichten erfüllten Lebens als Ehefrau und Mutter bringe eine ganz eigene, vorwärtsdrängende Kraft hervor und ein ebenso intensives inneres Leben wie die umsichtige, nachdenkliche, nur der Kunst allein gewidmete Existenz. Andere Leute bestreiten das.
Es gibt alle möglichen Sorten von Schriftstellern, Alice. Da hast Du Charles Dickens und die heilige Theresa von Ávila, die überhaupt nicht brave, von Liebhabern und Kindern umgebene George Sand – und Du hast Jane Austen. Schriftsteller handhaben ihr Leben und ihre Persönlichkeit und die Familie und das Jahrhundert, in das sie hineingeboren wurden, so gut sie eben können; sie tun für ihre alltägliche Existenz, was sie tun müssen, und bauen in der Stadt der Erfindung.
Es wird voll hier heutzutage, wie überall. Schau Dich um. Fast keine Stelle mehr, auf der nicht schon gebaut ist! Bleibt die Möglichkeit, daß sie einen anderen Ort erschließen, und so wird es wahrscheinlich kommen: sie werden einen Abhang entdecken, der bislang als Ödland galt, sich mit ein bißchen Findigkeit aber durchaus bebauen läßt. So, wie die Stadt heute ist, erstreckt sie sich weit in alle Richtungen, dringt mit trostlosen neuen Vororten bis zu einem dunstigen Horizont vor. Alle möglichen Leute entschließen sich jetzt, hier zu bauen, nicht mehr nur die, die dafür geboren sind. Ungelernte Schriftsteller können etwas zusammenzimmern, das einige Ähnlichkeit mit einem richtigen Haus besitzt, und sogar eine gewisse Zahl von begeisterten Besuchern anziehen. Innerhalb eines Jahres fällt das Gebäude in sich zusammen, und dann nutzt schnell jemand anderes das Grundstück – füllt die Lücke auf den Drehständern der Bahnhofsbuchläden. Aber das Ergebnis ist, daß die Busfahrt ins Zentrum der Stadt endlos lang zu dauern scheint – so viele Bücher, so ungeheuer viele, bevor man zu jenen herrlichen Plätzen kommt, wo die Besucher sich drängen und die Touristen hingerissen Mund und Augen aufsperren; und ich möchte, daß Du dort hinkommst, Alice, obwohl Dir niemand mit gutem Beispiel vorangegangen ist. (Ich weiß, daß Deine Mutter Bücher über Tennis liest; ich bezweifle, ob sie je wieder einen Roman gelesen hat, nachdem eine Überdosis Georgette Heyer sie dazu brachte, Deinen Vater zu heiraten. Bücher können gefährlich sein.) Ich möchte nicht, daß Dir die Vergnügen der Literatur entgehen. Schließlich bist Du trotz allem mein Fleisch und Blut.
Ich kann Dir einen Hinweis auf die geographische Lage der Stadt geben. Sie liegt in der Mitte zwischen dem Weg zum Himmel und dem Weg zur Hölle; diese beiden Wege waren auf dem Stich abgebildet, der im Kinderzimmer von mir und Deiner Mutter hing – bevor ich den breiten, lustvollen Weg zur Hölle einschlug, indem ich mit unserem Vater ging, als er auszog, und Deine Mutter auf dem schmalen, steilen Pfad der Rechtschaffenheit blieb, der zum Himmel führt, indem sie zu unserer Mutter hielt. Was für Dramen sich damals abspielten! Ach, kleine Alice mit Deinem grünen und schwarzen Haar, Du ahnst nicht, wie sehr sich die Welt in vierzig Jahren verändert hat.
Bevor Du Jane Austen richtig würdigen kannst, mußt Du ein wenig, ein ganz klein wenig mit der Stadt der Erfindung vertraut sein; jedenfalls mit ihren wichtigeren Gegenden. Die größten Baumeister arbeiten auf den Hügeln, im Schatten dieses oder jenes prächtigen Schlosses. Sie legen ganze Straßen an, in denen es würdig und respektabel zugeht: Mannstraße, Melville Avenue, Galsworthy-Weg. Du mußt zumindest wissen, wo die liegen. Vielleicht macht es mehr Spaß, an den Plätzen herumzuschnüffeln, wo ein Naiver fast aus Versehen ein glitzerndes Gebäude errichtet hat – Tressels Ragged Trousered Philanthropists zum Beispiel oder Flora Thompsons Lark Rise to Candleford oder James Stevens’ The Caretaker’s Daughter –, oder wo ein Kind etwas geschafft hat, was ein Erwachsener nicht kann. Der Pfad hinauf zu Daisy Ashfords Young Visitors ist immer voller entzückter Besucher. Aber man kann überall mit Genuß herumspazieren, vor allem, wenn man nicht allein ist. Du kannst die weltläufigeren Viertel durchstreifen, bei Sartre oder Sagan vorbeischauen, oder die bescheideneren Gassen und Dir dabei sagen: das ist ein gutes Haus für diese Gegend, oder: das hier ist wirklich eine Schande für die Nachbarschaft! Manchmal wirst Du auf ein ziemlich wackliges Gebäude stoßen, das aber so gut gelegen und so hübsch angestrichen ist, daß es die Besucher – und auch die Kritiker – für sich einnimmt; und alle drängen sich dort, rufen «Welch ein Meisterwerk!» und zeichnen es mit Preisen aus. Doch wenn die Zeit verstreicht, die Farbe abblättert, die ernsthaften Besucher ausbleiben, dann enthüllt es sich schließlich als das, was es ist: ein uninteressantes, unbedeutendes Haus.
Du wirst feststellen, daß die Gebäude ohne erkennbaren Grund in der Gunst der Besucher steigen und fallen. Wer liest heute schon Arnold Bennett oder Sinclair Lewis? Aber mit einigem Glück werden sie vielleicht schon bald wiederentdeckt. «Wie interessant», werden die Leute sagen und die knarrenden Türen aufdrücken. «Wie erstaunlich! Spürst Du die Atmosphäre hier? So vertraut, so wahr – das Verblüffende, das sich als das Gewöhnliche ausgibt. Warum waren wir bloß so lange nicht mehr hier?» Und dann wird ein Bennett, ein Lewis oder wer immer neu entdeckt; die Häuser seiner Phantasie werden restauriert, renoviert, man ölt die Scharniere der Türen, damit sie sich leichter öffnen lassen, und der Baumeister, der Schriftsteller, nimmt wieder den ihm gebührenden Platz in der großen andersweltlichen Rangordnung ein.
Baumeister bitten manchmal selbst Besucher herein (und sind gekränkt, wenn die sich nicht umsehen), aber immer empfinden sie die Besucher als anspruchsvolle, schwierige Leute: sie scheinen keine Ahnung zu haben, eine wie riskante Sache das Bauen von Häusern ist. Wenn sie nur die Zeit hätten, sagen die Besucher, täten sie es selbst. Dabei habe ich ein so spannendes Leben geführt, sagen sie. Ich sollte wirklich eines Tages einmal alles aufschreiben, ein Buch daraus machen! Und tatsächlich haben sie ein spannendes Leben gehabt, aber die bloße Aufzeichnung von Ereignissen ergibt kein Buch. Die Aneinanderreihung von Erfahrungen ergibt keine Idee. Zu urteilen ist für den Leser tausendmal leichter als das Erfinden für den Schriftsteller. Der Schriftsteller muß seine Idee und seine Gestalten aus dem Nichts herbeibeschwören und Wörter im Flug eifangen und sie aufs Papier nageln. Der Leser hat etwas, woran er sich festhalten und wovon er ausgehen kann, und das hat ihm der Autor großzügig zur Verfügung gestellt. Trotzdem fühlt sich der Leser berechtigt zu mäkeln.
Manche Baumeister bauen ihre Häuser und weigern sich, die Tür aufzumachen, so sehr fürchten sie sich vor Besuchern. In Schubladen und Schränken im ganzen Land liegen, darauf könnte ich schwören, die versteckten Manuskripte durchaus publizierbarer Romane, die nie das Licht der Welt erblicken werden, weil es an einer Versandtüte, einer Briefmarke und ein bißchen Nervenstärke fehlt. Gegen das Genie ist kein Kraut gewachsen, aber ich bin nicht so sicher, ob es sich auch immer zu erkennen geben will.
Wenn ein Baumeister die Tür eines soeben fertiggestellten Hauses öffnet und die Kritiker und die Menge hereinströmen, muß er manchmal wünschen, er hätte die Tür nie aufgemacht. Hardy schrieb nie wieder einen Roman, nachdem Jude der Unberühmte erschienen war, so entsetzt waren die Kritiker von dem Werk, und so entsetzt war Hardy von den Kritikern.
Dabei verstehe ich sie durchaus. Jude der Unberühmte hat mich für geraume Zeit vom Lesen abgehalten. Ich schob meine Besuche in der Stadt der Erfindung hinaus, weil ich mich vor dem fürchtete, was ich dort finden würde; den Riesen Verzweiflung zum Beispiel, der durch die bisher heiteren Straßen streift und den nichtsahnenden Besucher auf den Kopfhaut. Hardy, befanden die Kritiker, hatte den Käfig aufgeschlossen und den Riesen entwischen lassen; schlimmer noch, er hatte die Tore der Stadt geöffnet, den Riesen geradezu eingeladen und somit die öffentliche Sicherheit dort gefährdet.
Wenn Du auf Sicherheit aus bist, gehst Du besser hinunter in die Fertighausgegenden. Da sind die Rinnsteine säuberlich gefegt, und die Verzweiflung trägt einen Maulkorb, wenngleich die Häuser selbst ohne Eleganz und Lebendigkeit sind. Man kann nur staunen über so nichtige, aber so routiniert und geschickt gebaute Häuser. Romane nach Filmen – erst der Film, dann der Roman – wie Jaws, Alien, E.T