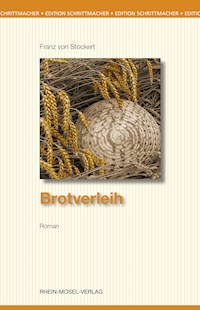
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edtion Schrittmacher
- Sprache: Deutsch
Brotverleih – nicht zu verwechseln mit Bootsverleih – ist ein kaleidoskopartiger Roman mit verschiedenen Erzählern, Sprechern und Schreibern; genaues Hinhören lohnt sich. Er handelt von der Verwirklichung einer bizarren Geschäftsidee – nicht bizarrer allerdings als manches erfolgreiche Finanzprodukt. Wer sich da alles dranhängt und wie die Hauptfigur Kaufunger, eine Art Candide, da reinrutscht und sich verstrickt, mit seiner ökonomischen Unbedarftheit, seinen exotischen Interessen und seinem humanitären Engagement, ist – wie im richtigen Leben, dabei nicht unkomisch. Personen und Orte sind, auch wenn sie bekannte Namen haben, reine Fiktion; auch haben sie keinen autobiographischen Bezug. Aus Erzählung, szenischen Protokollen, Dialogen und anderen Einlassungen (gemailte, gedruckte, auch gereimte) ergibt sich, wie aus Facetten, eine Lebens- und Beziehungsgeschichte, die auch ein Stück weit unsere politische Geschichte ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Printausgabe gefördert durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
Die Edition Schrittmacher wird herausgegeben von Michael Dillinger, Sigfrid Gauch, Arne Houben, und Gabriele Korn-Steinmetz.
© 2011 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel.: 06542-5151 Fax: 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-809-8 Lektorat: Gabriele Korn-Steinmetz Titelfoto: SarahC._pixelio.de
Franz von Stockert
Brotverleih
Roman
Edition Schrittmacher Band 27
RHEIN-MOSEL-VERLAG
***
I
Es ist ein sonniger Bahnsteig, auf den der Ankömmling erst tritt, als der Zug schon wieder angepfiffen wird.
Kein Geschrei, weder von Vögeln noch von Menschen, keine Bäume.
Wo glaubt er auch anzukommen – im Urwald?
Natürlich nicht; er hat nur die lange Bahnfahrt verschlafen und geträumt.
Vielmehr ist das der Ort hinter München, hinter Tupfing, Nähe Starnberger See, wohin das Nachlassgericht ihn bestellt hat.
Hier war er noch nie; ein alter Marktflecken wohl, noch mit alten Bauernhäusern zwischen den modernen Landhäusern und mit einem Designerhaus, von Merkator selbst für sich entworfen und zweifellos mit Stil in dieses ländliche Environment eingeplackt, vor vielleicht fünfzehn Jahren.
Kaufunger wird erwartet, und nachdem die andern aus dem Zug sich schon verlaufen haben, kommen einige Leute auf ihn zu. Ihnen voran die schwarze Witwe mit kurzen weißen Haaren, oder sagen wir weißblond – Frau Schäfer, er erkennt sie; einmal bei einem Treffen mit seinem Vater hat er sie gesehen. Die anderen kennt er nicht.
Frau Schäfer, als Lebensgefährtin seines Vaters, umarmt ihn und schluchzt, er sieht sie betroffen an und drückt ihre Hand (mit Smaragdring).
Die Leute geleiten ihn zum Haus und nehmen ihn unterwegs ins Gebet.
Abends allein hat Kaufunger Mühe sich zu erinnern, wer ihm was riet oder was von ihm wollte.
Wie war das noch? – Er nimmt seine Finger zu Hilfe.
Zuerst eröffnete ihm Frau Schäfer, was alles gar nicht zur Erbschaft – sondern ihr gehöre, nämlich das Haus und vieles mehr. Eindringlich bat sie ihn, die Schenkung seines Vaters zu Lebzeiten an sie vor Gericht zu bezeugen; nur so könnte der Großteil des Besitzes aus der Konkursmasse rausgehalten werden und auch er, Kaufunger, seinen Anteil kriegen, nämlich von ihr, das versprach sie ihm. Zugleich sollte er die Erbschaft ausschlagen, damit er nicht die Schulden zu übernehmen bräuchte. Kaufunger wollte sich’s überlegen.
Dann drängte sich ein Anwalt dazwischen – wie hieß er noch? – und erklärte: Mit dieser Schenkung, auch wenn Kaufunger sie bezeugt, käme Frau Schäfer bei Gericht nicht durch, nicht ohne ihn, den Anwalt, der sich da auskennt. Deshalb sollten sie beide seine Hilfe in Anspruch nehmen, gegen Beteiligung. Frau Schäfer wies das Ansinnen des Anwalts zurück und sagte zu Kaufunger: Vertrau mir. Darauf der Anwalt: So schlau sich Frau Schäfer jetzt auch vorkäme, er könnte nur warnen vor krummen Touren, er sei schließlich Mitwisser. Im Übrigen gehe es ihm um das Vermächtnis seines Mandanten Merkator und er betrachte deshalb ihn, den einzigen Sohn, als seinen Partner.
Da rochen aber noch andere Unrat. Zwei Männer in grün-schwarzen Trachtenanzügen, die bisher stumm mitgelaufen waren, ließen sich dahingehend ein, dass die Gläubigerbanken da wohl ein Wörtchen mitzureden hätten; als Sprecher derselben könnten sie Folgendes anbieten:
Er soll unbedingt die Erbschaft antreten und sie, die Banken, auszahlen. Er würde dabei nicht leer ausgehen. Man wüsste von dem Verstorbenen, dass er eine Schenkung an seinen Sohn beabsichtigt hätte. Die könnte dann zu seinen Gunsten aus der Schuldenmasse rausgenommen werden, dafür würden sie sich stark machen. Er hätte ja sicher einen Brief seines Vaters, der diese Schenkungsabsicht beweist. Sonst müsste auch der Anwalt seines Vaters davon wissen und in seiner Korrespondenz einen Beleg darüber finden. Das ist derselbe Anwalt, der auch Kaufunger vertreten möchte. Aber jetzt dazu äußern wollte er sich nicht.
Kaufungers Frage, was Merkator denn außer Schulden hinterlassen hätte, wurde nur ganz allgemein beantwortet (verschiedene Häuser … ) und seine andere Frage, wie und wo sein Vater eigentlich gestorben sei ( – jetzt nicht). Denn man war angekommen und wies Kaufunger auf das Haus seines Vaters.
Als er ins Haus will, gibt es Schwierigkeiten – kein Schlüssel. Jemand Amtlicher (vom Gericht wohl) schließt auf. Alle wollen mit rein, besonders die Gläubiger, es gibt Gerangel; der Mann vom Gericht (Nachlasspfleger nennt er sich) lässt Kaufunger rein und schließt hinter sich zu; dann schließt er den Strom an und gibt Kaufunger mit Blick auf seine Reisetasche Verhaltensregeln: Wenn er vor dem Gerichtstermin und -beschluss morgen Wertgegenstände, Testamente und andere Unterlagen wegnehmen sollte, sei das strafbar, hier übernachten darf er aber, dann verabschiedet er sich: Bis morgen.
Kaufunger ist froh, allein zu sein und hat sich schnell daran gewöhnt, hier zu übernachten.
Die Schränke, Schubladen, alles ist bereits gründlich durchwühlt, die Ordnung halbwegs wiederhergestellt. Kaufunger wüsste nicht, nach was er in dem Wust suchen sollte, oder scheut er sich? Als es dunkelt, legt er sich auf das Ledersofa (das Totenbett?), steht wieder auf, um zu telefonieren, es geht nicht. Später klopft es ans Fenster, eine Frau – die Lebensgefährtin, denkt er, aber es ist eine jüngere, sie ist vorgeschickt worden, ihn zu einem späten Abendessen in den Gasthof einzuladen. Kaufunger bittet sie pantomimisch rein, kann dann aber die Tür auch von innen nicht öffnen und hält sich für eingeschlossen. Sie macht ihm Zeichen, wie die Tür zu öffnen ginge, und er bedeutet ihr, dass er lieber zu Hause bliebe. Dann wird sie von einem Mann draußen (im Auto) zurückgerufen.
In der leer geräumten Küche findet er nichts Essbares, in der Speisekammer noch einige Konserven, auch Alkoholika, nicht viel, aber ausgefallene Sachen. Er nimmt eine Flasche Aguardente in die Hand, Feuerwasser aus Macapa, da wandelt ihn ein Gefühl von Heimkehr und Verlust an. Er muss an seinen Vater denken, an seine Späße, seine Frauen (eine hübscher und jünger als die vorige, jede wollte dem Sohn eine gute Stiefmutter sein), seine langen Abwesenheiten (in Geschäften); an seine eigene Internatszeit, Besuche zu Hause, Kräche, dann die Aufforderung seines Vaters, ihn auf seine Baustellen zu begleiten, bei ihm zu bleiben, sein Assistent zu werden und an die seltenen Wiedersehen.
Kaufunger stellt sich vor, hier und jetzt auf seinen Vater zu treffen, mit ihm zu reden, sich für seine Geschäfte zu interessieren, für seine Häuser (sein Blick fällt auf ein Regal voller Architekturzeitschriften), auch für seine neue Lebensgefährtin …
– Neu? Ich lebe schon zwanzig Jahre mit ihr zusammen, du Lumich, aber das weißt du ja!
– Ach ja, hab euch schon mal gesehen zusammen. Wie heißt eigentlich Frau Schäfer mit Vornamen? Kaufunger weiß es wirklich nicht.
Er träumte, dass alles hier in Rauch aufgeht, ein Autodafé oder als Grabopfer. Dann erschien, von dem Rauch angelockt, der berühmte Merkator, sein Vater, und sah ihn fragend oder auch mit einem verschmitzten Lächeln an: … da bin ich mal neugierig, ob du’s schaffst. – Was soll ich schaffen? –
… ob du’s herausfindest.
– Was soll ich herausfinden? So etwa.
Er wachte auf und wanderte durchs Haus. Er kam in einen Raum mit Zeichentisch – war das Merkators Arbeitsplatz? Ein Computer war nicht da. Wann hatte er zuletzt ein Haus gebaut? (Wann hatte er sich auf Geschäfte mit Häuserverkaufen und -kaufen verlegt?) In einem Zimmer standen zwei Betten; lebten sie hier zusammen, schliefen sie hier bis zu seinem Tod?
Es fehlten Bilder an der Wand, Fotos, so auch in den anderen Räumen ( – er hatte mal Kunst gesammelt), auch Kleider, die Schuhe der Frau, selbst die Ablagen im Bad über den Waschbecken waren leer. Gegen Morgen duschte Kaufunger kalt (Warmwasser ist abgestellt).
Dann wird er rausgetrommelt. Alle sind sie da: Nachlasspfleger, Anwälte, Frau Schäfer, um ihn zum Frühstück abzuholen und dabei noch einiges zu besprechen.
Er geht mit der Lebensgefährtin, das gebietet die Pietät, denkt er und sieht dabei deutlich den verschmitzten Ausdruck seines Vaters vor sich. Im Café sitzt er ihr an einem Tischchen gegenüber; die Frau ist dezent geschminkt. An den hinteren Tischen haben die Herren Platz genommen und sind ganz Ohr. Er fragt sein Gegenüber: Was haben Sie jetzt vor?
– Ich? Das kommt auf Sie an …
Wie ist er gestorben, will er fragen, aber ihm stockt die Stimme, als sie seine Hand nimmt und den Smaragdring von seinem Vater darin verschließt.
– Warst du bei ihm? fragt er, ich meine, wart ihr noch zusammen?
Was meinst du? flüstert sie.
– Ich meine, weil du nicht mehr in dem Haus lebst.
– Ich bin nach seinem Tod ausgezogen zu meiner Tochter, bevor sie mich rauswerfen.
– Du hast Kinder?
– Eine Tochter – und dich.
– Von mir aus kannst du bleiben, kannst das Haus behalten.
Du müsstest drauf verzichten, sagt sie ruhig.
– Auf das Haus?
– Auf alles, auf die ganze Erbschaft.
Die Herren werden unruhig: Da wird gerade jemand über den Tisch gezogen, murmelt einer vernehmlich. Ich habe ihn gewarnt, ein anderer: Aber er will ja nicht hören.
Warum soll ich auf alles verzichten? fragt er leise.
– Weil mir dein Vater schon alles überschrieben hat, wie du weißt.
– Woher weiß ich das?
– Er hat es dir doch geschrieben.
– Wann? Wo? In seinem Testament vielleicht?
– Es gibt kein Testament.
Ach nee, ruft einer der ungebetenen Zaungäste, hier ist sein Anwalt, fragen Sie ihn, er weiß es besser.
Ich kann und werde hier natürlich nichts sagen, nicht vor der Verhandlung, erklärte der Anwalt, indem er mit dem Stuhl heranrückte. Sie sollten aber nichts tun, was Sie später bereuen.
Dann warten wir die Verhandlung ab, sagte Kaufunger zu seiner Stiefmutter, denn vielleicht hat er ja dich als Erbe eingesetzt und – was ist denn mit deiner Tochter? Sie ist doch meine Schwester – oder Halbschwester!
Was? Was? Das wird ja immer schöner! rief ein Vierter.
Sagen Sie doch was! drängte er den Anwalt.
Auch nicht Halbschwester, sagte die Frau, du bist sein einziges Kind und Erbe, du musst dich entscheiden. – Aber wie?
– Es ist ganz einfach, erwiderte sie: Wenn du das Erbe antrittst, bleibt dir gar nichts als Schulden – wie dir die Herren sicher bestätigen werden …
– Wieso wir? Wie kommen wir dazu?!
– Wenn du verzichtest, fuhr sie gegen Widerstand fort, weil es längst mir gehört, dann bleibt es in der Familie, flüsterte sie und strich über seine geschlossene Hand.
– Ich will deine Tochter … wie heißt sie eigentlich?
– Inge – Ich will sie kennenlernen …
– Das wirst du, aber sie hat nichts damit zu tun. Ich hoffe, wir sehen uns nach dem Gerichtstermin noch bei uns, das heißt, bei Inge. Sie will dich natürlich auch kennenlernen.
Dann steht die Frau sichtlich erschöpft auf und haucht: Bis später.
Nach ihrem Abgang rücken sofort die Herren auf und bitten Kaufunger, sich wieder zu setzen.
Ich möchte Sie – wir möchten Sie – im Sinne Ihres verstorbenen – lassen Sie sich um Gottes willen nicht – Sie verlieren nicht nur Ihre Ansprüche, wenn
– Sie kommen in Teufels Küche!
In Teufels Küche? interessiert mich, meint Kaufunger. Er hat sein Handy gezückt und hält es in die Runde: Bitte noch einmal! – ich habe hier meinen Anwalt an der Strippe – machen Sie Ihre Angebote!
Nach kurzer Verblüffung beginnt das muntere Quodlibet von Neuem mit Misstönen und Trugschlüssen. Wie ein Konzert von Aras und Karakaras, wie Musik klingt das in Kaufungers Ohren, Musik des Urwalds.
Natürlich können Sie verzichten (nein, tun Sie’s nicht!) – aber zu wessen Gunsten?!
Das ist doch klar! (Eben nicht!) – Frau Schäfer hat jedenfalls keinen Rechtsanspruch – Auf welcher Seite stehen Sie? – Auf Ihrer! – Ich auch!
– Wer noch? – Ich stehe auf der Seite des Rechts! – Gut! Und das heißt?
– Der Wunsch des Verstorbenen – der Verstorbene ist hochverschuldet, das ist gerichtsnotorisch! – Einer für alle und alle für einen! Was soll ich jetzt tun? fragt Kaufunger aufgekratzt und schwenkt sein Handy.
Darf ich mal, sagt einer und greift danach. Ein anderer kriegt es zu fassen: Wer ist denn da dran?
Kaufunger hätte wohl gern einen Zeugen, noch besser einen Beistand, der das alles mit anhört und dann ihm das Passende sagt, am besten sein Vater. Der hat ihm das schließlich eingebrockt, er soll ihm zeigen, wie er da rauskommt. Kein väterliches Machtwort, aber ein Tipp, wie er denen ein Schnippchen schlagen kann, das wär’s doch, oder ein Zeichen des Einverständnisses, wenn er jetzt mit der Frau gegen die Herren – oder mit der Tochter gegen die Mutter – oder mit wem und für was?
Aber niemand hört zu; das Handy ist gar nicht an und wenn – wäre bestimmt nicht sein Anwalt dran (er hat keinen), sondern höchstens Brenda, von der er das Handy geliehen hat. Mit Bedauern und Gelächter bekennt er es den drei Herren.
Und schon geht sein Gelächter in ein stoßweises Luftholen und ungeschütztes Aufschluchzen über; damit hat nun niemand, auch er selbst nicht, gerechnet. Aber die Herren verstehen das, wie sie versichern, und warten diskret ab. Erst als einer dem zusammengekrümmten Häufchen Unglück die Hand auf die Schulter legt und versucht, ihm zugleich mit einigen Trostworten sein Sonderangebot in die Ohren zu blasen, da wehren ihn die beiden anderen ab. Dann stehen sie zu dritt auf.
Während Kaufunger noch eine Weile vor seinem kalten Kaffee inmitten des Stuhllagers saß, wie ausgesetzt auf einer Insel, gelobten die drei, da sie nun mal im gleichen Boot säßen, sich zu vertragen und gemeinsam das Schäfchen ins Trockene zu bringen, das heißt, niemanden sonst dranzulassen. – Schade, meinte einer, ich hätte den Sohn gern ins Boot geholt.
– Ja schade, aber er wollte ja nicht. – … Dass er jetzt nicht noch sein Herz für Frau Schäfer entdeckt! – oder für die Tochter! …
Zur Verhandlung im Merkator’schen Haus sind erschienen der leibliche Sohn, andere Kinder oder sonst Erbberechtige – keine, Frau Annemarie Schäfer, die Herren …
Der Richter fragte der Form halber nach einem Testament. – Keins gefunden.
Das kann ich erklären, sagte Frau Schäfer, mein Mann hat mir nämlich
– Sie sind die Ehefrau des Verstorbenen?
– Mein Lebenspartner (aha!) hat mir schon vor über einem Jahr alle seine Häuser und Besitzungen überschrieben.
Der Richter war an ihrer Erklärung – zu diesem Zeitpunkt – nicht interessiert, nahm widerwillig ein Papier entgegen, das ihre Einlassung begründen sollte, und schob es mit der flachen Hand zur Seite.
Dem Gericht liegt eine Vermögensliste vor: hauptsächlich Häuser, Grundstücke, Eigentumswohnungen. Eine Überschreibung auf andere natürliche oder juristische Personen ist aus den grundbuchlichen Eintragungen nicht ersichtlich, also unwirksam.
Hier meldeten sich zwei Herren zu Wort: Dazu könnten sie etwas sagen. Auch sie reichten eine Liste herüber und erläuterten mit einem Entschuldigungsblick hin zu dem Sohn, dass der Verstorbene völlig überschuldet gewesen sei und zum Zeitpunkt seines Ablebens über keine Vermögenswerte mehr verfügt hätte, insbesondere die Eigentumsrechte an den Grundstücken und Liegenschaften hätte er verwirkt, wie aus den Grundbüchern wohl nicht immer erkennbar – die hier aufgeführten Schuldforderungen sind aber fällig und werden von den Gläubigerbanken, die bis jetzt, aus Pietät, gezögert hätten, nunmehr, da eine Verständigung mit dem mutmaßlichen Erben nicht habe erreicht werden können, unverzüglich realisiert.
Der Richter blickt von einem zum andern, dann auch auf die Liste und quittiert mit einem dankbaren Lächeln, dass die Hauptgläubiger sich zusammengetan und ihm die Mühe des Zusammenzählens erspart haben. Er stellt fest, dass die Vermögensliste und die Liste der Bankschulden und der anderen Verbindlichkeiten in der Summe auffallend übereinstimmen (so auch die Liste der angeblichen Schenkungen).
– Herr Kaufunger, Sie sind als Alleinerbe festgestellt. Ich muss Sie nun fragen, ob Sie die Erbschaft antreten oder ausschlagen – auch wenn das Erbe, Vermögen gegen Schulden gerechnet (ohne Erbschaftssteuer) plus minus null sein sollte.
Darauf Kaufunger: Dann verzichte ich zu Gunsten … – Dies, wird er belehrt, könnte er gerade nicht bestimmen, sondern, wenn er das Erbe jemandem zuwenden möchte, eben dann müsste er es erst einmal antreten. Was Kaufunger denn auch tut.
Ha! rufen die Anwälte; die Frau sieht ihn nicht unfreundlich an.
– Schuldforderungen, soweit dem Gericht bekannt, werden zu den Akten genommen; weitere sind gegenüber dem Erben, Herrn Kaufunger, geltend zu machen, ebenso Ansprüche aus Schenkungen, soweit sie vor Eintritt des Erbfalls rechtswirksam wurden und dies von der Begünstigten belegt werden kann. Die Vermögensliste sowie die Schuldenliste werden im Auftrag des Gerichts (Nachlasspfleger) aktualisiert und zusammen mit dem Erbschein dem Erben zugestellt. Insoweit kann er über das Erbe verfügen.
Kaufunger: Dann kann ich mir doch gleich was mitnehmen, zur Erinnerung.
Der Nachlasspfleger erinnert daran, dass bewegliche Habe, soweit von Geldwert, hier bis auf Weiteres verbleiben muss.
– Sein Arbeitsstuhl zum Beispiel … – bleibt hier!
– Dann habe ich hier seine Kamera, sogar mit Film drin, schon älter, die kenne ich noch von früher …
Na, die könnte er doch haben, meint der Richter. – Sie sollte erst geschätzt werden, meint der Nachlasspfleger. Ob sie in dem Verzeichnis denn nicht aufgeführt sei. – Ich überprüfe das (der Nachlasspfleger).
– Dann will ich aber diesen Brotlaib hier und eine von den Weinflaschen!
– Die Weinflaschen seien erfasst, lt. Rechnung des Weinhändlers ein nicht unbeträchtlicher Wert und unbezahlt; das Brot gehe in Ordnung.
– Das wär’s dann. Der Richter schließt die Verhandlung und geht schnell weg. Ihm folgt der Nachlasspfleger.
– Das lief ja bestens! – Abwarten …
Der Anwalt zu Kaufunger: Sie hätten mit uns reden sollen, vorher. Was wollen Sie jetzt machen?
– Mit dem Brot?
– Im Ernst, ich habe viele Jahre Ihren Vater vertreten und würde auch Sie gerne vertreten, auch jetzt noch …
– In welcher Angelegenheit?
– Sie sind nun Alleinerbe und wollen doch sicher die sofortige Zwangsvollstreckung abwenden, ich sehe da gute Chancen. Ihr Herr Vater wäre jedenfalls …
Ich überleg’s mir, sagt Kaufunger, nimmt schnell die Karte des Anwalts (Dr. H. W. Dreher) und will raus hier. Da hält ihn Frau Schäfer auf: Du kommst doch noch zu uns?
– Ich dachte, ihr wärt mir böse. – Nicht doch, du hast getan, was du konntest, also wir zählen auf dich …
Sie nennt ihm Straße und Haus.
Eine Wohnung im ersten Stock. Laute Musik schallt ihm entgegen. Frau Schäfer führt ihn in einen Raum mit Fensterblick auf Bäume. Hier ist es ruhiger. Ein Holztisch, eine großzügige Sitzgruppe, im Halbdunkel stehen Kisten und Sachen, die noch nicht an ihrem Ort sind, wie Umzugsgut. Auf dem Flur laufen Leute herum, rufen, lachen, schreien wie auf einer Party, auch geht mehrmals die Türe auf und jemand steckt neugierig die Nase rein.
Frau Schäfer freut sich, endlich den Sohn bei sich zu haben, jetzt, wo Andrea nicht mehr da ist. – Andrea? – Dein Vater … na ja, er nannte sich so, nach Andrea Palladio.
Das wusste Kaufunger nicht. Er wusste nur, dass seinem Vater der Name Kaufunger missfallen hat, ursprünglich sogar Kaufhunger, und er sich dafür Merkator nannte, aber das schon seit Langem.
– Ja ja, so war er … Aber sie hätte ihn geliebt, sehr geliebt; er solle sich nicht täuschen lassen, nicht durch ihr Verhalten in der Erbschaftssache, auch nicht durch den Lärm hier.
– Das ist meine Tochter Inge; sie findet, jetzt, wo die Sache offiziell abgeschlossen ist, da ist auch die Trauerzeit zu Ende und sie kann ihren Geburtstag nachfeiern. Aber mir ist nicht nach feiern, ich vermisse deinen Vater so sehr.
Sie holt ein Foto von dem Verstorbenen: Das war kurz vor seiner letzten Reise.
Er nimmt sie in die Arme, sie weint. Dann sagt sie, wie froh sie sei, dass er gekommen wär und sie wollte ihn nun mit ihrer Tochter bekannt machen.
Drüben das große Balkonzimmer ist voller Gäste und Lärm. Kaufunger steht Inge gegenüber: Eine blühende Dorfschöne im Dirndlkleid zwischen ihren Freunden, und sie ist ziemlich aufgedreht.
Sieht gar net aus wie ein Erbschleicher, oder? ruft sie und lacht heftig. – Darf ich vorstellen: Der Alleinerbe!
Sie lässt ihm ein Glas geben und prostet ihm zu. Die Mutter versucht sie beiseite zu nehmen und sagt ihr etwas ins Ohr.
Die Tochter: So? Er wollt mich unbedingt kennenlernen, das hätt er früher haben können! Warum hat er uns nie besucht? Net amal seinen Vater, alle Jahre nicht, bevor er sich davon gemacht hat!
Kaufunger: Ich war all die Jahre im Ausland, da hat er mehr von euch gehabt als von mir. Und ihr habt auch mehr von ihm gehabt als ich. Aber wir haben uns schon gesehen machmal …
Inge: Habt ihr? Wann denn – und wann zum letzten Mal? (Sie blickt gespannt hin und her zu den flankierenden Männern, als könnten sie gleich durch ihre inquisitorische Fragerei in den Genuss einer dummen Antwort oder einer sehr aufschlussreichen kommen.)
– Ich weiß nicht, vor drei, vier Monaten etwa … – kann auch länger her sein.
– Kann länger her sein? Na, und über was habt ihr gesprochen, ich mein, hast du gewusst, was mit ihm los war? – Dass er erledigt war und alles der Mutter überschrieben hat, die Häuser, Firmen, Beteiligungen, sein ganzes Imperium! – Damit er nicht gepfändet wird?!
Die Mutter stellt sich zu Kaufunger und sieht ihre Tochter erschrocken an, auch andere treten auf seine Seite.
Kaufunger scheint zu überlegen, dann fragt er: Wie war er eigentlich zu dir? wie ein Vater?
Inge stutzt: Er war nicht mein Vater – für mich war er – der Andre (sprich Ándree).
Ihre Mutter darauf: Er hat dir diese Wohnung geschenkt zu deinem 25. Geburtstag!
– Na und? Vielleicht wird die ja auch noch zur Erbschaft gschlagen! Und der Alleinerbe wirft uns raus hier! Sie lacht schrill, dann fährt sie erschrocken fort: Das tust du aber nicht, gell, das nicht, Bruderherz! Sie bricht ab und starrt auf den Boden. Die Mutter macht einen Schritt auf sie zu, ohne Kaufungers Arm loszulassen. Der versichert, dass er nichts dergleichen vorhätte, und erwähnt mehr zur Mutter als zur Schwester einen Dreher (Anwalt), der sich darum kümmern wird, dass ihnen Haus und Wohnung bleiben. Die Mutter sieht ihn besorgt an: Dreher? – das hatten wir doch schon … Aber mehr Sorgen macht ihr jetzt die Tochter.
Inge steht stumm da, wie von allen Partygästen und -geistern verlassen.
– Was ist dir?
Inge sieht ihre Mutter an und wimmert: Mein erster Geburtstag ohne Andre …
Ach ja, ruft Kaufunger, du feierst Geburtstag! Und ich hab dir noch nicht gratuliert … Er umarmt sie mit Bruderkuss.
Das sollte auch sein Abschied sein, denn er will noch diese Nacht zurückfahren. Aber vorher möchte er, wenn das ginge, noch telefonieren.
Er wird von der Mutter ins Nachbarzimmer geführt und dabei beredet: Inge ist manchmal so – kratzbürstig (nennt sie’s), aber dann wieder gut; ihr werdet euch mögen. Wir bleiben doch in Verbindung, nicht? Ich meine, wir halten zusammen?
Kaufunger: Machen wir.
Vom Telefon aus hat er Einblick in die Partygesellschaft nebenan. Sie stellen sich gerade zum Gruppenfoto auf.
Hallo, ich bin’s … das wollte ich gerade …
das Handy, das geht nicht … nein, bei Leuten …
bei seiner Frau und ihrer Tochter … um die dreißig …
nicht die Frau, die Tochter! …
Kurze blonde Haare, schmaler Mund, grüne Augen, Designerbrille … nicht die Tochter, die Frau! …
ach die: dunkles Haar, die Augen auch dunkel, roter Mund, spitze Zunge … nein, eher üppig …
weil ich sie von hier aus sehe, sie posieren gerade für ein Foto … doch, da sind auch Männer – einen umarmt sie grade, aber er will lieber fotografieren …
die Verhandlung? Das war vormittags …
ja! Heute Vormittag …
was – und? ein komischer Tag war das.
… mich nicht – aber dich können sie hören, wenn du so schreist!
… das erzähl ich dir morgen … dann übermorgen …
Das weiß man eben nicht, wahrscheinlich gar nichts …
– doch, ein Laib Brot … Hallo?
Die letzten Takte hat ein Mann mitgehört, der sich noch eben an Inges Seite befand und jetzt bei Kaufunger auftaucht, mit Kamera.
Ob das stimmt, dass Kaufunger nur ein Brot von seinem Vater geerbt hätte – und warum gerade ein Brot, will er wissen.
Als Kaufunger das nicht sagen kann oder will, begründet der Mann seine Neugier mit dem Hinweis, dass er praktisch zur Familie gehöre, nämlich mit der Tochter verlobt sei.
Als Kaufunger auch dazu nichts herausbringt als ein ungläubiges ach! – und auch nicht fotografiert werden will, sagt der Mann: Als dann … nichts für ungut!
Ungut, so empfand Kaufunger auch die nächste Begegnung, die er vor dem Merkator’schen Haus hatte, wo er vor seiner Rückfahrt noch mal rein musste, um seine Sachen zu holen.
Der Nachlasspfleger erwartete ihn schon, und wie wäre er auch anders reingekommen? Aber Kaufunger hatte das Gefühl, dass der hinter ihm herschnüffelte, und sagte das auch. Drinnen gab es dann Streit um zwei Weinflaschen, die Kaufunger neben dem Brot in seine Reisetasche packen wollte.
Setzen Sie’s auf Ihre Rechnung! rief er dem Nachlasspfleger zu. Der erboste sich: – Auf meine Rechung?! Sie meinen, Ihre Rechnung! Und da ist einiges zusammengekommen: Bestattungskosten, die fortlaufenden Versicherungen, notwendige Instandhaltungen (nicht nur an diesem Haus) und … und …
Er soll auch nicht meinen, dass diese Kosten bei dem Nullsummenspiel unter den Tisch fielen. Die hätten mit den Bankschulden und sonstigen Passiva, die er geerbt hätte, nichts zu tun, sie würden getrennt ausgewiesen und müssten von Kaufunger bar bezahlt werden.
Dann weisen Sie sie eben nicht getrennt aus!
Oho! schloss der Nachlasspfleger, man stiftet mich zur Veruntreuung an, sauber!
Kaufungers Antwort: Spielen Sie doch nicht den Saubermann, Sie Trüffelschwein! Ich möchte nicht wissen, wie viel Sie schon beiseite geschafft haben!
Darauf der Nachlasspfleger: Kommen Sie runter, aber ganz schnell (er zeigte auf Kniehöhe). Sie haben überhaupt nur eine einzige Chance …
– Die wäre?!
– Wenn irgendwas für Sie (Kaufunger) übrig bleiben sollte, dann hätten Sie das mir zu verdanken – und mit mir zu teilen.
– Und was würden die Gläubiger dazu sagen?
– Der Nachlasspfleger ist nur dem Gericht verantwortlich. Und mit diesem Richter, zum Glück, kann man reden.
– Hatte nicht den Eindruck …
– Nicht Sie natürlich, sondern ich!
– Aha, dann sind hier also alle korrupt!
– Das habe ich nicht gehört!
– Hören Sie schlecht?
– Das wird teuer für Sie, das verspreche ich Ihnen!
– Dann leiste ich eben einen Offenbarungseid, was machen Sie dann?
– Ich weiß, dass Sie pleite sind, aber ich finde immer noch was. Ich werde Ihnen Ihr Auto unterm Hintern wegpfänden (Kaufunger hat keins) und wenn Sie meinen, Sie könnten das Ihrer Frau zuschieben (er hat keine), – ich kriege Sie!
Du kannst mich mal … murmelte Kaufunger und nahm die zwei Flaschen; es kam zum Handgemenge, in dessen Verlauf eine Flasche zu Bruch ging und Kaufunger dem Nachlasspfleger einen Rempler versetzte; dann verließ er mit einer Flasche, Brot und Tasche das Haus.
Allein im Erster-Klasse-Abteil.
Mit Glück hat er noch den Zug zurück nach Frankfurt erwischt.Wenn ihn der Schaffner erwischt – ohne Fahrkarte, dann macht erste oder zweite Klasse auch keinen Unterschied. Er hat doch nicht geglaubt, aus der Nachlassverhandlung mit prall gefüllten Taschen rauszukommen? Doch, das hat er wohl, denn er hat kein Geld dabei.
Er hörte auf das Knatschen der Federung und auf die Eisenräder, die ihn mit jeder Umdrehung weiter wegbrachten von den Leuten und Szenen in Hintertupfing, das mit der Entfernung immer kleiner wurde. Nicht mal die Rempelei mit dem Nachlasspfleger verfolgte ihn.
Er aalte sich auf seinem Fensterplatz, die Füße schräg gegenüber auf dem Mittelplatz, und sah den vorbeiziehenden Wolkenschwaden im Dämmerlicht nach, auch Greifvögel, Häuser und Liegenschaften eilten dem selben Fluchtpunkt zu, während er sich rücklings in den Abend und nach Hause tragen ließ.
Wo ein Aas ist, sammeln sich die Geier – ich schlage die Erbschaft aus, beschloss er.
Das geht sicher auch nachträglich, wie bei einem Haustürgeschäft.
Ja, so macht er’s, wer auch immer davon profitiert – und wem immer der vom Gericht bestellte Gauner dann seine Rechnung präsentiert …
Nur soll das nicht seine neue Mutter und Schwester sein; denn die will er ja (mittels Dreher) schadlos halten.
Gern hätte er jetzt die Flasche in seiner Linken geköpft und ins Brot zu seiner Rechten gebissen, aber er hatte keinen Korkenzieher und das Brot war viel zu hart.
Ein Geräusch weckt ihn; er blinzelt, ohne seinen halb liegenden Körper aufzurichten. Ihm gegenüber im milden Licht einer Schlummerleuchte sitzt eine Person und liest; nicht schlecht.
Sie muss, während er schlief, über seine ins Abteil gestreckten Beine weggestiegen sein. Ihre Beine, strumpflos, hat sie unter seinen Sitz gestreckt, der ausgefranste Jeansrock beginnt oberhalb der Knie. Ohne ihn anzusehen, sie liest ein Journal, streicht sie mit einer Hand ihren Rock vergeblich übers Knie. Beide, Hand und Knie, sind sehr braun: Eine Erste-Klasse-Frau. Aber dann spricht sie mit sich selbst, englisch, wenn ihn nicht alles täuscht. Er schließt die Augen, als sähe er’s nicht, tatsächlich malt er sich aber im Halbschlaf den kurzen Anblick dieses Nachschattengewächses aus – like a silent film. Die Handlung überlässt er in seiner Vorstellung ganz der beautiful actrice, während er selber sich mit der Rolle des Voyeurs begnügt; so die Nacht durchzufahren bis Frankfurt, das würde ihm gefallen.
Aber da taucht in dem Film von Weitem gestikulierend eine andere Person, Brenda, auf und schleudert ihm, da aus der Ferne nicht vernehmlich, stumme Beleidigungen an den Kopf.
Aber was hat sie denn? Sie rechnet doch heute sowieso nicht mehr mit ihm.
Und dann spricht da, außerhalb des Films, noch jemand, mit gedämpfter, fast tonloser Stimme. Hier versagt seine Einbildungskraft, wäre ja auch noch schöner … Da müssen zwei zugestiegen sein; die zweite Stimme ist männlich und spricht ebenfalls englisch (nicht richtig). Er sitzt, so viel Kaufunger hören kann, neben der Abteiltür, der Braunen schräg gegenüber. Sie sprach also nicht mit sich selbst, sondern zu ihrem Gegenüber. In ihrer Zwiesprache geht es um Geschäfte, um einen Vertrag wohl. Und das bringt Kaufungers Träumerei vollends durcheinander.
– I wonder if it works … (sagt sie) – What shell be? You just work for me and I work for you.
– What is the job you do for me? – Of course I support you, you profit from my relations, my protection, my help in rooming and financials – I see, contacts and consulting …
Kaufunger blinzelt und richtet sich etwas auf. Die beiden verstummen. Er sieht sich um.
Der Businessman sieht aus wie ein Sportsman, sie – ohne Journal vor dem Gesicht – ist eine ibero-amerikanische Schönheit, Stewardess vielleicht.
Wo sind wir? fragt Kaufunger. Die beiden sehen ihn an, die exotische Frau mit Überraschung erst, dann mit einem flüchtigen konspirativen Lächeln.
Ich will nach Frankfurt, erklärt Kaufunger.
Wir auch Frankfurt, sagt der Geschäftsmann, Air base ist vorbei, Ankunft wird sein in eine halbe Stunde.
Das ist weit nach Mitternacht. Die Frage ist, welche Anschlüsse es dann noch gibt. Kaufunger behauptet, dann eben ins Hotel zu gehen, er nennt zwei, drei große Namen.
Wir können Sie mit Wagen mitnehmen, bietet der Gentleman an, wir werden vom Bahnhof abgeholt.
So geschieht es, der Chauffeur des Wagens (kein gewöhnliches Taxi, sondern von einem Club) wundert sich über den dritten Fahrgast und verstaut das Fluggepäck der Lady.
Steigen wir erst mal ein, meint der Gentleman und setzt sich neben den Chauffeur, die Frau sitzt hinten und winkt Kaufunger zu sich. Unterwegs dann die Frage: Wohin?
To the club, entscheidet der Vordermann und fügt erklärend hinzu: … Lady first.
Darauf die Frau zu Kaufunger: To the club – is that okay?
Kaufunger antwortet, dass er lieber ins Hotel wolle, ins Imperial (den Name liest er gerade im Vorbeifahren).
The bar in your hotel – is it still open, what do you mean? fragt ihn die Frau.
Sure, sagt Kaufunger. Dann wollte sie auch lieber ins Hotel – together with you.
Der Mann vorne lässt anhalten.
Sie nehmen die Lady mit in Hotel? fragt er und fährt, ehe Kaufunger antwortet, fort: Okay, eine Nacht, das sind achthundert Euro und zwar jetzt, denn wir sehen uns nachher nicht mehr, ich fahr weiter in den Club. Ach, und Übernachtung, Getränke und so weiter übernehmen Sie, das ist ja klar.
Kaufunger sieht die Frau fragend an; sie lächelt und zuckt die Schultern. Ihr Manager wartet, ohne sich umzuschauen. Offenbar soll ihm der Kunde die Scheine über die Schulter reichen.
Ich habe kein Geld, sagt Kaufunger.
– Sie haben kein Bargeld bei sich?
– Auch keinen Scheck.
No check? sagt die Frau ungläubig, oh!
Der Manager dreht sich um und sieht ihn kurz an. Okay, sagt er, dann steigen Sie jetzt aus. Kaufunger sagt der schönen Brasilianerin Auf Wiedersehen.
Sie sieht ihn fragend an. – See you later!
– Oh yes – come to the club.
Kaufunger steigt aus, und das Auto fährt davon.
Er ist froh, dass er mit dem Schrecken davonkam. Aber ins Imperial, das kommt natürlich nicht in Frage. Also zu Fuß – oder irgendein Nachtfahrer nimmt ihn mit – nach Oberursel. Wo er denn in den frühen Morgenstunden ankommt.
II
Später fand Kaufunger auf dem Tresen in der Küche noch Kaffee in der Maschine, einen Zettel mit Besorgungen, eine zerbrochene Tasse; sein Brot steckte im Abfalleimer. Brenda Schneider war zwar, nachdem er sie aus dem Schlaf geklingelt hatte, noch mal kurz ins Bett zurückgekrochen, er daneben, aber jetzt war sie natürlich längst fort.
Für Besorgungen hatte er kein Geld; das brachte ihn darauf, heute endlich bei der IDA Centrale anzurufen, die sitzen ja in Frankfurt, auch wenn sie im brasilianischen Urwald tätig sind oder waren, vielmehr war Kaufunger dort tätig für sie. Er hatte bei denen noch was gut – Arbeitslohn für mindestens drei Monate.
Während er die Nummer suchte, Brenda musste sie haben, hat schließlich auch mal für die gearbeitet und noch heute Kontakt, – klingelte das Telefon.
Spreche ich mit Mac Artur? meldet sich der Anrufer. Kaufunger verneint.
Aber Sie kennen ihn? – Nein – Es geht nämlich um eine Erbschaft … –
Kaufunger schluckt: Ach ja? Und wer sind Sie?
– Starnberger Nachrichten, Redaktion Land und Leute, ich habe da Ihre Telefonnummer reingekriegt, bei Schneider, – stimmt doch?
– Hier sind die Kaufhunger Nachrichten …
– Ah so! Entschuldigen Sie.
Zufrieden mit seinem Scherz und durch die glücklich bestandene Gefahr bestärkt, rief Kaufunger bei der International Development Agency an und fragte nach Dieter Feudl.
Der meldete sich: Hallo? Wer – ach du bist’s … Gut, dass du anrufst! Seit wann bist du zurück in Deutschland?
– Schon eine Weile … Du, ich habe noch Geld von euch zu kriegen.
– Von der ARGE , richtig, für deine letzten Monate in Brasilien … Wir hatten damals den Kontakt zu dir verloren, dachten schon, du wärst im Urwald verschütt gegangen … (lacht)
– Wirklich? Aber du doch nicht … Außerdem hattet ihr mein Gehaltskonto.
– Natürlich, hab ich das nicht geglaubt, aber du weißt ja, die ARGE war etwas klamm damals, wir waren ja nur die Juniorpartner und die Amerikaner hatten doch unsere Konten eingefroren. Wir bleiben dran, du kriegst dein Geld noch, bestimmt. Aber was anderes: Was machst du so … – ? –
Nichts? Wir haben nämlich ein neues Projekt, eine Riesensache: Rumänien, Bulgarien, Türkei – und da haben Wir das Sagen! Wir suchen noch Partner … Na, da bist du doch dabei!
Was soll ich dabei, ich bin Übersetzer …
Jetzt mach dich nicht kleiner wie du bist, du mit deiner Auslandserfahrung. Du hast doch dort die Verhandlungen geführt, alles klar gemacht vor Ort – mit den Indios – genau, und wenn das da nicht weiterging, das war ja nicht deine Schuld. Aber jetzt kannst du ganz oben einsteigen, als Partner, mit Gesellschaftsvertrag, notariell abgesichert …
– Was soll ich denn einbringen?
– Na, deinen Namen zum Beispiel … ach ja, herzliches Beileid noch, dein Vater ist gestorben, wie ich gelesen habe, Merkator, das war doch dein Vater? – Ja.
– Na, da gibt’s doch jetzt warmen Regen, oder?
– Die Erbschaft –? nicht der Rede wert.
– Na na, und wenn’s nur der Pflichtteil ist, dann hast du doch ausgesorgt! Hallo? Ich glaub ja nicht, dass du nur noch am Strand liegst, mit schönen Frauen, an der Copacabana, du doch nicht … by the way, hast du noch Kontakt nach drüben?
– Ich will ein Buch schreiben über den brasilianischen Urwald, die Menschen, die Tiere … – Wirklich? Was macht eigentlich Manuela? Hast du sie mal wiedergesehen?
– Wie sollte ich? … nur Brenda Schneider.
– Schneider, Schneider … ach ja, die hat mal für uns gearbeitet.
– Und ist rechtzeitig nach Deutschland zurückgegangen …
– Ja ja, das waren Zeiten … aber jetzt, alter Junge, jetzt geht es richtig los! Dein Buch kannst du immer noch schreiben … Wir zählen auf dich!
– Ich weiß ja gar nicht, worum es geht.
– Warum kommst du nicht am nächsten Montag hier zu uns in die Zentrale? Wir haben da Teambesprechung – mit der Chefin, da können wir über alles reden. Ich bereite das vor und sage dir noch die Uhrzeit durch …
Kurz nach diesem Gespräch und während Kaufunger mental noch damit beschäftigt war, klingelte das Telefon: Herr Kaufunger? wurde er gefragt.
Ja, sagte er. Es war wieder die »Land und Leute«-Redaktion, und die Frau war froh, ihn diesmal drangekriegt zu haben. Sie wollte gern ein Interview mit ihm machen und könnte ihn auch gern an seinem Wohnort treffen.
Was wollen Sie wissen? fragte er in Geberlaune.
Nur ein paar Fragen wegen der Erbschaft, geht ganz schnell …
Und da er nun selbst neugierig wurde, konnte sie ihn leicht ausquetschen. Noch eine letzte Frage: Mac Artur, wie schreibt sich das eigentlich – ah so: Merkator.
Als sie sich sehr herzlich bedankte, fiel ihm noch die Bitte ein, ihn (Kaufunger) nicht namentlich in ihrem Blättchen zu erwähnen. Sie versprach’s.
Brenda kommt nach Hause, wortkarg, abgekämpft von der Arbeit in der Stadt. Er hat die Besorgungen nicht gemacht, hat aber auch keine Lust, essen zu gehen. Er schlägt ihr vor, die Flasche Wein mit ihm zu trinken und zu erzählen. Du zuerst.
Sie zieht sich ins Bad zurück, und lässt sich von dort mit Bürogeschichten vernehmen.
Sie kriegt alle Anfragen, Angebote, Einladungen und darüber ärgern sich die anderen; aber sie arbeitet ja auch für drei, die andern (in ihrem Team) werden zwar besser bezahlt, können aber nicht mal Briefe schreiben, vor allem die Studierten, die zum Teil noch jünger sind – benehmen sich wie die Analphabeten, verstehst du, kein Stil. Dann erzählt sie voller Stolz und Anerkennung von einem Inder Masutra, der sie abwerben möchte.
Kaufunger lachend: Masutra? Nicht mit Ka?
– Ein bekannter Mann in der Branche, schwer reich! Apropos …
Und damit tritt sie hervor aus dem Bad, im weißen Bademantel, … das war doch ein Witz, dass du nichts geerbt hast von deinem Vater!
Ein Witz? Kaufunger lacht.
Sie hätte da nämlich was anderes gehört.
– Vom wem?
Er soll Häuser, Firmen besessen haben, der Stararchitekt, ein richtiges Imperium! Sie hätte noch neulich mit Feudl drüber geredet, … auch so jemand, der möchte, dass ich für ihn arbeite, für die IDA, stell dir vor!
– Dieter Feudl?
– Der wusste alles über Merkator, aber er wusste nicht, dass das dein Vater war. – Wann war das, wann hast du ihn gesprochen? will Kaufunger wissen.
– Weiß nicht, am Dienstag vielleicht, jedenfalls als du weg warst, warum?
– Ich hab heute mit ihm gesprochen und da kannte er dich gar nicht mehr: Frau Schneider, wer ist das?
Ach du spinnst, sagt Brenda leichthin.
Nein, du spinnst, sagt Kaufunger, – von wegen Erbschaft … Hier die Flasche, das ist alles, ein guter Tropfen übrigens (er wiegt die Flasche kennerhaft in der Hand) und die trinken wir jetzt.
– Nicht, wenn das die ganze Erbschaft ist! (Sie reißt ihm die Flasche aus der Hand). Erst erzählst du, was du wirklich geerbt hast, du bist doch sein Sohn und Erbe – Bin ich das?
– Du spinnst wirklich, weißt du, wenn du dich nicht mal für dein Millionenerbe interessierst!
– Aber du interessierst dich dafür …
– Ich? Was hab ich denn damit zu tun?
– Tja, was würdest du tun, mit geerbten Millionen – Schulden?
– Wer sagt das?
– Die Gläubigerbanken. Von den Häusern bleibt da nicht viel …
– Wie viel? Hast du das geprüft?
– Kann ich drauf verzichten.
– Heißt das, du verzichtest drauf – auf das Erbe?!
– Hab ich vor.
Brenda hat einen roten Kopf bekommen, jetzt wird sie blass. Er sieht sie bedenklich an.
Ich möchte nicht wissen, wer sich am Ende sein Erbe unter den Nagel reißt, sagt sie, die schwarze Witwe wahrscheinlich …
– Sie ist blond.
– Oder ihre üppige Tochter …
Hab ich sie üppig genannt? will er wissen.
– Das hast du, und das war unfair!
– Wieso? Das steht ihr, jetzt erinner ich mich wieder.
– Was? Wem? Das wird ja immer schöner!
– Und du bist noch schöner … Hier und hier! Er zeigt und greift nach ihren Brüsten.
Weg da! Sie greift nach dem Stangenbrot, um ihm auf die Finger zu klopfen. Woher kommt das überhaupt, das war doch schon im Müll?!
– Von meinem Vater. Kaufunger nimmt den Kampf auf: Lass mich mal sehen, wer üppiger ist … – und pariert ihr Gefuchtel. Sie trifft mit dem Brot die Flasche, die Knall auf Fall am Boden zerbirst. Erschrocken hält sie inne und übergibt ihm das Brot: Tut mir leid.





























