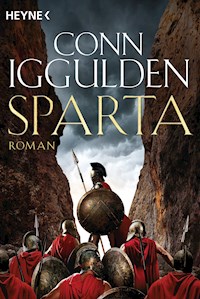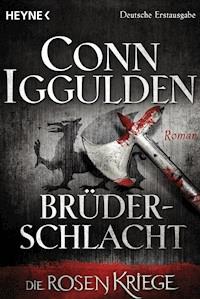
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Rosenkriege-Serie
- Sprache: Deutsch
Im Krieg der Könige erzittert das Reich!
Nach jahrelangen Kämpfen zwischen den königlichen Linien der Familien Lancaster und York ist das Reich zerrüttet. König Edward IV., der für das Haus York kämpft, wird nach Ravenspur vertrieben, wo er sich gegen die feindlichen Armeen der Lancasters rüstet. Doch im wieder aufflammenden Krieg übersieht Edward, dass sein wahrer Feind woanders sein Haupt erhebt. Henry Tudor, der rote Drache, ist zum Mann gereift. In seinen Händen hält er den Schlüssel, die Rosenkriege zu beenden. Unter den Tränen der Gefallenen und in Strömen von Blut kommt es zur letzten Schlacht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH
Nach jahrelangen Kämpfen zwischen den königlichen Linien der Familien Lancaster und York ist das Reich zerrüttet. König Edward IV., der für das Haus York kämpft, wird nach Ravenspur vertrieben, wo er sich gegen die feindlichen Armeen der Lancasters rüstet. Doch im wieder aufflammenden Krieg übersieht Edward, dass sein wahrer Feind woanders sein Haupt erhebt. Henry Tudor, der rote Drache, ist zum Mann gereift. In seinen Händen hält er den Schlüssel, die Rosenkriege zu beenden. Unter den Tränen der Gefallenen und in Strömen von Blut kommt es zur letzten Schlacht!
DER AUTOR
Conn Iggulden, geboren 1971, ist einer der erfolgreichsten Autoren historischer Stoffe. Iggulden lehrte Englisch an der University of London, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Drei Könige ist der dritte Band seiner Bestseller-Serie um die Rosenkriege. Iggulden lebt mit seiner Familie in Hertfordshire, England.
Mehr Informationen über den Autor und die Serie finden Sie unter www.conniggulden.com
CONN IGGULDEN
BRÜDER
SCHLACHT
DIE ROSENKRIEGE 4
ROMAN
Aus dem Englischenvon Christine Naegele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Meiner Mutter gewidmet
Im fünfzehnten Jahrhundert gab es in England zwei große Adelshäuser, die blutsverwandt waren. Die ältere Linie, Lancaster, hatte den Thron über drei Generationen inne – bis König Henry VI. erkrankte. Das nahm die jüngere Linie, York, zum Anlass, die Macht an sich zu reißen, was einen Krieg zur Folge hatte.
Es konnte keine zwei Könige geben. Edward von York verbündete sich mit Earl Warwick, und 1461 wurde die Sache auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Das Haus Lancaster unterlag. Königin Margaret floh mit ihrem Sohn nach Frankreich und ließ ihren Gemahl Henry zurück, der im Tower von London festgesetzt wurde.
König Edward IV. heiratete Elizabeth Woodville, die ihn aber gegen Earl Warwick aufhetzte. Nach endlosen Provokationen riss Warwick die Geduld, er ließ Edward verhaften. Außerdem erlaubte Warwick George, dem Duke von Clarence und Bruder des Königs, seine Tochter zu heiraten.
Obwohl Warwick Edward schließlich freiließ, wurden sie nie wieder Freunde. Edward klagte Warwick des Hochverrats an und wollte ihn nun seinerseits festnehmen lassen.
Am Ende des vorangegangenen Teils der Rosenkriege-Saga »Drei Könige« ist Warwick auf der Flucht. Zusammen mit seiner hochschwangeren Tochter und seinem Schwiegersohn, George von Clarence, verließ er England. Doch der sichere Hafen von Calais wurde ihm verwehrt, das Kind wurde auf See geboren und starb. Fortan lebten Warwick und Clarence als Exilanten in Frankreich, von Freunden und Familie verstoßen.
Jetzt erkannte der französische König Louis XI. seine einmalige Chance. Er stattete Warwick und Clarence mit einem Heer von Söldnern aus, samt den nötigen Schiffen, mit denen sie im September 1470 nach England zurückkehrten. Die Gerüchteküche brodelte, doch niemand wusste, wo sie landen würden. Die Zeit der Vergeltung war gekommen.
TEILEINS
1470
Denn dem trau’ nie, der einmal Treue brach.
WILLIAM SHAKESPEARE, Henry VI., 3. Teil
1
Der Fluss zog sich in einer Schleife um die Burg von Pembroke. Die Wintersonne schien rot auf die Burgmauern, und über allem erhob sich der Wohnturm, hoch und stolz wie eine Kathedrale.
Auf dem Pfad, der zum Torgebäude führte, ließ der Fremde seine Hände auf dem Sattelknopf ruhen, wobei sein Daumen über eine sich auflösende Naht im Leder fuhr. Sein Pferd war müde, und das Tier ließ den Kopf hängen, weil es zwischen den Pflastersteinen nichts zu fressen fand. Verglichen mit den Wachen, die auf ihn herabstarrten, erschien Jasper Tudor schmutzig wie ein Schafhirte. Sein Haar war so stark vom Straßenstaub verdreckt, dass es wie Filz aussah. Es hing ihm bis auf die Schultern hinab, sodass sein Gesicht im Schatten lag, jetzt, wo die Sonne sich dem Horizont näherte und der Tag zur Neige ging. Obwohl er erschöpft war, stand sein Blick niemals still, ihm entging keine Bewegung auf der Burgmauer. Ob eine der Wachen sich nach innen zum Burghof wandte oder zu einem Diensthabenden nach unten blickte – er bemerkte es, horchte hin und zog seine Schlüsse. Er wusste, dass man dem Burgherrn seine Anwesenheit gemeldet hatte. Er wusste auch, wie viele Stufen dieser Mann steigen musste, um das äußere, mit Eisen bewehrte Tor zu erreichen, das lediglich das erste von einem Dutzend weiterer Tore war, die die Burg vor einem Angriff schützen sollten.
Jasper zählte flüsternd vor sich hin, um den Zorn zu mäßigen, der ihn ergriffen hatte. Ihm war jede Stufe, jede Windung dieser Steintreppen dort drinnen vertraut, und jetzt verzog er angewidert den Mund, als William Herbert auf den Zinnen erschien. Der junge Earl blickte auf ihn herab, sein Gesicht fleckig vor Erregung. Der neue Herr von Pembroke war gerade mal siebzehn Jahre alt, ein rotgesichtiger junger Raufbold, der den Tod seines Vaters immer noch nicht verwunden hatte. Und wie es schien, war Earl Herbert über den Anblick des dunklen, drahtigen Mannes, der da zu ihm hochsah, nicht gerade erfreut, das konnte man an seinem Gesichtsausdruck ablesen und an der Art und Weise, wie er mit seinen großen Pranken die Steinmauer umklammerte.
Bis vor zwölf Jahren war Jasper Tudor der Earl von Pembroke gewesen und es war nicht leicht für ihn, die Fassung zu bewahren, wenn jetzt ein Mann, der halb so alt war wie er, voller Arroganz von seiner eigenen Burgmauer auf ihn herabblickte.
Earl William Herbert starrte ihn lediglich eine Zeit lang an, die Augen zusammengekniffen, als sei ihm etwas im Hals stecken geblieben. Der jüngere Mann hatte einen auffälligen großen Kopf. Das glatte Haar über der Stirn war gerade abgeschnitten. Unter seinem Blick neigte Jasper Tudor grüßend den Kopf. Schon mit dem Vater zu verhandeln wäre schwer genug gewesen, wenn der Mann noch gelebt hätte.
Der alte Herbert war keinen rühmlichen Tod gestorben, der seiner Familie zu neuen Ehren verholfen hätte. Er hatte sein Leben nicht im tapferen Kampf verloren, sondern war rücksichtslos umgebracht worden, als Warwick König Edward gefangen genommen hatte. Ein kleiner Verlust, der einfach hingenommen worden war, weil er von dem weitaus größeren Frevel überschattet wurde, als Warwick Hand an den König legte. Doch in Pembroke hatte die ganze Stadt getrauert.
Langsam dunkelte es, und Jasper Tudor schluckte nervös. Hier und da blitzte es hinter den Schießscharten auf, wenn eine der gepanzerten Wachen sich bewegte. Er wusste, es nützte ihm nichts, dass er sie entdeckt hatte. Vor dem Bolzen einer Armbrust gab es zu Pferde kein Entkommen.
Am Himmel sammelten sich Wolken, von den letzten Strahlen der Abendsonne vergoldet. Der neue Earl dort oben verlor langsam die Geduld. Zwar verspielte er damit etwas von seinem Vorteil, aber schließlich wäre es trotz aller Trauer und Überlegenheit für jeden Siebzehnjährigen schwer gewesen, der kühlen Beherrschtheit eines vierzigjährigen Mannes Paroli zu bieten.
»Also? Was wollt Ihr hier, Master Tudor?« Es schien dem jungen Earl ein gewisses Vergnügen zu bereiten, dass er keinen Titel gebrauchen musste. Jasper Tudor war König Henrys Halbbruder. Er war im Hause der Lancaster aufgewachsen und hatte auf ihrer Seite gekämpft. Er war gegen den achtzehnjährigen Edward von York in die Schlacht gezogen, den jungen Riesen, der immer noch voll Zorn den Tod seines Vaters betrauerte. Jasper unterdrückte den Schauer angesichts der Erinnerung an dieses gepanzerte Ungeheuer, dessen Rüstung so rot war wie die Abendsonne auf den Burgmauern von Pembroke.
»Ich entbiete Euch Gottes Gruß und empfehle mich Euch an. Ich bin zu Schiff von Frankreich direkt hierhergekommen, um allen Nachrichten vorauszueilen. Habt Ihr schon Neuigkeiten aus London?«
»Würde es Euch Euren walisischen Hals zuschnüren, wenn Ihr mich mit Lord anreden würdet?«, fragte William Herbert. »Ich bin der Earl von Pembroke, Master Tudor. Wenn Ihr in der Hoffnung auf ein Essen oder Geld an mein Tor gekommen seid, muss ich Euch enttäuschen. Ich bin auf Eure Neuigkeiten nicht angewiesen. Euer Lancaster-Pöbel und Euer abgerissener, gefangener König haben mir nichts zu sagen. Mein Vater ließ sein Leben bei der Verteidigung des rechtmäßigen Königs von England, Edward von York.« Der junge Mann zog spöttisch einen Mundwinkel hoch. »Während Ihr, Tudor, soweit ich weiß, enteignet wurdet. Man nahm Euch Ehre, Titel und Besitz. Eigentlich sollte ich Euch auf der Stelle umbringen lassen. Pembroke gehört mir. Alles, was meinem Vater gehört hat, gehört jetzt mir.«
Jasper nickte, als habe er etwas gehört, worüber es sich lohnte, nachzudenken. Er spürte, dass sich hinter der Aggressivität des jungen Mannes seine Unsicherheit verbarg. Wieder wünschte er, er hätte mit dem alten Earl verhandeln können, der ein Ehrenmann gewesen war. Doch so war es immer, wenn Kriege ausbrachen. Die guten Männer kamen um und hinterließen Söhne, die ihnen nachfolgten, wohl oder übel. Jasper schüttelte den Kopf, dass seine verfilzten Locken flogen. Auch er gehörte zu diesen Söhnen, und vielleicht war er ebenfalls weniger bedeutend als sein Vater, Owen. Und noch schlimmer, in den ganzen Jahren des Exils hatte Jasper keine Frau gefunden, keine Söhne gezeugt. Wenn der französische König ihn als seinen Vetter nicht unterstützt hätte, dachte Jasper, wäre er vielleicht verhungert, einsam und bettelarm. Doch er war loyal geblieben. Loyal gegen König Henry und Königin Margaret von Anjou, trotz ihres Abstiegs und ihrer verzweifelten Lage.
Jasper senkte den Blick, die Verachtung des Earls ließ seine Hoffnung schwinden. Doch er stand vor den Toren Pembrokes, und diese ehrwürdige Burg hatte einst ihm gehört. Von ihren Mauern hallte das Echo einer schmerzhaften Vertrautheit zurück, und irgendwie war es ihm ein Trost, hier zu sein, die Hand einfach ausstrecken und die Steine berühren zu können. Er durfte sich beim Anblick dieser Burgmauern nicht demütigen lassen. Noch einmal hob er den Kopf.
In dieser Festung gab es noch einen Menschen, den er liebte wie ein Vater seinen Sohn, und das war der eigentliche Grund seines Besuchs. Jasper Tudor war nicht nach Pembroke gekommen, um anzuklagen oder Rache zu üben. Die Umstände hatten ihn von Frankreich nach Hause zurückgerufen, und er hatte Warwick um Erlaubnis gebeten, dieses private Vorhaben zu erledigen. Als die große Flotte in See stach, war sein Schiff allein nach Westen gesegelt.
Jaspers Blick wanderte an den Zinnen entlang, doch bisher entdeckte er kein Zeichen vom Sohn seines Bruders, der hier seit vierzehn Jahren als Mündel lebte, doch in Wirklichkeit ein Gefangener war.
»Ich hatte immer geglaubt, Pembroke sei eine andere Welt als das große London mit seinem Trubel und seiner Geschäftigkeit«, sagte Jasper mit lauter Stimme. »Ein paar gute Pferdegespanne und zwei anstrengende Wochen auf der Straße – man kann es schaffen, aber es ist nicht einfach. Nur im Winter sind die Straßen ein solcher Morast, dass es besser ist, man segelt um die Küste von Cornwall herum, auch wenn das mindestens ebenso lange dauert und womöglich noch gefährlicher ist. Ich selbst fürchte diese Winterstürme, die einen Schiffsrumpf aufreißen können, sodass alle ertrinken, die ihr Leben auf dem Wasser riskieren, möge Gott ihren Seelen gnädig sein.«
Die Worte strömten förmlich aus ihm heraus, sodass der Earl glasige Augen bekam und schließlich verwirrt den Kopf schüttelte.
»Ihr kommt hier nicht herein, Master Tudor«, bellte Earl Herbert, dessen Geduld am Ende war. »Hört auf mit Euren walisischen Spielchen, ich werde Euch mein Tor nicht öffnen. Sagt, was Ihr zu sagen habt, dann geht zurück in Eure feuchten Wälder, zu Euren Lagern und Eurer Wilderei. Macht weiter als der dreckige, verhungerte Brigant, der Ihr seid. Ich werde mich derweil an Pembroke erfreuen, Lammbraten essen und alle Annehmlichkeiten genießen, die König Edward mir zukommen lässt.«
Jasper fuhr mit dem Daumen über sein Kinn, um seinen aufflammenden Ärger zu verbergen. Er liebte Pembroke immer noch, jeden Stein und Torbogen, jeden Saal und jeden muffigen Lagerraum, gefüllt mit Wein und Getreide und gepökeltem Hammel- und Ziegenfleisch. Er hatte in dieser Gegend gejagt. Pembroke bedeutete ihm Heimat, wie er sie sonst nirgendwo auf der Welt empfand. Als Kind war es sein Traum gewesen, eines Tages wie ein feiner Lord auf einer Burg zu leben. Als dieser Traum schließlich in Erfüllung ging, war Jasper Tudor zufrieden gewesen. Für den Sohn eines Soldaten konnte es keine größere Erfüllung geben.
»Ich frage noch einmal: Ob Ihr es gehört habt, Mylord, das Blatt hat sich gewendet. Earl Warwick ist wiedergekommen, mit einer Flotte und einem Heer.« Jasper zögerte, er suchte nach den passenden Worten. Der junge Earl über ihm hatte sich weit hervorgelehnt, als er den Namen hörte, er hatte die Steine der Mauer umfasst, als wolle er ein Stück herausbrechen und ihm an den Kopf schleudern. Langsam fuhr Jasper fort, er wollte auch noch in einiger Entfernung vom Torhaus gehört werden.
»Sie werden Lancaster wieder einsetzen, Mylord. Sie werden ein heißes Eisen in die Wunde legen, und das wird das Ende von York sein. Ich sage das nicht, um Euch zu drohen, sondern um Euch die Gelegenheit zu geben, die richtige Seite zu wählen, ehe Euch womöglich jemand mit dem Schwert in der Hand dazu auffordert. Jetzt bin ich wegen meines Neffen hier, Mylord. Wegen Henry Tudor, dem Sohn meines Bruders Edmund und Margaret Beaufort. Geht es ihm gut? Ist er sicher hier in der Burg?«
Als der Earl von Pembroke den Mund aufmachte, um zu antworten, nahm Jasper endlich eine Bewegung an der Mauer wahr, ein glattes Gesicht, umrahmt von dichtem schwarzem Haar. Gewiss der Junge, noch bartlos. Jasper ließ sich nicht anmerken, dass er ihn gesehen hatte.
»Ihr habt keinerlei Anspruch auf ihn«, fauchte William Herbert. »Mein Vater bezahlte tausend Pfund für dieses Mündel. Ich sehe, wie zerlumpt Euer Mantel ist, Tudor. Ich sehe Euren Schweiß und Dreck von hier aus. Könnt Ihr mir diese tausend Pfund zurückzahlen?« Das spöttische Grinsen des jungen Mannes verschwand, als Jasper Tudor hinter sich griff und einen Beutel aus Leinen und Leder hervorzog, der an seinem Gürtel befestigt gewesen war. Er schüttelte ihn, um die Goldmünzen klingeln zu lassen.
»Das kann ich«, sagte er, aber in seiner Stimme lag kein Triumph. Er spürte die Verachtung des Earls und wusste, es würde nichts ändern.
»Ach ja?« William Herberts Mund bewegte sich, als habe seine Wut ihm den Hals zugeschnürt. »Und habt Ihr auch die Jahre seiner Ausbildung dort in Eurem Beutel? Könnt Ihr die Zeit meines Vaters bezahlen? Sein Vertrauen?« Jetzt sprach er wieder schneller, sein Selbstbewusstsein war zurückgekehrt. »Dafür ist es zu wenig, Tudor.«
Es würde nach dem Willen des jungen Earls gehen, egal was gesagt wurde oder wer das bessere Argument hatte. Ein Mensch allein konnte die Tore von Pembroke nicht bezwingen, und zehntausend Mann auch nicht.
Seufzend befestigte Jasper den Beutel wieder am Gürtel. Wenigstens würde er jetzt dem französischen König nichts schuldig sein, wenn er ihm dieses geliehene Geld zurückbrachte. Er rieb sich die Stirn, als sei er müde, damit wollte er seine Augen vor dem Mann dort dreißig Fuß über ihm verbergen, um unauffällig einen Blick auf seinen Neffen werfen zu können. Jasper wollte nicht, dass man den Jungen entdeckte und fortschickte. Wenn er ihn direkt ansprechen würde, traute er William Herbert ohne Weiteres zu, dass er seinem Neffen das Leben schwer machen oder ihn gar absichtlich in Gefahr bringen würde. Als Jasper wieder sprach, waren seine Worte genauso für Henry Tudors Ohren wie für den neuen Earl von Pembroke bestimmt.
»Dies wäre eine Gelegenheit, ein wenig guten Willen zu zeigen, Mylord«, rief er hinauf. »Lasst die Vergangenheit ruhen, unsere Väter sind beide begraben. Ihr steht jetzt da, wo ich einst als Earl stand, und Pembroke gehört Euch. Die Jahre gehen dahin, Mylord, und wir können nicht einen Tag oder auch nur eine Stunde zurückholen, um eine bessere Entscheidung zu treffen.« Das Schweigen des Earls machte ihm Mut, zumindest überhäufte der junge Mann ihn nicht mehr mit Flüchen und Drohungen.
»Edward von York ist im Norden, Mylord, weit weg von seinen Armeen und seinen Burgen. Und jetzt ist es zu spät für ihn!«, fuhr Jasper stolz fort, so laut, dass seine Stimme überall gehört werden konnte. »Warwick ist nach England zurückgekommen! Mit einem großen Heer, das er in Kent und Sussex gesammelt hat, ja, und auch in Frankreich. Männern wie ihm leihen sogar Könige ihr Ohr. Sie sind eine andere Rasse als Ihr und ich, Mylord. Ihr werdet sehen, Earl Warwick wird Henry von Lancaster aus dem Tower befreien und er wird wieder regieren. Das ist Euer rechtmäßiger König – und er ist mein Halbbruder! Und jetzt möchte ich meinen Neffen nach London mitnehmen, Mylord. Ich bitte Euch, ihn mir zu übergeben, in gutem Glauben und im Vertrauen auf Eure Barmherzigkeit. Ich werde Euch die Ausgaben Eures Vaters zurückerstatten, auch wenn es alles kostet, was ich besitze.«
Während er gesprochen hatte, waren Fackeln und Laternen auf der Burgmauer erschienen, als sollten sie das letzte Tageslicht überstrahlen. William Herbert, im flackernden Lichtschein, wartete nicht lange, um die Sache zu beenden.
»Nein«, rief er hinunter. »Das ist meine Antwort. Nein, Tudor. Von meiner Hand bekommt Ihr nichts.« Der Earl genoss seine Macht über den zerlumpten Mann am Tor sichtlich. »Allerdings könnte ich Euch Euer Geld von meinen Leuten abnehmen lassen, wenn das nicht auch eine Eurer Lügen wäre. Seid Ihr nicht ein Straßenräuber? Wie viele Menschen habt Ihr ausgeraubt und ermordet, um so viel Geld zu haben, Tudor? Ihr walisischen Strauchritter seid alle Halsabschneider, das weiß doch jeder.«
»Bist du wirklich so töricht, Junge?«, brüllte Jasper Tudor zu dem jungen Mann hinauf, der vor Empörung schäumte. »Ich habe dir doch gesagt, das Blatt hat sich gewendet! Ich bin mit offenen Händen zu dir gekommen, mit einem ehrlichen Angebot. Und du blökst mich an und drohst mir immer noch, hinter deinen sicheren Burgmauern? Ist das dein ganzer Mut, diese Steine unter deinen Händen? Wenn du mir meinen Neffen nicht zurückgibst, dann hör gut zu, Junge! Solltest du ihm etwas antun, dann werde ich dich unter die Erde bringen. Hast du mich verstanden? Tief unter die Erde.« Er hatte in scheinbarem Zorn gesprochen, doch er warf einen Blick auf seinen vierzehnjährigen Neffen, der ihn ein Stück entfernt von den Zinnen beobachtete. Er hielt Blickkontakt mit dem Jungen, bis William Herbert sich umwandte, um zu sehen, was seine Aufmerksamkeit fesselte. Das Gesicht verschwand. Jasper konnte nur hoffen, dass seine Botschaft angekommen war.
»Sergeant Thomas!«, rief der junge Earl von Pembroke im Befehlston. »Nehmt ein halbes Dutzend Männer mit und bringt mir den Briganten, der sich dort auf meiner Straße herumtreibt. Er hat einem Earl des Königs nicht den gebührenden Respekt entgegengebracht. Und seid nicht zimperlich mit diesem walisischen Bastard. Lasst ihn ruhig etwas bluten, dann bringt ihn mir, damit ich ihn bestrafen kann.«
Jasper fluchte leise, als er jetzt ein lautes Poltern und Krachen aus dem Torhaus vernahm, gefolgt vom Rasseln schwerer Ketten. Von allen Seiten kamen Soldaten an die Mauer gerannt, um nach etwaigen verborgenen Angreifern Ausschau zu halten. Einige von ihnen hatten Armbrüste, und Jasper Tudor nahm ihre kalten, abschätzenden Blicke wahr. Es tat nichts zur Sache, dass der eine oder andere vor Jahren zu seinen Leuten gehört hatte, jetzt hatten sie einen neuen Herrn. Er schüttelte ärgerlich den Kopf, riss sein Pferd herum und gab ihm die Sporen, sodass das Tier einen Satz machte und auf die offene Straße galoppierte. In der Dunkelheit hörte er keine Bolzenschüsse. Sie wollten ihn lebend.
Henry Tudor hatte sich, so weit er es wagte, zwischen den Zinnen hervorgebeugt und den Reiter angestarrt. Trotzig hatte er vor dem Torhaus von Pembroke gesessen, mager wie ein Bettler auf seinem dunklen Pferd, und dennoch hatte er es gewagt, den neuen Earl herauszufordern. Der schwarzhaarige Junge hatte keinerlei Erinnerung an seinen Onkel und hätte ihn in einer Menschenmenge nicht erkannt. Er wusste lediglich, dass Onkel Jasper für König Henry gekämpft hatte, für Lancaster, in Städten, die so weit weg waren, dass er nur ihre Namen kannte.
Henry hatte das Bild seines Blutsverwandten in sich aufgenommen, er hatte, damit ihm kein Wort entging, sich an den rauen Steinen festgeklammert und fast einen Sturz riskiert. Er war in Pembroke geboren worden, sowohl er als auch seine Mutter waren dem Tode nahe gewesen, erzählte man. Er hatte gehört, dass es gewiss ein Wunder gewesen sei, dass eine so zierliche und junge Mutter die Entbindung überlebt hatte. Keine zwanzig Fuß von dem Torhaus, wo William Herbert stand, war Henry zur Welt gekommen. Seine Mutter war gerade dreizehn Jahre alt gewesen und halb wahnsinnig vor Angst und Schmerzen. Er war einer Amme übergeben worden, und die kleine Margaret Beaufort war verschwunden, um wieder verheiratet zu werden und ihren verstorbenen Mann und ihr einziges Kind so schnell wie möglich zu vergessen. Als die Anhänger Yorks Pembroke einnahmen und sein Onkel Jasper als Verräter verfolgt wurde, war Henry Tudor allein zurückgeblieben.
Er war überzeugt, dass diese Isolierung ihn stark gemacht hatte. Kein anderer Junge war ohne Mutter aufgewachsen, ohne Freunde, ohne Familie, stattdessen mit Feinden, die ihn verspotteten und drangsalierten. Das Ergebnis war, dass er genauso hart wie der Stein von Pembroke geworden war. Er hatte tausend Grausamkeiten von den Herberts erdulden müssen, von Vater und Sohn, aber er hatte durchgehalten, und während all dieser Jahre hatte er nur auf einen Moment der Schwäche oder der Unaufmerksamkeit gewartet.
Es hatte Zeiten gegeben, in denen er seinen Hass fast vergessen hatte. Dann musste er den winzigen Funken, der blieb, durch Anblasen am Leben halten. Als der alte Earl noch lebte, hatte es sogar Tage gegeben, an denen Henry sich fast wie ein zweiter Sohn des Mannes gefühlt hatte, anstatt wie ein bloßer Besitz, der verwahrt wurde wie ein Wertgegenstand, um zu gegebener Zeit zu Geld gemacht zu werden. Er sehnte sich nach einem anerkennenden Wort von William, doch der Ältere verpasste keine Gelegenheit, ihn zu demütigen. Dann hasste Henry sich selbst wegen seiner Schwäche, er klammerte sich förmlich an seinen Zorn und umschloss ihn mit seinem ganzen Körper.
Er hatte gehört, wie sein Onkel unten auf der Straße energisch wurde. Sein Redestrom traf Henry wie ein eiserner Draht, der sich um seinen Hals legte. Solltest du ihm etwas antun, dann werde ich dich unter die Erde bringen. Soweit er sich erinnerte, war es das erste Mal, dass jemand sich um sein Wohlergehen sorgte, und es erschütterte ihn. Und in diesem Augenblick, als er überrascht feststellte, dass jemand sich so um ihn sorgte, dass er sogar einem Earl drohte, hatte sein Onkel Jasper ihn angeblickt. Henry Tudor war erstarrt.
Er hatte nicht geahnt, dass sein Onkel bemerkt hatte, wie er näher geschlichen war. Der Blick war ihm durch und durch gegangen, und seine Gedanken gerieten ins Taumeln und schienen einen Moment auszusetzen. Unter die Erde. Tief unter die Erde. Hoffnung flammte in Henry auf, und er hatte sich wieder zurückgezogen, aus dem Blickfeld seines Onkels – aber auch aus dem Blickfeld eines Earls Herbert, der seinen Hass auf die Lancasters schon lange am schwächsten Glied dieser Kette ausließ. Henry Tudor hatte in den Kriegen keine Partei ergriffen, doch die Farbe seines Blutes, das so rot war wie die Rose der Lancaster, konnte er nicht verleugnen.
Der Junge rannte los, lief polternd über die Laufstege, die auf Balken unterhalb der Zinnen ruhten. Im flackernden Schein einer Fackel streckte eine der Wachen die Hand aus, um ihn aufzuhalten, aber Henry schlug sie zur Seite, und der Mann fluchte leise. Der alte Jones, stocktaub auf dem rechten Ohr. Der junge Tudor kannte jeden Mann und jede Frau in der Burg, von denen, die innerhalb der Mauern wohnten und der Familie Herbert diente, bis zu den etwa hundert weiteren Arbeitern, die jeden Morgen aus der Stadt heraufkamen, mit Wagen und Vorräten und ihrer Arbeitskraft.
Er sprang die Treppe hinunter, warf sich mit jugendlicher Unbekümmertheit gegen den äußeren Pfosten und taumelte gegen das Geländer. Er war tausend Mal über das Burggelände gerannt und hatte sich in Schnelligkeit und Ausdauer geübt. Das kam ihm jetzt zugute, gleichzeitig hatte er ein Ziel, das ihn alle Vorsicht vergessen ließ. Er rannte durch die Burg, als sei der Leibhaftige hinter ihm her.
In fast völliger Dunkelheit eilte er durch die Werkstatt, die sich im inneren Burghof befand. Mit erhobenen Armen sprang er über aufgestapelte Kisten, die nach Algen und Seewasser rochen. An jedem anderen Tag hätte er hier verweilt, um zuzusehen, wie die silberglänzenden Fische und die Austern ausgepackt wurden, aber heute hatte er ein anderes Ziel vor Augen und musste sich überzeugen, dass er sich nicht getäuscht hatte. Im offenen Gelände konnte er sehen, dass die Sonne hinter die Mauern versunken war und ein merkwürdiges Licht verbreitete, als er die steinernen Vorbauten des Bergfrieds erreichte, jenes wuchtigen Turms, der sich fünf Stockwerke hoch über den Rest der Burg erhob und vor einem Angriff völlig abgeriegelt werden konnte. Pembroke war für die Verteidigung gebaut worden, doch es gab eine Schwachstelle, die nur wenige kannten. Ein sorgsam gehütetes Geheimnis.
Im unteren Festsaal kam Henry schlitternd zum Halten. Hier saß der Burgvogt des Earls, ein rotgesichtiger Mann, der in ein ernstes Gespräch mit einem Bedienten vertieft war. Die beiden Männer beugten sich über eine Schriftrolle, als ginge es um den Sinn des Lebens und nicht nur um ein paar zerbrochene Dachziegel oder so und so viele Klafter Bauholz. Henry verfiel in einen langsamen, steifen Gang, als er die Halle am anderen Ende durchquerte, wo er den größten Abstand zu den Männern hatte. Ihm war, als blickten sie auf, aber vielleicht bildete er es sich auch nur ein, da sie ihn nicht ansprachen. Ohne sich umzusehen, ging er zur Tür, öffnete sie und gelangte in die Küchen dahinter, deren Hitze ihm entgegenschlug.
Pembroke hatte zwei Speisesäle, und unter dem größeren der beiden befanden sich die Küchen. Das Personal und weniger wichtige Gäste aßen im unteren Saal. Hier hatte Henry viele Abende in fast völliger Dunkelheit sein Brot und Fleisch gegessen, da man ihm selbst ein Talglicht nicht gönnte. Meist war er allein gewesen, während aus den oberen Fenstern, wo der Earl seine bevorzugten Gäste bewirtete, unbeschwertes Gelächter gedrungen war. Schon allein diesen Saal zu betreten hätte für Henry eine Tracht Prügel bedeutet, doch heute Abend interessierten ihn nur die Küchen – und das, was sich hier verbarg.
Die Mägde blickten kaum auf, als er hereinkam, sie dachten wohl, der magere Junge bringe nur seinen Napf zurück, obwohl er gewöhnlich von einem Holzteller aß und sich meist noch ein Stück hartes Brot mitnahm, entweder um selbst daran zu nagen oder die Dohlen im Turm damit zu füttern. Jedenfalls kannten sie den Jungen. Die Köchin konnte er nicht sehen, Mary Corrigan mit ihren roten Händen und der flatternden Schürze, die ihn davongejagt hätte. Der Dampf aus vielen kochenden Töpfen hing in der Luft. Es herrschte rege Geschäftigkeit. Die Frauen liefen mit Zutaten herum, maßen ab und wogen. Unwillkürlich fuhr er mit der Zunge über die Lippen, als er merkte, dass er noch nichts gegessen hatte. Sollte er sich von den Köchinnen etwas zu essen erbetteln? Sein Blick fiel auf einen Berg geschälter Äpfel, die bereits braun wie Honig wurden. Daneben schwammen große Käsestücke in einem Topf wässriger Molke. Wie lange würde es dauern, bis er wieder etwas zu essen bekäme?
Während er dort stand, umgeben vom Geklapper, den Gerüchen und der schweren Küchenarbeit, dachte er an die Tür auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes. In die Steinmauer eingelassen, war sie so schmal, dass ein erwachsener Mann nur seitlich hindurchkommen konnte. Ein Eichenbalken sicherte sie, er lag auf eisernen Halterungen, die in die Wand eingelassen waren. Henry kannte den Balken, doch er blickte überall hin, nur nicht gerade zu ihm. Er kannte jeden Winkel in Pembroke. Es gab keinen Lagerraum, keinen Speicher und keinen Pfad, den er nicht erforscht hatte, doch nichts hatte seine Neugier so beflügelt wie diese schmale Tür. Er spürte förmlich die Feuchtigkeit und die Kälte, die dahinter lag, auch wenn er im Moment vor Schweiß glänzte.
Er ging durch die Küche, und die Frauen traten mit ihren Töpfen und Tabletts zur Seite wie Tänzerinnen. Sie würden an diesem Abend sechshundert Männer und rund achtzig Frauen verpflegen müssen, an der hohen Tafel im großen Saal, wo die engsten Vertrauten des jungen Earls saßen, und außerdem die Falkner und Priester sowie, in einer späteren Sitzung, die Wachen und Stalljungen. Die Verpflegung war ein wichtiger Teil des Vertrags zwischen dem Lord und den Untergebenen, eine Pflicht und eine Last zugleich, halb Symbol, halb Sold.
Henry war an der Tür und hob mit etwas Anstrengung den Balken. Er vergeudete wertvolle Augenblicke damit, den Balken an die Wand zu stellen. Schwer atmend nahm er den Schlüssel vom Haken, als er eine Hand auf der Schulter spürte. Es war Mary Corrigan, die ihn fragend ansah. Sie war nicht größer als er selbst, aber sie musste dreimal so schwer sein.
»Und was soll das werden?«, sagte sie, indem sie sich die Hände an einem Lappen abwischte. Henry merkte, wie er rot wurde, aber er fuhr fort, den Schlüssel in dem alten Schloss zu drehen, bis er hörte, wie es sich mit einem Klicken öffnete.
»Ich gehe runter zum Fluss, Mary. Vielleicht erwische ich einen Aal.«
Sie zog die Augen zusammen, aber eher spöttisch als misstrauisch.
»Wenn Master Holt oder der Vogt wüssten, dass du diese alte Tür benutzt, würden sie dir das Fell über die Ohren ziehen, das ist dir doch klar, oder? Ts, Jungen! Zu faul, um den langen Weg zu nehmen. Nun, dann geh schon. Ich schließe hinter dir ab. Und häng alle Schlüssel wieder an ihre Plätze zurück. Und zurück kommst du übers Torhaus, verstanden? Bei dem Lärm höre ich dich hier nicht klopfen.« Zu Henrys Überraschung streckte die dicke Köchin die Hand aus, und mit ihren Fingern, die eine Eisenkelle hätten verbiegen können, fuhr sie ihm freundlich durchs Haar.
Henry merkte, wie ihm Tränen in die Augen traten. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal in seinem Leben geweint hatte. Es war möglich, dass er Pembroke nie mehr betreten würde, das wurde ihm plötzlich klar. Alle Menschen, die als seine Familie galten, wohnten in diesen Mauern. Zwar hatte Mary Corrigan ihn dreimal verprügelt, weil er etwas gestohlen hatte, aber sie hatte ihm auch einmal einen Kuss auf die Wange gegeben und ihm einen Apfel zugesteckt. Es war die einzige freundliche Geste, an die er sich erinnern konnte.
Er zögerte, doch dann dachte er an die dunkle Gestalt des Reiters. Sein Onkel war gekommen, um ihn zu holen. Henrys Entschluss stand fest, und er nickte ihr zu. Die Tür öffnete sich mit einem kalten Luftzug, er schloss sie hinter sich und ließ Marys rote Wangen und ihren Schweißgeruch zurück. Das Schloss schnappte ein, und er hörte die Anstrengung der Frau, als sie den Eichenbalken anhob und wieder an seinen Platz legte. Henry bemühte sich, ruhig zu bleiben, als er nach dem warmen Küchendunst jetzt die Kälte spürte.
Die Treppe machte sofort eine Wendung, sodass jemand, der von unten heraufkäme, weder einen festen Halt hätte noch genug Platz, um eine Axt zu schwingen. Steil ging es hinab, hinunter zu den Klippen unter der Burg von Pembroke. Auf den ersten Stufen hatte er noch etwas Licht, das durch den Türspalt fiel, aber nach der zweiten Windung war es plötzlich so dunkel, als habe ihm jemand ein nasses Tuch aufs Gesicht gedrückt.
Niemand wusste, ob die Höhle erst entdeckt worden war, nachdem die Burg schon gebaut war, oder ob sie vielleicht der Grund für die erste hölzerne Befestigung gewesen war, die man vor Jahrhunderten an dieser Stelle errichtet hatte. Henry hatte Pfeilspitzen aus Feuerstein gesehen, die man hier auf dem Boden gefunden hatte, angefertigt von Jägern einer vergangenen Zeit, die zu weit zurücklag, um etwas darüber zu wissen. Römische Münzen hatte man ebenfalls gefunden, schwarz angelaufenes Silber mit den Porträts längst toter Kaiser. Es war eine uralte Höhle, und Henry war begeistert gewesen, als er sie an einem verregneten Wintertag entdeckt hatte, in einer Zeit, die für ihn geprägt war von strengen Lehrern, von blauen Flecken und feuchten Burgmauern.
Der Hall seiner Schritte auf den Steinstufen klang jetzt anders, und er wusste, dass er sich einer Tür näherte. Auch diese war verschlossen, aber er tastete nach dem Schlüssel, der an einem Lederband hing. Als er die Tür aufgeschlossen hatte, musste er alle Kraft aufwenden, um sie zu öffnen, immer wieder stieß er mit der Schulter gegen den aufgequollenen Türrahmen, bis er schließlich in eine noch kältere Finsternis taumelte. Keuchend vor Anstrengung und Furcht, drückte er die Tür hinter sich zu und überlegte, was er mit dem Schlüssel machen sollte. Es schien nicht recht zu sein, einen so wichtigen Gegenstand einfach mitzunehmen. Er spürte die Wölbung der großen Höhle über sich – eine andere Welt, obwohl er direkt unter der Burg von Pembroke stand. Die Stille wurde nur vom Flattern der Tauben auf den Felsvorsprüngen unterbrochen, die er aufgestört hatte. Als es wieder still wurde, hörte er den Fluss.
In völliger Dunkelheit machte er ein paar Schritte und stieß mit dem Schienbein gegen den Kiel eines Ruderbootes, das wahrscheinlich jemand in die Höhle gezogen hatte, um es zu reparieren. Diese Höhle war auf Pembroke kein Geheimnis. Das Geheimnis war die versteckte Tür, die direkt ins Herz der Burg führte. Fluchend rieb Henry sich das Bein und merkte, dass er immer noch den Schlüssel in der Hand hatte. Er hängte ihn an den Bug des Bootes, wo man ihn finden würde, und tastete sich weiter. Der Boden der Höhle war glatt wie ein Flussbett.
Das letzte Hindernis war ein eisernes Tor, das man vor die Öffnung der Höhle in den Fels gesetzt hatte. Henry tastete nach einem weiteren Schlüssel und drehte ihn im Schloss, bis es klickte. Er trat nach draußen in die Dunkelheit, und mit dem Rücken zum Fluss schloss er das Tor wieder ab. Den Schlüssel warf er zurück in die Höhle. Für William Herbert mit seinem Spott und seiner Grausamkeit tat er dies nicht. Er tat es für Pembroke – und vielleicht auch für Mary Corrigan. Er wollte nicht, dass Fremde Pembrokes Geheimnis entdeckten.
Für ihn gab es kein Zurück. Henry merkte, wie er keuchte, und er bemühte sich, langsam und tief zu atmen, um sein wild klopfendes Herz zu beruhigen.
Er wandte sich dem Fluss zu und stellte fest, dass er schon seit einiger Zeit undeutlich Ruderschläge gehört hatte. Obwohl der Fluss genauso dunkel war wie die Höhle, die er verlassen hatte, glaubte er, etwas noch Dunkleres zu erkennen, etwa zwanzig Fuß lang. Er stieß einen Pfiff aus und hoffte, dass er sich nicht getäuscht hatte.
Ruderblätter tauchten klatschend ins Wasser, was in der Stille sehr laut klang. Das Boot glitt über den Fluss, und Henry Tudor starrte es ängstlich an. Schmuggler, Fischer, Wilderer und Sklavenhändler – es gab jede Menge von Leuten, für die es sich lohnte, nachts in ein Boot zu steigen. Und keiner von ihnen hätte es gerne, von einem Jungen entdeckt zu werden.
»Gut gemacht, Junge«, kam eine Stimme aus der Dunkelheit. »Deine Lehrer haben dir bestimmt auch gesagt, dass du ein kluger Bursche bist!«
»Onkel?«, flüsterte Henry. Er hörte, wie der Mann leise lachte, und fing an, die Böschung hinunterzuklettern, bis er fast ins Boot fiel. Eine dunkle Gestalt packte ihn an den Armen, dann wurde er so fest gedrückt, dass ihm fast die Luft wegblieb. Henry spürte den Stoppelbart des Mannes an seiner Wange, seine Kleider rochen nach Schweiß, nach Kräutern und Pferden. Er hatte keine Laterne angezündet, denn über ihnen erhoben sich die Mauern von Pembroke. Doch nach der Finsternis in der Höhle reichten Mond und Sterne, und Henry sah gut genug, als er zur Ruderbank geführt wurde und sich hinsetzte.
»Gut gemacht«, wiederholte Jasper Tudor. »Ich wünschte, mein Bruder lebte noch und könnte das sehen. Die Hälfte der Wachen sucht mich in der Stadt, die andere Hälfte läuft mit Feuer und Brand hinter einem meiner Männer her, und ich bin hier. Und du hast dich an die Höhle unter der Burg erinnert. Dein Vater wäre stolz auf dich.«
»Der würde mich ja gar nicht kennen, Onkel«, sagte Henry und runzelte die Stirn. »Er starb, ehe ich geboren wurde.« Er merkte, wie er vor der Wärme des Mannes in sich zurückwich, vor seinem Ton und seiner Umarmung, ganz bewusst zog er sich zurück, und diese vertraute Kälte war ihm wie ein Trost. Er rückte ein kleines Stück von ihm ab und brachte das Boot zum Schwanken. »Haltet Euch meinetwegen nicht länger auf, Onkel. Es gibt doch sicher ein weiteres Schiff, ein größeres. Ich habe gehört, was Ihr zu William Herbert gesagt habt. Fahren wir nach London?«
Henry sah nicht, wie sein Onkel Jasper ihn seltsam ernüchtert anstarrte. Sie waren sich vollkommen fremd, das wurde beiden im selben Moment klar. Henry hatte nie einen Vater oder eine Mutter gekannt. Es herrschte eine angespannte Stille, und er dachte, es sei nicht weiter verwunderlich, wenn sein Onkel verwandtschaftliche Gefühle für den einzigen Sohn seines Bruders hatte. Doch er selbst spürte keinen Drang, diese zu erwidern, seine Gefühle waren kühl wie das Wasser im Fluss. Und gerade dadurch fühlte er sich stark.
Jasper räusperte sich und brach sein Schweigen.
»Nach London, ja. Richtig, mein Junge! Mein Schiff liegt in Tenby. Diese kleine Barke ist nicht geeignet fürs offene Meer. Aber eine Meile flussabwärts warten Pferde auf uns. Kannst du reiten, Junge?«
»Selbstverständlich«, sagte Henry. Er war wie ein Ritter erzogen worden, oder zumindest wie einer von William Herberts Knappen. Zwar hatte seine Ausbildung mehr aus Ohrfeigen und Spott bestanden als echter Unterweisung, aber ihn haute so schnell nichts aus dem Sattel. Und er konnte mit dem Schwert umgehen.
»Gut. Wenn wir außer Sichtweite der Burg sind, sitzen wir auf und reiten an die Küste. Und dann nach London, mein Junge! Zu deinem Namensvetter, König Henry. Der Lancaster, der wieder eingesetzt werden wird. Bei Gott, ich kann es immer noch nicht fassen. Wir sind frei, während sie dort in den Wäldern immer noch nach uns suchen.«
Das Boot trieb mit der Strömung, die Ruder verursachten kaum ein Geräusch. Eine lange Zeit hörten sie nichts als das Plätschern des Wassers und ihr eigenes Atmen. Jasper schüttelte den Kopf über das beharrliche Schweigen des Jungen. Er hatte eine schwatzhafte Dohle erwartet. Stattdessen hatte er eine kleine Eule gerettet, aufmerksam, aber stumm.
2
Warwick presste voller Sorge die Lippen zusammen. König Henry stand vor der Londoner Menschenmenge und blickte von den Zinnen des Tower über die Stadt hinweg. Hier oben blies ein eiskalter Wind, und Warwick war unwillkürlich zusammengezuckt, als er sah, wie hinfällig der König geworden war. Henry von Lancaster war ein gebrochener Mann, eine leere Hülle. Zwar hatte man den König am Morgen in kostbar bestickte Stoffe und einen warmen Mantel gehüllt, doch darunter war der arme Kerl nur noch Haut und Knochen. Sein dicker Mantel schien ihm zu schwer, denn er stand noch gebeugter da als sonst. Er fröstelte, und seine Hände zitterten, als habe er Schüttelfrost oder eine Lähmung. Als der Ärmel an seinem Ellbogen hochrutschte, sah man keine Muskeln mehr, sondern nichts als Haut und Knochen.
Derry Brewer stand neben Warwick und dem König und sah hinab auf die wogende Menge. Auch der Meisterspion war nicht mehr der Mann, der er einst gewesen war. Er ging am Stock und betrachtete die Welt nur noch mit einem Auge. Die Narben an der Stelle des zweiten Auges waren unter einer weichen Lederbinde verborgen. Diese wiederum hatte dort, wo sie am Kopf anlag, die Haare abgerieben, sodass sie an der nackten Haut scheuerte. Warwick überlief es kalt, als er die beiden betrachtete, was Brewer nicht entging. Er wandte den Kopf und spürte den Abscheu des Jüngeren.
»Wir sind ein schöner Anblick, Junge, was?«, sagte er leise. »Ich mit meinem Auge, dem Bein, das nicht mehr mitmacht und den vielen Narben, die so stark ziehen, dass es sich anfühlt, als sei ich in Stoff gewickelt. Aber ich beklage mich nicht, schon gemerkt? O nein, ich bin ein Fels, wie Petrus. Vielleicht sollte ich meinen Namen ändern, um die Menschen daran zu erinnern. Hier steht Petrus Brewer, und auf diesem Fels will ich mein Königreich neu errichten.«
Der Meisterspion ließ ein leises, spöttisches Lachen hören.
»Und hier ist König Harry Sextus, unberührt wie ein neugeborenes Lamm. Doch nein! Ich erinnere mich an eine Verletzung. Die erhielt er auf dem Hügel von St. Albans, wisst Ihr es noch, Mylord?«
Warwick war klar, dass Brewer ihn ärgern wollte.
»Ihr erinnert Euch?«, sagte Derry, und seine Stimme wurde härter. »Das solltet Ihr auch, da es Euer Befehl war, und es waren Eure Bogenschützen, die schossen. Damals wart Ihr der Feind, Richard Neville, Earl von Scheiß-Warwick. Ich erinnere mich auch.« Er schüttelte wütend den Kopf, als er an dieses Jahr dachte. Und trotzdem war es ein besseres Jahr als dieses, das jetzt vor ihm lag, wo jeder Tag mit Schmerzen anfing.
»Außer diesem Kratzer hat König Henry, soweit ich weiß, in den vielen Jahren keine weitere Wunde davongetragen. Ist das nicht merkwürdig? Ein König, der nur einmal verwundet wird. Und dies von Eurem Pfeil, und der hat ihn zerbrochen, das sage ich Euch. Überall hatte er Sprünge, wie ein alter Krug. Und als er aus seiner Ohnmacht erwachte, war er so angegriffen und schwach, dass er sich in seiner Rüstung kaum aufrecht halten konnte. Da wirkte Euer Pfeil, als hätte man den Krug auf einen Steinboden fallen lassen.« Mit Unbehagen sah Warwick, wie der Meisterspion mit der Hand über sein fehlendes Auge fuhr, er wusste nicht, ob es ihn juckte oder ob er eine Träne abwischte. Jetzt deutete Brewer auf die Menge.
»Ach ja, diese jubelnden Menschen! Was für einen verdammten Lärm sie machen. Und der gilt diesem gebrochenen Mann hier. Ich sage Euch, Richard, lieber habe ich diese vielen Narben und nur ein gutes Auge, als dass ich meinen Verstand verlieren möchte. Was meint Ihr?«
Warwick antwortete mit einem Nicken und betrachtete den Mann argwöhnisch.
»Vielleicht würdet Ihr und König Henry zusammen einen ganzen Mann abgeben«, sagte er. »Euer Verstand und seine Person.«
Derry Brewer sah ihn an.
»Wie meint Ihr das? Wollt Ihr damit sagen, ich sei kein ganzer Mann?«
»Nein, so habe ich es nicht gemeint, Master Brewer.«
»Ach ja? Ich wäre bereit, es Euch sofort zu beweisen, wenn Ihr glaubt, Ihr seid mehr Manns als ich. Ich würde dich fertigmachen, Junge. Ich kenne da noch immer ein paar Tricks.«
»Natürlich«, sagte Warwick. »Ich wollte Euch nicht beleidigen.« Er merkte, wie sein Gesicht rot anlief, und natürlich entging es auch Derry nicht.
»Keine Angst, Mylord, ich würde Euch nichts antun. Nicht jetzt, wo Ihr auf der richtigen Seite steht.«
Warwick runzelte die Stirn, dann sah er das ironische Lächeln des Meisterspions. Warwick schüttelte den Kopf.
»Seht Euch vor, Master Brewer. Hier geht es um eine ernste Angelegenheit.«
Der König hatte sich während des ganzen Gesprächs nicht bewegt. Henry stand da wie sein eigenes Abbild aus Wachs, wie man es bei Krankheiten zu heiligen Stätten brachte, oder wie das Abbild Caesars, das Mark Anton der Menge in Rom gezeigt hatte. Als Warwick die Hand des Königs ergriff, war er fast überrascht, dass sie sich warm und weich anfühlte. Er zuckte zusammen, als er die geschwollenen Knöchel fühlte und die Venen, die wie Schnüre unter der Haut hin und her rutschten. Henry sah ihn an, als er die Berührung spürte, aber er schien niemanden zu erkennen. Seine Augen waren leer, bis auf einen Anflug von Traurigkeit.
Langsam hob Warwick seinen Arm, zusammen mit dem des Königs, eine Geste für die Schaulustigen unten. Die Menge brüllte und trampelte mit den Füßen, aber Warwick hörte, wie Henry aufstöhnte und versuchte, seinen Arm zu befreien, aber er war zu schwach, um sich Warwicks Griff zu entziehen. Es war erbärmlich, aber Warwick konnte nichts tun, als ihn weiter festzuhalten, er drehte den König hin und her, während er seinen Arm hochhielt.
»Ihr tut mir weh«, murmelte Henry und ließ den Kopf hängen. Warwick senkte seinen Arm, als er merkte, wie der Mann zu schwanken anfing. Wachen des Tower schoben sich an Derry Brewer vorbei und stützten den König. Warwick blickte auf Henrys Hand, die er losgelassen hatte. Seine Fingernägel waren schwarz vor Schmutz, und er schüttelte den Kopf.
»Besorgt Handschuhe für Seine Majestät!«, rief er den Wachen nach. Im Palast von Westminster gab es genügend Diener, die sich um den König kümmern würden, die ihn baden und ordentlich zurechtmachen würden. Vielleicht konnten die königlichen Leibärzte dem Mann sogar wieder etwas Leben einhauchen.
Derry Brewers Stimme unterbrach seine Gedanken.
»Der arme alte Kerl. Wenn ich ihn so ansehe, frage ich mich, ob ihm überhaupt bewusst ist, dass Ihr ihn befreit habt. Und ob er das geeignete … Faustpfand für Euren Aufstand ist, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
»Ich verstehe sehr gut. Aber es geht nicht um richtig oder falsch, Master Brewer. Er ist der König.«
Zu seinem Missfallen lachte Brewer laut auf.
»Die Wachen sind fort, Mylord. Und die da unten hören nicht, was hier oben gesprochen wird. Vielleicht glauben sie, dass das Blut eines Königs ein dunkleres Rot hat als das ihre, ich weiß es nicht. Aber Ihr …« Derry schüttelte den Kopf und lächelte ungläubig. »Ihr habt gesehen, wie Edward von York sich zum König machte. Man sagt, es sei Euer Vorschlag gewesen, dass er es tat. Und trotzdem verleugnet Ihr ihn jetzt. Vielleicht seid Ihr ja Petrus, Mylord, der seinen Herrn immer wieder verleugnet, ehe der Hahn kräht.«
»Henry von Lancaster ist König von England, Master Brewer«, sagte Warwick leise. Zum ersten Mal während dieses Gesprächs sah Derry, dass die Hand des anderen auf dem Griff seines Dolches am Gürtel ruhte. Er fühlte sich durchaus nicht bedroht von dem Earl, dennoch war Aufmerksamkeit geboten. Also verlagerte Derry sein Gewicht und umfasste seinen Stock fester. Er war mit Bleikugeln beschwert. Derry hatte in den Jahren seit Towton schon einige Männer damit überrascht.
»Ihr könnt ihn nennen, wie Ihr wollt«, erwiderte Derry. »Es hat nichts zu bedeuten. Seht Ihr die Menge dort unten? Wie sie alle hochstarren und hoffen, noch einen Blick auf ihn zu werfen? Wollt Ihr meinen Rat?«
»Nein«, sagte Warwick. Derry nickte.
»Schön für dich, Junge. Aber mein Rat ist trotzdem, dass Ihr dafür sorgt, dass der König sich an möglichst vielen verschiedenen Orten zeigt. Damit die Menschen sehen, dass Henry lebt und ein freier Mann ist. Und dann mischt etwas in sein Essen, das ihn aus dieser Welt schafft, damit er einschläft und nicht mehr aufwacht. Ganz ohne Schmerzen und ohne Blut. Lasst ihn sanft entschlafen. Sein Sohn wird einen guten König abgeben. Bei Gott, dieser Junge ist ein echter Enkel des Siegers von Azincourt. Auf den werden wir noch stolz sein.«
Warwick kniff die Augen zusammen und legte den Kopf auf die Seite, als könne er kaum glauben, was er da hörte.
»Ihr denkt, das ist meine Absicht?«, sagte er. »Traut Ihr mir das wirklich zu? Dass ich meinen König ermorde? Für einen Jungen, den ich kaum kenne?« Zu Derrys Überraschung lachte Warwick laut auf, es klang grell hier oben, wo ein starker Wind wehte. »Edward von York hat mal etwas ganz Ähnliches gesagt, als wir Henry in seiner Zelle besuchten. Er sagte, er wünsche ihm vierzig Jahre bei guter Gesundheit, sodass es auf der anderen Seite des Meeres keinen neuen jungen König geben könne. Er hatte verstanden, Master Brewer. Genau wie ich jetzt verstehe. Ihr braucht mich nicht auszuhorchen mit Euren Verdächtigungen. König Edward hat sich von mir abgewandt. Was ihn betrifft, so habe ich alle Brücken hinter mir abgebrochen. Es gibt kein Zurück. Das schwöre ich bei der heiligen Muttergottes, bei meiner Ehre und beim Leben meiner Töchter. Ich habe eine Armee zusammengerufen, um ihn zu schlagen, und sie wird über ihm zusammenschlagen wie eine Flutwelle. Cäsaren fallen, Master Brewer. Das habe ich im Laufe meines Lebens gelernt.«
Derry hatte seinen einäugigen Blick nicht von Warwick gewandt, während dieser sprach. Er wartete auf das erste Anzeichen einer Lüge oder einer Schwäche. Jetzt löste sich die schmerzhafte Anspannung in seinen Schultern. Langsam streckte er die Hand aus, um den Earl nicht zu erschrecken, und tätschelte seinen Arm.
»Bist ein guter Junge«, sagte er. »Du weißt, dass du viel Schaden angerichtet hast. Mit deinem Vater und mit York. Nein, lass mich ausreden. So ziemlich das Einzige, was du jemals gut gemacht hast, war der Kampf gegen Jack Cade und seine Rebellen. Weißt du noch? Davon wache ich immer noch so manche Nacht schweißgebadet auf, das kann ich dir sagen. Jetzt hast du die Möglichkeit, etwas zu tun, was nur den wenigsten Menschen in ihrem Leben vergönnt ist – nämlich einen Teil des Unrechts, das du verursacht hast, wieder gutzumachen. Ich hoffe, du ergreifst die Gelegenheit mit beiden Händen. Denn sie wird sich dir weiß Gott nicht noch einmal bieten.«
Warwick starrte ihn an, aber Derry Brewer drehte sich um und humpelte hinter dem König her, dem er gefolgt war und den er sein Leben lang beschützt hatte. In diesem Augenblick verstand Warwick, dass Brewer vielleicht die einzige Vaterfigur war, die Henry in seinem Leben je gehabt hatte.
Warwick blickte über den Mauerrand und dachte darüber nach, was auf dem Spiel stand. Tausende von Männern und Frauen drängten sich in den Straßen rund um den Tower von London, und es kamen immer noch mehr Menschen von weiter außerhalb dazu, sobald sie die Neuigkeit vernommen hatten. König Henry war frei. Lancaster war wieder auf dem Thron. Anfangs hatte es noch ein paar Handgreiflichkeiten gegeben, aber die wenigen, die es wagten, ärgerlich nach York zu fragen, waren bald zum Schweigen gebracht worden und lagen jetzt in ihrem Blut oder hatten die Flucht ergriffen. Die Londoner waren nicht zimperlich, mit ihnen legte man sich besser nicht an. Das wusste Warwick nur zu gut. Und er brauchte sie alle, die Hafenarbeiter und die Fischer, die Bäcker und die Schmiede, die Wilderer, die Edelleute und die Bogenschützen. Er brauchte auch die Bewaffneten, die Söldner, die der König von Frankreich ihm mitgegeben hatte, auch wenn das bei den Engländern Unmut auslöste. Und trotz der Kisten voll Silber, mit denen man sich ihre Loyalität erkaufte. Er brauchte sie alle und durfte jetzt nicht zögerlich sein. Sonst könnte es sein, dass ihn im Norden eine böse Überraschung erwartete.
Der Süden war schon immer Warwicks heimatliches Gefilde gewesen. Vor allem Kent und Sussex, aber auch Essex und Middlesex, die Königreiche der Vorzeit, wo man immer noch flüsternd von Edward von York als dem Usurpator und Hochverräter sprach. Männer aus Cornwall und Devon waren zu ihm gestoßen, als die Nachricht sich verbreitete. Ganze Dörfer waren gemeinsam aufgebrochen, um den rechtmäßigen König wieder einzusetzen. Warwick hatte London unterdessen zu einer waffenstarrenden Festung gemacht, was den Menschen Zeit ließ, zu Fuß oder zu Pferd zu ihm zu kommen. Sie wussten, er würde jeden von ihnen brauchen, um König Edward auf dem Schlachtfeld zu besiegen.
Allein der Gedanke, Edward gegenüberzustehen, versetzte ihn in Panik. Es weckte Erinnerungen an Towton – ein Goliath in silberner Rüstung, schnell und unaufhaltbar. Und trotzdem so verletzlich und von den Launen seiner Schutzengel abhängig, dass ein gut gezielter Stein oder eine Ranke, die sich um seinen Fuß schlang, ihn zu Fall bringen konnte. Warwick war in Towton dabei gewesen. Er hatte gesehen, wie schnell das Schicksal auch den besten Kämpfer ereilen konnte und dass dies mit Gerechtigkeit für gewöhnlich nicht viel zu tun hatte.
Er blickte zum Horizont und sah im Geiste England vor sich: die Weite des Südens, und wie das Land nach Norden immer schmaler zulief. Und er stellte sich den Süden vor wie den Kopf eines geschmiedeten Nagels, auf den er einhämmern würde mit dem Hammer aus Frankreich, um das feindliche Heer zu zerschmettern und mit ihm den jugendlich arroganten Edward von York. Es spielte keine Rolle, was vorher gewesen war, egal wie Derry Brewer das sah. Nichts konnte ungeschehen gemacht werden, auch wenn Könige und Bischöfe noch so sehr darum beteten. Warwick klopfte leicht mit der gepanzerten Hand auf die alten Steine des Towers. Wenn es ums Überleben ginge und Edward von York ihm ausgeliefert wäre, er würde nicht zögern. Das hatte Brewer ganz richtig erkannt. Warwick hatte schon einmal Könige festgenommen. Für ihn waren sie ganz gewöhnliche Menschen. Wenn ein Earl jemanden zum König machen konnte, dann musste er diesen König nicht auch noch lieben.
Bei dem Gedanken trat ein Lächeln um Warwicks Lipppen. Er wandte sich ab von der wogenden Menge dort unten. Beim Anblick dieses Meeres von Gesichtern, bei diesem Gemurmel und Geschrei, musste man unwillkürlich an einen Stall voller Hühner oder das Summen in einem Bienenstock denken. Aber dies hier waren Männer und Frauen, die einst einen Garten hatten pflegen sollen und so dumm gewesen waren, die einzige Frucht zu stehlen, die ihnen verboten worden war.
Warwick folgte den Wachen nach unten, wo die Kutschen warteten. Sein Lächeln wurde bitter. Vielleicht gäbe es gar keine Könige, wenn es keine Menschen gäbe, die ihnen folgten. Die Menschen erträumten sich solche Dinge und vergaßen dann, dass sie nur träumten. Sie setzten Füchse in den Hühnerstall und lachten, wenn es ein Blutbad gab.
Sowie seine Diener ihn im Schatten des Torhauses erblickten, traten sie hervor und drängten die Menge zurück, um dem Earl den Weg zu seinem Pferd frei zu machen. Ein Dutzend gepanzerter Ritter waren bereits auf ihre Pferde gestiegen, bereit, beim geringsten Anzeichen von Gefahr einzugreifen. Drohend blickten sie jeden an, der ihnen zu nahe kam. König Edward war beliebt. Das wusste Warwick sehr genau. Trotz all seiner Ausschweifungen und Grausamkeiten konnte dieser Riese, der erst achtundzwanzig Jahre alt war, mit einer gebieterischen Handbewegung die Menge auf seine Seite bringen oder in die Schlacht führen. Bestimmt waren nicht wenige darunter, die jederzeit ihr Leben für einen solchen Herrn hingegeben hätten. Warwicks Gefolgschaft dagegen war unsicher und nervös und hielt jede betrunkene Pöbelei für eine Bedrohung.
Auf einem schwarzen Wallach wartete ein schlanker junger Mann, den das vergangene Jahr auf eine harte Probe gestellt hatte. George, der Duke von Clarence, saß da, über den Sattelwulst gebeugt, die Arme aufgestützt, und starrte über die Köpfe der Menschen hinweg in die Ferne. London war ein Gewirr aus Wohnhäusern, Zünften, Wirtshäusern, Werkstätten, kleineren und größeren Läden, die sich alle am Ufer eines Flusses drängten, der Waren in Länder trug, die die meisten von ihnen niemals erblicken würden. Hier wurden kristallene Linsen geschliffen, Uhren hergestellt, Glas geblasen, Steine behauen, Fleisch zerteilt und verarbeitet. Es war ein geschäftiger Ort, der nie zur Ruhe kam.
George von Clarence schien nicht besonders erfreut über das, was er sah, doch Warwick wusste nicht, ob die Menschenmenge oder ein privater Ärger der Grund dafür war. Er zwang sich zu einem Lächeln, als sein Schwiegersohn sich aufrichtete und zu ihm herübersah.
»Von oben hat es geklungen wie eine Horde Löwen oder Bären«, sagte Warwick. »Hier unten klingt es eher wie schnatternde Gänse.«
Der Gatte seiner Tochter wollte gerade die Schultern zucken, doch dann erinnerte er sich an seine guten Manieren.
»Diese Londoner sind immer so laut, Mylord. Sie sind laut und grob. Und besonders sauber sind sie auch nicht. Mir ist mindestens ein Dutzend Mal Essen angeboten worden, gegen Bezahlung. Es gibt so viele Bettler und Straßenkinder und …« Er machte eine Handbewegung, es fehlten ihm die Worte.
»Seid dankbar, dass sie mit uns jubeln«, sagte Warwick. Auch ihm gefiel das Gedränge nicht – wie eine Flut, die einen unerbittlich fortreißen konnte.
»Ich habe sie auch schon erlebt, als sie von Hass und Wut erfüllt waren, George, wie damals, als Lord Scales griechisches Feuer über ihnen ausgegossen hat, keine zwölf Yards von hier, wo wir jetzt stehen.« Warwick erschauerte bei der Erinnerung an die brennenden Menschen, deren Schreie man hörte, bis ihre Lungen nur noch Feuer einatmeten. Lord Scales hatte jene Nacht nicht überlebt. Seine Wachen waren zur Seite getreten und hatten den Pöbel in seine Zelle gelassen.
»Habt Ihr mit dem König gesprochen, Sir?«, fragte George vorsichtig. Henry von Lancaster »König« zu nennen fiel ihm noch schwer. Warwick wandte sich von der feiernden Menge ab und schlug seinem Schwiegersohn auf die Schulter.
»Das habe ich«, log er fröhlich. »Seine Gefangenschaft hat ihn natürlich sehr geschwächt, aber ich habe ihm erzählt, wie Ihr mir gedient habt, und er stimmte mir zu. Wenn es erst ein neues Lancaster-Siegel gibt, um es unter die Urkunden zu setzen, werdet Ihr der zweite in der Thronfolge sein, nach seinem Sohn, Edward von Lancaster.«
George von Clarence war zwanzig Jahre alt und hatte erst wenige Monate zuvor auf See den Tod seines ersten Kindes miterleben müssen. Er gab seinem Bruder, König Edward, die Schuld an diesem Tod, und sein Zorn hatte derart Besitz von ihm ergriffen, dass es manchmal schien, als sei in ihm kein Platz mehr für irgendetwas anderes. Bei Warwicks Nachricht beugte er den Kopf.
»Ich danke Euch, Sir. Ihr habt Euch an unsere Absprache gehalten.«
»Natürlich«, erwiderte Warwick. »Ihr seid mein Schwiegersohn! Ich brauche Euch noch, George. Nicht zuletzt wegen der Leute, die Ihr ins Feld schicken könnt. Ihr seid der Duke von Clarence. Euer Bruder … nun ja, auch wenn er nicht mehr der König ist, dann ist er doch immer noch der Duke von York. Diese Bedrohung unterschätze ich nicht. Jeder Tag, den wir hier verlieren, ist einer mehr für Edward, um eine Armee zu versammeln. Und ich würde lieber mit der Hälfte der Männer losreiten und ihn überraschen, als noch mal ein Towton zu erleben. Davor bewahre uns Gott.«
Warwick sah, wie das Gesicht seines Schwiegersohnes nachdenklich wurde, als der junge Mann sich das Zusammentreffen mit seinem Bruder vorstellte. Er sah einen tiefen Schmerz und eine Wut, die sich allein auf den Mann richteten, der ihn einen Verräter genannt und zur Flucht gezwungen hatte. Warwicks Tochter Isabel hatte auf See im Sprühnebel entbinden müssen und ihre neugeborene Tochter bei der Kälte verloren. Warwick konnte bei Clarence kein Zeichen von Vergebung entdecken, und er war heilfroh darüber.
»Hab Geduld«, sagte er leise.
George sah ihn an und schien zu verstehen. Dass sie jetzt den rechtmäßigen König von Lancaster aus der Gefangenschaft befreiten, war lediglich ein Mummenschanz für die Menschenmenge – ein Feuer, das man hier in der Stadt entfachte und an dem der Pöbel seine Fackeln entzünden konnte. Und wo dies nun getan war, konnten sie nach Norden ziehen und Edward festsetzen, der am falschen Ort weilte und vom Glück verlassen war.
Königin Elizabeth von York keuchte. Sie spitzte die Lippen und atmete schwer, fast pfeifend, als sie den Weg neben der Abtei von Westminster entlangeilte. Ihre Töchter rannten neben ihr her, die drei Mädchen hatten ängstliche Gesichter und waren den Tränen nahe, genau wie ihre Mutter.
Die Schwangerschaft der Königin war so weit fortgeschritten, dass sie sich mit einer Hand stützen musste. Sie, die Gemahlin von König Edward, schwankte und torkelte wie ein betrunkener Matrose auf Landgang. Die Luft war kalt und schnitt in der Kehle, aber sie hatte immer noch genug Atem, um ab und zu ihren Mann zu verfluchen. Das Kind, das sie erwartete, war ihr sechstes. Sie wusste, wie dicht sie vor der Entbindung stand, und atmete schwer, trotzdem schleppte sie sich weiter. Sie war sich sicher, dass es diesmal ein Junge sein würde. Bei ihren Töchtern hatte sie unkomplizierte Schwangerschaften gehabt, bei den Jungen hatte sie sich dagegen jeden Morgen erbrechen müssen. Es war eine wahre Plage, aber immerhin durfte sie damit auf einen Prinzen und Thronfolger hoffen.
Ihre Mutter, Jacquetta, blickte sich jedes Mal um, wenn sie hörte, dass Elizabeth ein schlimmes Wort gebrauchte. Dann runzelte sie die Stirn und schnalzte missbilligend mit der Zunge. Fünfundfünfzig Jahre alt, blass und mit dünnem Haar, hatte sie zwei Ehemänner überlebt und vierzehn Kinder geboren, doch hatte sie weder ihren Akzent noch die guten Manieren ihrer Kindheit im Herzogtum Luxemburg verloren. Elizabeth rollte entnervt mit den Augen und biss sich auf die Zunge.
»Wir haben es fast geschafft, mein Täubchen«, sagte ihre Mutter. »Nur noch hundert Yards, mehr nicht. Dann sind wir in Sicherheit, bis dein Mann uns holen kommt.«