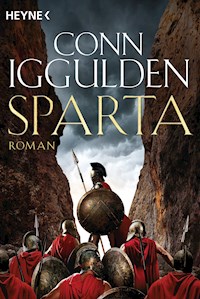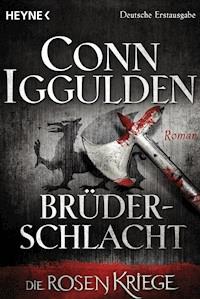9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rosenkriege-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Rosenkriege gehen weiter ...
London 1454: Das englische Reich ist gespalten. Der machthungrige Richard von York regiert als Statthalter, König Henry VI. ist krank und nicht mehr fähig, das Land zu regieren. Seine Gemahlin Margaret von Anjou steht ihm tapfer zur Seite, und die königstreuen Lords schwören ihrem Herrn Beistand. Doch die Schar der Feinde nimmt weiter zu. Richard von York geht mit den Earls von Salisbury und Warwick ein Bündnis ein, um die Krone endgültig zu erlangen. Doch dann gesundet Henry überraschend und will seine Regentschaft wieder aufnehmen. Die beiden Herrscherhäuser Lancaster und York stehen nun im offenen Kampf gegeneinander, und die Rosenkriege nehmen ihren blutigen Lauf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
DAS BUCH
England, 1454: Der kranke König Henry VI. befindet sich isoliert auf Windsor und ist nicht mehr fähig, sein Land zu regieren. Königin Margaret von Anjou steht ihm trotz aller Widernisse zur Seite, in der Hoffnung, dass ihr Sohn Edward eines Tages die Thronfolge antreten wird. Durch politisches Geschick und ihre überragende Persönlichkeit gelingt es Margaret, alle königstreuen Lords um sich zu sammeln.
Doch Richard Duke von York, der als Statthalter Englands gegen den König opponiert, weitet seinen Einfluss aus: Wer sich gegen ihn stellt, verschwindet hinter Gefängnismauern oder verliert sein Leben. Als Henry entgegen aller Erwartungen wieder in den Besitz seiner Kräfte gelangt, erkennt er sein Reich nicht mehr wieder. Er beendet die Regentschaft Richards und nimmt die Krone wieder in Anspruch – mit dramatischen Folgen. Unruhen erschüttern London und den Norden Englands; die Lords der Herrscherlinien Lancaster und York bekriegen sich immer heftiger: Es kommt zum offenen Kampf. Die Rosenkriege gehen weiter …
DER AUTOR
Conn Iggulden, geboren 1971, ist einer der erfolgreichsten Autoren historischer Stoffe. Iggulden lehrte Englisch an der University of London, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Das Bündnis ist der zweite Band seiner Serie um die Rosenkriege. Iggulden lebt mit seiner Familie in Hertfordshire, England.
Mehr Informationen über den Autor und die Serie finden Sie unter www.conniggulden.com
LIEFERBARE TITEL
Die Rosenkriege – Sturmvogel
CONN IGGULDEN
DASBÜNDNIS
DIE ROSENKRIEGE 2
ROMAN
Aus dem Englischenvon Christine Naegele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Victoria Hobbs,die gegen Windmühlen kämpft –und sie umwirft
PROLOG
Vicomte Michel Gascault war gewiss kein Spion. Er hätte es empört von sich gewiesen, wenn man ihn so genannt hätte. Natürlich stand es außer Frage, dass der französische Gesandte am englischen Hof bei seiner Rückkehr alles melden würde, was seinen Monarchen interessieren könnte. Ebenso stand es außer Frage, dass Vicomte Gascault viel Erfahrung mit den Königshäusern Europas hatte und sich mit Schlachten auskannte. Er wusste, was König Charles von Frankreich wissen wollte, und deshalb beobachtete Vicomte Gascault alles, was um ihn herum geschah, äußerst sorgfältig, auch wenn das nicht sehr viel war. Spione waren von geringer Herkunft, verkommene Gestalten, die sich in Torbögen herumdrückten und sich Losungsworte zuflüsterten. Vicomte Gascault, de l’autre côté – oder »andererseits«, wie man hierzulande sagte –, war ein französischer Höfling, der so hoch über diesen Dingen stand wie die Sonne über der Erde.
Solcher Art waren die Gedanken, mit denen er sich in seinen Mußestunden beschäftigte. Ganz gewiss würde er König Charles berichten, dass man ihn drei Tage lang ignoriert hatte, während derer er in einem prunkvollen Zimmer im Palast von Westminster Däumchen gedreht hatte. Die Diener, die man ihm schickte, waren nicht einmal sauber gewaschen, hatte er bemerkt, obwohl sie immer sehr prompt kamen. Einer von ihnen roch sogar nach Pferden und Urin, als seien die königlichen Ställe sein eigentlicher Arbeitsplatz.
Nein, das konnte man nicht abstreiten, für Gascaults körperliche Bedürfnisse war gut gesorgt, was man allerdings von seinen offiziellen Anliegen als Botschafter nicht sagen konnte. Jeder Tag begann damit, dass seine Diener ihn in seine schönsten Gewänder kleideten, ihm seine prächtigsten Mäntel anlegten, die sie aus den riesigen Truhen holten, die er, vollgepackt mit Kleidungsstücken, aus Frankreich mitgebracht hatte. Bisher hatte er noch keine Farbkombination wiederholen müssen, und auch wenn er gehört hatte, dass einer der englischen Diener ihn als den »französischen Pfau« bezeichnete, machte ihm das nichts aus. Bunte Kleider hellten seine Stimmung auf, und ansonsten gab es herzlich wenig, womit er sich die Zeit hätte vertreiben können. Er hielt nicht viel von den Speisen, die man ihm hier vorsetzte. Zwar wusste er, dass man einen französischen Koch in Dienst genommen hatte, aber ebenso klar war auch, dass dem Mann der Geschmack seiner Landsleute ziemlich egal war. Gascault schüttelte sich bei dem Gedanken an die faden Speisen, die hier auf den Tisch gekommen waren.
Die Stunden waren vergangen wie bei einer Beerdigung, und er hatte längst jedes Schriftstück gelesen, das man ihm mitgegeben hatte. Beim Schein eines Leuchters hatte er sich schließlich einem graubraunen Buch zugewandt, das ihm gehörte und das durchweg mit seinen Anmerkungen versehen war. De Sacra Coena von Berengarius war eins seiner Lieblingsbücher. Natürlich hatte die Kirche diese Abhandlung über das Letzte Abendmahl verboten. Alle Auseinandersetzungen, die sich mit den Geheimnissen um den Leib und das Blut befassten, erregte unweigerlich die Aufmerksamkeit der päpstlichen Spürhunde.
Gascault hatte es sich längst zur Gewohnheit gemacht, sich Bücher zu verschaffen, die eigentlich für den Scheiterhaufen bestimmt waren, weil sie ihrerseits seine eigenen Gedanken entzündeten. Er strich mit der Hand über das Papier, mit dem das Buch umhüllt war. Die Buchdeckel von De Sacra Coena waren natürlich abgelöst und verbrannt worden, die Asche sorgfältig beseitigt, damit kein neugieriges Auge sehen konnte, worum es sich hier handelte. Die anonyme, fleckige Lederhülle war leider eine Notwendigkeit in dieser Zeit, wo jeder jeden anschwärzte und verriet.
Er unterbrach seine Lektüre erst, als man ihn schließlich rief. Gascault hatte sich schon an die laut tönende Glocke gewöhnt, die alle halbe Stunde schlug, ihn aus dem Schlaf riss und seiner Verdauung mindestens ebenso schwer zusetzte wie die bedauernswerten Tauben, die immer so fad auf seinem Teller lagen. Er hatte die Schläge zwar nicht gezählt, aber er wusste, dass es spät war, als der Pferdeknecht – wie er ihn im Stillen nannte – in seine Gemächer trat.
»Viscount Gascart, man lässt Euch bitten«, sagte der Junge. Gascault ließ sich den Ärger darüber, wie man seinen stolzen Namen verschandelte, nicht anmerken. Es war klar, der Junge war ein Dummkopf, und der liebe Gott verlangte, dass man Mitleid mit diesen armen Geschöpfen hatte, die er unter die Menschheit gemischt hatte, auf dass sie Barmherzigkeit lerne – jedenfalls hatte Gascaults Mutter es ihm immer so erklärt. Vorsichtig legte er sein Buch auf die Armlehne und stand auf. Alphonse, sein Diener, stand nur einen Schritt hinter dem Jungen. Gascaults Augen wanderten zurück zum Buch, er wusste, es wäre ein Zeichen für seinen Diener, es in seiner Abwesenheit vor fremden Augen zu bewahren. Alphonse nickte kurz und verbeugte sich, während der Pferdejunge verwirrt die Pantomime verfolgte.
Vicomte Gascault schnallte sein Schwert um und ließ sich von Alphonse seinen gelben Mantel umlegen. Als er wieder auf den Stuhl blickte, war das Buch schon verschwunden. In der Tat, sein Diener war die Diskretion in Person, und das nicht nur, weil er nicht sprechen konnte. Gascault neigte dankend den Kopf und rauschte an dem Jungen vorbei nach draußen. Er ging durch die Vorräume und trat in den kalten Korridor.
Hier warteten fünf Männer auf ihn. Vier davon waren offenbar Soldaten, sie trugen den königlichen Wappenrock über der Rüstung. Der fünfte trug einen Mantel über Tunika und Hose, alles von genauso guter Qualität wie seine eigenen Kleider.
»Vicomte Michel Gascault?«, sagte der Mann. Gascault bemerkte, dass er den Namen perfekt aussprach, und er lächelte.
»Ich habe die Ehre. Zu Euren Diensten …«
»Richard Neville, Earl von Salisbury und Lordkanzler. Ich muss mich wegen der späten Stunde entschuldigen, aber Ihr werdet in den königlichen Gemächern erwartet, Mylord.«
Gascault passte sich dem Schritt des Mannes an und ignorierte die Soldaten, die hinter ihnen her trampelten. Er hatte in seiner Laufbahn schon seltsamere Dinge erlebt als ein Treffen um Mitternacht.
»Um den König zu sehen?«, fragte er boshaft, indem er den Earl genau beobachtete. Salisbury war kein junger Mann mehr, aber der Franzose fand, dass er drahtig und gesund aussah. Es wäre sicher keine gute Idee, ihn wissen zu lassen, wie viel man am französischen Hof über den Gesundheitszustand von König Henry wusste.
»Es tut mir leid, aber König Henry leidet an einer starken Erkältung, eine vorübergehende Sache. Ich hoffe, Ihr werdet keinen Anstoß daran nehmen, wenn ich Euch heute Abend zum Duke von York bringe.«
»Mylord Salisbury, es tut mir schrecklich leid, das zu hören«, erwiderte Gascault mit Nachdruck. Er sah, dass Salisburys Augen sich einen Moment verengten, und unterdrückte ein Grinsen. Beide wussten, dass es am englischen Königshof Familien gab, die enge Bindungen zu Frankreich hatten, entweder durch Blutsverwandtschaft oder durch Titel. Die vorgebliche Ahnungslosigkeit des französischen Königs, Henrys Gesundheitszustand betreffend, war nichts weiter als ein Spiel zwischen den beiden. Der englische König war seit Monaten kaum bei Bewusstsein, er war so abwesend, dass man ihn nicht in die Wirklichkeit zurückholen konnte. Nicht ohne Grund hatten seine Lords einen aus ihren Reihen als »Protektor des Königreichs« gewählt. Richard, der Duke von York, war der eigentliche König, abgesehen vom Titel, und Vicomte Gascault hatte auch gar kein Interesse daran, einen König zu besuchen, der in Träumen verloren war. Man hatte ihn hierher gesandt, um die Macht des englischen Hofes einzuschätzen und herauszufinden, wie entschlossen man war, Englands Interessen in Frankreich zu verteidigen. Gascaults Augen blitzten vor Vergnügen kurz auf, ehe er seine Gefühle wieder unter Kontrolle bekam. Wenn er berichtete, dass das Land geschwächt und ohne König Henry handlungsunfähig war, genügte Gascaults Wort, um in Frankreich hundert Schiffe flottzumachen und jeden englischen Hafen auszurauben und niederzubrennen. Die Engländer hatten es lange genug mit Frankreich so gemacht, erinnerte er sich, vielleicht war jetzt endlich die Zeit gekommen, den Spieß umzudrehen.
Salisbury führte die kleine Gruppe durch endlose Korridore, dann ging es zwei Treppen hinauf zu den königlichen Gemächern. Selbst zu dieser späten Stunde war der Palast von Westminster noch hell erleuchtet von Lampen, die im Abstand von wenigen Schritten angebracht waren. Trotzdem stellte Gascault fest, dass es feucht und modrig roch, eine unangenehme Begleiterscheinung des nahe gelegenen Flusses. Als sie die letzte, schwer bewachte Tür erreichten, widerstand er der Versuchung, seinen Mantel und den Kragen ein letztes Mal zurechtzuzupfen, aber Alphonse hätte ihn sicher nicht gehen lassen, wenn nicht alles perfekt gewesen wäre.
Die Soldaten wurden entlassen, und die Tür wurde von den inneren Wachen geöffnet. Salisbury streckte die Hand aus, um dem Gast den Vortritt zu lassen.
»Nach Euch, Vicomte«, sagte er. Er hatte scharfe Augen, merkte Gascault, als er sich verbeugte und hineinging. Dem Mann entging nichts, und wieder sagte er sich, dass er vorsichtig sein müsse. Die Engländer waren vieles: bestechlich, unbeherrscht, habgierig, es war eine ganze Latte von Sünden, die man ihnen nachsagte. Doch noch nie, solange die Welt bestand, hatte jemand sie dumm genannt. Wenn Gott sie doch mit Dummheit schlagen könnte! Dann würden ihre Städte und Burgen innerhalb einer Generation König Charles gehören.
Salisbury machte leise die Tür hinter sich zu. Vicomte Gascault stand in einem Zimmer, das kleiner war, als er erwartet hatte. Vielleicht war es nur recht und billig, dass ein »Protektor« sich nicht den Luxus eines Königshofes leistete, jedoch flößte dieser Raum ihm Unbehagen ein. Durch die Fenster sah man die schwarze Nacht, und der Mann, der sich erhob, um ihn zu begrüßen, war ebenfalls in Schwarz gekleidet und im Schatten der trüben Lampen kaum von seiner Umgebung zu unterscheiden.
Mit ausgestreckter Hand forderte Richard, der Duke von York, Gascault auf, näher zu treten. Dem Franzosen sträubten sich die Nackenhaare vor abergläubischer Furcht, aber er ließ sich nichts anmerken. Er blickte sich kurz um, entdeckte aber nichts Verdächtiges außer Salisbury, der ihn beobachtete.
»Vicomte Gascault, ich bin York. Es ist mir ein Vergnügen, Euch willkommen zu heißen, und ich bedaure außerordentlich, dass ich Euch so schnell wieder nach Hause schicken muss.«
»Mylord?«, fragte Gascault verwirrt. Er setzte sich auf den Stuhl, auf den sein Gegenüber gezeigt hatte, und versuchte sich zu konzentrieren, während York sich auf der anderen Seite des breiten Tisches hinsetzte. Der englische Duke hatte ein sauber rasiertes kantiges Kinn und wirkte schlank in seinen schwarzen Kleidern. Gascault starrte ihn noch immer verständnislos an, während York sich eine lose Haarsträhne aus der Stirn strich. Dabei warf er den Kopf zurück, ließ aber Gascault nicht aus den Augen.
»Ich fürchte, ich verstehe nicht, Mylord York. Verzeiht, ich weiß nicht, wie man einen Protektor des Königreichs korrekt anspricht …« Gascault sah sich um, ob irgendwo Wein oder etwas Essbares zu sehen war, aber es war nichts da, vor ihm erstreckte sich nur die helle Platte des Eichentisches.
York sah ihn unverwandt mit gesenkten Augenbrauen an.
»Ich war in Frankreich Lieutnant des Königs, Vicomte Gascault. Ich bin sicher, das man Euch das erzählt hat. Ich habe auf französischem Boden gekämpft, und ich habe Ländereien und Titel an Euren König verloren. Das alles wisst Ihr. Ich erwähne es auch nur, um Euch daran zu erinnern, dass ich Frankreich kenne. Ich kenne Euren König – und, Gascault, ich kenne Euch.«
»Mylord, ich verstehe nicht, warum …«
York fuhr fort, als hätte er gar nicht gesprochen.
»Der König von England schläft, Vicomte Gascault. Wird er jemals wieder aufwachen? Oder wird er in seinem Bett sterben? Landauf, landab zerbricht man sich darüber den Kopf. Und ich zweifle nicht, dass man sich auch in Paris darüber den Kopf zerbricht. Ist das die Chance, auf die Euer König so lange gewartet hat? Auf die er so lange hingearbeitet hat? Verzeiht, aber Ihr seid nicht einmal stark genug, uns Calais abzunehmen – und da träumt Ihr von England?«
Gascault schüttelte den Kopf und wollte gerade den Mund aufmachen, um es abzustreiten. Doch York hob die Hand.
»Ich lade Euch ein, Gascault. Entscheidet, wie Ihr wollt. Versucht Euer Glück, solange König Henry vor sich hindämmert. Ich würde sehr gern wieder auf dem Grund und Boden stehen, der mir einst gehörte. Und ich würde schrecklich gern mit einer Armee auf französischem Gebiet marschieren, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Also, denkt über mein Angebot nach. Der Kanal, er ist kaum mehr als ein breiterer Fluss. Und der König, er ist auch nur ein Mensch. Und ein Soldat, nun ja, wenn es ein englischer Soldat ist, ist er auch immer noch ein Mensch, nicht wahr? Er kann versagen. Er kann fallen. Nur zu, greift uns an, solange unser König schläft, Vicomte Gascault! Erklimmt unsere Mauern, dringt in unsere Häfen ein. Ich heiße Euch willkommen, genau wie die Menschen hier Euch willkommen heißen werden. Es wird ein raues Willkommen sein, das verspreche ich Euch. Wir sind raue Kerle. Aber wir haben Schulden zu begleichen, und in der Beziehung sind wir mit unseren Feinden sehr großzügig. Für jeden Hieb, den Ihr uns versetzt, geben wir drei zurück, ohne Rücksicht auf die Kosten. Versteht Ihr mich, Vicomte Gascault? Sohn von Julien und Clémence? Bruder von André, Arnaud und François? Ehemann von Elodie? Vater zweier Söhne und einer Tochter? Soll ich ihre Namen nennen, Gascault? Oder soll ich noch Euer Haus beschreiben, mit den Kirschpflaumenbäumen am Tor?«
»Genug, Monsieur«, sagte Gascault leise. »Ich verstehe, was Ihr sagen wollt.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte York. »Oder soll ich einen Befehl schicken, schneller als Ihr reiten könnt, schneller als Ihr segeln könnt, damit Ihr mich wirklich versteht, ganz genau so, wie ich es meine, wenn Ihr nach Hause zurückkehrt? Ich bin bereit dazu, Gascault.«
»Bitte nicht, Mylord«, erwiderte Gascault.
»Bitte?«, sagte York. Sein Gesicht war hart und wirkte im Schatten der trüben Lampe noch dunkler. »Nun, das werde ich entscheiden, wenn Ihr abgereist seid. Auf Euch wartet ein Schiff, Gascault – und Männer, die Euch zur Küste bringen werden. Und für die Nachricht, die Ihr Eurem König bringt, wünsche ich Euch das Glück, das Ihr verdient. Gute Nacht, Vicomte Gascault. Geht mit Gott!«
Gascault stand mit zitternden Knien auf und ging zur Tür. Salisbury hielt den Kopf gesenkt, als er sie öffnete, und der Franzose holte vor Angst tief Luft, als er die Soldaten sah, die draußen standen. In der Dunkelheit sahen sie bedrohlich aus, und fast hätte er aufgeschrien, als sie ihn hinausließen, dann kehrt machten und mit ihm davonmarschierten.
Salisbury machte leise wieder die Tür zu.
»Ich glaube, sie werden nicht kommen, zumindest dieses Jahr nicht mehr«, sagte er.
York schnaubte verächtlich.
»Bei Gott, es juckt mich in den Fingern. Wir haben die Schiffe und die Leute. Wenn sie mir nur folgen würden. Aber sie liegen da wie treue Hunde und warten darauf, dass Henry aufwacht.«
Salisbury antwortete nicht. York sah, dass er ihn erwartungsvoll ansah, und lächelte müde.
»Ich glaube aber, es ist noch nicht zu spät. Jetzt lass den Spanier kommen, damit ich ihm die gleiche Rede halte.«
TEIL EINS
1454–1455
Menschen, die vom Gesetz unterdrückt werden,
können ihre Hoffnung nur auf Gewalt setzen.
Wenn das Gesetz ihr Feind ist,
werden sie zu Feinden des Gesetzes.
EDMUND BURKE
1
Der kühle, graue Morgen war kaum angebrochen, als die Burg zum Leben erwachte. Pferde wurden aus den Ställen geholt und gestriegelt, Hunde bellten und balgten sich und erhielten Fußtritte, wenn sie jemandem in den Weg liefen, Hunderte von jungen Männern, beladen mit Zaumzeug und Waffen, eilten im Burghof hin und her.
Henry Percy, der Earl von Northumberland, starrte aus dem Fenster des großen Wohnturmes auf das Treiben rund um seine Festung. Die heißen Augusttage hatten die Steinmauern gewärmt, aber trotzdem hatte der alte Mann sich in einen Pelzumhang gehüllt, den er vor der Brust fest zusammenhielt. Er war noch immer groß und breitschultrig, aber vom Alter gebeugt. Sein sechstes Jahrzehnt hatte ihm Rheuma und steife Gelenke beschert, sodass ihn jede Bewegung schmerzte, was nicht gerade zur Verbesserung seiner Laune beitrug.
Düster gestimmt blickte der Earl durch die Butzenscheiben. In der Stadt begann sich das Leben zu rühren. Die Welt erwachte zusammen mit der aufgehenden Sonne, und nachdem er lange genug abgewartet hatte, war er jetzt bereit zu handeln. Er beobachtete, wie die bewaffneten Ritter sich versammelten, ihre Knappen reichten ihnen ihre Schilde, die schwarz übermalt oder mit Sackleinwand verhüllt waren. Das blau-gelbe Wappen der Percys war nirgendwo zu sehen, sodass die Waffenknechte, die auf seinen Befehl warteten, einen düsteren Anblick boten. Sie würden eine Zeit lang anonyme graue Männer sein müssen, Strauchritter, ohne Heim und Familie. Ehrlose, wobei gerade die Ehre die Kette war, die sie aneinander schmiedete.
Der alte Mann schneuzte sich und rieb sich die Nase. Nun, dieser Trick würde natürlich kaum jemanden täuschen, aber trotzdem würde er hinterher behaupten können, dass kein Ritter oder Bogenschütze der Percys mit dem Morden etwas zu tun hatte. Und was wichtiger war – diejenigen, die ihn beschuldigen könnten, lägen sowieso kalt in der Erde.
Er war noch immer tief in Gedanken, als er seinen Sohn hörte. Die Sporen des jungen Mannes klirrten und klapperten bei jedem Schritt auf dem Holzfußboden. Der Earl wandte sich zu ihm um, sein altes Herz klopfte vor Erwartung.
»Gott gebe Euch einen guten Tag«, sagte Thomas Percy und verbeugte sich. Auch er warf einen Blick durch das Fenster auf das Treiben unten im Burghof. Thomas zog fragend eine Augenbraue hoch, und sein Vater knurrte missmutig, da ihn das laute Getrampel der Dienstboten störte.
»Komm mit.« Ohne auf eine Antwort zu warten, eilte der Earl den Korridor entlang, sodass Thomas nichts übrig blieb, als ihm zu folgen. Am Eingang zu seinen Privatgemächern zerrte er seinen Sohn ungeduldig hinein und warf die Tür hinter sich zu. Thomas stand wartend da, während sein Vater hastig durch die Räume schritt und Türen auf- und zuschlug. Sein Gesicht war vor Misstrauen tiefrot angelaufen, und durch die geplatzten Äderchen auf Wangen und Nase wirkte es noch dunkler. Mit dieser Gesichtsfarbe konnte der Earl nie blass aussehen. Der Grund für diesen marmorierten Teint lag wohl eher in dem starken Gebräu von jenseits der Grenze, aber die Gesichtsfarbe passte gut zu seiner inneren Verfassung. Das Alter hatte den Mann nicht milder werden lassen, im Gegenteil, es hatte ihn ausgetrocknet und härter gemacht.
Nachdem er sich überzeugt hatte, dass sie wirklich allein waren, kam der Earl zu seinem Sohn zurück, der noch immer geduldig an der Tür wartete. Thomas Percy, Baron Egremont, war nicht größer als sein Vater, doch mit seinem geraden Rücken konnte er über den Kopf des alten Mannes hinwegblicken. Mit zweiunddreißig Jahren war er im besten Mannesalter, mit schwarzem Haar und starken, sehnigen Unterarmen, das Ergebnis von mehr als sechstausend Stunden Waffentraining. Er stand da, förmlich strotzend vor Gesundheit und Kraft, das Gesicht weder durch Krankheit noch von Narben verunstaltet. Beide Männer hatten die typische Percy-Nase, diesen ausgeprägten Keil, den man auch in den Dörfern und Höfen von Alnwick immer wieder antraf.
»So, wir sind unter uns«, sagte der Earl endlich. »Sie hat ihre Ohren überall, deine Mutter. Ich kann nicht einmal mit meinem Sohn sprechen, ohne dass ihr jedes Wort zugetragen wird.«
»Worum geht es denn?«, erwiderte sein Sohn. »Ich sehe, dass die Leute sich mit Bögen und Schwertern bewaffnet haben. Geht es wieder um die Grenze?«
»Diesmal nicht. Die verdammten Schotten sind im Moment ruhig, obwohl ich überzeugt bin, dass Douglas bereits wieder um meine Gebiete herumschnüffelt. Die werden im Winter kommen, wenn sie nichts mehr zu essen haben, und versuchen, meine Kühe zu stehlen. Aber dann werden wir’s ihnen schon zeigen.«
Sein Sohn versuchte, sich seine Ungeduld nicht anmerken zu lassen. Er wusste, dass sein Vater stundenlang über »diesen gerissenen Douglas« schimpfen konnte, wenn man ihn ließ.
»Aber die Männer dort draußen, Vater … Sie haben die Wappen verhüllt. Wer bedroht uns denn, dass wir mit Strauchrittern vorgehen müssen?«
Sein Vater trat näher. Er streckte die Hand aus, hakte einen knochigen Finger in den ledernen Brustpanzer seines Sohnes und zog ihn dichter heran.
»Die Nevilles deiner Mutter, Junge, immer und ewig diese Nevilles. Wie ich mich auch drehe und wende, immer sind sie da und stehen mir im Wege!« Earl Percy formte mit den Fingern einen Schnabel, mit dem er dicht vor dem Gesicht seines Sohnes in die Luft stieß. »Es gibt so viele davon, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Eingeheiratet in jede adlige Linie! In jedes Haus! Die verdammten Schotten setzen mir an der Flanke zu, sie überfallen England und brennen ganze Dörfer auf meinem Gebiet nieder. Wenn ich mich nicht so entschlossen zur Wehr setzen würde, wenn ich es auch nur ein Jahr versäumen würde, diese jungen Kerle umzubringen, die sie immer wieder schicken, um es zu probieren, würden sie wie die Heuschrecken in den Süden einfallen. Wo wäre England denn ohne Percys Armee? Aber den Nevilles ist das alles egal, sie verbünden sich mit York, diesem Emporkömmling. Auf den Schultern der Nevilles steigt er auf, während man uns unsere Titel und Besitztümer stiehlt.«
»Vogt der Westmark«, murmelte sein Sohn, der diese Tiraden leid war. Er hatte sie schon so oft gehört. Earl Percys Blick wurde noch finsterer.
»Und das ist nur einer von vielen. Ein Titel, der deinem Bruder zugestanden hätte, mit fünfzehnhundert Pfund im Jahr, bis Salisbury, dieser Neville, ihn bekam. Das habe ich schlucken müssen, Junge. Ich habe auch geschluckt, dass er Kanzler wurde, während der König schläft und vor sich hin träumt und Frankreich dabei verloren ging. Ich habe so viel geschluckt, dass ich es satthabe bis obenhin.«
Der alte Mann hatte seinen Sohn so nahe zu sich herangezogen, dass ihre Gesichter sich fast berührten. Er küsste Thomas flüchtig auf die Wange, dann ließ er ihn los. Aus alter Gewohnheit blickte er sich noch mal im Raum um, obwohl sie allein waren.
»In dir fließt das gute, ehrliche Blut der Percys, Thomas. Es wird das Blut deiner Mutter mit der Zeit verdrängen, genauso wie ich die Nevilles aus dem Land verdrängen werde. Jetzt ist diese Familie mir geschenkt worden, Thomas, verstehst du? Durch Gottes Gnade habe ich endlich die Chance, mir alles zurückzuholen, was sie mir gestohlen haben. Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich Windstrike satteln und sie persönlich niederreiten, aber … die Zeiten sind vorbei.« Die Augen des alten Mannes glänzten wie im Fieber, als er zu seinem Sohn aufsah. »Du musst jetzt mein rechter Arm sein, Thomas. Du musst mein Schwert und meine Fackel sein.«
»Ihr ehrt mich«, murmelte Thomas, dessen Stimme versagte. Als Zweitgeborener war er herangewachsen, ohne viel Liebe von seinem Vater zu spüren. Henry, sein älterer Bruder, war mit tausend Mann in Schottland, um dort plündernd und mordend die grausamen Clans in ihre Schranken zu weisen. Thomas dachte an ihn. Er wusste, es war nur Henrys Abwesenheit, die seinen Vater dazu veranlasst hatte, ihn jetzt ins Vertrauen zu ziehen. Er hatte sonst niemanden, den er schicken könnte. Der Gedanke war für ihn bitter, aber er witterte doch gleichzeitig eine Chance. Schließlich war sein Vater der einzige Mensch, der das Recht hatte, über ihn zu urteilen, und jetzt konnte er ihm zeigen, was er zu leisten imstande war.
»Henry hat natürlich unsere besten Kampfhähne mitgenommen«, sagte sein Vater, der seine Gedanken erraten zu haben schien. »Und ich muss ein paar starke Leute hier in Alnwick behalten, falls der schlaue Douglas sich an deinem Bruder vorbeimogelt und hier auftaucht, um uns zu überfallen. Für diesen elenden Mistkerl gibt’s doch kein größeres Vergnügen, als mir etwas zu klauen. Ich schwöre, er …«
»Vater, ich werde euch nicht enttäuschen«, sagte Thomas. »Wie viele Männer werdet Ihr mir mitgeben?«
Sein Vater schwieg, ungehalten, weil er unterbrochen worden war. Schließlich nickte er.
»Ungefähr siebenhundert. Zweihundert Waffenknechte, der Rest Ziegeleiarbeiter, Schmiede und gewöhnliche Männer mit Bögen. Aber du wirst Trunning dabei haben, hör auf ihn und befolge seinen Rat. Er kennt das Gebiet um York, und er kennt die Leute. Wenn du in deiner Jugend nicht so viel Zeit mit Trinken und Huren vertan hättest, würde ich vielleicht weniger an dir zweifeln. Aber lassen wir das … Doch vergiss nie: Es sind meine Männer, nicht deine. Höre auf Trunning! Er wird dich immer gut beraten.«
Thomas war rot angelaufen, in ihm stieg Zorn auf. Der Gedanke, dass diese beiden alten Männer hier etwas zusammen planten, versetzte seine Nerven in Spannung, die sein Vater zwar bemerkte, aber ignorierte.
»Hast du mich verstanden?«, sagte sein Vater scharf. »Du unternimmst nichts, was Trunning nicht gebilligt hat. Das ist mein Befehl an dich.«
»Ich verstehe«, sagte Thomas, der sich bemühte, seine Enttäuschung zu verbergen. Für einen Moment hatte er gedacht, sein Vater würde ihm das Kommando anvertrauen, statt ihm wieder seinen Bruder oder einen anderen vor die Nase zu setzen. Ihm war, als hätte er etwas verloren, was er noch nie besessen hatte.
»Sagt Ihr mir wenigstens, wohin ich reiten soll, oder muss ich das auch Trunning fragen?«, sagte Thomas. Seine Stimme bebte, und sein Vater verzog verächtlich und amüsiert den Mund.
»Nimm es nicht so schwer, Junge. Du hast einen starken Arm, und du bist mein Sohn, aber du hast keine Erfahrung als Befehlshaber. Die Männer respektieren dich nicht so wie Trunning. Wie könnten sie auch? Er hat zwanzig Jahre lang gekämpft, sowohl in England als auch in Frankreich. Er wird dafür sorgen, dass dir nichts passiert.« Der Earl wartete auf ein Zeichen der Zustimmung, aber Thomas’ Gesicht blieb finster, er fühlte sich verletzt und war empört. Earl Percy schüttelte den Kopf und fuhr fort.
»Morgen gibt es bei den Nevilles eine Hochzeit, Thomas, unten bei Tattershall. Der Clan deiner Mutter hat wieder mal zugeschlagen. Und Salisbury, dieser eitle Gockel, wird bei der Hochzeit seines Sohnes natürlich dabei sein. Und alles wird eitel Freude sein, weil sie eine frischgebackene Ehefrau in ihr Herrenhaus nach Sheriff Hutton mitnehmen können. Das weiß ich alles von meinem Beobachter. Der hat Kopf und Kragen riskiert, um mich rechtzeitig zu informieren. Na ja, ich habe ihn auch gut bezahlt. Jetzt hör zu. Sie werden teils zu Pferde sein und teils zu Fuß, eine fröhliche Hochzeitsgesellschaft auf dem Weg zu ihrem Festgelage an einem herrlichen Sommertag. Und du wirst auch dort sein, Thomas. Du wirst sie niederreiten und keinen von ihnen am Leben lassen. So lautet mein Befehl. Hast du gehört?«
Thomas schluckte schwer, während sein Vater ihn ansah. Earl Salisbury war der Bruder seiner Mutter, dessen Söhne waren seine Vettern. Thomas hatte damit gerechnet, dass es sich um einen entfernteren Zweig aus dem Hause Neville handelte, nicht um die Wurzel und das Oberhaupt des Clans selbst. Wenn er das tat, was sein Vater von ihm verlangte, würde er sich an einem einzigen Tag mehr Todfeinde verschaffen als in seinem ganzen bisherigen Leben. Trotzdem nickte er, stumm, denn es hatte ihm die Sprache verschlagen. Sein Vater verzog verärgert den Mund, wieder einmal spürte er die Schwäche und Unentschlossenheit dieses Sohnes.
»Salisburys Sohn heiratet Maud Cromwell. Du weißt, dass ihr Onkel die Hand auf verschiedene Güter der Percys gelegt hat und meinen Anspruch auf sie missachtet. Er bildet sich anscheinend ein, er könne meine Besitztümer als Mitgift den Nevilles schenken, weil beide jetzt zusammen so stark sind, dass ich gezwungen bin, meine Ansprüche gegen ihn fallen zu lassen. Ich schicke dich dort hin, damit du ihnen klarmachst, was Gerechtigkeit bedeutet. Um Stärke zu demonstrieren, um unsere Rechte zu wahren, die Cromwell nicht anerkennt, der sich feige hinter einem noch größeren Schatten versteckt! Jetzt hör mir gut zu. Zieh mit den siebenhundert Mann nach Tattershall und bringt sie alle um, Thomas. Und sorge auch dafür, dass Cromwells Nichte unter den Toten ist, damit ich ihren Namen erwähnen kann, wenn ich ihren trauernden Onkel demnächst im königlichen Gericht treffe. Verstehst du?«
»Natürlich verstehe ich!«, sagte Thomas, der seine Stimme inzwischen wiedergefunden hatte. Seine Hände zitterten, als er seinen Vater wütend ansah, aber er fürchtete die Verachtung des alten Mannes, falls er sich weigern würde. Er biss die Zähne zusammen, sein Entschluss stand fest.
An der Tür, durch die sie gekommen waren, hörte man Klopfen, und beide Männer schraken auf wie ertappte Verschwörer. Thomas trat zur Seite, damit man sie öffnen konnte, und wurde blass, als er seine Mutter erblickte.
Sein Vater reckte sich.
»Jetzt geh, Thomas. Mach deiner Familie und deinem Namen Ehre.«
»Bleib hier, Thomas!«, sagte seine Mutter mit kalter Stimme. Thomas zögerte kurz, dann verneigte er sich knapp, drückte sich an ihr vorbei und ging davon.
Countess Eleanor Percy wandte sich heftig ihrem Mann zu.
»Wie ich sehe, bewaffnen sich deine Wachen und Soldaten, verdecken aber das Wappen der Percys. Was für einen hinterhältigen Plan hast du ihm diesmal eingeflüstert, Henry? Was hast du vor?«
Earl Percy holte tief Luft. Seine Genugtuung war nicht zu übersehen.
»Hast du denn nicht an der Tür gelauscht wie eine Dienstmagd? Ich bin überrascht«, sagte er. »Was ich vorhabe, geht dich nichts an.« Während er sprach, ging er an ihr vorbei zur Tür. Eleanor stellte sich ihm in den Weg und hielt ihm die Hand vor die Brust. Der Earl packte sie grob und quetschte ihre Finger zusammen, sodass sie aufschrie. Er drückte noch fester zu, seine andere Hand an ihrem Ellbogen.
»Bitte, Henry. Mein Arm …«, keuchte sie. Er verdrehte ihr den Arm noch stärker, und sie stieß einen lauten Schmerzensschrei aus. Er sah einen Diener, der im Korridor angelaufen kam, und trat wütend gegen die Tür, sodass sie mit einem Knall zuflog. Seinen eisernen Griff noch immer um Hand und Arm seiner Frau, die vor Schmerzen wimmerte, zwang er sie, sich tief herunterzubeugen.
»Ich habe nichts weiter vor, als zu tun, was deine Nevilles auch mit mir tun würden, wenn ich in ihrer Gewalt wäre«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Hattest du etwa gedacht, ich würde es dulden, dass dein Bruder sich gegen den Namen Percy erhebt? Als Kanzler des Dukes von York bedroht er jetzt alles, für das ich stehe, und alles, was meinem Schutz untersteht. Verstehst du das? Ich habe dich genommen, damit du mir Söhne gebärst. Und das hast du getan. Aber wage es nicht, mich nach den Angelegenheiten meines Hauses auszufragen.«
»Du tust mir weh«, sagte sie, das Gesicht vor Schmerz und Wut verzerrt. »Du siehst Feinde, wo gar keine sind. Und wenn du dich mit meinem Bruder anlegst, der wünscht sich deinen Tod, Henry. Richard wird dich umbringen.«
Mit einem wütenden Schnauben schleuderte er sie durchs Zimmer, sodass sie zu Boden stürzte. Ehe sie aufstehen konnte, war er bei ihr, brüllte sie mit vor Wut verzerrtem Gesicht an, während er ihr die Kleider vom Leib riss. Sie schluchzte und kämpfte, aber seine Wut verlieh ihm ungeahnte Kräfte, und er ignorierte ihre Fingernägel, die ihm Gesicht und Arme zerkratzten. Mit einer Hand drückte er sie nieder und entblößte ihren weißen Rücken, während er mit der anderen Hand seinen Gürtel löste und ihn doppelt zusammenlegte.
»In meinem Haus redest du nicht in diesem Ton mit mir!« Schlag um Schlag traf der Ledergürtel mit lautem Klatschen auf ihren Rücken, ebenso laut war ihr verzweifeltes Schreien. Niemand kam, und er schlug auf sie ein, bis sie still war und sich nicht länger wehrte. Aus langen roten Striemen sickerte Blut und verfärbte den feinen Stoff, während er keuchend nach Atem rang und dicke Schweißtropfen von Stirn und Nase auf ihre Haut fielen. Mit grimmiger Befriedigung schnallte der Earl schließlich seinen Gürtel wieder um und ließ seine schluchzende Frau liegen.
Diener öffneten ihm die Tür, als Thomas Percy, Baron Egremont, in den Schlosshof hinaustrat. Der Himmel war blau, und der Lärm von Hunderten von Männern schlug über ihm zusammen und ließ sein Herz stärker pochen. Irritiert stellte er fest, dass auch seine eigenen Diener schon bereitstanden, wahrscheinlich auf Befehl seines Vaters, und geduldig auf ihn warteten. Sie hielten Teile seiner Rüstung und die Waffen bereit, andere machten Balion fertig, das große schwarze Streitross, das er im Jahr zuvor für einen sündhaften Preis gekauft hatte. Wie es schien, hatte sein Vater keinen Zweifel daran gehabt, wie ihr Gespräch ausgehen würde. Thomas runzelte die Stirn, als er durch die Menge auf die kleine Gruppe zuging. Von oben hörte er gedämpft die Schreie seiner Mutter, zweifellos verprügelte der Alte sie wieder einmal. Thomas empfand dabei nur Ärger, weil sie sich damit in seine Gedanken drängte. Er zog es vor, zu Boden zu sehen, statt sich den peinlichen Blicken der Männer auszusetzen. Bei jedem neuen Schrei zuckten sie entweder zusammen oder sie grinsten, was seine Wut auf sie nur noch verstärkte. Der Aufstieg der Nevilles fraß seinen Vater auf, er steigerte sein Misstrauen und führte immer wieder zu Wutausbrüchen, dabei hätte der Earl jetzt eigentlich seinen Ruhestand genießen und die Verwaltung des Besitzes seinen Söhnen überlassen sollen. Als der Lärm endlich nachließ, sah Thomas zum Fenster der Privatgemächer seines Vaters hoch. Es war typisch, dass der Alte seine Pläne schon seit Tagen in die Tat umsetzte, ohne seinem Sohn gegenüber auch nur ein Wort von seinen Absichten zu erwähnen.
Schnell und geschickt warf Thomas seinen ledernen Brustpanzer und den Mantel ab und zog sich hier im Hof bis auf die Hose und Untertunika aus, auf denen sich schon jetzt dunkle Schweißflecken zeigten. Hier gab es keine falsche Scham, und die vielen jungen Männer witzelten und lachten, während sie, auf einem Bein hüpfend, den zweiten gepanzerten Stiefel anzogen oder nach einem Kleidungsstück riefen, das versehentlich bei einem anderen gelandet war. Thomas setzte sich auf einen hohen Hocker und wartete geduldig darauf, dass seine Diener ihm das gepolsterte Wams anzogen und die verschiedenen Teile seiner Rüstung darüber befestigten. Sie passte ihm gut, und wenn die Kratzer und Dellen auch eher vom Trainieren als von der Schlacht her stammten, sah sie doch alles in allem würdig und verlässlich aus. Er hob die Arme, um sich den Brustpanzer anlegen zu lassen und sah missbilligend auf die matten Stellen, die von einer Küchenmagd stammten, die ihn wie einen Kochtopf gescheuert hatte, sodass das blau-gelbe Wappen verschwunden war. Er reckte den Hals, um nach seinem Schwert zu sehen, das für ihn bereitlag. Thomas stieß einen leisen Fluch aus, denn auch hier war das schöne emaillierte Wappen mit einem Stichel entfernt worden. Natürlich alles auf Geheiß seines Vaters, aber er hatte dieses Schwert seit seinem zwölften Geburtstag, und es schmerzte ihn, es so beschädigt zu sehen.
Stück um Stück wurde ihm die Rüstung angelegt, dann stand er da und empfand dieses großartige Gefühl von Stärke und Unverwundbarkeit, das sich immer einstellte, wenn er so gepanzert war. Lord Egremont griff nach seinem Helm, den der Haushofmeister ihm ehrfürchtig reichte. Als er ihn aufsetzte, hörte Thomas, wie die Stimme des Schwertmeisters über den Burghof hallte.
»Sowie die Tore offen sind, sind wir weg«, rief Trunning den versammelten Männern zu. »Also seid bereit, denn wir werden nicht wie Hofdamen noch mal umkehren können, falls jemand einen Handschuh verliert. Keine persönlichen Diener außer solchen, die reiten und mit Schwert oder Bogen umgehen können. Trockenfleisch, ein Säckel Hafer, ein bisschen Bier und Wein, mehr nicht! Vorräte für sechs Tage. Ihr reitet mit leichtem Gepäck, oder ihr bleibt zurück.«
Trunning unterbrach sich, sein Blick wanderte über die Ritter und sonstigen Männer. Er sah Percys Sohn und ging zu ihm.
Thomas empfand eine gewisse Befriedigung darüber, dass er auf den kleineren Mann herabsehen konnte. »Was gibt’s, Trunning?«, sagte er mit absichtlich kühler Stimme.
Trunning antwortete nicht gleich, er stand nur da und sah ihn an, wobei er an seinen weißen Schnurrbartenden kaute, die ihm über den Mund hingen. Der Schwertmeister hatte beide Söhne des alten Earl im Waffenhandwerk ausgebildet und in so zartem Alter damit angefangen, dass Thomas sich an keine Zeit erinnern konnte, wo Trunning nicht da gewesen war und über ungeschickte Hiebe geschimpft hatte oder wissen wollte, wer ihm beigebracht habe, den Schild »wie eine schottische Jungfrau« zu halten. Thomas konnte sich auf Anhieb an fünf Knochenbrüche erinnern, die ihm der rotgesichtige kleine Mann im Laufe der Jahre zugefügt hatte – zweimal die rechte Hand, zweimal war es der Unterarm gewesen, und einmal der Fuß, als Trunning im Zorn aufgestampft hatte. Jede dieser Verletzungen hatte geschiente Glieder und wochenlange Schmerzen bedeutet, dazu natürlich vernichtenden Spott für jeden Schmerzenslaut, der ihm beim Verarzten entfuhr. Thomas hasste diesen Diener seines Vaters nicht, noch fürchtete er ihn. Er wusste, dass Trunning dem Hause Percy und Northumberland treu ergeben war, wie ein besonders bissiger alter Hund. Doch trotz aller Rangunterschiede konnte Thomas, Lord Egremont, sich nicht vorstellen, dass dieser Mann ihn jemals als gleichwertig akzeptieren würde, geschweige denn als seinen Vorgesetzten. Der beste Beweis dafür war, dass sein Vater Trunning das Kommando über diese Aktion übertragen hatte. Die beiden Alten waren aus demselben Holz geschnitzt, keiner von ihnen besaß auch nur einen Funken Güte oder Barmherzigkeit. Kein Wunder, dass sie sich so gut verstanden.
»Euer Vater hat also mit Euch gesprochen? Hat Euch erzählt, was ansteht?«, fragte Trunning schließlich. »Hat er auch gesagt, dass Ihr in allem meinen Befehlen folgen sollt, damit Ihr mit nichts weiter als ein paar frischen Kratzern auf Eurer schönen Rüstung heil wieder nach Hause kommt?«
Thomas unterdrückte den Schauer, der ihm bei der Stimme des Mannes über den Rücken lief. Vielleicht war es das Ergebnis der vielen Jahre des Brüllens beim Training, dass er immer heiser war und seine Worte stets von tiefen, krächzenden Atemzügen begleitet waren.
»Ja, er hat mir gesagt, dass Ihr die Befehle geben werdet, Trunning. Bis zu einem gewissen Punkt.«
Trunning blinzelte ihn träge an.
»Und was für ein Punkt wäre das, mein edler Lord Egremont?«
Bestürzt merkte Thomas, dass sein Herz anfing zu hämmern und er heftiger atmete. Er hoffte, der Schwertmeister würde seine Beklommenheit nicht bemerken, aber damit war kaum zu rechnen, er kannte Thomas zu lange. Trotzdem sprach er mit fester Stimme, er war entschlossen, sich von diesem Mann, der nichts als ein Diener war, nicht länger einschüchtern zu lassen.
»Der Punkt, wo Ihr und ich verschiedener Meinung sind, Trunning. Ich bin es, der die Ehre des Hauses schützen wird. Ihr könnt Befehle geben, zum Marschieren, zum Angreifen und so weiter, aber die Regeln, nach denen wir vorgehen, werde ich bestimmen.«
Trunning starrte ihn an, er legte den Kopf auf die Seite und rieb sich eine Stelle über dem rechten Auge.
»Wenn ich Eurem Vater sage, dass Ihr Euch widersetzt, wird er Euch als Kochgehilfe mitschicken, wenn überhaupt«, sagte er mit bösem Grinsen. Zu seiner Überraschung drehte sich der junge Mann jetzt um, sodass er ihm ins Gesicht sehen konnte. Er beugte sich herunter.
»Wenn Ihr beim Alten tratscht, dann werde ich hierbleiben. Dann könnt Ihr sehen, wie weit Ihr kommt, ohne einen Sohn der Percys an der Spitze. Aber dann, Trunning, habt Ihr Egremont zum Feinde. Hiermit habe ich Euch meine Bedingungen mitgeteilt. Macht, was Ihr wollt.«
Thomas wandte sich absichtlich seinen Bediensteten zu, winkte sie heran und bat sie um einen Tropfen Öl für sein Visier. Er spürte Trunnings Blick, und sein Herz raste noch immer, aber in dieser Sache war er sich sicher. Er sah sich nicht um, als der Schwertmeister davonging, es interessierte ihn auch nicht, ob er in die Burg ging, um sich bei seinem Vater zu beschweren. Lord Egremont klappte das Visier herunter, damit niemand sein Gesicht sah. Sein Vater und Trunning waren alte Männer, und trotz ihres Starrsinns und ihrer Bosheit war es irgendwann aus mit ihnen. Thomas würde die Bogenschützen und Schwertkämpfer gegen die Hochzeitsgesellschaft seines Onkels anführen, entweder mit Trunning oder ohne ihn, es war ihm egal. Noch einmal überblickte er die kleine Armee, die sein Vater zusammengetrommelt hatte. Die meisten von ihnen waren nichts weiter als Dorfbewohner, die dem Ruf ihres Feudalherrn gefolgt waren. Doch egal, ob Schmied, Metzger oder Gerber, sie alle hatten seit frühester Kindheit mit Axt oder Bogen trainiert und Fertigkeiten erworben, die für einen Mann wie Percy von Alnwick von Nutzen waren. Thomas lächelte und hob noch einmal das Visier.
»Am Tor formieren!«, brüllte er. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Trunning herumfuhr, aber Thomas ignorierte ihn. Mit alten Männern war es irgendwann vorbei, erinnerte er sich mit Befriedigung. Ab jetzt würden die Jungen regieren.
2
Derry Brewer hatte eine Stinklaune. Es schüttete, und der Regen prasselte auf seine Glatze. Er hatte noch nie darüber nachgedacht, wie praktisch ein dichter Haarschopf bei Regen war. Jetzt lag sein Schädel blank, das Trommeln verursachte ihm Kopfschmerzen, und seine Ohren juckten. Noch schlimmer war es, dass er eine völlig durchweichte braune Kutte anhatte, die ihm um die nackten Waden schlug und die Haut wund rieb. Sein Kopf war ihm erst an diesem Morgen ziemlich fachmännisch rasiert worden, er fühlte sich noch ungewohnt an und war empfindlich, besonders jetzt, wo er derart den Elementen ausgesetzt war. Die Mönche, die mit ihm zogen, trugen alle eine Tonsur, ihre weiße Kopfhaut glänzte nass in dem trüben Licht. Soweit Derry wusste, hatte keiner von ihnen seit Tagesanbruch irgendetwas gegessen, obwohl sie den ganzen Tag über gelaufen waren und dabei viel gesungen und gebetet hatten.
Die mächtigen Mauern des königlichen Schlosses lagen vor ihnen am Ende der Erbsengasse, als sie betend und mit der Bitte um milde Gaben mit der Glocke läuteten. Sie waren die Einzigen, die so dumm waren, im Regen zu stehen, während es doch genügend Unterstände gab. Windsor war eine wohlhabende Stadt, das Schloss, in deren Diensten die meisten der Bewohner standen, war nur zwanzig Meilen von London entfernt, genau wie das halbe Dutzend weiterer Schlösser rund um die Hauptstadt – alle einen Tagesmarsch voneinander entfernt. Der königliche Haushalt hatte die besten Goldschmiede, Juweliere, Winzer und Stoffhändler aus London angelockt. Und da der König persönlich hier residierte, war die Bevölkerung um mehr als achthundert Bedienstete des Schlosses angewachsen, was die Preise ansteigen ließ, egal, ob es sich um Brot, Wein oder ein goldenes Armband handelte.
Mürrisch, wie er war, dachte Derry darüber nach, dass sicherlich auch die Franziskaner vom Geld angelockt worden waren. Er war sich immer noch nicht ganz im Klaren, ob seine schmuddeligen Weggefährten am Ende vielleicht auch nichts Besseres als ziemlich schlaue Bettler waren. Klar, Bruder Petrus ließ seine Tiraden über Sünde und Habgier auf die Zuhörer los, aber die anderen Mönche hatten außer ihren Schalen für milde Gaben auch Messer im Gepäck, die sie zum Verkauf feilboten. Ein besonders kräftiger unter ihnen schien sich mit seiner Rolle als Messerschleifer abgefunden zu haben, denn er führte einen großen Schleifstein mit sich. Der stille Godwin trug ihn auf den Schultern, so gebeugt, dass er kaum sehen konnte, wohin er ging. Die anderen behaupteten, er trüge seine Last als Sühne für ein früheres Vergehen, aber Derry hatte nicht zu fragen gewagt, um was für eine Sünde es sich handelte.
Auf ihrem Weg von einer Kirche zur anderen, machte die Gruppe immer wieder Halt in Dörfern, um Andachten zu halten, dabei nahmen sie Wasser oder selbst gebrautes Bier an, das die Dorfbewohner ihnen herausbrachten, während sie ihren Schleifstein aufbauten und Messer schliffen und jeden segneten, der ihnen eine Münze dafür gab, egal wie klein. Derry durchzuckte ein Schuldgefühl, wenn er an den Lederbeutel dachte, den er im Schritt versteckt bei sich trug. Darin war genug Silber, um sie alle königlich zu bewirten, aber wenn er den Beutel hervorziehen würde, würde Bruder Petrus das Geld wahrscheinlich irgendeinem faulen Taugenichts schenken und die Mönche weiter hungern lassen. Derry blies die Backen auf und wischte sich den Regen aus den Augen, der ihm ununterbrochen über das Gesicht lief, sodass er alles wie durch einen Schleier sah.
Vor vier Tagen war es ihm als eine gute Idee erschienen, sich diesen Mönchen anzuschließen. Ihr bescheidenes Gewerbe brachte es mit sich, dass sie alle bewaffnet waren. Sie waren es auch gewohnt, nachts auf der Straße zu sein, wenn Diebe versuchten, selbst die zu bestehlen, die nichts hatten. Derry war gerade im Stall einer heruntergekommenen Kaschemme gewesen, als er Bruder Petrus hörte, der von Windsor sprach, wo man für die Genesung des Königs beten wollte. Keiner hatte sich groß gewundert, dass es hier einen weiteren Reisenden gab, der dasselbe Ziel hatte und mit ihnen gehen wollte, schließlich war die Seele des Königs in Gefahr und das Land voller Räuber und Spitzbuben.
Derry seufzte und rieb sich das Gesicht. Er nieste gewaltig und konnte gerade noch den saftigen Fluch unterdrücken, der ihm auf der Zunge lag. Erst heute Morgen hatte Bruder Petrus mit seinem Stock einen Müller verprügelt, der auf offener Straße lästerlich geflucht hatte. Es hatte Derry großes Vergnügen bereitet, den sanftmütigen Anführer der Gruppe bei einem Wutausbruch zu beobachten, der ihm auf den Kampfplätzen des Londoner Ostends schnell einen gewissen Ruf eingebracht hätte. Sie ließen den Müller auf der Straße liegen, aus dessen Ohren Blut tropfte – sein Wagen war umgeworfen und seine Mehlsäcke alle geplatzt. Bei der Erinnerung daran musste Derry grinsen, und er blickte hinüber zu Bruder Petrus, der bei jedem dreizehnten Schritt seine Glocke erklingen ließ, sodass es von den Mauern oben auf dem Hügel widerhallte.
Die Burg ragte düster im Regen auf. Die dicken Mauern und die runden Türme waren in den Jahrhunderten, seit ihre Grundsteine gelegt worden waren, noch nie bezwungen worden. König Henrys Festung wachte über Windsor, fast wie eine zweite Stadt innerhalb der ersten, eine Heimstatt für Hunderte von Menschen. Derry starrte hinauf, seine Füße schmerzten vom Kopfsteinpflaster.
Es war an der Zeit, sich von der kleinen Gruppe von Mönchen zu verabschieden, und Derry überlegte, wie er das Thema anschneiden sollte. Bruder Petrus war überrascht gewesen über seinen Wunsch, genau wie die anderen die Tonsur zu tragen. Obwohl sie es für sich selbst als eine Absage an die Eitelkeit akzeptierten, wäre dies für Derry nicht nötig gewesen. Er hatte seine ganze Überredungskunst gebraucht, ehe der Ältere ihm zugestanden hatte, dass er mit seinem Kopf machen könne, was er wolle.
Der junge Mönch, der sich mit dem Rasiermesser über Derrys dichtes Haar hermachte, hatte ihn zweimal geschnitten und ihm außerdem ein Stück Kopfhaut von der Größe eines Penny abgeschabt. Derry hatte das alles stoisch über sich ergehen lassen, und schließlich hatte Bruder Petrus ihm anerkennend auf die Schulter geklopft.
Jetzt, in diesem strömenden Regen, fragte Derry sich, ob es die Sache wert gewesen war. Er war ohnehin hager und ausgemergelt, und in einer alten Kutte wäre er vielleicht auch ohne Tonsur als Mönch durchgegangen, aber das Risiko war groß, und die Leute, die ihn jagten, hatten schon mehr als einmal bewiesen, dass sie zum Äußersten entschlossen waren. Seufzend sagte er sich abermals, dass es den Preis wert war, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals im Leben so niedergeschlagen gewesen zu sein.
Er hatte es sich nicht ausgesucht, der Erzfeind von Richard Plantagenet, Duke von York, zu sein. Rückblickend musste Derry zugeben, dass es besser gewesen wäre, er hätte sich etwas diplomatischer verhalten. Der Mann, der ihn ausgebildet hatte, hätte über den Stolz, den er gezeigt hatte, vermutlich missbilligend mit dem Finger gedroht – der alte Bertle hätte ihm gewiss einen langen Vortrag darüber gehalten, dass man seinen Feinden nie zeigen darf, wie stark man ist, niemals. Fast glaubte Derry, die verärgerte Stimme des Alten zu hören, als er langsam den Berg hinaufging. Solange sie dich für schwach halten, schicken sie keine starken, kaltblütigen Mörder aus London hinter dir her. Sie bezahlen auch nicht für jeden Bericht darüber, wo man dich gesehen hat, mit gutem Silber. Und sie setzen keinen Preis auf deinen Kopf, Derry!
Vielleicht hatte es ihn gerettet, für ein paar Tage ein Franziskaner zu sein. Vielleicht war es auch nur Zeitverschwendung gewesen, er würde es nie wissen. Auf jeden Fall war er auf seiner Wanderung mit den Mönchen Gruppen von feindselig aussehenden jungen Männern begegnet, Männern, die lachten und johlten und sich abwandten, wenn Bruder Petrus um eine milde Gabe bat. Jeder Einzelne von ihnen oder vielleicht sogar alle hätten von York beauftragt und bezahlt sein können, Derry wusste es nicht. Er hielt seinen Blick zu Boden gerichtet und wanderte mit den anderen weiter.
Der Regen ließ nach, aber in der Nähe hörte man es donnern, und dunkle Wolken ballten sich am Himmel. Bruder Petrus nutzte den Augenblick der Ruhe, indem er den Klöppel seiner Glocke mit der einen Hand festhielt und die andere hob, um seine durchweichte, fröstelnde Gruppe anzuhalten.
»Brüder, die Sonne geht bald unter, und es ist zu nass, um heute Nacht im Freien zu schlafen. Ich kenne eine Familie am anderen Ende der Stadt, weniger als eine Meile von hier, jenseits des Hügels. Die werden uns in ihrer Scheune schlafen lassen, wir werden dafür ihr Haus segnen und sie an unserer Andacht teilnehmen lassen.«
Bei diesen Worten hellten sich die Gesichter der Mönche auf, und Derry stellte fest, dass ihm diese merkwürdige Art von Leben durchaus einen gewissen Respekt abnötigte. Mit Ausnahme des stiernackigen stillen Godwin sah keiner von ihnen besonders robust und widerstandsfähig aus. Er dachte, dass vielleicht der eine oder andere dieses Wanderleben besser fand als zu arbeiten, andererseits nahmen sie es sehr ernst mit ihrer Armut in einer Zeit, wo jeder zweite Mensch einer Arbeit nachging und alles daransetzte, der Armut zu entkommen. Derry räusperte sich und unterdrückte den Husten, den er sich geholt hatte.
»Bruder Petrus, darf ich Euch um ein Wort bitten?«, sagte er. Der Anführer der kleinen Gruppe wandte sich ihm mit mildem Lächeln zu.
»Natürlich, Derry«, sagte er. Die Lippen des älteren Mannes waren blau. Wieder dachte Derry an den Geldbeutel, der sicher und warm zwischen seinen Beinen verborgen war.
»Ich … äh … ich werde nicht mit euch weiterziehen«, sagte Derry und blickte auf seine Füße hinunter, um die Enttäuschung im Gesicht des Mönchs nicht sehen zu müssen. »Hier im Schloss ist jemand, den ich sprechen muss. Ich werde wohl eine Weile hierbleiben.«
»Ach so?«, erwiderte Bruder Petrus. »Nun, Derry, wenn du gehen musst, dann geh. Aber nicht ohne Gottes Segen.« Zu seiner Überraschung streckte der Ältere seine Hände aus und legte sie Derry auf den wunden Kopf, den er leicht niederdrückte. Derry ließ es sich gefallen, er war merkwürdig gerührt von dem Glauben des alten Mannes, der jetzt den heiligen Christophorus und den heiligen Franziskus anrief, damit sie ihn auf seinem weiteren Weg beschützten und ihm beistanden.
»Ich danke Euch, Bruder Petrus. Es war mir eine Ehre.«
Der ältere Mann lächelte und ließ seine Hände sinken.
»Ich hoffe nur, dass den Leuten, denen du entgehen willst, die Sonne in die Augen scheint, Derry. Ich werde darum beten, dass sie so blind wie Saulus von Tarsus sind, wenn du ihnen begegnest.«
Überrascht sah Derry ihn an, und Bruder Petrus lachte leise.
»Es passiert nicht oft, dass jemand bereits nach ein, zwei Tagen bei uns auf einer Tonsur besteht, Derry. Nun ja, es wird dir nicht schaden, obwohl Bruder John ein wenig unvorsichtig mit der Klinge war.«
Derry starrte ihn an, amüsiert, trotz seiner schmerzenden Kopfhaut.
»Ich habe mich gefragt, Bruder, warum einige von euch eine Tonsur von nicht mehr als drei Fingerbreit haben, während er mich bis über die Ohren kahl rasiert hat.«
Bruder Petrus’ Augen blitzten.
»Das war meine Entscheidung, Derry. Ich dachte, wenn ein Mann so dringend eine Tonsur haben will, dann soll man seinen Wunsch auch so gründlich wie möglich erfüllen. Bitte vergib mir, mein Sohn.«
»Natürlich, Bruder Petrus. Ihr habt mich wohlbehalten hierhergebracht.« Mit plötzlichem Entschluss hob Derry seine Kutte hoch, suchte in den Tiefen der Falten und zog schließlich den Geldbeutel hervor. Er drückte ihn Bruder Petrus in die Hand und schloss seine Finger um das feuchte Leder.
»Dies ist für Euch. Davon könnt Ihr einen Monat leben, vielleicht länger.«
Bruder Petrus wog den Beutel nachdenklich in der Hand, dann hielt er ihn Derry wieder hin.
»Gott sorgt für uns, Derry, immer. Ich bin gerührt von deiner Freundlichkeit, aber behalte ihn.«
Derry schüttelte den Kopf, er hob die Hände und trat einen Schritt zurück.
»Es gehört Euch, Bruder Petrus, bitte.«
»Schon gut, schon gut«, sagte der Ältere und steckte den Beutel ein. »Sicher werden wir das Geld gut gebrauchen können, oder sonst jemand, der es noch nötiger hat als wir. Geh mit Gott, Derry. Wer weiß, vielleicht bleibst du irgendwann einmal länger als nur zwei Tage bei uns. Darum werde ich beten. Jetzt kommt, Brüder, es fängt wieder an zu regnen.«
Jeder Einzelne trat auf Derry zu, drückte ihm die Hand und gab ihm gute Wünsche mit, selbst der stille Godwin, der Derrys Hand mit seiner großen Pranke fast zerquetschte und Derry auf die Schulter klopfte, wie immer den großen Schleifstein auf dem Rücken.
Derry stand allein auf der Straße, auf dem Hügel vor der königlichen Burg, und sah hinter den Mönchen her, die nach der anderen Seite hinuntergingen. Es hatte tatsächlich wieder angefangen zu regnen, und Derry fröstelte, als er sich dem Torhaus zuwandte. Er hatte das Gefühl, dass er beobachtet wurde, und ging schneller, um in den Schutz der Mauer und zu dem wachhabenden Soldaten zu gelangen. Derry blinzelte mühsam in die Dunkelheit, als er näher kam. Der Mann war bis auf die Haut durchnässt, genau wie er selbst, bei jedem Wetter musste er mit seiner Pike und der Alarmglocke hier stehen.
»Guten Abend, mein Sohn«, sagte Derry, wobei er die Hand hob und das Kreuzzeichen machte. Der Wachsoldat sah ihn an.
»Hier dürft Ihr nicht betteln, Vater«, sagte er barsch. »Tut mir leid«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. Derry lächelte freundlich, seine weißen Zähne leuchteten in dem sonnenbraunen Gesicht.
»Schickt Eurem Hauptmann eine Nachricht. Er wird herauskommen.«
»Bei diesem Regen bestimmt nicht, Vater«, erwiderte der Mann verlegen.
Derry sah schnell zu beiden Seiten die Straße hinunter. Es war niemand zu sehen, und er war müde und halb verhungert.
»Sag zu ihm das Wort ›Weinberg‹, dann kommt er.«
Der Soldat sah ihn einen Moment zweifelnd an, während Derry versuchte, einen möglichst selbstsicheren Eindruck zu machen. Schließlich zuckte der Soldat die Schultern und stieß einen lauten Pfiff aus. Im Torhaus hinter ihm wurde eine Tür geöffnet, und Derry hörte jemanden fluchen, weil Wind und Regen hereindrangen.
Der Mann, der herauskam, hatte einen stattlichen Schnurrbart, der allerdings schon nass herunterhing. Er trocknete gerade seine Hände an einem Tuch ab, um seinen Mund hatte er Reste von Rührei. Er ignorierte den Mönch, der im Regen vor ihm stand, und wandte sich an den wachhabenden Soldaten.
»Was gibt’s?«
»Dieser Mönch, Sir. Er wollte, dass Ihr herauskommt.«
Derry verlor langsam die Geduld, weil der Sergeant der Wachen ihn weiterhin ignorierte. Jetzt sprach er, doch inzwischen zitterte er so vor Kälte, dass er die Worte nur mit Mühe herausbrachte.
»Mir ist kalt, ich bin hungrig und todmüde, Hobbs. Die Losung ist ›Weinberg‹, und die Königin wird mich sehen wollen. Lasst mich rein.«
Sergeant Hobbs, entrüstet über diesen Ton, wollte gerade eine schroffe Antwort geben, als er merkte, dass der Mann ihn mit Namen angesprochen hatte, außerdem hatte er das Losungswort benutzt, das man ihm vor einigen Wochen eingeschärft hatte. Er beruhigte sich und wurde sofort freundlicher. Er sah sich den schmuddeligen Mönch näher an.
»Master Brewer? Du lieber Gott, Mann, was ist denn mit Eurem Kopf passiert?«
»Tarnung, Hobbs, wenn Ihr es genau wissen wollt. Lasst Ihr mich jetzt durch? Mir tun die Füße weh, und mir ist so kalt, dass ich mich kaum noch rühren kann.«
»Aber ja, Sir, natürlich. Ich bringe Euch zur Königin. Ihre Hoheit hat erst vor ein paar Tagen nach Euch gefragt.«
Es regnete noch stärker und prasselte nur so auf den unglücklichen Wachsoldaten, der zurückblieb, als sie hinein ins Warme gingen.
So müde und heruntergekommen er auch war, Derry fiel sofort auf, wie ruhig es überall war. Die Stille wurde noch tiefer, je näher er mit Hobbs den königlichen Gemächern kam. Die Diener bewegten sich fast geräuschlos und flüsterten, wenn sie sprechen mussten. Bis sie an der richtigen Tür angekommen waren, wo Hobbs ein neues Passwort sagte, war Derry sich sicher, dass es im Zustand des Königs keine Veränderung gegeben hatte. Vierzehn Monate war es jetzt her, seit König Henry in diese tiefe Benommenheit gefallen war, aus der er nicht geweckt werden konnte. Man war bereits im Spätsommer des Jahres 1454, und noch immer gab es auf dem Thron in London keinen König, stattdessen regierte der Duke von York als Protektor des Königreichs. England sah auf eine lange Geschichte von Regenten zurück, die die Amtsgeschäfte unmündiger Könige versahen – Henry selbst hatte auch gute und zuverlässige Männer gebraucht, die an seiner Stelle regierten, als er als kleines Kind den Thron bestieg. Doch dass ein König vertreten werden musste, weil er in geistige Umnachtung fiel, das hatte es noch nicht gegeben – wahrscheinlich ein Erbe der französischen Linie, aus der seine Mutter stammte.
Derry musste sich eine gründliche Durchsuchung gefallen lassen. Als die Wachen sich überzeugt hatten, dass er keine Waffen bei sich trug – oder zumindest hatten sie keine gefunden –, wurde er gemeldet, und die Tür zu den inneren Gemächern öffnete sich.
Die Königin und ihr Gemahl saßen beim Abendessen. Im ersten Moment sah es aus, als säße König Henry ganz normal da, über eine Schale mit Suppe gebeugt. Doch dann sah Derry die Seile, mit denen er an seinem Stuhl festgebunden war, und den Diener mit dem Löffel, der neben seinem Herrn saß und ihn fütterte. Beim Nähertreten sah Derry, dass Henry ein Lätzchen trug, auf dem mindestens ebenso viel Suppe war, wie man ihm eingeflößt hatte. Die nahrhafte Brühe tropfte dem König von den schlaffen Lippen, und als Derry das Knie beugte und den Kopf neigte, hörte er leise Würgegeräusche.
Sergeant Hobbs war an der Schwelle stehen geblieben. Die Tür wurde hinter Derry geschlossen, und die junge Königin erhob sich von ihrem Stuhl. Sie sah ihn besorgt an.
»Euer Kopf, Derry! Was ist mit Eurem Haar geschehen?«
»Königliche Hoheit, ich hielt es für besser, unbemerkt zu Euch zu kommen, ohne dass man über jeden meiner Schritte berichtet. Das Haar, nun, das ist unbedeutend. Es wächst ja wieder. Zumindest hat man mir das versichert.« Genervt stellte er fest, dass die Königin nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken konnte.
»Euer Kopf sieht aus wie ein Ei, Derry! Sie haben Euch ja nicht ein Haar stehen lassen.«
»Ja, Euer Hoheit, der Franziskaner war außergewöhnlich gründlich mit seinem Rasiermesser.« Als er sich erhob, taumelte er leicht, ein Schwächeanfall, bedingt durch die Wärme im Raum und seinen großen Hunger. Die Königin bemerkte es, und ihr Gesicht wurde ernst.
»Humphrey! Hilf Master Brewer auf einen Stuhl, ehe er uns umfällt. Schnell.«