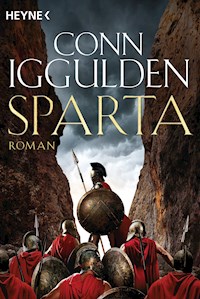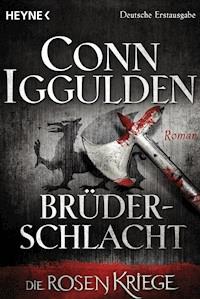9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rosenkriege-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein Sturm zieht über England herauf: Der Kampf um die Krone beginnt
England 1437: König Henry VI. ist krank und unfähig zu regieren, das Königshaus gerät ins Wanken. Zudem droht ein Konflikt mit Frankreich, der England in eine Katastrophe reißen könnte. Die Vermählung Henrys mit der französischen Adeligen Margaret von Anjou soll die Macht des Reiches sichern. Doch das Bündnis mit den verhassten Franzosen ruft bei der Bevölkerung Empörung hervor. Richard, Duke von York, nutzt den Hass gegen den König und seine willensstarke Gemahlin zu seinen Zwecken – die Rosenkriege beginnen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
»Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist.« Prediger 10:16
Im frühen 15. Jahrhundert wird das mächtige englische Königreich in seinen Grundfesten erschüttert. Henry VI, genannt »das Lamm«, besteigt den englischen Thron. Das Königshaus ist gespalten: Richard, Duke von York, strebt nach der Krone. König Henry nämlich ist nicht in der Lage, sein Land zu regieren.
Die Macht halten seine engsten Vertrauten in Händen: allen voran Derry Brewer, ein undurchschaubarer Meister der Strategie, sowie William de la Pole, der edelmütige Duke of Sufford. Aber auch von außen droht Unheil. Der französische König plant, alle von England besetzten Gebiete in seinem Land zu unterwerfen.
Um die Position Englands zu stärken, soll Henry die junge französische Adelige Margaret von Anjou heiraten. Doch der Preis des neuen Bündnisses ist hoch: Die Kolonien werden geopfert, das englische Volk reagiert mit Wut und Hass. In diesen schweren Zeiten wächst die junge Margaret über sich selbst hinaus und steht Henry mit unerwarteter Entschlossenheit im Kampf gegen den verräterischen Richard zur Seite …
Conn Iggulden, geboren 1971, ist einer der erfolgreichsten Autoren historischer Stoffe. Iggulden lehrte Englisch an der University of London, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Sturmvogel ist der erste Band seiner neuen Serie um die Rosenkriege, die England in einen verheerenden Bürgerkrieg rissen. Iggulden lebt mit seiner Familie in Hertfordshire, England. Mehr Informationen über den Autor und die Serie finden Sie unter www.conniggulden.com
CONN IGGULDEN
STURMVOGEL
ROMAN
Aus dem Englischenvon Christine Naegele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe
WARS OF THE ROSES: STORMBIRD
erschien 2013 bei Penguin, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 09/2014
Copyright © 2013 by Conn Iggulden
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlagillustration: Nele Schütz Design
Farbige Karte und Stammbaum der königlichen Linien© by Andrew Farmer
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-14557-6
www.heyne.de
Für Mark Griffith,ein Nachkomme des John von Gaunt
PROLOG
Anno Domini 1377
Unter dem Bett standen Schalen mit dunklem königlichen Blut, die der Arzt vergessen hatte. Alice Perrers saß zusammengesunken auf einem Stuhl, müde von der Anstrengung, dem König seine Rüstung anzulegen. Die Luft im Zimmer roch säuerlich nach Schweiß und Tod, und Edward lag da wie seine eigene Grabmalfigur, weißbärtig und bleich.
Alice blickte ihn an, in ihren Augen standen Tränen. Der Schlag, der Edward niedergestreckt hatte, war aus heiterem Himmel gekommen, unsichtbar wie ein warmer Windstoß. Leise beugte sie sich vor und wischte den Speichel ab, der aus seinem schlaffen Mundwinkel troff. Wie stark war er einst gewesen, ein Mann unter Männern, der von morgens bis abends kämpfen konnte. Noch glänzte seine Rüstung, aber sie war zerschrammt und voller Narben, wie der Körper, den sie bedeckte und dessen Fleisch und Muskeln verkümmert waren.
Sie war sich nicht sicher, ob er sie überhaupt noch hörte, deshalb wartete sie darauf, dass er die Augen öffnete. Sein Bewusstsein kam und schwand, Lebenszeichen, die im Laufe des Tages immer kürzer und schwächer wurden. Im Morgengrauen war er wach geworden und hatte flüsternd darum gebeten, dass man ihm seine Rüstung anlege. Der Arzt war aufgesprungen und hatte einen neuen Absud geholt, den der König trinken sollte. Schwach wie ein Kind hatte Edward sich gegen das übel riechende Gebräu gewehrt und angefangen zu würgen, als der Arzt es ihm mit Gewalt einflößen wollte. Als Alice das merkte, hatte sie entschlossen eingegriffen. Trotz seiner wütenden Proteste hatte sie den Arzt aus den königlichen Gemächern gedrängt und seine Drohungen ignoriert, und schließlich war es ihr gelungen, die Tür hinter ihm zu schließen.
Edward hatte gesehen, wie sie seinen Kettenpanzer vom Ständer nahm, und über sein Gesicht war ein Lächeln gehuscht, dann hatten sich seine blauen Augen wieder geschlossen, und er war in die Kissen zurückgesunken. Eine Stunde hatte sie, hochrot vor Anstrengung und sich immer wieder den Schweiß abwischend, mit Lederriemen, Schnallen und Metall gekämpft, um den alten Mann, der sich aus eigener Kraft nicht mehr bewegen konnte, hin und her zu rollen. Doch ihr Bruder war ebenfalls ein Ritter, und es war nicht das erste Mal, dass sie einem Mann die Rüstung anlegte.
Als sie ihm schließlich noch die Panzerhandschuhe über die Hände gezogen hatte und sich dann erschöpft zurücklehnte, nahm er es kaum noch wahr, leise stöhnend schwankte er zwischen Bewusstsein und Ohnmacht. Seine Hände zuckten unruhig auf der zerwühlten Decke, und endlich begriff sie, was er wollte. Alice griff nach dem großen Schwert, das an der Wand lehnte, sie musste es mit beiden Armen hochheben, um es so hinzulegen, dass seine Hände den Griff umschließen konnten. Sie dachte zurück an die Zeit, da Edward diese Klinge geschwungen hatte, als sei sie federleicht. Sie wischte sich die Tränen ab, als seine Hand sich krampfhaft darum schloss, wobei der Panzerhandschuh in der Stille ein leise knirschendes Geräusch machte.
Jetzt sah er wieder aus wie ein König. Es war geschafft. Sie nickte zufrieden, denn wenn seine Stunde gekommen sein würde, sähe er aus wie früher. Sie zog einen Kamm aus der Tasche und fing an, ihm den weißen Bart und das wirre Haar zu kämmen. Es würde nicht mehr lange dauern. Die rechte Seite seines Gesichts war schlaff, sah aus wie geschmolzenes Wachs, und seine Atemzüge kamen röchelnd und unregelmäßig.
Mit ihren achtundzwanzig Jahren war sie fast vierzig Jahre jünger als der König, doch bis zu seiner Krankheit war Edward rüstig und stark gewesen, und es schien, als würde er ewig leben. Solange sie denken konnte, war er der Herrscher gewesen, und sie kannte auch niemanden, der sich an seinen Vater erinnerte, und noch viel weniger an den mächtigen »Schottenhammer«, der vor ihm regiert hatte. Mit ihren Schlachten, von denen niemand für möglich hielt, dass sie zu gewinnen seien, hatte die Familie der Plantagenets England zusammengeschweißt und Frankreich in Stücke gerissen.
Ihr Kamm blieb in seinem Bart hängen. Der König öffnete die blauen Augen und sah sie an. Alice erschauerte unter seinem ernsten Blick – ein Blick, der sie immer wieder hatte schwach werden lassen.
»Ich bin da, Edward«, sagte sie fast flüsternd. »Ich bin da. Du bist nicht allein.«
Die linke Seite seines Gesichts verzog sich zu einer Grimasse, und er hob seinen linken Arm, ergriff ihre Hand mit dem Kamm und ließ ihn wieder sinken. Jeder Atemzug bereitete ihm Mühe, und bei dem Versuch zu sprechen, lief er vor Anstrengung rot an. Alice beugte sich zu ihm hinunter, um ihn zu verstehen.
»Wo sind meine Söhne?«, fragte er, wobei er kurz den Kopf vom Kopfkissen hob. Seine rechte Hand lag zitternd auf dem Schwertgriff, was ihn zu trösten schien.
»Sie kommen, Edward. Ich habe Boten nach John ausgesandt, die ihn von der Jagd zurückrufen werden. Edmund und Thomas sind im anderen Flügel. Sie werden alle kommen.«
Noch während sie sprach, hörte sie polternde Schritte und Männerstimmen. Sie kannte seine Söhne gut und bereitete sich innerlich darauf vor, dass dieser intime Moment jetzt zu Ende war.
»Sie werden mich wegschicken, mein Geliebter, aber ich werde in deiner Nähe bleiben.«
Sie beugte sich hinab und küsste ihn auf den Mund. Seine Lippen glühten im Fieber.
Als sie sich wieder aufrichtete, hörte sie die laute Stimme Edmunds, der den beiden anderen von einer Wette erzählte, die er abgeschlossen hatte. Sie wünschte sich, der älteste Bruder wäre auch dabei, aber der Schwarze Prinz war vor knapp einem Jahr gestorben und würde das Königreich seines Vaters nie regieren. Sie war überzeugt, dass der Verlust des Erben ein Schicksalsschlag gewesen war, der alles andere ausgelöst hatte. Ein Vater sollte keine Söhne verlieren müssen, dachte sie. Es war ein grausames Schicksal, nicht nur für einen König.
Die Tür wurde krachend aufgestoßen, und Alice fuhr zusammen. Die drei Männer, die eintraten, sahen alle auf verschiedene Weise ihrem Vater ähnlich. Sie alle hatten das Blut des alten Longshanks in ihren Adern, und damit gehörten sie zu den stattlichsten Männern, die sie je gesehen hatte. Sie nahmen den ganze Raum ein, und Alice fühlte sich bedrängt, noch ehe die Männer etwas gesagt hatten.
Edmund von York, schlank und schwarzhaarig, machte ein unwilliges Gesicht, als er die Frau sah, die bei seinem Vater saß. Er hatte die Mätressen seines Vaters nie gebilligt, und als Alice ängstlich aufstand, verfinsterte sich sein Ausdruck noch mehr. John von Gaunt an seiner Seite hatte den gleichen Bart wie sein Vater, nur dass der seine noch voll und schwarz und spitz zugeschnitten war, sodass er den Hals verdeckte. Hoch aufgerichtet standen die Brüder am Lager ihres Vaters und blickten auf ihn hinunter, der die Augen wieder geschlossen hielt.
Alice zitterte.
Der König war ihr Beschützer gewesen, und sie war reich geworden durch diese Verbindung. Aber sie war sich nur zu bewusst, dass jeder dieser Männer ihr alles wieder nehmen konnte, ihren Besitz und ihre Ländereien. Der Titel des »Dukes« war so neu, dass seine Machtbefugnisse noch nicht ganz klar waren. Sein Status war höher als der eines Earls oder eines Barons und kam fast dem des Königs gleich.
Zwei Köpfe der fünf großen Häuser fehlten. Lionel, der Duke von Clarence, war vor acht Jahren gestorben und hatte nur eine kleine Tochter hinterlassen. Der Sohn des Schwarzen Prinzen, Richard, war ein Junge von zehn Jahren. Er hatte von seinem Vater das Herzogtum Cornwall geerbt, und später würde er auch das Königreich erben. Alice kannte beide Kinder und hoffte inständig, dass der Junge – im Schatten seiner mächtigen Onkel – lange genug leben würde, um König zu werden. Doch wenn sie ehrlich war, rechnete sie kaum damit. Der Jüngste der drei Brüder war Thomas, der Duke von Gloucester. Er war immer freundlich zu Alice gewesen, vielleicht, weil er ihr altersmäßig am nächsten war. Auch jetzt war er der Einzige, der ihre Anwesenheit zur Kenntnis nahm, als sie zitternd dastand.
»Ihr seid meinem Vater ein großer Trost gewesen, Lady Perrers«, sagte Thomas. »Aber dies ist die Stunde für die Familie.«
Alice sah ihn durch ihre Tränen an, dankbar für seine freundlichen Worte. Ehe sie antworten konnte, sprach Edmund von York.
»Er will sagen, dass du gehen kannst, Mädchen«, sagte er. Er sah sie nicht an, sein Blick ruhte auf der Gestalt seines Vaters, der in seiner Rüstung auf dem hellen Laken lag.
»Raus mit dir!«
Schnell verließ Alice den Raum, während sie sich die Tränen abwischte. Die Tür blieb offen stehen, und sie blickte zurück auf die drei Söhne, die um den sterbenden König standen. Leise machte sie die Tür zu und ging schluchzend zurück in ihre Gemächer, die sie im Palast von Sheen bewohnte.
Die drei Brüder blieben lange stumm. Ihr Vater war der Mittelpunkt in ihrem Leben gewesen, das einzig Beständige in einer turbulenten Welt. Fünfzig Jahre lang hatte er regiert, und das Land war unter ihm stark und wohlhabend geworden. Keiner von ihnen konnte sich eine Zukunft ohne ihn vorstellen.
»Sollte nicht ein Priester an seinem Bett sein – statt einer Hure?«, fragte Edmund viel zu laut. Er sah nicht, wie sich die Miene seines Bruders John verzog. Edmund bellte die Welt grundsätzlich laut an, er war einfach nicht fähig, leise zu sprechen – oder vielleicht wollte er es auch nicht.
»Wir können ihn immer noch bitten, die Letzte Ölung zu spenden«, erwiderte John mit absichtlich leiser Stimme. »Er ist draußen in dem kleinen Zimmer und betet. Er wird sich noch so lange gedulden.«
Wieder wurde es still, aber schließlich wurde Edmund unruhig. Er blickte hinab auf die reglose Gestalt, auf die Brust, die sich unter den mühsamen, rasselnden Atemzügen hob und senkte.
»Ich sehe nicht ein …«, fing er an.
»Ruhig, Bruder«, unterbrach John ihn leise. »Lass uns einfach nur … ganz still sein. Er hat seine Rüstung und sein Schwert verlangt. Jetzt dauert es nicht mehr lange.«
Als sein jüngerer Bruder sich im Zimmer nach einem Stuhl umsah und ihn laut schleifend heranzog, schloss John für einen Moment resigniert die Augen.
»Man braucht ja nicht die ganze Zeit zu stehen, oder?«, fragte Edmund selbstzufrieden. »Man kann es sich genauso gut bequem machen.« Er stützte die Hände auf die Knie und sah seinen Vater an. Als er weitersprach, klang seine Stimme überraschend gedämpft. »Ich kann es kaum glauben. Er war immer so stark.«
John von Gaunt legte Edmund die Hand auf die Schulter. »Ich weiß, Bruder. Auch ich liebe ihn.«
Mit gerunzelter Stirn sah Thomas die beiden an.
»Soll er wirklich mit eurem Gewäsch in den Ohren sterben?«, fragte er streng. »Seid endlich still oder betet, entweder – oder.«
John packte Edmunds Schulter etwas fester, denn er ahnte, dass sein Bruder eine patzige Antwort geben wollte, doch zu seiner Erleichterung blieb er still, wenn auch widerwillig. John ließ ihn los. Edmund sah zu ihm auf und funkelte ihn böse an.
»Hast du daran gedacht, John«, sagte er in gewohnter Lautstärke, »dass jetzt nur noch ein kleiner Junge zwischen dir und der Krone steht? Wenn es den kleinen Richard nicht gäbe, wärst du morgen König.«
Sofort wurde er von den beiden anderen ärgerlich aufgefordert, den Mund zu halten. Er zuckte die Schultern.
»Gott weiß, die Häuser York und Gloucester werden nicht auf den Thron kommen. Aber was ist mit dir, John? Du bist nur noch um Haaresbreite davon entfernt, mit Gottes Segen zum König gemacht zu werden. Daran würde ich an deiner Stelle jetzt denken.«
»Edward wäre der rechtmäßige Anwärter gewesen«, sagte Thomas. »Oder Lionel, wenn er am Leben geblieben wäre. Edwards Sohn Richard ist der einzige männliche Nachkomme, und dabei bleibt es, Edmund … Mein Gott, wie kannst du nur so reden, während unser Vater noch auf dem Totenbett liegt. Und was heißt hier, ›um Haaresbreite …‹ Du schweigst besser, Bruder, mir reicht es. Es gibt nur einen Nachfolger. Und es gibt nur einen König.«
Der alte Mann auf dem Bett öffnete die Augen und wandte den Kopf. Sie sahen es, und Edmund blieb die grobe Antwort im Hals stecken. Alle drei beugten sich vor, um besser hören zu können, während ihr Vater schwach lächelte, wobei der geöffnete Mund in seiner gesunden Gesichtshälfte den Blick auf seine gelben Zähne freigab.
»Seid ihr gekommen, um mich sterben zu sehen?«, fragte König Edward.
Sie lächelten über diesen Lebensfunken, und John merkte, wie seine Augen sich mit Tränen füllten, sodass sein Blick verschwamm.
»Ich habe geträumt, Jungs. Ich träumte von einem grünen Feld, über das ich ritt.« Die Stimme des Königs war dünn und näselnd und so schwach, dass sie ihn kaum hörten. Doch in seinen Augen sahen sie noch immer den Mann, den sie kannten. Er war noch immer da und hatte ein Auge auf sie.
»Wo ist Edward?«, fragte der König. »Warum ist er nicht hier?« John wischte sich ärgerlich die Tränen aus den Augen.
»Er hat uns verlassen, Vater. Voriges Jahr. Sein Sohn Richard wird König werden.«
»Ach. Ich vermisse ihn. Ich habe ihn in Frankreich kämpfen sehen, wusstet ihr das?«
»Ich weiß, Vater«, erwiderte John. »Ich weiß es.«
»Die französischen Krieger überrannten ihn, sie schrien und brachen hindurch. Edward stand ganz allein da, mit nur einer Handvoll Leute. Meine Barone fragten mich, ob sie Reiter schicken sollten, um meinem Erstgeborenen beizustehen. Er war sechzehn Jahre alt. Wisst ihr, was ich ihnen sagte?«
»Du lehntest ab, Vater«, flüsterte John.
Der alte Mann stieß ein heiseres Lachen aus, seine Miene verfinsterte sich. »Ich sagte nein. Ich sagte, er müsse sich seine Sporen verdienen.« Sein Blick wanderte zur Decke, in Erinnerung verloren. »Und das tat er! Er kämpfte sich heraus, zurück an meine Seite. Da wusste ich, dass er König werden würde. Ich wusste es. Kommt er noch?«
»Er kommt nicht, Vater. Er ist tot, und sein Sohn wird König sein.«
»Ja, ein Jammer. Ich wusste es. Ich habe ihn geliebt, diesen Jungen, diesen tapferen Kerl. Ich habe ihn geliebt.«
Der König atmete aus, und aus und wieder aus, bis ihn der Atem verließ. Die Brüder warteten in schmerzlicher Stille, John hielt schluchzend seinen Arm vor die Augen. König Edward der Dritte war tot, und die Stille lastete auf ihnen wie ein schweres Gewicht.
»Holt den Priester für die Letzte Ölung«, sagte John. Er schloss seinem Vater die Augen. Einer nach dem anderen beugten sie sich hinab, um dem Vater die Stirn zu küssen und ihn ein letztes Mal zu berühren. Als der Priester geschäftig hereinkam, verließen sie ihn. Sie traten hinaus in die warme Junisonne und in ihr neues Leben.
TEIL EINS
Anno Domini 1443
Sechsundsechzig Jahre nach dem Tode Edwards III.
Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist.
PREDIGER 10,16
1
Es war kalt in England. Der Raureif ließ die Wege in der Dunkelheit weiß leuchten und hängte glitzernde Spitzengewebe an die Bäume. Die Wachen auf den Zinnen traten zitternd von einem Fuß auf den anderen, und in den hohen Gemächern hörte man den Wind seufzend und pfeifend um die Mauern streichen. Das Feuer im Kamin hätte ebenso gut gemalt sein können, so wenig Wärme erzeugte es.
»Ich erinnere mich gut an Prinz Hal, William! Ich erinnere mich an den Löwen! Noch zehn Jahre, und auch der Rest Frankreichs hätte ihm zu Füßen gelegen. Mein König war Henry von Monmouth und sonst niemand. Gott weiß, ich würde auch seinem Sohn folgen, aber dieser Junge ist nicht wie sein Vater, und das weißt du auch. Statt eines Löwen von England haben wir ein sanftes Lämmchen, das uns im Gebet anführt. Mein Gott, es ist zum Heulen.«
»Derry, bitte! Du hast eine laute Stimme. Und ich will diese lästerhaften Reden nicht hören. Ich erlaube sie meinen Leuten nicht, und von dir erwarte ich auch etwas Zurückhaltung.«
Der jüngere der beiden Männer blieb stehen und sah auf, einen harten Ausdruck im Gesicht. Er machte zwei schnelle Schritte und kam nahe heran, die Arme wie zum Kampf erhoben. Er war einen halben Kopf kleiner als Lord Suffolk, aber er war kräftig gebaut und muskulös.
»Manchmal könnte ich dich würgen, William!«, sagte er. »Das da draußen sind meine Leute. Oder denkst du etwa, ich will dich in eine Falle locken, hast du davor Angst? Sollen sie es ruhig hören. Sie wissen, was ich mit ihnen mache, wenn sie auch nur ein Wort davon wiederholen.« Er versetzte Suffolk einen spielerischen Schlag auf die Schulter und quittierte dessen gerunzelte Stirn mit einem Lachen.
»Lästerlich? Du bist schon ein Leben lang Soldat, William, aber du redest wie ein frommer Priester. Ich könnte dich mühelos aufs Kreuz legen, William. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du kämpfst gut, wenn du dazu aufgefordert wirst, aber ich kämpfe, weil es mir Spaß macht. Und darum wird das meine Aufgabe sein, William. Darum werde ich es sein, der die Stelle findet, wo er verwundbar ist, und das Messer hineinstößt. Wir brauchen keine sanftmütigen Höflinge, William, nicht für diese Aufgabe. Dazu ist jemand wie ich notwendig, jemand, der Schwächen erkennt und keine Angst hat zu handeln.«
Lord Suffolk machte ein düsteres Gesicht, er holte tief Luft. Der Meisterspion des Königs hatte eine ganz eigene Art, einem Beleidigungen und Komplimente gleichzeitig an den Kopf zu werfen. Doch Suffolk wusste, es hatte keinen Zweck, beleidigt zu sein, denn damit erreichte man nichts. Er war sich ziemlich sicher, dass Derihew Brewer selbst sehr gut wusste, wie weit er gehen konnte und wie weit nicht.
»Vielleicht brauchen wir keinen Höfling, Derry, aber auf jeden Fall brauchen wir einen Lord, um mit den Franzosen zu verhandeln. Und du hast mir geschrieben, weißt du noch? Ich habe in Orléans alles stehen und liegen gelassen und bin gekommen, um dich anzuhören. Ich wäre dir daher dankbar, wenn du mich in deine Pläne einweihen würdest, sonst reise ich wieder ab.«
»So stellst du dir das also vor? Ich finde die Lösung für all unsere Probleme, aber ich soll sie meinem hochwohlgeborenen Freund anvertrauen, damit der das Lob dafür erntet? Damit alle sagen können: ›Dieser William Pole, dieser Earl von Suffolk – was für ein kluger Bursche‹, während man Derry Brewer vergisst.«
»William de la Pole, Derry, wie du genau weißt.«
Derrys Antwort kam mit zusammengebissenen Zähnen und klang fast verächtlich.
»Ach ja? In Zeiten wie diesen brüstest du dich mit einem französisch klingenden Namen? Ich hatte dir wirklich mehr Verstand zugetraut. Die Sache ist nämlich die, William, dass ich es in jedem Fall tun werde, ganz gleich, was mit dem Lämmchen passiert, das uns jetzt regiert. Denn ich will nicht, dass mein Land von irgendwelchen Idioten und arroganten Hurensöhnen auseinandergerissen wird. Ich habe eine Idee, aber sie wird dir nicht gefallen. Ich will mir nur sicher sein, dass du weißt, welche Gefahr uns droht.«
»Ich weiß es«, sagte Suffolk, und seine grauen Augen wirkten hart und kalt.
In Derrys Grinsen war keine Spur von Humor zu entdecken, allerdings stellte Suffolk fest, dass er die weißesten Zähne hatte, die er je bei einem Erwachsenen gesehen hatte.
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte er verächtlich. »Das ganze Land wartet darauf, dass der kleine Henry sich endlich auch nur zu einem halb so mutigen Mann entwickelt, wie es sein Vater war, damit er endlich dessen großes Werk vollendet, das uns die Hälfte Frankreichs einbrachte und den Dauphin in die Flucht jagte. Die Menschen warten, William. Der König ist zweiundzwanzig. In dem Alter war sein Vater bereits ein echter Krieger. Erinnerst du dich? Der alte Henry hätte ihnen schon längst das Fell über die Ohren gezogen und sich Handschuhe draus gemacht. Aber nicht das Lämmchen. Nicht sein Sohn. Denn das Lämmchen kann weder führen, noch kann es kämpfen. Dem wächst ja nicht mal ein Bart, William! Wenn die erst merken, dass er nichts unternehmen wird, sind wir alle verloren, verstehst du? Wenn die Franzosen nicht mehr in der Angst leben, dass König Harry, der Löwe von England, zurückkommt, ist es aus. Vielleicht kommt dann in ein oder zwei Jahren ein französisches Heer die Themse herauf. Es gibt ein kleines Gemetzel, ein paar Vergewaltigungen, und von da an ziehen wir die Mütze und beugen das Knie, sobald wir eine französische Stimme hören. Willst du eine solche Zukunft für deine Kinder, William? Denn das ist die Gefahr, die uns droht, William Pole, du Engländer.«
»Dann sag mir, wie wir sie zum Waffenstillstand bewegen können«, sagte Suffolk langsam und eindringlich.
Mit seinen sechsundvierzig Jahren war er ein stattlicher Mann, mit einem eisengrauen Haarschopf, der ihm fast bis auf die Schultern fiel. Er hatte in den letzten paar Jahren an Leibesfülle zugenommen, und neben Derry kam er sich alt vor. Seine Glieder schmerzten bei jeder Gelegenheit, außerdem hatte er vor Jahren an einem Bein eine schwere Verletzung erlitten, und der Muskel war nie richtig geheilt. Im Winter hinkte er, und auch jetzt spürte er ein unangenehmes Ziehen im Knie. Er verlor langsam die Geduld.
»Genau das hat der Junge auch zu mir gesagt«, erwiderte Derry. »Erwirke einen Waffenstillstand, Derry, sorge dafür, dass wir Frieden bekommen. Frieden! Wo wir in einer guten Kampfsaison alles gewinnen könnten. Ich könnte speien! Und sein armer alter Vater wird sich vermutlich im Grabe umdrehen … Jedenfalls habe ich mehr Zeit in den Archiven verschwendet, als es ein gesunder, kräftiger Mann jemals tun sollte. Und ich habe etwas gefunden, William Pole. Ich habe etwas gefunden, das die Franzosen nicht ablehnen können. Bring es ihnen! Sie werden jammern und klagen, aber sie werden nicht widerstehen können. Er wird seinen Waffenstillstand bekommen.«
»Und hättest du vielleicht die Güte, mir deine Entdeckung mitzuteilen?«, fragte Suffolk, der seinen Unmut nur noch mit Mühe zügeln konnte. Der Mann brachte ihn zur Weißglut, aber Derry ließ sich nicht hetzen, außerdem hatte er den Verdacht, der Meisterspion genieße es, einen Earl auf die Folter zu spannen. Suffolk wollte Derry auf keinen Fall die Freude machen, seine Ungeduld zu zeigen. Er ging zur anderen Seite des Tisches, wo ein Krug mit Wasser stand. Er schenkte sich einen Becher ein, den er in großen Zügen leerte.
»Unser lieber Henry braucht eine Frau«, erwiderte Derry. »Und wir können warten, bis die Hölle zufriert, ehe der französische König ihm eine Prinzessin an die Seite gibt, wie seinem Vater. Nein, der König der Franzosen wird seine Töchter mit Franzosen verheiraten, und ich werde ihm nicht die Genugtuung verschaffen, einen Antrag unsererseits abschlagen zu können. Aber es gibt noch ein weiteres Haus, William. Das Haus Anjou. Der dortige Duc hat theoretisch Ansprüche auf Neapel, Sizilien und Jerusalem. Der alte René nennt sich König und hat in den letzten zehn Jahren versucht, diese Ansprüche geltend zu machen und damit seine Familie in den Ruin getrieben. Er hat mehr an Lösegeldern gezahlt, als du oder ich je zusammen besitzen werden. Und er hat zwei Töchter, eine davon ist dreizehn, und sie ist noch niemandem versprochen.«
Suffolk schüttelte den Kopf und füllte erneut seinen Becher. Er hatte dem Wein und dem Bier abgeschworen, doch dies war so ein Moment, wo er beides vermisste.
»Ich kenne Duc René von Anjou«, sagte er. »Er hasst die Engländer. Seine Mutter war eine gute Freundin dieser Johanna von Orléans. Schon vergessen? Wir haben sie verbrannt.«
»Völlig zu Recht«, sagte Derry. »Du warst dabei, du hast sie gesehen. Wenn diese kleine Hexe nicht mit dem Teufel im Bunde war, dann weiß ich es auch nicht … Aber du verstehst nicht, William. Der König hört auf René. Dieser eitle französische Pfau verdankt René von Anjou nicht nur seine Krone, er verdankt ihm alles. Es war Renés Mutter, die ihm Zuflucht gewährt hat, als er vor Angst davongelaufen ist. Und sie war es auch, die die kleine Johanna nach Orléans geschickt hat, damit der Hasenfuß endlich angreift. Es ist nur dieser Familie zu verdanken, dass Frankreich überhaupt noch unter französischer Herrschaft ist, oder zumindest das, was noch davon übrig ist. Und das Haus Anjou ist der Schlüssel zum Ganzen, William. Mein Gott, der König von Frankreich ist mit Renés Schwester verheiratet! Diese Familie kann mit dem König machen, was sie will. Und sie hat eine unverheiratete Tochter! Ich sage dir, das ist unsere Gelegenheit. Ich habe sie mir alle angesehen, William, jeden kleinen französischen ›Lord‹, der auch nur drei Schweine und zwei Bedienstete hat. Margaret von Anjou ist eine Prinzessin, und ihr Vater ist arm geworden bei dem Versuch, das zu beweisen.«
Suffolk seufzte. Es war spät, und er war müde.
»Derry, es geht nicht, selbst wenn du recht hast. Ich kenne den Duc. Nicht nur einmal hat er sich bei mir beschwert, dass die englischen Soldaten über den Tapferkeitsorden spotten, den er vergibt. Er fühlt sich von uns gekränkt.«
»Dann hätte er ihn nicht ›Orden der Argonauten‹ nennen sollen, meinst du nicht?«
»Das ist auch nicht alberner als Hosenband-Orden, oder? Wie auch immer, Derry, er wird uns seine Tochter nicht geben, jedenfalls nicht im Gegenzug für einen Waffenstillstand. Vielleicht würde er sie für eine beträchtliche Summe hergeben, wenn es wirklich so schlecht um ihn steht, wie du sagst, aber für einen Waffenstillstand? So dumm sind sie nicht, Derry. Wir haben seit zehn Jahren keinen Feldzug mehr unternommen, und mit jedem Jahr wird es schwerer, die eroberten Gebiete zu halten. Sie haben einen Gesandten hier, und ich bin überzeugt, er hält die Augen offen und erzählt ihnen haarklein, was er sieht.«
»Er erzählt ihnen das, was ich ihn sehen lasse. Ich habe diesen parfümierten Knaben im Griff, mach dir keine Sorgen. Aber ich habe dir noch nicht gesagt, was wir dem alten René Schönes zu bieten haben. Warum ist er denn so arm wie eine Kirchenmaus? Weil er keine Pacht mehr von den Ländereien seiner Vorfahren bezieht. Und warum das? Weil sie uns gehören. Er besitzt zwei heruntergekommene alte Burgen, von denen aus er die besten Anbaugebiete Frankreichs überblickt – auf denen brave Engländer ihre Ernte einfahren. Große Teile der Provinz Maine und das gesamte Anjou, William! Wenn er die Möglichkeit hat, diese Gebiete zurückzubekommen, dann wird ihn das sehr schnell an den Verhandlungstisch bringen, und wir können unseren Waffenstillstand fordern. Zehn Jahre? Wir verlangen zwanzig! Und die verdammte Prinzessin obendrein. Der König wird auf René von Anjou hören. Die Froschfresser werden sich überschlagen, den Handel zu besiegeln.«
Suffolk rieb sich erschöpft die Augen. Er glaubte Wein im Mund zu schmecken, obwohl er seit über einem Jahr keinen mehr angerührt hatte.
»Das ist doch Wahnsinn. Du willst, dass ich mehr als ein Viertel unserer Gebiete in Frankreich weggebe?«
»Glaubst du, mir bereitet das Freude, William?«, fragte Derry ärgerlich. »Ich habe mir monatelang den Kopf nach einer anderen Möglichkeit zerbrochen, das kannst du mir glauben. Aber der König will auf Biegen und Brechen einen Waffenstillstand – nun, auf diesem Wege hätten wir ihn. Es ist der einzige Weg. Wenn es einen anderen gäbe, hätte ich ihn gefunden.« Derry verdrehte die Augen. »Wenn unser junger Herr König das Schwert seines Vaters führen könnte – mein Gott, wenn er es auch nur hochheben könnte –, tja, dann bräuchten wir dieses Gespräch überhaupt nicht zu führen. Dann wären wir dort draußen, würden in die Hörner stoßen, und die Franzosen würden davonrennen. Aber wenn er es nicht kann – und er kann es nicht, William, du hast ihn selbst gesehen –, dann ist dies der einzige Weg zum Frieden. Und gleichzeitig besorgen wir ihm eine Frau. Alles Übrige fällt dann nicht mehr ins Gewicht.«
»Hast du es dem König schon gesagt?«, fragte Suffolk, der die Antwort schon ahnte.
»Wenn ich es ihm gesagt hätte, wäre die Sache bereits besiegelt, oder nicht?«, erwiderte Derry spöttisch. »›Tu, was du für richtig hältst, Derry. Ganz wie du meinst, Derry.‹ Du weißt doch, wie er ist. Ich kann ihn zu allem überreden. Leider kann das auch jeder andere. Er ist schwach, William. Wir können nichts weiter machen, als eine Frau für ihn finden, abwarten und hoffen, dass er einen starken Sohn bekommt.« Er sah Suffolks zweifelndes Gesicht und schnaubte. »Bei den Schotten hat es doch auch funktioniert. Der Schottenhammer hatte einen Schwächling als Sohn, aber sein Enkel? Ich wünschte, ich hätte unter einem König wie ihm dienen können. Das heißt … ich habe ja unter einem solchen König gedient. Unter Harry – dem Löwen in der Schlacht von Azincourt. Vielleicht ist einem ein solches Glück nur einmal im Leben vergönnt. Aber solange wir auf einen geeigneten Monarchen warten müssen, solange brauchen wir einen Waffenstillstand. Mit etwas anderem wird dieser bartlose Jüngling nicht fertig.«
»Hast du von dieser Prinzessin schon mal ein Bild gesehen?«, fragte Suffolk und starrte in die Ferne.
Derry lachte verächtlich.
»Margaret? Dir gefallen diese jungen Dinger? Du bist doch ein verheirateter Mann, William Pole! Was interessiert es dich, wie sie aussieht? Sie ist fast vierzehn und Jungfrau, alles andere ist unwichtig. Und selbst wenn sie mit Warzen übersät wäre, würde unser Henry sagen: ›Wenn du es für richtig hältst, Derry …‹«
Derry stand jetzt dicht bei Suffolk und stellte fest, dass der Ältere gebeugter schien als bei seinem Eintreten.
»Sie kennen dich in Frankreich, William. Sie kennen deinen Vater und deinen Bruder – und sie wissen, dass deine Familie ihre Abgaben zahlt. Sie werden auf dich hören, wenn du ihnen den Vorschlag unterbreitest. Wir haben dann immer noch den Norden und die Küste. Wir haben immer noch Calais und die Normandie, die Picardie, die Bretagne – bis nach Paris. Wenn wir das halten könnten und dazu noch Maine und das Anjou, würde ich die Fahnen schwenken und zusammen mit dir losmarschieren. Aber wir können es nicht.«
»Ich möchte es erst vom König selbst hören, ehe ich zurückreise«, sagte Suffolk mit düsterem Blick.
Derry sah weg, er schien nicht ganz glücklich.
»In Ordnung, William. Ich verstehe. Aber weißt du … Nein, ist schon gut. Er ist in der Kapelle. Vielleicht kannst du ihn bei seinen Gebeten unterbrechen. Aber er wird mir ohnehin zustimmen, William. Verdammt, er sagt doch zu allem ja.«
Der vereiste Rasen knirschte unter ihren Schritten, als die beiden Männer in der Dunkelheit zur Kapelle von Windsor gingen, die der Jungfrau Maria, Edward dem Bekenner und dem heiligen Georg geweiht war. Im schwachen Licht der Sterne, mit Atemwölkchen vor dem Gesicht, nickte Derry den Wachen an der äußeren Tür kurz zu, ehe sie in die von Kerzen erhellte Kirche eintraten, in der es fast ebenso kalt war wie draußen.
Auf den ersten Blick schien die Kirche leer, doch Suffolk ahnte, dass jemand da war, und sah schließlich auch die Männer zwischen den Statuen stehen. In ihren dunklen Roben waren sie fast unsichtbar, solange sie sich nicht bewegten. Ihre Schritte auf dem Steinboden hallten in der Stille wider, als sie auf die beiden Männer zuschritten, in ihren Gesichtern spiegelte sich die Verantwortung, die sie trugen. Derry wurde zweimal aufgehalten, bis sie ihn erkannten und er im Kirchenschiff weitergehen durfte, dorthin, wo die einsame Gestalt im Gebet versunken war.
Der Betstuhl des Monarchen war fast völlig umschlossen von vergoldeten Schnitzereien und nur schwach von den Lampen erhellt, die hoch über ihm hingen. Henry lag auf den Knien und hielt die gefalteten Hände vor sich ausgestreckt, fest ineinander verflochten und völlig bewegungslos. Er hatte die Augen geschlossen, und Derry seufzte leise. Eine Zeit lang standen er und Suffolk wartend da und sahen das erhobene Gesicht des Jungen an, auf dem in der Dunkelheit ein goldener Schimmer lag. Der König wirkte engelsgleich, aber fast brach es ihnen das Herz, als ihnen bewusst wurde, wie jung und zerbrechlich er aussah. Es hieß, seine Geburt sei für seine französische Mutter sehr schwer gewesen. Sie hatte Glück gehabt, dass sie selbst überlebte, und der Junge war blau und halb erstickt zur Welt gekommen. Neun Monate später war sein Vater, Henry V., gestorben, von einer eigentlich harmlosen Krankheit dahingerafft, nachdem er sein Leben lang Krieg geführt hatte. Manche waren der Meinung, es sei ein Segen, dass der alte Kriegerkönig nicht mehr miterleben musste, zu welcher Art von Mann sein Sohn heranwuchs.
In der Düsternis sahen Derry und Suffolk sich wortlos an, beide empfanden den Verlust. Derry trat näher.
»Es kann noch Stunden dauern«, flüsterte er Suffolk ins Ohr. »Du musst ihn unterbrechen, oder wir stehen bis morgen früh hier.«
Suffolk räusperte sich, und in dem hohen Kirchenraum klang es lauter, als er es erwartet hatte. Der König öffnete langsam die Augen, als komme er von weither in die Gegenwart zurück. Langsam wandte er den Kopf und sah die beiden Männer überrascht an. Er lächelte, bekreuzigte sich und murmelte ein kurzes letztes Gebet, ehe er aufstand, steifbeinig vom stundenlangen Knien.
Suffolk sah, wie er sich mit dem Riegel am königlichen Betstuhl abmühte, dann stieg er herab und kam näher. Er trat aus dem Lichtschein in die Dunkelheit, sodass sie sein Gesicht jetzt nicht erkennen konnten.
Beide Männer knieten nieder, Suffolks Knie protestierten, und über ihren gebeugten Köpfen ertönte das leise Lachen des Königs.
»Ich freue mich, Euch zu sehen, Lord Suffolk. Kommt, steht auf, der Boden hier ist zu kalt für alte Männer. Ich höre meine Kammerzofe immer darüber klagen, und ich glaube, sie ist jünger als Ihr. Also, auf, auf! Ehe Ihr Euch erkältet.«
Als Derry aufgestanden war, öffnete er die Laterne, die er mitgebracht hatte, und ihr Licht verbreitete sich in der Kapelle. Der König war denkbar einfach gekleidet, in dunklen Wollstoff und Lederschuhe mit flacher Kappe, wie ein ganz gewöhnlicher Stadtbewohner. Er trug keinen Goldschmuck, und mit seinem jungenhaften Aussehen hätte man ihn für einen Lehrbuben halten können, allerdings nur in einem Gewerbe, das nicht allzu viel Körperkraft erforderte.
Suffolk suchte in seinem Gesicht nach einer Ähnlichkeit mit dem Vater, aber der arglose Blick und die schmächtige Figur ließen nichts von der gewaltigen Kraft ahnen, über die seine Vorfahren verfügt hatten. Fast hätte Suffolk die Verbände an den Händen des Königs übersehen, doch als er sie schließlich erblickte, hielt der König sie hoch und wurde rot.
»Schwertübungen, Lord Suffolk. Der alte Marsden sagt, sie werden schon härter werden, aber sie bluten und bluten. Eine Zeit lang dachte ich …« Er unterbrach sich und tippte sich mit dem verbundenen Finger leicht auf den Mund. »Aber nein, Ihr seid bestimmt nicht aus Frankreich gekommen, um euch meine Hände anzusehen, oder?«
»Nein, Euer Gnaden«, erwiderte Suffolk leise. »Könnt Ihr mir einen Augenblick Zeit gewähren? Ich habe mit Master Brewer über unsere Zukunft gesprochen.«
»Eigentlich kann ich diesen Ort nicht verlassen. Ich darf jede Stunde eine Pause machen, um Wasser zu trinken oder den Topf aufzusuchen, aber dann muss ich zu meinen Gebeten zurückkehren. Kardinal Beaufort hat mir das Geheimnis verraten, und es ist keine große Last.«
»Ein Geheimnis, Euer Ehren?«
»Dass die Franzosen nicht kommen, solange der König betet, Lord Suffolk! Mit meinen betenden Händen, auch wenn sie blutig sind, halte ich sie zurück. Ist das nicht eine wunderbare Sache?«
Suffolk holte langsam tief Luft und verfluchte den Großonkel des jungen Mannes für seine Dämlichkeit. Es war völlig sinnlos, dass Henry sich auf diese Art und Weise seine Nächte um die Ohren schlug, obwohl Suffolk vermutete, dass es die Sache für alle, die um ihn waren, erleichterte. Kardinal Beaufort lag vermutlich irgendwo in der Nähe und schlief. Suffolk beschloss, ihn zu wecken und zusammen mit dem Jungen beten zu lassen. Schließlich konnten die Gebete eines Königs durch die eines Kardinals nur verstärkt werden!
Derry hatte aufmerksam zugehört und wartete darauf, sprechen zu können. »Ich schicke die Männer hinaus, Mylord Suffolk. Mit Eurer Erlaubnis, Euer Gnaden? Dies ist eine private Angelegenheit, die niemand hören sollte.«
Henry machte eine zustimmende Bewegung, während Suffolk sich über den förmlichen Ton amüsierte. Wenn Derry auch verbittert war und keinen Hehl aus seiner Verachtung machte, war er in Gegenwart des Königs doch vorsichtig. Hier in der Kapelle würde es von seiner Seite keine lästerlichen Reden geben.
Der König schien das halbe Dutzend Männer nicht zu bemerken, das Derry aus der Kapelle hinaus in die eiskalte Nacht komplimentierte. Suffolk vermutete, der eine oder andere werde sehr wohl zwischen den dunklen Säulen verborgen bleiben, aber schließlich kannte Derry seine Männer. Außerdem wurde Henry ungeduldig, und sein Blick wanderte ständig zurück zu seinem Betstuhl.
Suffolk merkte, wie ihn eine Welle der Zuneigung für seinen jungen König überflutete. Er hatte Henry aufwachsen sehen, auf dessen Schultern die Hoffnung eines ganzen Landes ruhte. Suffolk hatte erlebt, wie sich diese Hoffnungen zerschlagen und langsam in Enttäuschung aufgelöst hatten. Man konnte nur ahnen, wie schwer das alles für den Jungen selbst gewesen sein musste. Denn trotz seiner Eigenheiten war Henry nicht dumm, und die vielen Spöttereien und Verunglimpfungen dürften nicht unbemerkt an ihm vorübergegangen sein.
»Euer Gnaden, Master Brewer hat einen Plan, wie man eine Gemahlin und gleichzeitig einen Waffenstillstand aushandeln könnte, im Gegenzug für zwei große französische Provinzen. Er glaubt, die Franzosen wären im Tausch gegen Maine und Anjou damit einverstanden.«
»Eine Gemahlin?« Henry schien überrascht.
»Ja, Euer Gnaden, denn die Familie, um die es geht, hat eine heiratsfähige Tochter. Ich wünschte …« Suffolk zögerte. Er konnte den König schlecht fragen, ob er verstand, was er sagte. »Euer Gnaden, sowohl in Maine als auch im Anjou leben englische Untertanen von Euch. Man würde sie ausweisen, wenn wir die Provinzen aufgeben. Ich frage mich, ob das nicht ein zu hoher Preis für einen Waffenstillstand wäre.«
»Wir müssen einen Waffenstillstand haben, Lord Suffolk. Wir brauchen ihn. Das sagt auch mein Onkel, der Kardinal, und Master Brewer stimmt ihm zu. Doch erzählt mir von der Frau. Habt Ihr ein Bild?«
Suffolk schloss einen Moment die Augen, ehe er ihn ansah.
»Ich werde eins anfertigen lassen, Euer Gnaden. Doch zurück zum Waffenstillstand. Maine und Anjou sind die südlichsten Provinzen unserer Gebiete in Frankreich. Zusammen sind sie so groß wie Wales, Euer Gnaden. Wenn wir einen so großen Teil des Landes weggeben …«
»Wie heißt es, dieses Mädchen? Aber ich kann es wohl nicht gut ein Mädchen nennen. Aber ›Frau‹ auch nicht, nicht wahr, Lord Suffolk?«
»Nein, Euer Gnaden. Sie heißt Margaret. Margaret von Anjou.«
»Ihr werdet nach Frankreich gehen, Lord Suffolk, und sie Euch ansehen. Wenn Ihr zurückkommt, möchte ich alles über sie erfahren, bis ins letzte Detail.«
Suffolk ließ sich seinen Unmut nicht anmerken.
»Euer Gnaden, sehe ich das richtig, dass Ihr für den Preis des Friedens bereit seid, diese Gebiete in Frankreich aufzugeben?«
Zu seiner Überraschung beugte sich der König ganz nahe zu ihm, seine blauen Augen leuchteten.
»Wie Ihr schon sagtet, Lord Suffolk, wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand. Ich verlasse mich auf Euch, meine Wünsche auszuführen. Bringt mir ein Bild von ihr.«
Während dieses Gesprächs war Derry zurückgekommen, bemüht um einen neutralen Gesichtsausdruck.
»Ich glaube, Ihre Königliche Hoheit möchte jetzt zu Ihren Gebeten zurückkehren, Lord Suffolk.«
»Ja, das möchte ich«, stimmte Henry zu und hob zum Abschied eine verbundene Hand. Suffolk sah einen dunkelroten Blutfleck in der Mitte der Handfläche.
Sie verbeugten sich tief vor dem jungen König Englands, der wieder zu seinem Platz zurückging und sich hinkniete. Langsam schloss er die Augen und faltete die Hände.
2
Margaret musste nach Luft schnappen, nachdem jemand, der es offenbar eilig hatte, so heftig mit ihr zusammengestoßen war, dass sie beide umgerissen wurden. Undeutlich nahm sie fest zusammengebundenes braunes Haar und einen gesunden Schweißgeruch wahr, ehe sie mit einem Aufschrei hinfiel. Ein kupferner Topf war mit so lautem Scheppern auf die Pflastersteine des Schlosshofes gefallen, dass ihr die Ohren klangen. Noch im Fallen hatte die Magd versucht, den Kessel zu ergreifen, aber er war durch die Bewegung nur noch weiter weggeschleudert worden.
Die Magd sah sie verärgert an und wollte gerade zu einem deftigen Fluch ansetzen, doch als sie Margarets elegantes rotes Kleid mit den sich bauschenden weißen Ärmeln sah, wich das Blut aus ihrem Gesicht, das von den Küchenfeuern rot und erhitzt war. Einen Moment blickte sie um sich und überlegte, ob sie wegrennen sollte. Bei den vielen fremden Gesichtern im Schloss bestand immerhin eine kleine Möglichkeit, dass das Mädchen sie nicht wiedererkennen würde.
Seufzend wischte sich die Magd die Hände an der Schürze ab. Die Küchenmeisterin hatte sie vor den Brüdern und dem Vater gewarnt, aber sie hatte auch gesagt, das jüngste Mädchen sei ein nettes kleines Ding. Sie streckte die Hand aus und half Margaret auf die Beine.
»Es tut mir leid, meine Liebe. Ich hätte nicht so rennen sollen, aber heute sind alle so in Eile. Hast … habt Ihr Euch wehgetan?«
»Nein, ich glaube nicht«, erwiderte Margaret zögernd. Sie hatte Schmerzen in der Seite, und wahrscheinlich hatte sie sich den Ellbogen aufgeschürft, aber die Frau trat bereits ungeduldig von einem Bein aufs andere und wollte weiter. Als Margaret wieder auf den Füßen stand, lächelte sie die junge Magd an, deren Gesicht vor Schweiß glänzte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!