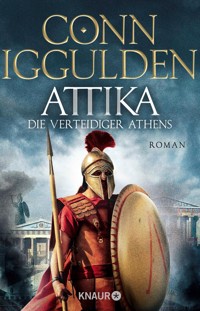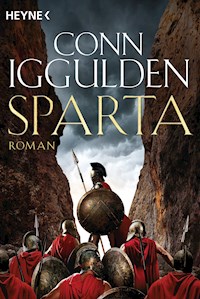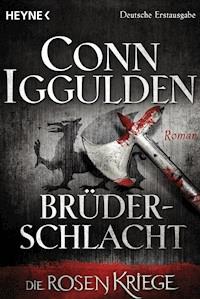12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Attika
- Sprache: Deutsch
Manchmal kann die Freiheit nur mit Blut erkauft werden: Episch, tragisch und actionreich erzählt Conn Igguldens historischer Abenteuerroman »Attika. Die Schlacht von Marathon« von der größten Bedrohung für das antike Athen. Nie war Athen einer Niederlage näher: 490 vor Christus dringt der mächtige Perserkönig Dareios der Große mit seinen kampferprobten »Unsterblichen« tief ins Land der Griechen vor. Die Athener sind hoffnungslos in der Unterzahl, und die Götter schweigen zu ihren Bitten. Xanthippus, der oberste Feldherr der Griechen, lässt seine Männer bei Marathon einen Schildwall errichten, der die Perser um jeden Preis aufhalten soll. Denn eine Niederlage würde Sklaverei bedeuten. »Die Schlacht von Marathon« ist ein meisterhaft geschriebener Pageturner und der 1. Teil von Conn Igguldens Attika-Reihe, die von unbeugsamem Freiheitswillen und der tragischen Lebensgeschichte des Feldherrn Xanthippus erzählt. »Iggulden ist eine Klasse für sich, wenn es um epische, historische Romane geht.« Daily Mirror
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Conn Iggulden
Attika
Die Schlacht von Marathon
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Urban Hofstetter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Manchmal kann die Freiheit nur mit Blut erkauft werden: Episch, tragisch und actionreich erzählt Conn Igguldens historischer Abenteuerroman »Attika. Die Schlacht von Marathon« von der größten Bedrohung für das antike Athen.
Nie war Athen einer Niederlage näher: 490 vor Christus dringt der mächtige Perserkönig Dareios der Große mit seinen kampferprobten »Unsterblichen« tief ins Land der Griechen vor. Die Athener sind hoffnungslos in der Unterzahl, und die Götter schweigen zu ihren Bitten.
Xanthippus, der oberste Feldherr der Griechen, lässt seine Männer bei Marathon einen Schildwall errichten, der die Perser um jeden Preis aufhalten soll. Denn eine Niederlage würde Sklaverei bedeuten.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Glossar
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Teil 2
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Historische Anmerkungen
Für Simon Broome, einen großartigen Lehrer.
»Er sprach mit mir – seine Worte hatten Flügel.«
Homer
»Bringt mir schnell einen Becher Wein, damit ich meine Gedanken befeuchten und etwas Kluges sagen kann.«
Aristophanes
Glossar
Die Unterstreichungen markieren die betonten Silben.
Archon (ἄρχων) Herrscher, Anführer
Epistatai (ἐπιστάται) Zweite Reihe in der Phalanx, hinter den Protostatai
Epistates (ἐπιστάτης) Vorsitzender der athenischen Volksversammlung
Keleustes (κελευστής) Offizier auf einer Trireme
Phalanx (Φάλαγξ) Eine schwer bewaffnete Militäreinheit
Protostatai (πρωτοστάται) Erste Reihe in einer Phalanx, vor den Epistatai
Strategos (στρατηγός) General, Kommandeur
Trierarch (τριήραρχος) Kommandeur einer Trireme
Agora (Ἀγορά) Offener Platz, Markt
Areopagus (Ἄρειοςπάγος) Areshügel, athenischer Gerichtsort
Kerameikos (Κεραμεικός) Töpferviertel von Athen
Eretria (Ἔρέτρια) Griechische Stadt in Euböa
Marathon (Μαραθών) Fenchelfeld an der Ostküste Attikas
Platäa (Πλάταια) Griechische Stadt in Böotien
Pnyx (Πνύξ) »Gerammelt voll« – Hügel, auf dem die Athener Volksversammlung stattfindet
Salamis (Σαλαμίς) Insel vor Athen
Agariste (Ἀγαρίστη) Ehefrau des Xanthippos
Ariphron (Ἀρίφρων) Ältester Sohn von Xanthippos und Agariste
Aristides (Ἀριστείδης) Strategos, Archon eponymos 489 v.Chr.
Eleni (Helen) (Ἑλένη) Tochter von Xanthippos und Agariste – wird in antiken Quellen nicht genannt.
Epikleos (Ἔπικλέος) Freund des Xanthippos
Herakles (Ἡρακλῆς) Für seine Stärke berühmter Sagenheld
Kimon (Κίμων) Sohn des Miltiades
Kleisthenes (Κλεισθένης) Athenischer Abgeordneter
Miltiades (Μιλτιάδης) Militärführer, Vater von Kimon
Perikles (Περικλῆς) Sohn von Xanthippos und Agariste
Pheidippides (Φειδιππίδης) Marathonläufer
Themistokles (Θεμιστοκλῆς) Archon eponymos 493 v.Chr.
Xanthippos (Ξάνθιππος) Strategos, Anführer, Ehemann von Agariste
Xerxes (Ξέρξης) König von Persien
Athena (Ἀθηνᾶ) Athenische Schutzgöttin
Eupatridai (Εὐπατρίδαι) Athenische Adelsgeschlechter
Erektheis
Aegeis
Pandionis
Leontis
Akamantis
Oeneis
Kekropis
Hippothontis
Aeantis
Antiochis
Prolog
In der Luft hing dichter Blütenstaub von Bergblumen. Er roch nach Parfüm oder Lackdämpfen. Alles, was kreuchte und fleuchte, mied die heißen Felsen und kauerte hechelnd in den Schatten. Ringsum wuchsen Bocksdorn und trockenes Gestrüpp. Grillen zirpten in den Zweigen von Pinien, die es irgendwie schafften, an die Steine geklammert zu überleben.
In der Stille, die genauso alt zu sein schien wie die umgebenden Hügel, erklang ferne Musik – erst ein hauchzarter Ton, der zu einem Gemisch aus Trompetenstößen und lauten Stimmen anschwoll. Eidechsen huschten davon, als die durchgeschwitzten königlichen Tänzerinnen mit lärmenden Zimbeln, Pfeifen und Trommeln die Anhöhe erklommen. Auf einen knappen Befehl hin hielten sie an.
Der Großkönig ritt auf seinem Hengst nach vorn. Als er abstieg, konnte man erahnen, wie anmutig er als junger Mann gewesen war. Dareios warf einem Sklaven die Zügel zu und stieg mühsam auf einen großen flachen Stein, um die Ebene zu überblicken. Aus dieser Höhe konnte er die Narben sehen, die Kriege und Feuersbrünste im Land hinterlassen hatten. Bewegt zog er die Augenbrauen zusammen. Es war lange her, doch er erinnerte sich noch sehr gut. In diesem Moment schien es ihm, als müsste er nur einen einzigen Schritt machen, um wieder in jener Zeit zu sein, an der Seite seines Vaters und noch mit seinem ganzen Leben vor sich.
Die Stadt Sardis lag in Ruinen, die Flammen waren längst erloschen. Als sich ein leises Lüftchen regte, glaubte Dareios jedoch, verbranntes Holz und gesprungene Ziegel zu riechen, außerdem einen Hauch Parfüm oder Fäulnis. In der Ferne sah er Menschen. Die Luft war so klar, dass Dareios den Funkenflug von Kochfeuern ausmachen konnte, über denen dünne Rauchfäden in den Himmel stiegen. Gewiss waren einige der Leute dort Flüchtlinge, die wieder zurückgekehrt waren, als die Flammen erstarben. Andere mochten gekommen sein, um die Ruinen zu plündern und nach Goldklümpchen zu durchsuchen, die früher einmal Münzen gewesen waren.
Die Stadt war ein einziger riesiger Scheiterhaufen. An seinem Aussichtspunkt in den hohen, weit von der Stadt entfernten Bergen hatte Dareios Mühe, sich die Straßen, Parks und Viertel vorzustellen, die den Flammen zum Opfer gefallen waren. Er sah, dass die Wachtürme entlang des großen Walls umgestürzt und zerbrochen waren. Auch die Straßen, die von der Stadtmauer wegführten, waren ramponiert: Die Asche und der Ruß an den Fußsohlen der fliehenden Familien hatten dunkle Spuren auf ihnen hinterlassen, die an die Adern im Arm eines alten Mannes erinnerten. Dareios war sicher, dass dort unten mittlerweile die Pest grassierte. Die Überlebenden kümmerten sich ohne Ordnung nicht um die Toten, sondern liefen mit abgewandtem Blick an den von Fliegen übersäten Leichen vorbei.
Dem Großkönig machte diese Vorstellung nichts aus. Er hatte den Tod bereits viele Male gesehen und wusste, dass seine Arbeiter die Gefallenen in riesigen flachen Gruben vor der Stadt verscharren mussten, ehe sie mit dem Wiederaufbau beginnen konnten.
Schließlich wandte Dareios den Kopf, um seinen jungen Sohn in seine Überlegungen mit einzubeziehen. Xerxes saß ein Stück hinter den vordersten Reihen mit einem untergeschlagenen Bein auf den Schultern eines jungen Elefantenbullen. Dareios sah, dass der Junge von irgendetwas abgelenkt wurde, vielleicht von einem seiner Schoßtiere. Xerxes war ständig auf der Suche nach irgendwelchen Kreaturen, die er zum Spaß dressierte. Zuletzt eine Grille, davor eine winzige blaue Eidechse, die beim Fressen ihr Futter mit beiden Vorderfüßen festgehalten hatte. Der Großkönig selbst hatte nie ein Bedürfnis nach derlei Dingen verspürt. Er fürchtete, dass der Junge sich nicht genug für das Reich interessierte, das er einmal erben würde. Dareios seufzte. Würden seine väterlichen Sorgen je ein Ende nehmen?
Er hatte die königliche Prozession mit seinem Absitzen zum Stillstand gebracht. Hinter Dareios standen sechzigtausend Mann. Sie reichten so weit auf dem Weg zurück, dass er die hintersten Reihen nicht ausmachen konnte. Nachdem sie den ganzen Morgen über stetig bergauf marschiert waren, stand ihnen ihre Erleichterung über die Rast ins Gesicht geschrieben. Dareios war gekommen, um Krieg zu führen, doch er hatte nur Asche vorgefunden.
Vorne rasteten die Tänzerinnen und zitterten vor Erschöpfung. An diesem Morgen war eine von ihnen gestürzt. Sie war mit schlaffen Armen und Beinen und weiß verdrehten Augen zu Boden gefallen und hatte erst gekreischt, als die nachfolgenden Karren und Männer über sie hinwegzogen. Nur die königlichen Elefanten, die penibel darauf achteten, welche Knochen sie zermalmten, waren um das Mädchen herumgetrottet.
Dareios wusste, dass er seinen Seneschall nicht eigens darauf ansprechen musste. Ashars grimmige Miene und seine geröteten Wangen verrieten, wie sehr er sich wegen dieses Vorfalls schämte. Die Herrin der Tänzerinnen würde am Abend sicher geschlagen, vielleicht sogar an einen Baum gebunden und als Futter für Löwen und Wölfe zurückgelassen werden. Die anderen würden mitbekommen, wie ihr geschah, und begreifen, dass sie dem Großkönig die Ehre, die er ihnen erwies, nicht mit Schande vergelten durften.
Dareios war kein kraftvoller junger Krieger mehr. Als er darüber nachdachte, vom Fels zu klettern, achtete er darauf, angesichts des Zwickens in seinen Hüften und seinem Kreuz nicht das Gesicht zu verziehen. Früher wäre er einfach hinuntergesprungen und hätte sich an seiner Kraft erfreut. Doch seine Diener kannten ihn. Während er dagestanden und in die Ferne geblickt hatte, hatten sie Stufen gebracht. Die stieg er nun mit geradem Rücken und unbewegter Miene hinunter.
Während der Großkönig zu seinem Sohn ging, streuten andere Diener getrockneten Lavendel und Myrte vor ihm auf den staubigen Pfad. Es war eine Beleidigung für Dareios, zu Xerxes aufschauen zu müssen, doch der Junge wirkte auf seinem Sitzplatz hoch oben auf dem Elefanten wie festgefroren. Der riesige Bulle schwenkte den Kopf zur Seite, um den Mann neben sich zu betrachten. Sowohl der Junge als auch das Tier befanden sich in einem äußerst schwierigen Alter. Dareios winkte die Blütenblatt-Diener fort. Sie blieben am Rand seines Blickfeldes stehen und warteten zitternd darauf, den Boden vor seinen welterschütternden Schritten erneut beduften zu dürfen.
»Komm da runter, Xerxes«, sagte der Großkönig leise.
Sein Sohn nickte und hielt eine Hand so, dass der Elefant sie sehen konnte. Als das Tier den Rüssel hob, stieg er darauf und ließ sich sanft herunterheben. Er schien stolz auf diesen Trick, der eher zu einem Marktplatz oder Holzfällerlager gepasst hätte. Dareios ging nicht darauf ein. Stattdessen legte er Xerxes einen Arm um die Schultern und führte ihn zu der Stelle, wo er von Anfang an auf seinen Vater hätte warten sollen. Am Ziel angekommen, stützte Dareios sich mit einer Hand auf den warmen Felsbrocken.
»Sieh nur«, sagte er. »Die Stadt ist ganz dunkel vor Asche.«
Xerxes spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Ferne und nickte unbeeindruckt. Dareios war stolz auf diesen jungen Mann, der sein Nachfolger werden würde … so Ahura Mazda, der Gott der Weisheit, will, fügte er in Gedanken schnell hinzu. Es empfahl sich nicht, sich der Zukunft allzu gewiss zu sein, weder anderen gegenüber noch insgeheim. Der Gott des Lichts hörte alles.
»Das ist Sardis, die Hauptstadt dieser ganzen Region«, sagte er. »Oder besser gesagt: Sie war es. Sie wurde von Feinden geplündert und niedergebrannt, unter anderem auch der große zweitausend Jahre alte Tempel. Deswegen habe ich so viele Soldaten mitgenommen, Xerxes. Bis morgen werden sie sämtliche Häuser und Tempel bis auf die Grundmauern abtragen. Danach bauen wir alles wieder auf.«
»Wer würde es wagen, eine unserer Städte anzugreifen?«, fragte Xerxes.
»Männer aus Athen und Eretria«, erwiderte sein Vater. »Die Griechen. Vor ein paar Jahren haben sie Abgesandte hergeschickt und um Freundschaft gebeten. Ich habe geglaubt, sie hätten sich damit einverstanden erklärt, zu einem meiner geliebten Untertanenvölker zu werden. Sie haben meinem Statthalter Erde und Wasser überreicht und sind über das Meer nach Hause zurückgekehrt. Ich muss zugeben, dass ich seither kaum noch einen Gedanken an sie verschwendet habe.« Der Großkönig lächelte und machte Anstalten, seinem Sohn die Haare zu zerzausen. Als Xerxes sich ihm entzog, versuchte er zu verbergen, wie sehr ihn das kränkte. »Dies hier ist der Rand der Welt, Xerxes. Das Meer ist keine zwei Tage von hier entfernt – und dahinter befinden sich Regionen, die noch nie das Glück hatten, mit meinen Gesetzen und Soldaten in Berührung zu kommen.« Er ließ den Arm über die Ebene gleiten. »Hier herrsche ich, über Sklavenmärkte und die Goldminen. Jeder Topf und jeder Becher gehören mir, jede Münze, jeder Balken und jedes Kind. Doch bis zur Zivilisation, dem Herzen des Reichs, ist es weit. Vielleicht war ich zu nachsichtig mit ihnen. Ich bin schon immer zu vertrauensselig gewesen.« Er sah, dass sein Sohn unbehaglich von einem Bein aufs andere trat, und lächelte erneut. »Niemand kann behaupten, ich hätte keine Ehre, Xerxes. Das verstehst du doch, oder? Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch, selbst wenn um mich herum die Welt untergeht. Wenn ich einem Feind vergebe und ihn wie ein Kind in mein Haus aufnehme, weiß er, dass er nie mehr Ärger mit mir bekommen wird. Selbst den Griechen ist das klar. Sie mögen vielleicht zetern und sich mir widersetzen, doch für Männer, die ihren Stolz ablegen und mir Erde und Wasser darbieten, werde ich immer ein gütiger Gott sein.«
»Aber wieso? Warum würdest du den Männern, die dies hier getan haben, die Sardis niedergebrannt haben, vergeben?«
Dareios beugte sich näher an seinen Sohn heran. Hundert Diener und Sklaven warteten nur darauf, all seine Wünsche zu erfüllen, und auf dem Rücken seines Elefanten spähten zwei nackte Frauen mit schwarz umrandeten Augen durch die Vorhänge seiner Sänfte. Doch im Moment war er mit seinem Erben allein.
»Hör mir gut zu, Xerxes, und merke es dir für die Zeit, wenn du selbst Großkönig sein wirst: Ich habe noch nie mein Wort gebrochen, weil ich möchte, dass jeder, der gegen meine Armeen ins Feld zieht, ängstlich seine Verbündeten beobachtet und sich fragt, ob sie ihn mitten in der Schlacht im Stich lassen werden. Ich will, dass er genauso sicher weiß, wie er seinen eigenen Namen kennt, dass ich ihn bis ans Ende der Welt ohne Rachegefühle als Verbündeten ehren werde, wenn er nur den Staub küsst und mir in seinen hohlen Händen Wasser anbietet. Denn er wird ein lebender Beweis für meine Gnade sein. Verstehst du das?«
Xerxes schüttelte kaum merklich den Kopf und schloss die Augen. Einen Moment später schlug er sie wieder auf. »Ihr Vertrauen in dich schwächt sie alle …«, sagte Xerxes erstaunt. »Wenn wir anrücken, stellen sich Brüder gegen Brüder und Freunde gegen Freunde.« Dareios lächelte. »Aber was ist mit deiner Ehre, wenn du dich nicht rächst, Vater?«, fuhr Xerxes fort. »Ist das nicht ein zu hoher Preis?«
»Nein. Mein Reich umfasst vierzig Nationen – Medien, Assyrien, Lydien, Indien – und so viele Untertanen wie silberne Fische im Meer. Wenn ich ein Lügner und Betrüger wäre, hätten sie sich mehr Mühe gegeben, mich abzuwehren. Doch stattdessen gewähre ich ihren Anführern Paläste und Ländereien. Vermutlich fragen sie sich gelegentlich, ob sie überhaupt erobert worden sind.«
»Aber das wurden sie«, sagte Xerxes.
Sein Vater nickte.
»Ja, doch die Städte des sogenannten ›Ionischen Bundes‹ orientieren sich an ihren Vorvätern, den Griechen, und nicht an uns. Vielleicht glaubten sie, ich wäre zu weit weg, um mich darum zu kümmern, was sie im äußersten Westen meines Reiches treiben. Sie baten Athen um Hilfe bei ihrem Verrat, und diese griechischen Hurensöhne schickten Schiffe aus Eretria und ihre Hoplitensoldaten an unsere Westküste, um meine dortigen Völker zu ermorden und zu terrorisieren. Nun tönen sie laut, dass sie das Joch abschütteln wollen, das ich ihnen auferlegt habe, und bezeichnen unsere Herrschaft als ›Unverschämtheit‹.« Der Großkönig lachte finster. »Als die Griechen meine Garnison zerstörten, haben sie die Reetdächer von Sardis in Brand gesteckt. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet und alles vernichtet, sogar den Tempel von Kybele, der großen Göttermutter. Das ist nur schwer zu vergeben.« Dareios blickte eine Weile nachdenklich in die Ferne und legte seinem Sohn erneut eine Hand auf die Schulter. Diesmal schüttelt Xerxes sie nicht ab. »Ich werde hier eine Weile lang alles wiederaufbauen lassen. Anschließend werden die Heere, die ich mitgenommen habe, in sämtliche Städte des Ionischen Bundes einmarschieren und Strafen verhängen, die ich für angemessen halte. Sie werden den Männern die Hände abhacken, sodass sie nie wieder einen Speer oder ein Schwert halten können. Die schönsten Kinder werden wir auf unseren Sklavenmärkten verkaufen. Die alten Männer und Frauen werden verbrannt. Was meines Erachtens eine Gnade ist … für all jene, denen sie ansonsten zur Last gefallen wären. Siehst du? Trotz meines brennenden Zorns bleibe ich weise. Ich bin kein Tyrann, Xerxes. Wenn ich mich bewege, ist es, als würden sich die Berge bewegen. Meine Schritte verursachen stärkere Erschütterungen als die von tausend Königen. Wenn ich einmal nicht mehr bin, wirst du es selbst erleben. Alle Menschen, auch die Könige, sind unsere Sklaven.«
Bei diesen Worten hellte sich Xerxes’ Miene auf. Er hob die linke Hand und berührte die Finger seines Vaters, die noch immer auf seiner Schulter lagen.
»Und was ist mit den Griechen, Vater?«
»Sie sind mit ihren Schiffen zurückgekehrt und schlafen wie unschuldige Kinder. Schließlich haben sie meine Garnisonen vernichtet. Sie glauben, damit sei alles erledigt. Doch da täuschen sie sich. In Wahrheit hat es gerade erst angefangen! Wenn ich hier fertig bin, werden wir uns wiedersehen.«
Der Großkönig blickte über die Schulter zu seinen Leibgardisten, die mit ihren weißen getäfelten Umhängen in mehreren Reihen hinter ihm standen. Trotz der drückenden Hitze blieben sie vollkommen reglos, als wären sie aus Stein gemeißelt. Der General, der sie befehligte, trat auf Dareios’ knappen Blick hin vor und warf sich der Länge nach in den Staub. Dabei hielt er sich beide Hände vor die Augen, als würde er geblendet. Als er sich wieder erhob, war seine geölte Ausrüstung mit Staub verklebt, sodass er nicht mehr wie ein Ehrengardist, sondern wie ein Soldat auf einem Feldzug aussah. Dareios sah darin ein gutes Omen.
»Bring mir einen Bogen, General Datis.«
Während der Großkönig die Hand ausstreckte, wurde die Waffe in Windeseile aus ihrem Futteral genommen und gespannt. Dareios nahm sie entgegen. Der Bogen war fast genauso groß wie er selbst. Das eingeölte Holz und das goldene Griffband glänzten in der Sonne.
»Pfeil«, sagte Dareios. Er bekam einen, nockte ihn ein und spannte die geflochtene Sehne mit einer fließenden Bewegung, die von lebenslanger Übung zeugte. Als er den Pfeil von der Sehne schnellen ließ, schien er eine Ewigkeit über dem abschüssigen Hang und der dahinterliegenden Ebene aufzusteigen, ehe er sich in der Ferne verlor.
»Ich schicke diesen Schaft, um meinen Eid zu bekräftigen«, murmelte Dareios ehrfürchtig. »Ich werde nicht ruhen, bis ich die Athener ihrer gerechten Strafe zugeführt habe.« Er gab den Bogen zurück und winkte seinen Weinsklaven zu sich.
Der schlanke junge Mann, der dem Großkönig seit Jahren diente und sich am goldenen Hof eine gewisse Autorität erworben hatte, ließ sich, ohne zu zögern, auf den Bauch fallen, als er spürte, in welcher Stimmung sein Herr sich befand.
»Vom heutigen Tag an hast du eine neue Aufgabe, Mischar. Erhebe dich nun und empfange sie aus meiner Hand.«
Der Eunuch erhob sich geschmeidig und schlug die Augen nieder. Der staubige Boden hatte seinem Seidengewand nicht gutgetan. Dareios sah, wie Xerxes die Schweißflecken darauf bemerkte und das Gesicht verzog. Solche Nachlässigkeiten waren unentschuldbar. Schließlich gab es Sklaven, die einen Mann beliebig oft baden und umziehen konnten. Wenn Mischar überhaupt ein Mann war. Als Kind hatte Xerxes ihn einmal von Wachen festhalten lassen, um die Narbe zwischen seinen Beinen zu besichtigen. Damals hatte Mischar wie eine Frau geheult. Wie seltsam, dass ein Sklave erwartete, einen Rest Würde bewahren zu können, denn die gehörte ihm natürlich ebenso wenig wie sein Leben! Dareios wusste, dass sein Sohn fand, dass er manchen Dienern zu viele Freiheiten gewährte, vielleicht weil er sie schon lange kannte.
»Mischar«, fuhr der Großkönig fort, »du wirst jeden Abend, wenn ich mich zum Essen setze, zu mir kommen. Du unterbrichst mich, ohne eine Bestrafung fürchten zu müssen, und sagst die folgenden Worte: ›Vergiss nicht die Griechen, Herr.‹ Verstehst du, was ich dir aufgetragen habe?«
Der Weinsklave nickte. Er zitterte so heftig, dass er aussah, als würde er sich jeden Moment übergeben. Ein Schweißtropfen rann ihm über die Stirn und verschwand in der Falte neben seinem bemalten Mund. »Ich … ich verstehe, Majestät. Es wird so geschehen, wie du es sagst.«
»Ja, das wird es, Mischar. Wenn du es vergisst, lasse ich deine schöne Zunge rausreißen. Jetzt lass uns allein und suche dir ein neues Seidengewand. Das, was du gerade trägst, eignet sich nur noch zum Verbrennen.«
Der Eunuch verbeugte sich tief und verschwand.
Xerxes beobachtete seinen Vater erwartungsvoll.
»So«, sagte der Großkönig. »Nun werde ich meine Schulden bei den Griechen nicht mehr vergessen, bis ich sie tausendfach zurückgezahlt habe. Sie sind ein kleines, weit verstreut lebendes Volk. Ich werde den Phöniziern Schiffe abkaufen und ein paar meiner untätigen westlichen Garnisonen in ihre Heimat marschieren lassen. Hier gibt es zu viele Palastoffiziere, Xerxes. Fette und verweichlichte Männer, die sich einen schlanken Lenz machen. Ich glaube, ein kleiner Feldzug wird ihnen guttun. Vielleicht werde ich sogar erleben, wie sich meine Unsterblichen auf hoher See schlagen. Ich fände es amüsant, Männer wie General Datis ins Meer kotzen zu sehen.« Der Großkönig lachte, und seine finstere Stimmung verflog.
»Und jetzt lass dir dein Pferd bringen. Ich möchte, dass du mit den Kundschaftern ausschwärmst, wenn wir die Ebene erreichen.«
»Mir wäre es lieber …«
»Tu mir den Gefallen, Xerxes«, sagte sein Vater sanft.
Xerxes neigte den Kopf. »Sehr wohl.«
Der Großkönig lächelte. »Gut, die Männer sollen dich reiten sehen. Bei Sonnenuntergang erwarte ich dich zum Mahl mit meinen Offizieren. Meine Generäle und ich werden planen, wie wir diese ionischen Städte, die vor uns zittern, bestrafen.«
Xerxes verbeugte sich noch einmal und trat respektvoll einige Schritte zurück, bevor er sich abwandte und den Wünschen seines Vaters nachkam. War er erst selbst Großkönig, konnte er es anders halten, doch jetzt diente er wie alle anderen Dareios, dem Eroberer und Zerstörer von Nationen.
Teil 1
490 v.Chr.
Kapitel 1
Xanthippos stand vollkommen still. Er atmete durch die Nase und murmelte den Sklaven, die um ihn herum arbeiteten, Anweisungen zu. Die drei Männer neigten nur ganz leicht den Kopf und konzentrierten sich weiter auf ihre Aufgaben. Sie alle dienten der Familie seiner Frau bereits seit ihrer Kindheit. Ihm schoss durch den Kopf, dass jeder Spartiate sieben Sklaven hatte, die ihn für den Krieg rüsteten. Vielleicht waren die Athener effizienter. Xanthippos lächelte weder, noch sprach er den Gedanken laut aus. Dafür war er zu nervös und ungeduldig. Er war achtunddreißig Jahre alt und würde womöglich den Tag nicht überleben.
Xanthippos konnte den Aufruhr in der Stadt nicht mehr hören, bezweifelte jedoch, dass er nachgelassen hatte. Das Haus seiner Frau stand auf einem riesigen Anwesen mit Oliven- und Feigenbaumhainen. Der Raum, in dem ihm die Rüstung angelegt wurde, befand sich in der Mitte des Gebäudes, weit weg von den Außenmauern, die auch für eine Festung angemessen gewesen wären. Xanthippos stand auf einer von weißen Steinsäulen umringten Fläche. Es war ein friedlicher, zum blauen Himmel hin offener Ort, weit weg vom Tumult und der Kriegsangst. Um dieses stille Herz des Gebäudes herum befanden sich zwei Etagen mit rund einem Dutzend Räumen. Das Tor in der Außenmauer öffnete sich zur Straße nach Eleusis.
Xanthippos war lange vor Sonnenaufgang von Geschrei erwacht. Hausboten waren auf die Agora geschickt worden, zu den bronzenen Heldenstatuen, die die zehn Stämme Athens repräsentierten. Der Rat des Areopags hatte unter jedem der Standbilder fein säuberlich beschriftete und von Sklaven mit flackernden Fackeln beleuchtete Papyrusblätter ausgehängt. Alle Stämme waren einberufen worden, sämtliche Demen der Stadt und des Umlands. Ihre schlimmsten Befürchtungen hatten sich bewahrheitet.
Xanthippos stöhnte, als ihm mit großem Druck die Beinschienen angelegt wurden. Sie waren exakt an die Form seiner Schienbeine und Knie angepasst und benötigten weder Befestigungsriemen noch Bänder, sondern wurden festgeklemmt. Sie schimmerten, als bestünden sie aus Gold, und waren mit dem gleichen gesegneten Öl eingerieben worden wie Xanthippos’ Arme und Beine.
»Einen Moment«, sagte er.
Als die Männer zurücktraten, sprang er in eine tiefe Hocke und stellte zufrieden fest, dass die Beinschienen an Ort und Stelle blieben. Sobald er wieder stand, griff einer der Sklaven um ihn herum und schnürte ihm einen weißen Leinenrock um die Hüften. Seine Oberschenkel würden unbedeckt bleiben. Es war eine Sache, in der Sommerhitze nackt herumzurennen oder Kampfübungen zu machen, in einer Schlacht war es jedoch keine gute Idee. Von seinem Vater hatte er gelernt, wie nützlich ein Stück Stoff sein konnte, wenn man sich Blut oder Schweiß aus den Augen wischen musste.
Mit nacktem Oberkörper sah Xanthippos zu, wie der Brustharnisch angehoben wurde. Das Innenfutter war aus dickem und fest vernähtem gebleichtem Leinen. Davor hingen die schweren Bronzeschuppen. Xanthippos wusste, dass er ihn bei jedem einzelnen Schritt, den er aus der Stadt hinaus machte, spüren würde. Er war wie eine zweite Haut, die er sich für den Krieg überstreifte. Ein paar der anderen Strategoi bevorzugten massive Bronze- oder Lederplatten, doch Xanthippos fühlte sich darin eingeengt. Er hatte einen Mann gesehen, der seinen Brustpanzer abnehmen musste, um sich die Sandalen zu schnüren. Er war ihm so hilflos erschienen wie ein Fisch an Land. Seine Schuppen, die vom selben Meisterschmied stammten wie seine Beinschienen, gaben ihm dagegen das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Ihm gefiel auch, dass sich die Bronze im Kontakt mit Haut erwärmte.
Die Diener befestigten den Harnisch mit zwei Riemen an den Schultern und einem Gurt um die Hüften. Zwei kleinere Platten – die Flügel – hingen vor seinem Unterleib und schützten die großen Adern ganz oben an seinen Beinen. Hinter seinem runden Schild würde ein Gegner nur die bronzenen Beinschienen und seinen Helm sehen – einen Mann aus Gold. Diese Vorstellung erfreute ihm. Seine Arme waren nicht gepanzert. Xanthippos ballte die Fäuste und schwang sie, um die steifen Schultern zu lockern und sicherzugehen, dass seine Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt war.
Während die Sklaven seine Nieten-Sandalen schnürten, band er sich ein Tuch um den Kopf, das seinen Schweiß aufsaugen und den Druck des Helms dämpfen würde. Ein paar Sklaven brachten derweil seine Waffen herein. Xanthippos, spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Sie waren nicht mit dem Reichtum der Alkmaeonidae, der Familie seiner Frau, gekauft worden, deren Stammbaum sich bis zu den Abenteurern in Homers Ilias zurückverfolgen ließ. Nein, die vielen Kratzer und Dellen und die kleine Lötstelle am Nasenschutz zeugten von jahrelangem Gebrauch. Jedes Teil seiner Hopliten-Ausrüstung hatte ihm irgendwann einmal das Leben gerettet. Xanthippos betrachtete sie mit so viel Stolz und Zuneigung, wie andere Männer ihrem Lieblingshund entgegenbringen würden.
»Wo ist mein Hoplon?«, fragte er, als er den Schild nirgends entdeckte.
Der Mann, den er angesprochen hatte, drehte sich Hilfe suchend zum ältesten Sklaven um.
Manias verneigte sich. »Die Herrin will ihn dir selbst zeigen«, antwortete er, mit ungewöhnlich ernster Stimme.
»Ich verstehe. Agariste hat ihn also neu bemalen lassen.«
Es war keine Frage gewesen, doch Manias nickte und errötete unter dem kalten Blick des Hausherrn. Als Sklave der Alkmaeonidae hatte er der Familie seit der Geburt seiner Herrin in verschiedenen Aufgaben gedient. Er hatte Agariste schon als kleines Mädchen auf den Schultern getragen und war ihr seither bedingungslos ergeben.
Nervös sahen die Sklaven zu, wie Xanthippos mit unverhohlener Wut den Speerschaft nach Rissen absuchte. Es gab keine. Aus einer Laune heraus winkte er die Männer ein Stück zurück und ließ die großartige Waffe sirrend um seinen Kopf und Oberkörper kreisen. Der Speer war anderthalbmal so lang wie er selbst. Das eiserne Blatt wurde perfekt durch den Bronzedorn am anderen Ende des Schafts ausbalanciert – dem Eidechsentöter, wie ihn die Hopliten nannten. Der Schaft aus mazedonischer Esche fühlte sich gut an. Als er ihn in den Händen hin und her drehte, spürte Xanthippos in der Oberfläche Abdrücke von den Werkzeugen, mit denen die Handwerker ihn bearbeitet hatten. Mit diesem Dory hatte er Männer getötet. Er war froh, ihn zu halten.
Xanthippos fuhr mit der Hand durch die Rosshaare, aus denen der Kamm seines Helms bestand. Kein Staubkorn war darauf zu sehen, und die zahlreichen Borsten waren sauber gestutzt. Zufrieden stellte er den Helm neben sich auf den Boden und zog sein Schwert aus der Scheide, um die eiserne Klinge auf Macken zu prüfen. Manche Dinge konnte man nicht Sklaven überlassen, egal, wie erfahren sie waren. Das Schwert war gut gepflegt worden, seit er es das letzte Mal zum Wohl der Stadt gezogen hatte. Es war mit Olivenöl eingefettet und frei von hartnäckigen schwarzen Rostflecken. Er schob es in die Scheide zurück und schnallte sich den Schwertgurt um die Taille.
Agariste trat aus dem schattigen Kreuzgang hinter dem sonnendurchfluteten Raum. Trotz ihrer zierlichen Statur trug sie den runden Schild, den schwersten und wichtigsten Teil seiner Ausrüstung, persönlich. Er war in ein weißes Tuch eingeschlagen, doch Xanthippos glaubte ohnehin zu wissen, mit welchem Motiv er verziert war.
»Lasst uns allein«, sagte sie freundlich.
Die Sklaven zogen sich ins Halbdunkel zurück. Sie waren geübt darin, ihre Befehle zu befolgen. Schließlich war dies ihr Haus und hatte zuvor ihrem Vater gehört. Ihr Onkel Kleisthenes hatte vermutlich an genau der Stelle gestanden, an der Xanthippos sich gerade befand – der Mann, der die athenische Demokratie umgestaltet und die Namen der zehn Stämme ausgewählt hatte. Agariste stammte aus einem berühmten Geschlecht, was Xanthippos gelegentlich als Bürde empfand. Doch er wusste, dass sie ihn in ihrer jugendlichen Unbekümmertheit aufrichtig liebte. Sie hatten geheiratet, als sie sechzehn und er dreißig gewesen war. Damals hatte er gerade am Beginn seiner politischen Laufbahn gestanden. Seither waren acht Jahre vergangen. Inzwischen war sie selbst erwachsen, und er verdankte seinen Aufstieg zum Teil der Unterstützung ihrer Familie. Doch sie fürchtete nach wie vor seine Geringschätzung. Er wusste, dass er ihr mit einem einzigen ungehaltenen Wort Tränen in die Augen treiben konnte. Und er sah ihr auch jetzt deutlich an, dass sie schreckliche Angst hatte, ihm könnte nicht gefallen, was sie getan hatte.
»Dann zeig es mir mal«, sagte er und streckte die freie Hand aus.
Sie biss sich auf die Unterlippe, zog das Tuch vom Schild und ließ es auf die Fliesen fallen.
Der Löwe überraschte ihn nicht. Er suchte Agariste schon seit Jahren im Schlaf heim. Sie hatte Xanthippos den Traum Dutzende Male in allen Details beschrieben. Für ihn hörte er sich jedoch nicht wie eine Prophezeiung an. Obwohl er Agariste um des lieben Friedens willen nicht widersprach, glaubte er nicht, dass die Götter einer närrischen jungen Frau eine echte Vision anvertrauten. Vielmehr ging er davon aus, dass sich in dem Traum ihre Sorge um ihn oder die Kinder ausdrückte.
Dass nun nicht mehr das schlichte alte Auge seinen Schild zierte, machte ihm Angst. Es hatte jeden seiner Feinde angestarrt, doch nun war der Schild dank Agariste blind.
»Er sieht sehr gut aus«, sagte er.
»Gefällt er dir wirklich?«, fragte sie und sah ihm tief in die Augen. »Nein, du magst ihn nicht.«
»Er ist schön«, erwiderte er aufrichtig. Der Künstler, der das Bild gemalt hatte, war tatsächlich sehr talentiert. Der Löwe, der in der Mitte des Schildes brüllte, schien nur aus einem Kopf, Zähnen und Zorn zu bestehen. Dennoch wäre es ihm lieber gewesen, wenn weiterhin das Auge über ihn gewacht hätte.
»Als ich zum ersten Mal träumte, dass ich einen Löwen zur Welt bringe«, unterbrach sie rasch das Schweigen, »habe ich geglaubt, das Tier müsste mein ungeborenes Kind sein. Schließlich war ich damals schwanger. Aber dann habe ich deinen Schild gesehen und gedacht … Was ist, wenn du der Löwe bist? Was, wenn ich dazu beitragen kann, dass mein Xan der Löwe von Athen wird?«
»Ich kann nicht sagen, was von beidem richtig ist«, entgegnete er. »Nicht heute.«
Diese Unterhaltung verlangte ihm mehr ab, als ihm recht war. Mit seinem Kriegswerkzeug in der Hand und der Schlacht vor Augen wollte er grimmig und schweigsam sein. Doch Agariste rüttelte wie immer an seiner harten Schale und lockte ihn aus der Reserve.
Die Sklaven waren nicht zu sehen, aber er wusste, dass sie in Rufweite waren.
»Agariste … was heute geschehen wird …«
»Oh, die Kinder! Ich muss sie holen, damit sie sich von dir verabschieden können.«
»Nein, Aggi …«, rief er, doch sie war bereits gegangen und hatte ihn allein unter dem strahlend blauen Himmel stehen lassen. Die Sonne stieg immer höher, und er konnte es mit einem Mal gar nicht mehr erwarten aufzubrechen. Fast wäre er einfach gegangen, doch dann hörte er die Stimmen seiner Kinder, ein Geräusch, in dem er sich wie in einem Dornengestrüpp verfing.
Ariphron war mit sieben der Älteste, seine sechsjährige Schwester Eleni folgte ihm auf den Fersen. Sie kamen wie kleine Gänse herbeigelaufen und sahen ehrfurchtsvoll ihren Vater an, der wie ein lebender Gott golden schimmerte. Agariste hielt die Hand ihres jüngsten Sohnes. Perikles war fünf und schien den Tränen nahe.
Xanthippos legte seinen Speer ab und kniete sich hin.
»Kommt zu mir, meine Kleinen. Du auch, Perikles. Schon gut. Komm nur her.«
Die drei rannten zu ihrem Vater, warfen sich ihm an die Brust und strichen mit großen Augen über die Bronzerüstung.
»Wirst du Perser töten?«, fragte Ariphron.
Xanthippos sah seinen ältesten Sohn an und nickte. »Ja, viele Perser. Hunderte.«
»Werden sie herkommen und uns töten?«
»Niemals. Jeder Mann in Athen bewaffnet sich gerade und stellt sich ihnen entgegen. Sie werden es noch bereuen, hierhergekommen zu sein.«
Irritiert beobachtete Xanthippos, wie Eleni aus heiterem Himmel das Gesicht verzog und laut zu schluchzen begann. Hätte er dieses Treffen doch bloß nicht gestattet.
»Wie wäre es, wenn du deine Schwester und deinen Bruder in die Küche bringst, Ariphron? Gib ihnen etwas Obst oder was immer der Koch vorrätig hat. Würdest du das für mich tun?«
Sein Ältester nickte feierlich. Er begriff, dass sein Vater ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe übertrug. Xanthippos konnte eine weitere Umarmung nicht verhindern, doch schließlich führte Ariphron seine beiden Geschwister davon.
Agariste bückte sich und hob den Speer auf. Er sah in ihrer Hand merkwürdig aus, und Xanthippos nahm ihn ihr schnell ab. Es hatte an diesem Tag bereits zu viele schlechte Omen gegeben – zuletzt die weinenden Kinder. Nachdem er bereits das Auge auf seinem Schild verloren hatte, wollte er nicht, dass sie auch noch die Waffe fallen ließ – was ein weiteres schlimmes Vorzeichen gewesen wäre. Seine Hand schloss sich um ihre. Er spürte ihre Wärme und roch ihr Parfüm, ein Gemisch aus Rose, Lavendel und Moschus. Als ihm der Duft in die Nase stieg, fragte er sich, ob er bereits das süße Öl auf seinem eigenen Scheiterhaufen roch.
»Wenn wir verlieren, Agariste …«
»Sag das nicht, Xan. Damit beschwörst du nur eine Katastrophe herauf. Bitte nicht.«
»Ich muss es sagen, um zu wissen, ob du die Situation begreifst.«
»Bitte …« Sie sah aus, als würde sie sich jeden Moment umdrehen und weglaufen.
Xanthippos spürte Zorn in sich aufsteigen. Warum war sie bloß so naiv? Er umfasste ihr Handgelenk so fest, dass sie aufschrie. »Wenn wir verlieren und sie herkommen, musst du die Kinder töten.«
»Das kann ich nicht.« Sie wich seinem Blick aus und versuchte, sich ihm zu entwinden.
Doch er ließ sie nicht los und packte trotz ihrer Tränen noch fester zu. »Du bist die Hausherrin, Agariste. Du wirst es tun. Wenn du die Klinge nicht selbst führen kannst, dann überlass es Manias. Muss ich dir etwa erzählen, was die Perser mit gefangenen Kindern anstellen? Wirst du mich dazu zwingen, es dir in allen schrecklichen Einzelheiten zu schildern? Sie sind wie die Pest, Agariste. Ich habe die Opfer ihrer … Aufmerksamkeiten gesehen. Die Leichen. Wenn wir verlieren, werden sie an Athen ein Exempel statuieren. Die Stadt wird zerstört, und es wird nirgends mehr sicher sein. Diese Schlacht ist nicht mit den früheren zu vergleichen, als eine spartanische Armee unter der Akropolis aufmarschiert ist oder wir gegen die Reiter von Thessalien gekämpft haben. Wir sind Griechen und wissen, wie weit man in einem Krieg gehen darf. Die Perser dagegen … sie sind zu grausam, meine Liebste. Und so zahlreich wie Sandkörner. Wenn sie siegen, musst du die Kinder und dich selbst vor ihren Untaten bewahren.«
»Wenn du es befiehlst, mein Gemahl, werde ich es tun«, sagte sie und neigte den Kopf.
Als er ihr in die Augen sah, war er jedoch nicht sicher, ob sie die Wahrheit sagte. Die Angehörigen ihrer Familie waren seit Jahrhunderten reich und mächtig und daher von Haus aus sehr zuversichtlich, insbesondere, was ihre Überlebensfähigkeit anbelangte. Er konnte nur beten – zu Ares, Zeus und Hera, der Göttin der Ehe –, dass Agariste verschont bleiben und niemals herausfinden würde, wie zerbrechlich die Welt in Wirklichkeit war.
»Wenn ich kann, werde ich heimkommen«, versprach er und verabschiedete sich mit einem raschen Kuss.
Er sagte ihr nicht, wie wenig er an seine Rückkehr glaubte. Die Griechen, die meinten, sie könnten diese Schlacht gewinnen, hatten noch nie einer persischen Armee gegenübergestanden. Die Streitmacht in Ionien war wie ein Schwarm schwarzer Heuschrecken gewesen – dabei hatte es sich angeblich nur um einen kleinen Teil des persischen Heers gehandelt. Xanthippos hatte damals gegen sie gekämpft, um Griechen zu unterstützen, die einfach nur frei sein wollten. Er hatte gesehen, wie die Perser sich an Unschuldigen rächten. Die Erinnerung daran riss ihn noch immer regelmäßig aus dem Schlaf. Der Arzt seiner Frau hatte ihm versichert, dass diese Träume im Lauf der Jahre vergehen würden, doch es schien, als würde er das nicht mehr erleben. Nachdem er Sardis brennen gesehen hatte, würde er nun auf griechischem Boden kämpfen müssen.
Xanthippos nahm seinen Helm und drückte ihn sich fest auf den Kopf. Seine Haare waren oben zu einem Zopf gebunden, der mögliche Schläge abfedern sollte. Das Innenfutter des Helms roch wie immer nach altem Schweiß und ranzigem Öl. Als er durch den kreuzförmigen Sichtschlitz blickte, fielen ihm sofort all die anderen Male ein, als er diesen Helm getragen hatte, und er merkte, wie sich seine Stimmung verfinsterte. Andächtig nahm er seinen Speer und den Schild und packte sie mit festem Griff. Auf dem Sammelplatz bei der Akademie würde es Blutopfer geben. Da er einer der Anführer der Versammlung war, würde man vielleicht ihn damit beauftragen, die Götter mit einem geschlachteten Widder gnädig zu stimmen. Auf jeden Fall würde man ihm jedoch befehlen, Menschen zu töten.
»Du wirst heimkehren«, sagte Agariste unvermittelt. »Ruhmreich und mit deinem Löwenschild. Ich sehe es deutlich vor mir, Xan.«
Wegen des Helms konnte er sie nicht küssen, doch sie umarmte ihn noch einmal und klammerte sich an seine Rüstung. Xanthippos sah Sklaven und Hausdiener auf ihn warten. Rund fünfzig von ihnen ließen die Arbeit ruhen, um zuzusehen, wie ihr Herr in den Krieg zog. Köche und greise Gärtner knieten sich hin, während er an ihnen vorüberging, junge Pferdeknechte starrten dem schimmernden Mann hinterher, der für sie und die Stadt kämpfen würde.
Auf der sonnenbeschienenen Straße jenseits der Mauer ging es überraschend ruhig zu. Er hatte mit einem Strom von Flüchtlingen gerechnet, doch offenbar erfassten die meisten Bewohner der Stadt die Situation besser als seine Frau. Es gab keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Die Perser waren gelandet, und wenn es ihnen nicht gelang, sie ins Meer zurückzutreiben, würde alles vorbei sein.
Xanthippos bedankte sich bei dem Knecht, der ihm sein Pferd brachte, und nickte den beiden Männern zu, die mit ihm zum Sammelplatz eilen würden. Xenias und Theos waren ehemalige Sklaven, die sich mit Geld und Geschicklichkeit die Freiheit erkauft hatten. Als Xanthippos in ihre ernsten Gesichter blickte, wurde ihm bewusst, wie falsch sich alles anfühlte. Einerseits standen seine Frau und ihre Sklaven Spalier, um ihn zu verabschieden. Seine Kinder hatten sich natürlich ebenfalls aus dem Haus geschlichen und sahen ihn nun wie kleine Eulen über die Mauerkrone hinweg an. Xanthippos nickte Ariphron zu. Man hätte fast meinen können, es wäre ein Tag wie jeder andere.
Andererseits tat sich vor ihm ein dunkler Abgrund auf. Xanthippos konnte bereits die Stille spüren, die ihn in wenigen Augenblicken umfangen würde. Er und seine beiden Sekundanten würden sich zu einem Ort begeben, an dem sich das athenische Heer sammelte, um entweder ihren Feind zu vernichten oder selbst vernichtet zu werden.
Er musste gehen und seine Familie zurücklassen. Die Angst um sie lastete schwerer auf ihm als seine Rüstung. Er reichte seinen Sekundanten den Schild und den Speer und bestieg das Pferd. Dann nahm er die Zügel und ritt los. Seine Kinder riefen ihm hinterher. Ihre hohen Stimmen wurden mit jedem Schritt leiser. Er blickte nicht zurück.
Kapitel 2
Ursprünglich war die Akademie als Übungsplatz für die jungen Krieger der Stadt gedacht gewesen. Ein wunderschöner, um einen heiligen Hain aus zwölf Olivenbäumen angelegter Ort, mit Statuen und einer Laufbahn am Flussufer. Doch mittlerweile wurde die Akademie seit mehr als hundert Jahren nicht mehr ordentlich instand gehalten. Die Laufstrecke war mit mehr Moos und Fingerhirse als Asche und kleinen Steinchen bedeckt, in den Hainen wucherte Unkraut, und die Fußwege waren unebene Trampelpfade aus Lehm. Xanthippos’ Miene verfinsterte sich, während er durch das hoffnungslos verfallene Areal zum Sammelplatz ritt.
Als Xanthippos die vielen Soldaten sah, fasste er wieder neuen Mut. Nur die Götter oder die Spartaner hätten schneller in den Krieg ziehen können als sein Volk. Obwohl der Vormittag noch nicht ganz vorbei war, konnte Xanthippos bereits die Banner aller zehn Stämme ausmachen. Seinen eigenen aus Akamantis entdeckte er sofort. Von den tausend Mann, die er befehligen würde, hätte er viele beim Namen nennen können – auf jeden Fall jedoch alle aus seinem Heimat-Deme in Cholargos. Es waren nur hundert, und Xanthippos kannte jeden Einzelnen von ihnen gut.
Er schritt die Reihe ab und begrüßte sie. Wenn er einen Freund sah, blieb er stehen und wechselte mit ihm ein paar Worte. Sie trugen allesamt ähnliche Helme, Brustharnische und Beinschienen. Einschließlich der Waffen und des Schildes konnte so eine Ausrüstung bis zu einem Jahreseinkommen verschlingen. Die meisten hatten ihre geerbt oder auf dem Schlachtfeld erobert.
»Da ist er ja!«, rief eine vertraute Stimme.
Der Mann, dem sie gehörte, hatte zusammen mit Xanthippos am Sardis-Feldzug in Ionien teilgenommen. Epikleos stammte aus einer wohlhabenden Familie, die ihr Geld vor allem mit dem Öl- und Feigenhandel verdiente. Er behauptete, von seinen vier Brüdern das schlechteste Los gezogen zu haben, weil er sich seit seiner Jugend als Soldat verdingen müsse, anstatt sich mit etwas Anständigem zu beschäftigen, wie der Politik oder der Dichtkunst. In Wahrheit war Epikleos jedoch einer der begabtesten Kämpfer, die Xanthippos je kennengelernt hatte. Er war nicht dazu geschaffen, Geschäfte zu machen oder Verse zu schmieden. Die Übungsrunden mit ihm hatten Xanthippos höchstwahrscheinlich mehr als einmal das Leben gerettet.
»Der Schild gefällt mir«, sagte Epikleos. »Ein Löwe ist besser als das alte tote Auge. Das war Agariste, oder?«
Xanthippos merkte, dass er errötete. »Ja, sie hat von einem Löwen geträumt«, erwiderte er knapp und wechselte rasch das Thema: »Was gibt’s hier Neues?«
Sein Freund ölte sich gerade ein und dehnte die Muskeln. Epikleos trug einen Brustpanzer aus reiner Bronze. Das zusätzliche Gewicht nahm er gern dafür in Kauf, dass er damit wie ein junger Herakles wirkte. Es gefiel ihm, dass die jüngeren Krieger ihn ansahen, dachte Xanthippos. Epikleos konnte erstaunlich eitel sein. Früher hatte er Xanthippos’ Speer getragen, ein Junge, der seinem bronzenen Helden folgte. Es war merkwürdig, nun kleine Fältchen um seine Augen zu sehen.
»Da drüben geht es zu wie in einem Bienenstock«, sagte Epikleos und nickte zur anderen Seite des Feldes.
Xanthippos sah zu dem massiven Steinaltar, um den sich mehrere Männer in Rüstung scharten. Auf dem Boden lagen Helme mit Federbüschen, Schilde und Speere, die seinen eigenen ähnelten. Als Erstes fiel sein Blick auf Themistokles, der gerade laut auflachte. Er schien in jeder Gruppe aufzufallen. Was vielleicht an seinen vielen dunkelblonden Haaren lag, die er im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden hatte. Wenn er sie offen trug, ähnelte er Agaristes Löwen.
Neben Themistokles stand der Mann, den Xanthippos mehr als alle anderen respektierte. Eigenartigerweise war er leicht zu übersehen. Aristides hatte in Athen genauso viel zu sagen wie Themistokles, doch er war zurückhaltender und nachdenklicher. Wenn er bei der Versammlung sprach, beugten sich die anderen Teilnehmer vor, um ja keines seiner Worte zu verpassen. Im Volksmund hieß es, Themistokles sei der Erste, der den Soldaten einen ruhmreichen Angriff befehle, doch nur Aristides könne ihnen erklären, wo es langgehe. Die Athener schätzten beide Männer, doch man sagte, sie würden einander verachten.
Sklaven und Kuriere rannten zum großen Altar und wieder von ihm weg. Sie sahen tatsächlich wie schwirrende Bienen aus. Xanthippos sah, dass die Stämme in Reih und Glied antraten und sich abmarschbereit machten. Plötzlich merkte er, wie trocken seine Kehle war, und rief nach Wasser.
Einer der vorbeieilenden Jungen kam schlitternd zum Stehen und drückte ihm einen Schlauch in die Hand. Als Xanthippos daraus trank, spürte er einen Druck in seiner Blase. Es war, als flösse die körperwarme Flüssigkeit direkt durch ihn hindurch. Die zehntausend Männer in Bronzerüstung waren Athens gesamtes Heer. Einerseits eine beeindruckende Zahl, wenn man bedachte, dass all diese Männer ausgerüstet und mit Wasser und Nahrung versorgt werden mussten. Doch es waren bei Weitem nicht genug.
»Was ist mit Sparta?«, fragte er und warf dem Jungen den Wasserschlauch zurück. »Kommen sie?«
Epikleos schüttelte finster den Kopf. »Ich habe gehört, dass sie eines ihrer Feste feiern. Angeblich können sie währenddessen nicht marschieren.«
»Dann sollten wir vielleicht auf sie warten«, sagte Xanthippos.
Epikleos lachte verächtlich. »Ja, das würde ihnen sicher gefallen. Können wir nicht ohne ihre Erlaubnis und ohne ihre Hand zu halten, in den Krieg ziehen?« Er bemerkte Xanthippos’ skeptischen Blick und schüttelte den Kopf. »Aus Platäa sind tausend Mann gekommen. Schau, da drüben stehen sie, mit ihrem General Arimnestos. Wir haben sie gerettet, als sie bedroht wurden. Gute Männer erinnern sich an ihre Schulden und begleichen sie, wenn sie können. Gute Männer aus Platäa!« Sein Lächeln wirkte zynisch. »Andere Schulden werden heute ignoriert. Niemand sonst steht uns zur Seite. Aber wir wissen, womit wir es zu tun bekommen. Unsere Kundschafter sind zurückgekehrt und scheinen nicht beunruhigt zu sein.« Er lachte, doch in seinem Blick lag kein Humor. »Die Perser sind bereits gelandet«, fuhr er fort und beugte sich dichter an Xanthippos heran. »Zwanzig- oder dreißigtausend Soldaten und noch mal so viele Ruderer. Es heißt, Eretria jenseits des Golfs von Euböa sei verloren und brenne noch. Nein, Xan. Wir müssen heute aufbrechen und sie attackieren, bevor sie zu weit ins Landesinnere vordringen und befestigte Stellungen errichten können. Wir haben nur eine Chance, sie ins Meer zurückzuwerfen. Wir werden also nicht auf die Spartaner warten. Sollen sie doch kommen, wenn wir gewonnen haben. Ich freue mich schon auf ihre Gesichter!«
»Wenigstens wartet keine Reiterei auf uns!«, sagte Xanthippos.
Epikleos schüttelte den Kopf. »Sie haben angeblich Pferde von Bord geführt.« Er wechselte einen besorgten Blick mit Xanthippos. Jeder, der schon mal zu Flötenklängen und Trommelschlägen in einer Formation marschiert war, kannte die Angst vor berittenen Feinden. Sie waren einfach zu schnell.
»Wo sind sie gelandet?«, fragte Xanthippos. »Wie weit weg?« Er spürte, wie sein Herz pochte – nicht vor Freude oder Angst, sondern in gespannter Erwartung. Er würde mit zehntausend bronzenen Hopliten in die Schlacht ziehen. Sie waren die Elitesoldaten von Athen und würden nicht versagen.
Epikleos stützte sich mit der Spitze seines Speers auf den staubigen Boden. »Auf der Ebene, wo der Fenchel wächst. Ich glaube …«
Er verstummte, als der Archon – der oberste Strategos der athenischen Streitmacht – die Stämme zur Aufmerksamkeit rief. Miltiades hatte einen dichten Bart und trug einen mit polierten Eisennoppen besetzten getäfelten Umhang. Seine Kleidung sah eher östlich als griechisch aus. Seine nackten Arme waren kräftig und schwarz behaart, seine Hände erinnerten an Keulen. Man konnte sich nur schwer vorstellen, wie er mit ihnen eine Geliebte streichelte. Sie schienen ausschließlich dazu geschaffen, andere zu zerschmettern und zu erwürgen.
Themistokles und Aristides befehligten unter ihm jeweils zwei Stämme im Zentrum des Heers. Als Archon hatte Miltiades in der Schlacht das Oberkommando über die Hopliten von Platäa und alle zehn athenischen Strategoi. Er selbst befand sich mit seinem eigenen Stamm im linken Flügel. Xanthippos schluckte. Der Stamm von Akamantis würde ebenfalls in diesem Flügel sein. Dort würde jeder die anderen Männer um sich herum kennen, aus der Schule und von den Truppenübungen, aus der Arbeit und der Volksversammlung. Sie trugen Schilde mit den Symbolen ihrer Häuser. Sie konnten nicht desertieren, während die anderen und die Geister ihrer Vorväter sie beobachteten. Und schon gar nicht unter den Blicken der Männer von Platäa! Nach der Schlacht würden sich in Griechenland keine Geschichten über die Feigheit der Athener verbreiten. Für Tage wie diesen machten sie ihre Kampfübungen und rannten jeden Morgen auf den Laufstrecken der Sportplätze.
Am Steinaltar schwang Miltiades ein Bein über einen riesigen schwarzen Widder und packte von hinten seinen Kopf. Das Tier wehrte sich mit aller Kraft. Kostbare Landkarten wurden zusammengerollt und stattdessen Bronzeschüsseln für das Blut aufgestellt. Zwei Wahrsager standen bereit, um aus der Leber des Widders die Zukunft zu lesen. Mit einem Mal war es so still geworden, dass Xanthippos die Banner im Wind knattern hörte.
Miltiades schlitzte dem Widder die Kehle auf. Während das Leben aus dem Tier entwich, trat es so heftig gegen den Steinaltar, dass die Schalen darauf vibrierten. Themistokles kam herbei, um Miltiades zu helfen. Er packte das Vlies des Widders und lenkte seinen Blutstrom in die Schüsseln. Nach einer Weile schlitzten die beiden Männer dem toten Tier der Länge nach den Bauch auf. Ihre Arme waren bis zum Ellbogen blutverschmiert, und sie hatten auch ein paar Spritzer im Gesicht. Die Wahrsager schnitten die glänzende Leber heraus und legten sie in eine Schüssel. Einer der beiden, der Oberste ihrer Kaste, untersuchte sie.
»Er wird hocherfreut sein«, raunte Epikleos Xanthippos zu. »So ein gutes Omen wird er noch nie gesehen haben.«
Und tatsächlich wies der Hohepriester von Athen auf irgendeine Besonderheit des Organs hin und strahlte. Die Generäle entspannten sich, und auch Xanthippos war erleichtert, obwohl er sich über Epikleos’ Respektlosigkeit ärgerte. Über solche Dinge machte man keine Witze. Er musste wieder daran denken, dass er das Auge auf seinem Schild verloren hatte, und betete leise zu Apoll, dass er trotzdem alles sehen würde. Der Gedanke, blind zu sein, machte ihm noch mehr Angst als der Tod selbst. Vielleicht, weil er sich Blindheit vorstellen konnte, während der Tod für ihn unbegreiflich blieb.
Als Miltiades den Eid der athenischen Hopliten aufzusagen begann, wurde es erneut leise. Die Männer von Platäa senkten die Köpfe und verschränkten in stummem Respekt die Hände, während zehntausend Stimmen in Miltiades’ Worte einfielen. Xanthippos wurde warm ums Herz.
»Ich werde meinen Speer und meinen Schild nicht entehren und die Schlachtreihe nicht verlassen. Ich werde alles, was heilig ist, verteidigen und das Land stärker machen, als ich es vorgefunden habe. Ich werde auf die hören, die mir befehlen, und die Gesetze meiner Stadt befolgen. Wenn jemand sie zu ändern versucht oder mich bedroht, werde ich nicht nachgeben. Ich werde niemals nachgeben. Ich ehre die Kulte und den Glauben. Die Götter sind meine Zeugen: Ares und Athena, Zeus, Thallo, Auxo, Herakles. Die Grenzen des Landes sind meine Zeugen, sein Weizen, seine Gerste, seine Oliven, seine Feigen und seine Weinstöcke. Meine Zeugen sind die, die heute an meiner Seite stehen.«
Die Hopliten brüllten, und die Männer von Platäa schlossen sich ihnen an. Als der laute Jubel erstarb und die Hörner erklangen, gesellte sich Miltiades zu den Kommandanten im linken Flügel. Er begrüßte Xanthippos mit einem Nicken. Miltiades würde mit den Hopliten der Stadt marschieren. Kundschafter und Kuriere ritten auf Pferden voraus. Ihnen folgten die Marketender, Diener, Waffenschmiede und Musikanten mit Wagen voller Wasserschläuche. Sie würden schnell vorankommen, da sie nur Proviant für ein einziges Mahl dabeihatten, das für alle reichen würde, die am Abend noch lebten.
Kapitel 3
Sie marschierten nach Osten, mit ockerfarbenen Bergen und grünem Gestrüpp zu ihrer Linken. Während sie der gewundenen Straße zur Küste folgten, erreichte die Sonne ihren höchsten Stand und schien im Zenit festzuhängen. Späher eilten voraus, zu Fuß oder auf flinken kleinen Pferden, die ebenso drahtig waren wie sie selbst. Diese Männer erstatteten zunächst dem Archon Miltiades Bericht, und erst danach den Strategoi, die sich in der Marschordnung hinter ihm befanden. Xanthippos beobachtete, wie die Burschen so schnell wie möglich herbeieilten, abstiegen und neben den Generälen hergingen, um ihnen alles mitzuteilen, was sie gesehen hatten. Es war keine besonders anspruchsvolle Aufgabe, und einige von ihnen waren fast noch Kinder. Sie schienen sich selbst jedoch unglaublich wichtig zu nehmen. War Xanthippos auch einmal so jung und unschuldig gewesen? Manchmal war ihm seine Jugend noch so präsent, als wäre sie gerade erst zu Ende gegangen. Doch an Tagen wie diesem konnte er sich kaum noch an sein damaliges Selbstvertrauen und seine schier unerschöpflich wirkende Kraft erinnern.
Miltiades führte die Marschkolonne an. Neben ihm gingen die Bannerträger und die jugendlichen Trommler. Für einen Mann in den Fünfzigern war er recht gut zu Fuß – zumindest solange Sklaven seinen Schild und den Speer trugen. Diese Waffen dienten nur zur Zier. Im Unterschied zu den übrigen Strategoi würde Miltiades nicht mitkämpfen, sondern seinen Deme aus der Ferne befehligen. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass auf dem Schlachtfeld wenigstens einer einen kühlen Kopf bewahrte.
An Miltiades’ Seite befand sich ein Mann, den Xanthippos nicht gut kannte. Kallimachos war zum Polemarch, dem offiziellen Kriegsherrn, bestimmt worden – er sollte bei diesem Feldzug die Augen und Ohren der Volksversammlung sein. Xanthippos bemerkte, dass er anstelle einer Rüstung lediglich einen Umhang, einen Chiton und Sandalen trug. Er sah aus, als befände er sich auf einem Ausflug ins Grüne. Die Autorität, die ihm verliehen worden war, hatte nicht einmal den Aufbruch vom Truppensammelplatz überlebt. Da er über keine persönliche Kampferfahrung verfügte, war ihm gar nichts anderes übrig geblieben, als die Befehlsgewalt sofort an Miltiades abzutreten.
Als Xanthippos beobachtete, wie Miltiades sich vorbeugte, um den Boten zu lauschen, wäre er am liebsten vorgelaufen, um ihre Neuigkeiten ebenfalls zu hören. Doch das ging nicht. Er musste bei den Männern bleiben, die er in die Schlacht führen würde. Natürlich schlug Epikleos, so laut, dass alle es hören konnten, vor, dass er doch mal nach vorne gehen und herausfinden solle, was sich so tat. Xanthippos reagierte nicht darauf. Die Strategoi waren keine geschwätzigen Straßenhändler, die sich neugierig um einen der Ihren scharten. Nein, er würde geduldig abwarten – und das wusste Epikleos ganz genau. Xanthippos sah, wie sein Freund sich amüsierte, und verfluchte ihn insgeheim dafür, während er sich bereit machte, den nächsten Jungen anzuhalten, der mit Neuigkeiten an der Kolonne entlang nach hinten lief. Er musste aufpassen, dass er nicht übersehen würde. Männern wie Epikleos oder Themistokles schien so etwas nie zu passieren. Im Gegensatz zu ihm zogen sie stets alle Blicke auf sich.
Xanthippos senkte den Kopf, um seinen finsteren Gesichtsausdruck zu verbergen. Als ein Mann in seiner Nähe eine Bemerkung über die bislang zurückgelegte Strecke machte, fuhr er ihm unverhältnismäßig barsch über den Mund. Xanthippos sah, dass der andere wütend wurde, und bereute seine Worte sofort, doch er konnte sie nicht zurücknehmen. Xanthippos hatte gelernt, sich niemals zu entschuldigen. Es spielte keine Rolle, ob die Männer seine Launen, seine politische Macht oder den Reichtum seiner Frau fürchteten. Wichtig war nur, dass sie in Reih und Glied blieben und nicht vor geschleuderten Steinen oder Pfeilen zurückschreckten, wenn er ihnen den Befehl zum Vorrücken gab. Nur so konnten sie bis zum Sonnenuntergang überleben. Marathon war lediglich fünf Wegstunden von Athen entfernt, rund einhundertsechzig Stadien, die alle zweihundert Schritte laut ausgerufen wurden. Die Straße war nur ein Trampelpfad, aber immerhin trocken im Sommermonat Metageitnion. Der längste Tag des Jahres lag bereits hinter ihnen. Dennoch würde es noch eine ganze Weile hell sein, wenn sie den Landeplatz der Perser erreichten. Miltiades und seine Strategoi wollten vor Ort entscheiden, ob sie noch an diesem Tag angreifen oder an einem sicheren Ort das Lager aufschlagen würden.
Xanthippos sah säuerlich zu, wie Miltiades weiterhin in aller Seelenruhe den Kundschafter an seiner Seite ausfragte. Ahnte er denn nicht, wie sehr die anderen Männer in der Kolonne nach Informationen gierten? Auch wenn die disziplinierten Athener sich ihre Ungeduld nicht anmerken ließen. Sie alle hatten an diesem Morgen genau wie Xanthippos ihre Häuser verlassen. Sie trugen die gleiche Bronze, den gleichen Speer und das gleiche Schwert wie er. Vielleicht verstanden sie ja auch ebenso gut wie er, was auf dem Spiel stand. Diese Vorstellung tröstete ihn.
Männer wie Themistokles und Aristides befanden sich in der Mitte der Marschkolonne, wo sie mit ihren Stämmen das Zentrum einer Gefechtslinie bilden konnten. Sie mussten genauso lange auf die Berichte warten wie Xanthippos. Als er zurückblickte, glaubte er zu sehen, dass Themistokles ihn anstarrte. Xanthippos lächelte nicht. Bei einem Marsch gab es keinen Platz für kleinliche Rivalitäten zwischen den Mitgliedern der Volksversammlung. Themistokles war ein Angeber, doch aus irgendeinem Grund, den Xanthippos nicht recht verstand, auch ein geborener Anführer. Die Soldaten freuten sich, wenn der blonde Hüne mit ihnen lachte, sich ihnen anvertraute und sie an der Schulter packte. Eigentlich hätten sie ihn dafür verachten müssen, so häufig, wie die Hoplitenausbilder vor Offizieren warnten, die um die Gunst ihrer Männer buhlten. Sie waren alte, knorrige Soldaten, die sich durch nichts beeindrucken ließen, doch wenn Themistokles sie inspizierte, lächelten sie wie kleine Jungs. Xanthippos hatte es schon mehrfach gesehen. Es war ihm ein Rätsel. Die Männer brauchten Stärke, Distanziertheit, ein strenges Auftreten. Sie wollten nicht von einem Strategos in Gefahr gebracht werden, der aus einem Weinschlauch trank und lachte, bis ihm das Gesöff aus der Nase lief.
Xanthippos schüttelte den Kopf. Themistokles’ Gegner taten ihn gern als leichtsinnigen Spaßmacher ab. Xanthippos glaubte jedoch, dass mehr in ihm steckte. Sein Ehrgeiz war nicht zu übersehen. Er wirkte sowohl kaltschnäuzig als auch amüsiert, als ob er nichts auf der Welt wirklich ernst nehmen könnte. Xanthippos wusste nicht, was er von ihm halten sollte, und war froh, dass sie nicht Seite an Seite kämpfen würden. Themistokles war ein Mann, der alles durcheinanderbrachte. Allerdings musste er sich wie die anderen Strategoi auch bedingungslos an Miltiades’ Befehle halten.
Xanthippos merkte, dass seine Kehle erneut trocken war, und rief nach Wasser. Der Junge, der sich umblickte und zu ihm gerannt kam, war in Miltiades’ Nähe gewesen. Es kam ihm ganz selbstverständlich vor, ihn nach Neuigkeiten zu fragen, wie er es auch bei einer Begegnung auf der Agora getan hätte. Der Wasserträger errötete vor Stolz, als er Xanthippos den Schlauch reichte. Er war bereits flacher, als er sein sollte. Im trockenen Landesinneren war Wasser ein kostbares Gut. Bis zum Ende des Tages würden sie alle wie Krähen krächzen. Xanthippos hatte es bereits erlebt.
»Der Kundschafter spricht von zehntausend Pferden und mindestens doppelt so vielen Männern.«
Xanthippos merkte, dass die Männer um ihn herum fast über ihre eigenen Füße stolperten, um etwas mitzubekommen, und winkte ab. Kaum jemand konnte große Zahlen zuverlässig einschätzen. Es war eine Fähigkeit, die weder gelehrt noch geübt werden konnte. Andererseits hatte Xanthippos an der ionischen Küste, dem westlichen Rand des persischen Reichs, einzelne Garnisonen gesehen, die ebenso groß gewesen waren wie das gesamte athenische Heer. Persische Gefangene hatten behauptet, es gebe in ihrer Heimat zahlreiche jeweils zehntausend Mann starke Regimenter und insgesamt eine Million Soldaten. Xanthippos konnte nur beten, dass sie gelogen hatten, um ihren Feinden Angst einzujagen.
»Sonst noch was?«, fragte er und betrachtete die Reihen vor sich. Wie Themistokles überragte auch Xanthippos die meisten seiner Landsleute. Würde ich löschen: Die Götter verliehen den Söhnen von Fischern und Wohlhabenden Größe, damit sie sich von den anderen abhoben. Er sah den Kundschafter nach hinten reiten. Bei Miltiades stand bereits der Nächste und zeichnete mit ernster Miene Bilder in die Luft, um zu veranschaulichen, was er beobachtet hatte.
»Die Schiffe sollen von Eretria über die Meerenge gekommen sein. Der Kundschafter hat gesagt, ein paar seiner Kameraden seien in die Hügel hinaufgestiegen und hätten vom Hafen in Eretria Rauch aufsteigen sehen.«
Xanthippos nickte bedrückt. Sobald sich ein Krieg anbahnte, zirkulierten sofort die wildesten Gerüchte, doch anscheinend hatte Epikleos recht gehabt. Eretria befand sich jenseits einer Meerenge nördlich von Marathon. Die lang gestreckte, hügelige Insel Euböa war ein natürlicher Schutzwall, der Athen gegen Poseidons Zorn abschirmte. Eretria war eine wohlhabende Hafenstadt mit rund dreißigtausend Einwohnern. Wenn die Perser sie überfallen hatten, war es dort sicher zu unvorstellbaren Gewaltakten gekommen – die womöglich nach wie vor im Gange waren. Xanthippos biss die Zähne zusammen. Er hasste die Perser für ihre Arroganz und entsetzliche Grausamkeit und wegen der quälenden Träume, die sie ihm aufgebürdet hatten. Manchmal glaubte er, zu vieles gesehen zu haben, um je wieder ruhig schlafen zu können. »Bring den Leuten weiter hinten Wasser, Kleiner«, sagte er.
Als Xanthippos den verwirrten und gekränkten Gesichtsausdruck des Jungen sah, bereute er seinen unfreundlichen Tonfall. Er streckte den Arm aus, um ihm die Haare zu zerzausen, doch der Junge duckte sich unter seiner Hand weg und rannte mit dem gurgelnden Wasserschlauch über der Schulter weiter nach hinten.
Der berittene Kundschafter transportierte derweil sein Wissen an der Kolonne entlang. Er trug die Nase so hoch, dass er Xanthippos erst bemerkte, als der die rechte Hand hob und ihn zu sich rief. Und sogar da schien der Mann noch zu zögern. Xanthippos blickte über die Schulter und sah, dass Themistokles ihn ebenfalls ungeduldig zu sich winkte.