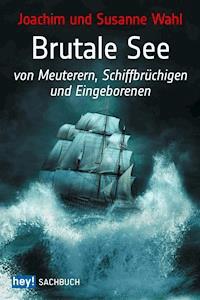
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jeder kennt sie – die Geschichten über wagemutige Seefahrer, tragische Schiffsunglücke und blutige Meutereien. Aber was verbirgt sich hinter den Mythen um Kapitän Ahab, William Bligh und den berühmt-berüchtigten Sklavenaufstand auf der Amistad? Dicht und hoch spannend erzählen Joachim und Susanne Wahl neun prägende Begebenheiten aus der Geschichte der Seefahrt und nehmen Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Begegnen Sie tollkühnen Abenteurern, eitlen Emporkömmlingen, grausamen Menschenschindern und wahren Helden. „Brutale See“ ist ein Buch über stolze Schiffe, nautische Meisterleistungen und mächtige Nationen. Aber vor allem ist es ein Buch über Menschen, die durch ihr Können und ihre Selbstlosigkeit, ihre Schwäche und Lasterhaftigkeit entscheidend zu dem Verlauf einiger der aufsehenerregendsten Kapitel der Seefahrtsgeschichte beigetragen haben. Jedes Kapitel enthält eine Einführung zum Zeitgeschehen, eine Beschreibung der Schiffe und ihrer Besatzungen sowie Erläuterungen zu Motivation und Ziel der Reisen. Wer mehr über die einzelnen Ereignisse oder allgemeine Aspekte der Seefahrt erfahren möchte, findet Infokästen zu ausgewählten Themen sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Brutale See
Von Meuterern, Schiffbrüchigen und Eingeborenen
Copyright der E-Book-Originalausgabe © 2015 bei hey! publishing, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung: FinePic®, München
ISBN 978-3-95607-297-0
www.heypublishing.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Themenkasten 1
Kapitel 1 Die Nieuw Hoorn 1619 – Explosion an Bord
Themenkasten 2
Kapitel 2 Die Batavia 1629 – Die blutigste Meuterei der Seefahrtsgeschichte
Themenkasten 3
Kapitel 3 Die Nijenburg 1763 – Meuterei der „Schwefelbande“
Themenkasten 4
Kapitel 4 Die Bounty 1789 – Rufmord und Klassenjustiz
Themenkasten 5
Kapitel 5 Das Floß der Medusa 1816 – „Das Gesetz der See“
Themenkasten 6
Kapitel 6 Der Walfänger Essex 1820 – Die wahre Geschichte zu Moby Dick
Themenkasten 7
Kapitel 7 Die Globe 1824 – Mord und Totschlag in der Südsee
Themenkasten 8
Kapitel 8 La Amistad 1839 – Irrfahrt eines Sklavenschiffs
Themenkasten 9
Kapitel 9 Das Maria-Massaker 1840 – Verschollen im australischen Busch
Danksagung
Glossar
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das 16. bis 19. Jahrhundert war die Zeit der großen Entdeckungsreisen und weitreichenden Kolonialisierungsbestrebungen. Die Weltmeere wurden befahren, um unbekannte Länder zu entdecken sowie neue Märkte und lukrative Handelswaren zu erschließen. Landnahme, Ausbeutung, kommerzieller Walfang und das Aufeinandertreffen von fremden Kulturen führten ebenso zu Konflikten wie die schwierigen Lebensbedingungen während monatelanger Schiffspassagen. Zivilisten, Soldaten und Matrosen waren auf engstem Raum zusammengepfercht. Es gab kaum eine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Das strenge Regiment, der nicht selten triste Alltag an Bord, physische und psychische Belastungen und die meist bunt zusammengewürfelten Besatzungen lieferten den Nährboden für Revolten. Dass missliebige Besatzungsmitglieder ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden, war nicht nur bei Piraten üblich, und gestrandete Schiffsbesatzungen sahen sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sie hatten sowohl gegen Hunger und Durst zu kämpfen als auch Auseinandersetzungen mit aggressiven Leidensgenossen und mitunter feindseligen Eingeborenen zu erwarten. So sollen bereits 1525 sämtliche Überlebenden einer bei Cape St. Helen in Florida gestrandeten, spanischen Karavelle von Ureinwohnern niedergemacht worden sein. Später eingeleitete Bergungs- und Rettungsaktionen waren nur in wenigen Ausnahmefällen von Erfolg gekrönt.
Verschiedene Ursachen
Die Archive großer Seefahrtsnationen, zum Beispiel der Niederlande, Englands, Spaniens und Portugals, sind voll mit Berichten von Schiffsunglücken, deren Ursachen und Folgen – Havarien, die durch den Verlust der Schiffe und ihrer Ladungen einen beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden darstellten und nicht selten gleich mehrere Hundert Menschen das Leben kosteten. Auslöser waren vielfach Naturgewalten, insbesondere tage- oder wochenlang anhaltende Stürme, die alleine den größten Zoll an Menschen und Material auf See gefordert haben. Daneben liest man von Monsterwellen, die noch bis vor wenigen Jahren als Seemannsgarn abgetan wurden, von Tsunamis, die durch Erd-, Seebeben oder Vulkanausbrüche verursacht wurden und von der Begegnung mit „Seeungeheuern“, die zumindest im Fall der Essex nicht gänzlich ins Reich der Phantasie verbannt werden können.
Andere Gründe für Schiffsdesaster waren technisches Unvermögen, verrottete Planken, versehentlich ausgelöste Feuersbrünste, bedrohliche Hungersnöte oder ansteckende Krankheiten an Bord, die mitunter komplette Schiffsmannschaften ins Verderben rissen. Walfänger gingen in ihren kleinen Fangbooten ein extrem hohes Risiko ein, denn der Waltran versprach enorme Gewinne. In unbekannten Gewässern lauerten Riffe nahe unter der Wasseroberfläche und die Seekarten der Zeit boten nur vermeintliche Sicherheit, denn Navigationsfehler zählten mit zu den häufigsten Gründen für den Verlust ganzer Schiffskonvois. Einige Ereignisse dieser Art mögen hier als Beispiel dienen:
Das britische Kriegsschiff Mary Rose sinkt in der im Ärmelkanal zwischen Hampshire und der Isle of Wight gelegen Meerenge Solent am 19. Juli 1545 bei ruhiger See und ohne direkte Feindeinwirkung bei der Abwehr eines französischen Flottenverbands. Die Viermastkaracke bekommt während eines Wendemanövers Schlagseite nach Steuerbord. Durch die offenen Stückpforten dringt Wasser ein. Mehr als 650 schwer bewaffnete Soldaten finden den Tod. 1968 wird das Wrack von Unterwasserarchäologen geortet, dann in mühsamer Kleinarbeit geborgen und später im Museum von Portsmouth präsentiert. Die Ausrüstungsgegenstände und Skelettreste, die im Schlick überdauert haben, sind einmalige Zeugnisse ihrer Zeit.
Am 1. April 1585 begibt sich die Santiago zusammen mit anderen Schiffen auf die Fahrt von Portugal nach Indien. Ein Sturm zerstreut die Flotte und isoliert das Schiff. Später läuft es vor der Küste von Mosambik auf ein Riff. Admiral Fernão de Mendonça und 18 weitere Männer besteigen das einzig unbeschädigte Beiboot und wollen Hilfe holen – kehren allerdings nie zurück. Ein Teil der Menschen rettet sich vorübergehend auf nahe gelegene Felsen, einige bleiben auf dem Wrack, andere ertrinken in der aufsteigenden Flut, die das Riff überspült. Um die notdürftig reparierte Schaluppe nicht zu überlasten, werden zahlreiche Personen ins Meer geworfen, so auch Fernão Ximenes, der sich anstelle seines älteren Bruders Gaspar zur Verfügung stellt, dann aber stundenlang hinter dem Boot her schwimmt und letztlich aus Barmherzigkeit doch wieder aufgenommen wird. Münzen aus dem Wrack sind noch heute im Antikhandel erhältlich.
Das fast 70 Meter lange, schwedische Flaggschiff Wasa versinkt am 10. August 1628 kurz nach seinem Stapellauf vor Stockholm. Beim Untergang des pompös ausgestatteten, aber völlig see-untüchtigen Dreimasters ertrinken etwa 50 Personen in Sichtweite des Ufers. In den Jahren von1956 bis 1961 wird das Wrack geborgen und archäologisch untersucht.
Beim Untergang der 26 Jahre alten und mit 100 Kanonen bestückten HMS Royal George, die für Reparaturarbeiten gekrängt im Spithead, dem östlichen Teil der Meerenge Solent, ankert, kommen am 29. August 1782 mindestens 800 Personen, fast die Hälfte davon Frauen und Kinder, ums Leben. Aufgrund der Seitenlage war Wasser in die Stückpforten eingedrungen. Laut Untersuchungsbericht sollen Planken, Kiel und Spanten vom Schiffsbohrwurm zerfressen gewesen sein.
Am frühen Morgen des 26. Februar 1852 läuft die Fregatte Birkenhead, ein Dampfschiff mit eisernem Rumpf, Schaufelradantrieb und Besegelung, vor Kapstadt in haiverseuchtem Gewässer auf ein Riff und sinkt innerhalb von 25 Minuten. Von den insgesamt etwa 690 Besatzungsmitgliedern, Soldaten und Passagieren überleben nur weniger als 200. Zum ersten Mal in der Seefahrtsgeschichte gilt nicht der Grundsatz „Jeder ist sich selbst der nächste“, sondern „Frauen und Kinder zuerst“. Die meisten Militärs ertrinken unter Deck im Schlaf. Ein Großteil der Soldaten des 74. schottischen Hochland-Infanterieregiments versinkt in Hab-Acht-Stellung.
Meuterei
Der Begriff „Meuterei“ ist militärischen Ursprungs und steht für gemeinschaftlich begangene Gehorsamsverweigerung, Bedrohung oder tätliche Angriffe gegen Vorgesetzte. Der Sachverhalt ist heute sowohl im deutschen Wehrstrafgesetz (WStG §§ 20 ff.) wie im Seemannsgesetz (SeemG §§ 115 f.) als auch im Zusammenhang mit der Gefangenenmeuterei im Strafgesetzbuch (StGB § 121) verankert, wird rückblickend und im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch vor allem mit der Schifffahrt in Verbindung gebracht. Zu meutern heißt, die bestehende Hierarchie in Frage zu stellen. Es gilt der Grundsatz: Eine (dienstliche) Anordnung, und sei sie auch noch so sinnlos, muss ausgeführt werden – Nichtbefolgung bedeutet Meuterei. Bereits die Verabredung oder der Versuch einer Auflehnung gegenüber weisungsbefugten Personen sind strafbar. Unter Umständen genügt schon ein nur widerwillig oder zögerlich ausgeführter Befehl, um eine entsprechende Strafe zu provozieren. Und ein Schiff auf hoher See ist eine Welt für sich. Man kann sich auch bei persönlichen Animositäten kaum aus dem Weg gehen, ist im Rahmen der Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten einzelner Besatzungsmitglieder wohl oder übel aufeinander angewiesen. Das reibungslose Zusammenspiel Aller ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen der Mission.
Die möglichen Ursachen für eine Meuterei sind vielfältig. Dazu gehören ungenügende oder schlechte Verpflegung, unpünktlich oder zu gering ausbezahlte Heuer und über längere Zeit verwehrter Landgang. Wer meutert, greift die bestehende Ordnung an, will die Machtverhältnisse ändern, will sich nicht mit den Privilegien der Höhergestellten an Bord abfinden, kann ungerechtfertigte oder übermäßig harte Disziplinarmaßnahmen gegenüber sich selbst oder seinen Kameraden nicht ertragen oder will, aus welchen Gründen auch immer, das Schiff und/oder die geladenen Besitztümer an sich bringen – und riskiert dabei wissentlich die Todesstrafe. Das trifft dann in der Regel nicht nur die Rädelsführer, sondern auch deren Mitläufer und manchmal sogar diejenigen, die sich den Meuterern lediglich im Eifer des Gefechts angeschlossen haben, um vorerst am Leben zu bleiben. Seeleute sind genügsam, leidensfähig, fatalistisch und hart im Nehmen, meist auch religiös und bis zu einem gewissen Grad abergläubisch. Es muss also schon eine außergewöhnliche Situation eintreten, um sie dazu zu veranlassen, gegen die Obrigkeit aufzubegehren. Drei Beispiele aus der jüngeren Geschichte mögen verdeutlichen, dass auch politische Motive eine solche Aktion bewirken können:
Ende Juni 1905 soll der starke Madenbefall im Suppenfleisch der unmittelbare Auslöser der Meuterei auf der Knjas Potjomkin Tawritscheski, bekannt unter der Bezeichnung „Panzerkreuzer Potemkin“, gewesen sein. Es war allerdings ein Aufstand gegen den Zaren, dem sich unter den Aktivisten Afanasij Matjuschenko und Grigori Wakulintschuk etwa einhundert Kameraden anschlossen und der den Kommandanten und einige Offiziere des Schiffes das Leben kostete. Die Aufrührer wollen zunächst der Revolution in Odessa beistehen, gewinnen unter den Verfolgern sogar noch einige Überläufer, müssen dann aber, nach einigem Hin und Her, das Scheitern ihres Vorhabens eingestehen, setzen die Potemkin im rumänischen Konstanza eigenhändig auf Grund und erbitten politisches Asyl. Zwei Jahre später wird Matjuschenko mit einem gefälschten Pass in Russland aufgegriffen, abgeurteilt und erhängt.
Zum Ende des ersten Weltkriegs plant die Admiralität am 24. Oktober 1918 eine finale Entscheidungsschlacht der deutschen Flotte gegen die britische Royal Navy. Doch die Matrosen wollen nicht aus Gründen der Ehre verheizt werden und verweigern den Befehl. Die betreffenden Schiffe werden nach Kiel zurückbeordert, wo sich die Arbeiter mit den Seeleuten solidarisch erklären. Es kommt zur sogenannten Novemberrevolution. In deren Folge ist Kaiser Wilhelm II. letztlich zur Abdankung gezwungen. Die Weimarer Republik entsteht.
Im November 1975 übernehmen der Politoffizier Kapitänleutnant Valeri Sablin und andere Mitglieder der Führungscrew in einer unblutigen Aktion das Kommando über die sowjetische Fregatte Storoschewoi („Wächter“), um mit Hilfe der Medien auf massive Missstände im Reich aufmerksam zu machen. Ein linientreuer Offiziersanwärter kann fliehen und die Behörden über das Vorhaben informieren. Sablins Fluchtversuch nach Schweden endet vor Gotland. Er ergibt sich und wird später exekutiert. Seine Geschichte lieferte die Vorlage für den Kinofilm „Roter Oktober“ mit Sean Connery in der Hauptrolle.
Die Bounty und die Hermione
Ein Kapitän, der bereits bei geringfügigen Verfehlungen zu drakonischen Maßnahmen griff, zog zwangsläufig den Unmut seiner Mannschaft auf sich. Und dass es offensichtlich sadistisch veranlagte Schiffsführer, Offiziere und Unteroffiziere gab, die ihre Untergebenen bei jeder sich bietenden Gelegenheit drangsalierten, ist mehrfach belegt. In der Unausweichlichkeit des Schiffsalltags schien daraufhin eine Meuterei in manchen Fällen regelrecht vorprogrammiert.
Der mit Abstand berühmteste Aufstand, der in diesem Zusammenhang stets genannt wird – und deswegen auch in diesem Buch nicht fehlen darf, ist die Meuterei auf der Bounty, die sich Ende April 1789 ereignete und durch mehrere Filmklassiker als Prototyp einer von einem despotischen Kommandanten provozierten Rebellion ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Doch inzwischen ist bekannt, dass die Geschehnisse um Kapitän William Bligh und seinen Gegenspieler, Steuermannsmaat Fletcher Christian, differenzierter betrachtet werden müssen. Ersterer war zwar ein Pedant, neigte zu Jähzorn und Arroganz, war jedoch nicht der gewalttätige Tyrann, als der er gerne hingestellt wird, und letzterer war nicht die standhaft-aufrechte und vielfach gedemütigte Identifikationsfigur mit ausgeprägtem Sinn für Edelmut und Gerechtigkeit, sondern ein wahrscheinlich gestörter und äußerst labiler Charakter. Im Übrigen verlief die Meuterei auf der Bounty, ohne dass unmittelbar jemand zu Schaden gekommen wäre und ist damit die am wenigsten dramatische und harmloseste Story in diesem Buch. In ihrer Kolumne über die nachstehend kurz zusammengefassten Ereignisse auf der Hermione schrieb Annabel Venning in der Daily Mail vom 21. Februar 2009: „The mutiny which occurred onboard HMS Hermione in 1797 made the events on the Bounty appear civilised.“[1] Die Rebellion auf der Hermione gilt bis heute als die blutigste Meuterei in der Geschichte der britischen Kriegsmarine. Ein kurzer Abriss der Geschehnisse mag als Einstimmung dienen:
Die Fregatte HMS Hermione ist knapp 40 Meter lang, fast 10 Meter breit und mit 32 Geschützen bestückt. Sie läuft nach über zweijähriger Bauzeit im September 1782 vom Stapel und patrouilliert erfolgreich in der karibischen Mona Passage. Im Verband mit der HMS Renommee und der HMS Diligence nimmt sie mehrere Prisen zwischen Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Mit dem Oberbefehl über die 170 Mann starke Besatzung war seit Februar 1797 der inzwischen 28-jährige Hugh Pigot betraut worden. Spross einer Familie hochrangiger Marineoffiziere, der bereits zwölf Jahre zur See gefahren war, als er mit 24 zum Kommandeur der HMS Swan aufstieg und ein halbes Jahr später die HMS Success übernahm. Seit dieser Zeit eilte ihm der Ruf eines überheblichen, brutalen und skrupellosen Leuteschinders voraus. Kapitän Pigot hatte nicht nur im Schnitt alle drei Tage eine Auspeitschung angeordnet, sondern in der Regel auch ein Mehrfaches der üblichen Zahl von zwölf Schlägen verhängt – zwei seiner Untergebenen waren den Verletzungen infolge ihrer Bestrafung mit der „neunschwänzigen Katze“ erlegen.
Im September 1797 ereignen sich innerhalb weniger Tage drei Vorfälle, die das Fass zum Überlaufen bringen: Ein Matrose aus der Crew von Midshipman David Casey vergisst beim Einholen der Segel einen Reffknoten anzubringen. Casey wird daraufhin gezüchtigt und degradiert. Während eines Sturms sind die Männer in der Takelage fieberhaft damit beschäftigt, die Segel einzuholen. Da gibt der Kapitän Order, so schnell wie möglich abzuentern. Wer als Letzter an Deck erschiene, würde ausgepeitscht werden. Somit war vorhersehbar, dass es am ehesten die weit oben beschäftigten Toppgasten treffen würde, die zu den angesehensten Matrosen zählten. In ihrer Panik stürzen daraufhin drei junge Seeleute zu Tode. Pigot, davon völlig ungerührt, verhöhnt die Verunglückten abfällig als „Landratten“, eine Bezeichnung, die unter Seeleuten als schwere Beleidigung gilt und lässt sie ohne das übliche Zeremoniell über Bord werfen. Diejenigen, die es wagen, sich darüber zu beschweren, bekommen anderntags die Peitsche zu spüren.
Am späten Abend des 21. September eskaliert die Situation. Kanonenkugeln scheppern über das Deck und behindern die herbei eilenden Offiziere. Etwa zwei Dutzend Matrosen, einige alkoholisiert, fallen mit Entermessern und Beilen bewaffnet über den Kapitän her, schleudern ihn schwer verletzt ins Meer. Kurze Zeit später fallen der aufgestauten Wut der Männer noch weitere neun Männer zum Opfer, darunter der Schiffsarzt und ein erst 14-jähriger Fähnrich. Auch sie landen, zum Teil noch lebend, im Wasser. Master Southcott, Geschützmeister Searle, Zimmermann Price, Casey und der Koch Moncrief, die unter anderem zur Steuerung des Schiffes noch von Nutzen sind, werden verschont. Um sich der britischen Gerichtsbarkeit zu entziehen, segeln die Meuterer anschließend nach Venezuela, übergeben die Hermione dem spanischen Gouverneur und bitten um politisches Asyl. Den dortigen Behörden versichern sie, man habe Kapitän Pigot und die anderen Offiziere ausgesetzt – ganz so, wie etwa acht Jahre zuvor auf der Bounty verfahren worden war.
Das Schiff wird in Santa Cecilia umbenannt, zwei Jahre später im Auftrag von Admiral Sir Hyde Parker aber von den Engländern wieder zurückerobert und zuletzt unter dem Namen HMS Retribution 1805 in den Docks von Deptford abgewrackt. Die britische Marine fahndet noch längere Zeit nach den Meuterern und kann letztlich 33 von ihnen vors Kriegsgericht bringen. Casey, Southcott und einige andere werden begnadigt, 24 Männer zum Tod verurteilt und erhängt.
Jede Geschichte ist anders
In diesem Buch werden neun ausgewählte Begebenheiten aus der Zeit vom frühen 17. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts geschildert und vor dem Hintergrund neuester Forschungsergebnisse dargestellt. Allesamt Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben und sich aus überlieferten Schriftquellen detailliert rekonstruieren lassen. Alte Logbücher, Augenzeugenberichte, Tagebücher von Beteiligten oder Berichte von Zeitgenossen liefern die Grundlage für spannende Einblicke in ein Genre, das rückblickend häufig romantisierend betrachtet wird, in Wirklichkeit jedoch von harten Lebensbedingungen geprägt war.
Jede Geschichte ist anders – einige bekannt, andere nahezu unbekannt, verschiedene haben „Geschichte geschrieben“, darstellende Künstler, Romanschriftsteller oder Filmschaffende inspiriert, manche sind im Dunkel der Historie versickert und erst später im Zuge archäologischer Entdeckungen wieder ins Blickfeld geraten. Es handelt sich weder um Piraten- oder Freibeutergeschichten noch um Begegnungen von Seekriegsverbänden. Zu beiden Themen existieren zahlreiche Publikationen. Auch sind Legende und Wirklichkeit nicht immer zu trennen.
Die vorgestellten Geschehnisse sind authentisch und beschränken sich bewusst auf die zivile Seefahrt. Die jeweiligen Akteure und Opfer sind fast durchweg namentlich bekannt. Dem Leser begegnen Personen, die real existiert und gelitten haben. Ihre Schicksale rühren an, ihre Charaktere sind so vielfältig, wie man sich Zeitgenossen überhaupt nur vorstellen kann, die Geschehnisse mitunter erschreckend oder faszinierend. Wir begegnen erbarmungslosen Psychopathen ebenso wie Menschen, die angesichts ausweglos erscheinender Situationen über sich hinaus wachsen oder seemännische Meisterleitungen vollbringen, Menschen, die versagen und resignieren, solchen, die heldenhaft und mutig agieren, aber auch solchen, deren Selbstüberschätzung oder Fahrlässigkeit Tragödien heraufbeschwören. Wir finden Kameradschaft, Souveränität und Empathie ebenso wie Verachtung, primitive Gewalt und Rücksichtslosigkeit. In Extremsituationen, wie zum Beispiel bei den Überlebenden der Essex, war Kannibalismus der letzte Ausweg, um nicht zu verhungern.
Zu jedem Kapitel gehören eine kurze Einführung zum Zeitgeschehen und der eigentlichen Motivation der Reise sowie die Beschreibung des Schiffes und der Zusammensetzung seiner Besatzung, soweit es die Archivlage erlaubt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ablauf der Ereignisse, dem Hergang der Katastrophe beziehungsweise den Aktivitäten der Protagonisten wie auch der Schilderung dessen, was danach geschah – bis hin zur Aussendung von Suchexpeditionen, dem Aufspüren von Meuterern und deren Bestrafung, dem weiteren (beruflichen) Werdegang einzelner Beteiligter oder dem Schicksal des Schiffes. Literaturhinweise ermöglichen dem Leser eine weitergehende, intensivere Beschäftigung mit den jeweiligen Vorfällen.
Themenblöcke zu einzelnen, allgemeinen Aspekten der Schifffahrt oder den Möglichkeiten des Überlebens auf hoher See dienen einerseits als inhaltliche Trenner zwischen den Kapiteln und sollen andererseits zu einem tieferen Verständnis der vor Jahrhunderten an Bord herrschenden Bedingungen beitragen. Dem Interessenten sei insbesondere das außerordentlich facettenreiche, von Eberhard Schmitt herausgegebene, Werk „Indienfahrer 2 – Seeleute und Leben an Bord im Ersten Kolonialzeitalter“ aus dem Jahr 2008 empfohlen.
Hinter den Geschichten
Wer sich mit den Hintergründen der überlieferten Geschichten näher beschäftigt, dem erschließen sich im wahrsten Sinne des Wortes neue Welten. Die Reiseberichte europäischer Zeitgenossen vermitteln nicht nur die zu erwartende, ethnozentrische Sicht- und Denkweise des 16. bis 18. Jahrhunderts, sie erlauben zudem faszinierende Einblicke in mannigfache Lebensbereiche der besuchten Völker. Der Leser weiterführender Literatur entdeckt exotische Speise- und Getränkevorlieben, traditionelle Methoden von Pflanzenbau und Viehwirtschaft, ungewöhnliche Alltagspraktiken, Opfer- und Bestattungsrituale oder detaillierte Beschreibungen zur Kleidung und zum Erscheinungsbild. So erfährt er zum Beispiel von Menschenopfern, Männern, die wie Frauen lebten, weißen Mohren, archäologischen Untersuchungen an Gräbern der „Titicacarasse“, Handel mit Menschenkot, Frauen, die bessere Händler waren als Männer, dass Tabakpflanzen mit abgestandenem Urin gespritzt wurden oder die Bezeichnung „Rhinozeros“ ganz allgemein für Lasttiere verwendet wurde.
Nicht weniger bemerkenswert sind die logistischen Leistungen der Vereinigen Ostindischen Compagnie, abgekürzt VOC, die im Laufe ihrer fast zweihundertjährigen Geschichte immense Waren- und Geldströme zwischen den Niederlanden und ihren überseeischen Gebieten bewegte. Jahresberichte ihrer Handelsniederlassungen, akribisch geführte Bestell- und Lieferlisten, Schiffsjournale und Logbücher liefern detaillierte Angaben zu stattgefundenen Transaktionen. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Walfangs, die unmenschlichen Begleitumstände des Sklavenhandels, die Probleme der Territorialverwaltungen im Umgang mit Eingeborenen und anderes können im vorliegenden Band nur gestreift werden.
Zuständigkeiten und Hierarchie
Für den reibungslosen Ablauf einer langen Seereise mit mannigfachen logistischen, technischen und nautischen Herausforderungen, insbesondere in kritischen Situationen, war eine klare Kommandostruktur unabdingbar. Jedes Besatzungsmitglied wusste genau, wer wem was zu sagen und was er zu tun oder zu lassen hatte.
Auf den Kapitän – bei der VOC Schiffsführer oder Schipper genannt – und seinen Stellvertreter, den Obersteuermann, die vor allem für die Navigation verantwortlich waren, folgten einer bis drei Untersteuerleute. Sie veranlassten Segelmanöver und instruierten den Rudergänger. Zur mittleren Führungsebene gehörten der Hochbootsmann, quasi ein Obermatrose, der zweite Bootsmann, auch als Schiemann bezeichnet, die sich mit ihren Maats und Gehilfen um die Takelage, Tau- und Blockwerk, Anker, Pumpen, Laden und Löschen oder das Teeren des Schiffes zu kümmern hatten.
Mit speziellen Aufgaben betraut waren der Krankentröster, der sonntags eine Predigt las und sich um das Seelenheil der Männer bemühte, während der Oberchirurg mit seinen Assistenten die leibliche und medizinische Versorgung der Kranken und Verwundeten sicherstellte, oder der Konstabler, zuständig für die Schiffsartillerie, das Trockenhalten des Pulvers und Vorgesetzter der Kanoniere. Weitere Sonderfunktionen erfüllten der Bottelier, der die Essensrationen austeilte und dafür sorgen musste, dass die Vorräte nicht verdarben; häufig mehrere Böttcher zum Anfertigen und Instandhalten von Fässern, Zubern und Eimern sowie der Quartiermeister mit Aufsicht über die Wachablösung, den Ausguck, das Aussetzen der Beiboote und beim Landgang. Und nicht zuletzt der Koch mit seinen Küchenjungen, die festgesetzte Zeiten zu beachten hatten; der Profos, der den Wachwechsel ausrief und Disziplinarstrafen vollzog; der Schiffskorporal zur Pflege der Handwaffen; ein Trompeter und weitere Handwerker wie Segelmacher, Schmied sowie ein halbes Dutzend Zimmerleute, die als „Müßiggänger“ keine Wache gehen mussten. Am unteren Ende der Hierarchie standen die Matrosen, die weniger erfahrenen Jungmatrosen und ganz unten mehrere Dutzend Schiffsjungen, kaum älter als zwölf bis vierzehn Jahre und ständig mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.
Zur Besatzung der VOC-Schiffe gehörten außerdem Beamte der Kompagnie, die vor allem die Interessen ihrer Auftraggeber im Blick hatten. Der Oberkaufmann stand sogar noch über dem Kapitän und konnte diesem, auch ohne jegliche seemännische Erfahrung, Weisungen erteilen. Ihm zugeordnet waren ein Unterkaufmann sowie Buchhalter und Assistenten, die den Warenverkehr protokollierten, Journale führten und Berichte verfassten. Dazu kamen Soldaten, deren Kommandeur zwar in der Offiziersmesse speiste, dem Schiffspersonal aber nichts zu sagen hatte, die neben der Bewachung von Kapitänskajüte und Konstablerkammer oder gelegentlichem Exerzieren während der Fahrt nicht weiter beansprucht waren. Sie wurden, wie die Kaufleute, für mindestens fünf Jahre zum Dienst nach Übersee geschickt. Die meisten von ihnen überlebten diese Zeit nicht, viele starben an Tropenkrankheiten. Nur etwa 30 % sahen ihre Heimat jemals wieder.
Organisation und Anspruch
Eine Seereise, bei der Hunderte von Menschen unterschiedlichster Funktion, Herkunft und sozialer Stellung für längere Zeit auf engstem Raum zusammengepfercht leben müssen, bedarf fester Regeln. Auf den Handelsschiffen der VOC heuerten im 18. Jahrhundert im Schnitt über 50% Ausländer an. Doch nur wenige Besatzungsmitglieder hatten Anspruch auf etwas Intimsphäre. Lediglich den höheren Diensträngen, oberen Funktionsträgern oder vornehmeren Passagieren standen eigene Kajüten zu – die besten Quartiere dem Kapitän und dem Oberkaufmann. Steuerleute, Unterkaufmann, der oberste VOC-Assistent sowie betuchte Privatpersonen erhielten in der Regel ebenfalls separate Kabinen, die Schreiber Gemeinschaftsunterkünfte. Allesamt im Heck gelegen. Ihnen und ihren Bediensteten war zudem der Decksbereich achtern des Großmastes vorbehalten, wo sich der Seegang weniger auswirkt. Die feine Gesellschaft speiste auf Zinngeschirr, mit Servietten und Tischtüchern, Stewards reichten den Wein aus eigenen Vorräten. Der Kommandeur der Soldaten und der Krankenbesucher aßen ebenfalls in der Offiziersmesse, der Konstabler in seiner Kammer, die Bootsleute und der Schiffskorporal in der Back, wo ihnen immerhin noch eine doppelte Getränkeration zustand.
Die Soldaten, die zum Dienst in der Niederlassung abkommandiert waren, wurden auf dem Orlop-Deck einquartiert, das auf der Rückfahrt als Warenlager diente, und durften nur zu bestimmten Zeiten an Deck. Sie, wie auch die Matrosen, wurden in sogenannte Packe, Tische oder Messen zu sieben bis acht Mann eingeteilt, von denen jeweils einer für eine Woche für Essenholen und Abwasch zuständig war. Sie aßen mit Holzgeschirr zwischen ihren Seekisten und Schlafmatten kauernd. Den weniger privilegierten Passagieren wurde das Zwischendeck zugewiesen. Um Ärger zu vermeiden, achtete man darauf, sie von den Besatzungsmitgliedern mit niederen Diensträngen fernzuhalten. In den Augen der Seeleute waren sie lediglich Platzhalter für die spätere Fracht, zudem ansonsten lästig, da zu Beginn der Schiffsreisen jämmerlich das Deck verunreinigend und ständig im Weg stehend, später neugierig und ständig meckernd.
Wichtige Entscheidungen an Bord traf der Schiffsrat, dem neben dem Schipper, Obersteuermann und Hochbootsmann auch der Ober- und Unterkaufmann sowie, bei entsprechendem Dienstrang, der Kommandeur der Soldaten angehörten. Hier wurde nicht nur beschlossen, ob unterwegs weitere Häfen angesteuert werden sollten, sondern auch Disziplinarstrafen ausgesprochen. Fuhren mehrere Schiffe im Konvoi, gab es einen übergeordneten Breiten Rat.
Obwohl der Oberkaufmann mit 80-100 Gulden monatlich mehr verdiente als der Kapitän und gut das Doppelte seines Stellvertreters, wurden hochrangige Kompagnie-Angestellte immer wieder wegen Schmuggels und Selbstbereicherung überführt. Buchhalter kamen mit circa 20 Gulden auf dasselbe Lohnniveau wie Konstabler, Koch, Hochboots- und Unterzimmermann, ein einfacher Matrose auf elf und ein Schiffsjunge auf fünf Gulden.
Themenkasten 1
Skorbut – Mit Zahnfleischbluten fängt es an
Die Anzeichen von Skorbut, auch „Scharbock“, „Faulfieber“ oder „Seepest“ genannt, einer Krankheit, die auf länger andauernden Vitamin C- beziehungsweise Ascorbinsäuremangel zurückzuführen ist, waren schon bei Seeleuten der Antike gefürchtet. Erste Symptome sind Blutungen und Schwellungen des Zahnfleischs, Durchfall, Fieber, Zahn- und Haarausfall. Dann kommen Gelenkentzündungen sowie Geschwüre an Unterschenkeln und Füßen hinzu. Skorbutgeschädigte Knochen sind anfälliger für Frakturen, Wunden heilen schlecht, das Immunsystem wird zunehmend schwächer. Gewebeeinblutungen führen zu anämischen Zuständen und in fortgeschrittenem Stadium folgen Muskelatrophie, Blindheit, Halluzinationen und Tod durch Herzversagen.
Die Holländer wussten solch dramatischen Verläufen bereits Ende des 16. Jahrhunderts durch die gezielte Verabreichung von Zitrusfrüchten zu begegnen. Gerrit de Veer, unter Kapitän Jacob van Heemskerck und Obersteuermann Willem Barentsz mitfahrender Handelsvolontär und Überlebender der 1596/97 gescheiterten Suche nach einem nördlichen Seeweg nach Indien, erwähnt in seinem Bericht aus dem Jahr 1598 mehrfach die segensreiche Wirkung des Löffelkrauts. Als weitere – mehr oder weniger wirksame – Gegenmittel galten Essig, Wein, aus Fichten- und Kieferntrieben gebrautes „Sprossenbier“, Zwiebeln, Knoblauch, Rüben, Kresse, Petersilie, Sellerie, Sauerampfer oder Obst in jeglicher Form. Der berühmte Entdecker James Cook schwor bei seiner zweiten Weltumsegelung 1776 insbesondere auf die Wirkung von Malzextrakt und Sauerkraut im Verbund mit ausreichend Frischwasser sowie regelmäßigen Reinigungsmaßnahmen an Bord.
Die bei ausgewogener Ernährung verfügbare, körpereigene Vitamin C-Reserve eines Erwachsenen reicht circa zwei bis drei Monate aus. Spätestens dann gilt es, wieder Frischobst oder -gemüse zuzuführen – was bei Passagen, die oftmals ein halbes Jahr oder länger dauerten, nicht immer einfach zu bewerkstelligen war. Bei entsprechender Versorgung besserte sich der Zustand der Betroffenen nach fünf bis zehn Tagen zusehends.
Auch wenn die Kapitäne stets danach trachteten, ihre Vorräte unterwegs aufzufrischen, finden sich in den Logbüchern immer wieder Eintragungen, wonach große Teile der Schiffsbesatzung oder Passagiere infolge des Scharbocks arbeitsunfähig wurden oder starben. Von der Etoile, die Anfang September 1768 auf ihrer Fahrt nach Borneo auf den Molukken ankerte, wird berichtet, dass die gesamte Mannschaft von Skorbut befallen, die Hälfte davon schwer erkrankt und der Schiffsmeister bereits gestorben waren. Fast zwanzig Jahre später waren auf der Nootka im Prinz William Sound nur der Kapitän und zwei Matrosen noch einsatzbereit, 22 Besatzungsmitglieder dem Scharbock erlegen. Nach einem erfolgreichen Reihenversuch des schottischen Schiffsarztes James Lind ordnete die britische Admiralität Ende des 18. Jahrhunderts für ihre Seeleute die regelmäßige Gabe von Zitronensaft an.
Kapitel 1 Die Nieuw Hoorn 1619 – Explosion an Bord
Der geschichtliche Hintergrund und die „VOC“
Die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert war in Europa eine Zeit politischer, geistiger und wirtschaftlicher Umwälzungen. Im Augsburger Religionsfrieden von 1555 war zwar die Gleichberechtigung zwischen Anhängern der Reformation und Katholiken anerkannt worden, aber die interkonfessionellen Konflikte schwelten weiter und mündeten schließlich 1618 in den Dreißigjährigen Krieg, eines der verheerendsten Ereignisse auf europäischem Boden. Die Konflikte mit den Türken, die Siebenbürgen und Ungarn besetzt hatten, führten 1593 in einen Krieg, der bis 1606 andauerte. Gleichzeitig war der Freiheitskampf der Niederlande gegen die Herrschaft Spaniens in ein neues Stadium getreten, nachdem sich die nördlichen Provinzen Holland, Seeland, Utrecht, Friesland und andere 1579 zu einer Union zusammengeschlossen und zwei Jahre später für unabhängig erklärt hatten. Die Grenzkonflikte zu den weiterhin spanisch dominierten Südprovinzen konnten vorläufig 1609, aber endgültig erst 1648 befriedet werden. Die Republik der Vereinigten Niederlande entwickelte sich nun zu einer ernst zu nehmenden Wirtschaftsmacht, ging auf Konfrontationskurs zu den Spaniern, Portugiesen und Engländern, die den lukrativen Überseehandel bislang kontrolliert hatten und steuerte die Gewürzinseln direkt an. Die unterschiedlichen Interessen aller Beteiligten wurden sowohl in den Kolonialgebieten selbst als auch unterwegs auf See immer wieder in blutigen Auseinandersetzungen ausgefochten.
Den Seeweg nach Indonesien um die Südspitze Afrikas herum hatten zuerst die Portugiesen gefunden. Ende des 16. Jahrhunderts organisierten dann niederländische Kaufleute mit hohem Gewinn eigene Handelsreisen, unter anderem nach Banten auf Java, zu den Molukken und Banda-Inseln – zwischen 1595 und 1599 mehr als ein Dutzend Fahrten, für die jeweils eigene Handelsgesellschaften gegründet worden waren. Der erste Konvoi stand unter Leitung von Cornelis de Houtman, nach dessen Bruder Frederic de Houtman 1619 die Houtman-Abrolhos vor der Westküste Australiens benannt worden waren[2]. Die niederländischen Unternehmer stellten alsbald fest, dass die Konkurrenz untereinander unnötige Ressourcen band. Nach längeren Verhandlungen – Einfluss, Proporz und Zuständigkeiten betreffend – wurde daraufhin am 20. März 1602 die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ins Leben gerufen. Eine Aktionärsgesellschaft mit einem Gründungskapital von umgerechnet drei Millionen Euro und föderaler Struktur, die, gegen entsprechende Abgaben, von staatlicher Seite nicht nur mit einem Handelsmonopol für das Gebiet zwischen dem Kap der guten Hoffnung und der Magellanstraße versehen, sondern auch mit uneingeschränkten Hoheitsrechten für diese Regionen ausgestattet wurde. Damit verband sich das Privileg zur Ernennung von Gouverneuren, zum Bau von Handelsniederlassungen, Siedlungen und Festungsanlagen sowie zur Unterhaltung von Armeeeinheiten. Ebenso das Mandat zum Abschluss von Verträgen mit örtlichen Landesfürsten oder der Durchführung militärischer Operationen zur Durchsetzung eigener Ansprüche. Die VOC, seinerzeit auch gelegentlich personifiziert als „Jan Kompanie“[3] bezeichnet, konnte demnach in den überseeischen Gebieten wie ein eigener Staat agieren. Geleitet wurde sie von einem Gremium mit Hauptsitz in Amsterdam, dem die Direktoren der Kammern, die ihre jeweiligen Gesellschaften vertraten, angehörten – aufgrund ihrer Anzahl die „Heeren XVII“ genannt[4] –, die gleichzeitig auch als Teilhaber involviert waren. Aktien gezeichnet hatten Vertreter aller Einkommensschichten vom Dienstpersonal bis zum Topverdiener.
Die VOC kontrollierte zu ihrer Blütezeit ab der Mitte des 17. Jahrhunderts nahezu den gesamten Warenverkehr zwischen Asien und Europa, mischte im innerasiatischen Handel mit und hatte zu dieser Zeit bereits 17.000 Soldaten sowie 12.000 Seeleute unter Vertrag. Sie betrieb etwa dreißig Handelsstationen in Übersee, unter anderem auf Ceylon, Taiwan, Sumatra, Celebes und den Molukken in Indien, Bengalen, Thailand und Japan und vertrieb Pfeffer, Muskatnüsse, Nelken und Zimt, später verstärkt Textilien, Silber, Kaffee, Tee, Salpeter, Farbstoffe wie Indigo und Zinnober, Luxusgüter wie japanische Lackarbeiten und chinesisches Porzellan. Ihre Hauptniederlassung in Ostindien gründete sie 1619 auf der indonesischen Insel Java durch einen Festungsbau an dem Ort, der bis dato Jacarta hieß und nannte die Stadt fortan Batavia. Diese wurde Sitz von Generalgouverneur Jan Pieterzoon Coen van Hoorn mit absoluter Herrschaftsgewalt und des Hohen Rats, dem die obersten Vertreter der VOC sowie die ranghöchsten Militärs der Garnison vor Ort angehörten. Dieser Rat koordinierte sämtliche Aktivitäten der VOC in Asien, war lediglich den Herren XVII Rechenschaft schuldig und zudem für anhängige Gerichtsverfahren zuständig. Wie an anderen Standorten auch entstanden Hafenanlagen, Marktplätze, Kirchen, Hospitäler und wehrhafte Forts. Um die Jahrhundertwende lebten in Batavia bereits 70.000 Menschen.
Das Handelsimperium der VOC erlitt im Verlauf des 18. Jahrhunderts deutliche Risse. Infolge steigender Verwaltungskosten, veränderter Kundenwünsche, dem Erstarken konkurrierender Nationen und politischer Veränderungen, wie zum Beispiel dem vierten Niederländisch-Englischen Krieg 1780-1784 und den napoleonischen Kriegen zwischen 1795 und 1806, wurde sie, fast zweihundert Jahre nach ihrer Gründung, zum Jahresende 1799 offiziell liquidiert. Während dieser Zeit sind Schätzungen zufolge Waren im Gegenwert von über einhundert Milliarden Euro umgesetzt und auf den VOC-Werften mehr als 1500 Schiffe unter Segel gesetzt worden. Die astronomischen Gewinne der Großaktionäre wurden sogar durch die stets allgegenwärtige und bei einer derart weit verzweigten Organisationsform kaum kontrollierbare Korruption ihrer Bediensteten nur unwesentlich geschmälert. Mitnahmeeffekte und mannigfache Gelegenheiten zur Selbstbereicherung hatten es nicht wenigen VOC-Angestellten erlaubt, sich mit einem erklecklichen Vermögen zur Ruhe zu setzen.
„Denkwürdige Beschreibung der Ost-Indischen Reise …
… von Willem Ysbrantsz[5] Bontekoe van Hoorn“ lautet der Titel des 1646 erschienenen Journals eines der bekanntesten niederländischen Kapitäne, die für die VOC in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts tätig waren. Aber erst der Untertitel seines Berichts lässt erahnen, dass der „Schipper nebst Gott“, wie sich die Schiffsführer seinerzeit ebenfalls zu nennen pflegten, tatsächlich Außergewöhnliches erlebte: „Ergreifende, höchst wunderliche und gefährliche Dinge, die ihm widerfuhren“[6]. Das Bildnis des damals 59-jährigen zeigt einen älteren Herrn mit hoher Stirn, tiefen Stirnfalten, vorstehenden Wangenknochen, markanter, schmaler Nase, Schnauzer und Kinnbart. Seine Reise hielt ihn fast sieben Jahre von zu Hause fort. Obwohl auf Tagebüchern des Protagonisten basierend, steht zu vermuten, dass sein Verleger Jan Jansz. Deutel aus Leiden den Bericht noch stilistisch überarbeitet, dem Zeitgeist entsprechend dramatisiert und Schipper Bontekoe ein besonders hohes Maß an Gottvertrauen in den Mund gelegt hat.
Ein Eintrag im Taufregister der reformierten Gemeinde der holländischen Stadt Hoorn weist für den 27. Juni 1587 seinen Vater als Ysbrant Willemsz. van Westsanen aus. Den Namen Bontekoe legte sich die Familie erst später zu – in Anlehnung an die Darstellung einer schwarzbunten Kuh, die den Giebel ihres Hauses in der Veermanskade 15 schmückte. Willem soll mindestens neun Geschwister gehabt haben, darunter zwei Brüder, die, wie sein Vater, ebenfalls als Schipper tätig waren. Ansonsten ist über seine Familie wenig bekannt. Bevor er mit 31 Jahren bei der VOC verpflichtet wurde, war er als Handelsschiffer in Diensten seiner Vaterstadt unterwegs. Im August 1617 war sein Schiff De Bontekoe, mit einer Holzladung in die Levante beordert, von algerischen Piraten[7] aufgebracht und den befeindeten Spaniern ausgeliefert worden. Da gerade ein Waffenstillstand mit den Niederlanden ausgehandelt worden war, kamen der Schipper und seine Mannschaft gegen Zahlung von Lösegeld frei. Die Herren XVII übertrugen ihm das Kommando über die Nieuw Hoorn mit dem Auftrag, von Generalgouverneur Jan Pietersz Coen in Ostindien angefordertes Kriegsmaterial nach Batavia zu transportieren. Die VOC war von dort aus ständig bestrebt, ihre Handelsbeziehungen, nötigenfalls mit Gewalt, auszubauen.
Bontekoe ist furchtlos, zupackend, den ihm anvertrauten Männern gegenüber fürsorglich und verantwortungsbewusst, belesen[8], manchmal aber auch ein bisschen dickköpfig und lässt – im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen – gegenüber den Eingeborenen, denen er begegnet, bisweilen sogar ein gewisses Verständnis durchblicken. Der im Auftrag der Kammer von Hoorn ebendort auf Kiel gelegte, nagelneue Dreimaster Nieuw Hoorn hat eine Ladekapazität von 350 Lasten[9] und ist ein mittelgroßes Retourschiff mit typischem Spiegelheck, zwei Beibooten und üblicher Bestückung zur Abwehr von Seeräubern. Der oberste VOC-Vertreter an Bord ist Oberkaufmann Heyn Rol. Außer ihm und dem Schipper nehmen 204 Mann an der Reise teil.
Die ersten Monate auf See
Am 28. Dezember 1618 legt die Nieuw Hoorn von Texel, 18 Meilen vor Amsterdam gelegen, ab. Ihr Ziel ist Bantam, ihre Fracht besteht aus 56.000 Silbermünzen, die für die Unternehmungen der Compagnie in Übersee, wie zum Beispiel den Ausbau der Infrastruktur oder den Ankauf neuer Ware, die Entlohnung der Angestellten, insbesondere aber auch als Bestechungsgelder für diverse Lokalfürsten gedacht sind, und 360 Fässer mit Schießpulver als Nachschub für die Garnison vor Ort beziehungsweise die in der Region operierenden Schiffe und Soldaten. Bereits Anfang Januar gerät das Schiff in einen heftigen Sturm, der zwei Wochen lang anhält. Stehendes Wasser auf dem Oberdeck zwingt die Matrosen, ihre aufschwimmenden Seekisten zu zertrümmern, da diese beim Ausschöpfen im Weg sind. Am Großmast zeigt sich ein gefährlicher Riss, aber es gelingt, ihn mit Hilfe einer Stenge durch das Hauptdeck hindurch behelfsmäßig zu wangen – ansonsten hätte die Reise bereits hier ihr vorläufiges Ende gefunden. Kurz darauf kommen die Enchuysen und die Neu-Zeelandt in Sicht, die Richtung Koromandelküste beziehungsweise Java unterwegs sind. Man tut sich zusammen und der kleine Konvoi nimmt Kurs auf die Kanaren. In einer Kalme treibt die Nieuw Hoorn von den anderen ab zur Ilha del Fogo, einer der Kapverdischen Inseln, die zu dieser Zeit von Spanien besetzt ist. Doch der Landgang zur Auffrischung von Proviant und Wasservorräten scheitert im Kugelhagel ihrer Feinde. Unterdessen muss der Großmast durch Anlegen einer aufgesägten Spiere erneut verstärkt werden. Bontekoe notiert, dieser sei nun „fast so dick, wie eine Kirchensäule“. Die drei Schiffe finden erneut zueinander und so erfährt der Schipper, dass die anderen auf der Ilha de Mayo ebenfalls unter Beschuss geraten und dabei zwei Seeleute ums Leben gekommen sind.
In Äquatornähe wechseln sich unstete Winde und Flauten ab, es dauert Wochen, bis die kleine Flotte bei den Abrolhos vor der brasilianischen Küste beidrehen und Kurs auf das Kap der guten Hoffnung nehmen kann. Mit steifem Westwind im Rücken entschließen sich die Schipper dann jedoch, entgegen den Vorgaben der VOC, das „Kap de Bonesperance“ nicht anzulaufen. Noch sind keine Versorgungsprobleme an Bord aufgetreten. Doch das soll sich bald ändern. Die Enchuysen hält sich nun Richtung Nordost und der Kapitän der Neu-Zeelandt kann sich mit Bontekoe nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen, die Nieuw Hoorn ist wieder solo unterwegs. Die Überquerung des Indischen Ozeans steht bevor, Skorbut bricht aus. Mehrere Dutzend Männer erkranken. Kurze Zeit später liegen bereits 40 von ihnen arbeitsunfähig in ihren Kojen. Bontekoe bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, Madagaskar anzusteuern. Aber starke Brandung verhindert die Landung. Inzwischen sind einige der Kranken gestorben. Das Schiff erreicht die unbewohnte Insel Maskarinas nahe Mauritius.
Trotz Rols Bedenken lässt der Schipper die stark geschwächten Männer an Land bringen. Zu deren Versorgung findet die Mannschaft alles, was das Herz begehrt: Tauben, Papageien und Gänse im Überfluss, Landschildkröten, die mit Trockenpflaumen gekocht werden und deren ausgelassenes Fett sich bestens zum Braten des Federviehs eignet. Bei der Vogeljagd büßt Obersteuermann Jan Piet ein Auge ein, als der Lauf und der Schaft seiner Flinte beim Schuss auseinander fliegen. Fische, Aale sowie Kokos- und „Zuckerpalmen“ ergänzen den üppigen Speiseplan. Nach drei Wochen, die nebenbei genutzt wurden, um das Schiff zu kalfatern und durchzulüften, sind die meisten wieder genesen. Man nimmt Proviant auf, unter anderem etwa 100 Schildkröten und in Essig eingelegten Fisch. Nächste Station ist die Insel Sancta Maria nahe Madagaskar.
Hier wird die Besatzung freundlich empfangen und mit jeder Menge Obst versorgt. Die Eingeborenen tauschen Schafe, Kälber und Reis gegen Glasperlen, Löffel und kleine Glocken. Bontekoe hält fest, dass sie scheinbar Ochsenköpfe anbeten – „ohne Sinn für den wahren Gott“. Die Besatzung krängt das Schiff und reinigt dessen Rumpf vom anhaftenden Muschelbelag. Dann geht es in südöstlicher Richtung weiter und auf 33° südlicher Breite mit kontinuierlichem Westwind über den Indischen Ozean, um die übliche Route wieder aufzunehmen.
Ein Missgeschick und eine fatale Kettenreaktion
Um in die Sundastraße einfahren zu können, galt es, rechtzeitig nach Nordost abzudrehen. Doch die Nieuw Hoorn scheint etwas vom Kurs abgekommen zu sein. Am Nachmittag des 19. November 1619 befindet sie sich rund 80 Meilen von Sumatra entfernt auf etwa 5,5° südlicher Breite. Botteliersmaat Keelemeyn ist gerade damit beschäftigt, Branntwein abzuzapfen, um davon anderntags jedem Seemann seine übliche Ration austeilen zu können[10]. Um in dem dunklen Laderaum besser sehen zu können, hat er den mitgebrachten Kerzenhalter fest in den Boden des darüber liegenden Fasses gesteckt. Beim ruckartigen Herausziehen des Halters passiert das Unglück: ein Stück brennender Docht[11] fällt versehentlich genau in das Spundloch des Fasses. Der Alkohol fängt augenblicklich Feuer, das Fass zerspringt. Sofort wird mit reichlich Wasser gelöscht und die Angelegenheit scheint noch mal glimpflich ausgegangen zu sein. Aber eine halbe Stunde später wird erneut Feueralarm gegeben – der brennende Branntwein war nach unten geflossen und hatte die dort lagernde Schmiedekohle entzündet. Jetzt schlagen die Flammen empor. Sofort werden Eimerketten gebildet, um so viel Wasser wie möglich heranzuschaffen. Die gesamte Besatzung ist in Aufregung, der Schipper packt an vorderster Front mit an. Doch die glühenden Kohlen verursachen eine extrem starke Rauchentwicklung. Die Männer können im Zwischendeck kaum etwas sehen, stinkend schwefliger Qualm nimmt ihnen den Atem.
Bontekoe schickt sie zwischendurch nach oben, befürchtet, einige könnten bereits erstickt sein. Um noch mehr Wasser ins Innere zu bringen, werden Löcher ins Hauptdeck geschlagen.
Inzwischen arbeiten sich die Flammen bedrohlich an die Pulvervorräte heran. Der Schipper will die Fässer schleunigst über Bord gehen lassen, doch Rol verweigert seine Zustimmung. Auf diese Weise könne man zwar das Schiff retten, hätte dann allerdings einem feindlichen Angriff nichts mehr entgegenzusetzen. Unter den Seeleuten macht sich zunehmend Panik breit. Einige sind schon in die Barkasse geflüchtet, die die Nieuw Hoorn im Schlepptau hat. Jetzt wird auch die Schaluppe vom Oberdeck noch zu Wasser gelassen. Immer mehr Besatzungsmitglieder setzen sich ab. Auf Zuruf klettert nun auch der Oberkaufmann am Fallreep herunter, will die Männer in der Barkasse dazu bewegen, auf Bontekoe zu warten, doch die hören nicht auf ihn – kappen die Taue und rudern vom brennenden Schiff weg. Der Schipper hatte in der Hektik unter Deck nichts bemerkt, hastet nach oben und ist stinksauer, lässt das aufgegeite Großsegel anbrassen und will den Flüchtigen in seiner Wut über den Leib wegsegeln[12]. Die Nieuw Hoorn kommt den beiden Booten näher – da spitzt sich die Lage auf dem Schiff erneut zu.
Bontekoe und die Zimmerleute klettern über die Reling und versuchen, Löcher in den Rumpf zu bohren, wollen den Kielraum zwei bis drei Meter voll laufen lassen, um endlich dem Feuer Einhalt zu gebieten. Doch die Bordwände sind mit Metallplatten beschlagen. Gleichzeitig werden nun fieberhaft Pulverfässer ins Meer geworfen, doch das geht nicht schnell genug. Unmengen von Wasser sind schon in den Laderaum geschüttet worden, aber es hilft nichts. Mit dem nunmehr ebenfalls in Brand geratenen Öl breiten sich die Flammen noch schneller überallhin aus. Es passiert das Unausweichliche: Die restlichen 300 Pulverfässer detonieren in einer gewaltigen Explosion und zerreißen das Schiff in zigtausend Stücke. In diesem Moment sind noch rund 120 Menschen an Bord, etwa die Hälfte davon zusammen mit dem Schipper auf der Back[13]. Sie werden „hinweg gerissen und zu Brei geschlagen“. Bontekoe schickt ein Stoßgebet gen Himmel, fliegt durch die Luft und findet sich wenige Augenblicke später inmitten der Trümmer auf dem Wasser treibend wieder. Neben ihm der Großmast, an dem er sich festklammert. Mit „zerschundenem“ Rücken und zwei Kopfwunden hat er das Inferno überlebt.
Eben verschafft sich der Schipper noch ein Bild von der Lage, da taucht in seiner Nähe Harmen von Kniphuysen auf. Dem Jungmatrosen gelingt es, auf einen Teil des Vorderstevens zu klettern und Bontekoe mit Hilfe einer Spiere zu sich zu bugsieren. Während die Sonne untergeht, nähern sich die beiden Boote der Unglücksstelle. Harmen kann sich schwimmend retten, doch der verletzte Schipper muss mit Hilfe eines Seils zur Schaluppe gezogen werden.
Nach zwei Wochen Land in Sicht
Von den ursprünglich 206 Männern an Bord sind noch 72 am Leben. Neben Bontekoe, Rol und Harmen konnten sich unter anderen Obersteuermann Piet, Untersteuermann Meyndert Krijnsz, Schiffszimmermann Teunis Ysbrantsz sowie der Barbier und Schiffsarzt und der Prediger retten. Gegen den Rat Bontekoes, vorerst in der Nähe der Trümmer zu bleiben, um bei Tagesanbruch eventuell noch umher treibende Lebensmittel auffischen oder vielleicht sogar einen Kompass bergen zu können, gibt der Oberkaufmann die Anweisung loszurudern. Bei Helligkeit erweist sich diese Aktion als schwerer Fehler. Außer zwei kleinen Wasserfässchen und acht Pfund Zwieback stehen den Überlebenden keine weiteren Vorräte zur Verfügung. Es ist abzusehen, dass sie damit nur wenige Tage bestehen können. Die Männer müssen nun voll und ganz den Fähigkeiten ihres Schippers vertrauen, der infolge seiner Verletzungen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist.
Bontekoe ordnet umgehend an, die Hemden auszuziehen und daraus Segel zu nähen. Als Garn dient ein aufgespleißtes Tau. Er bastelt sich einen Kreuzstab sowie einen Gradbogen, ritzt eine Windrose und eine grobe Seekarte in den Boden des Bootes und orientiert sich nach dem letzten Besteck auf der Nieuw Hoorn. In der Nacht dienen die Sterne als zusätzliche Navigationshilfe. Schon wenig später gibt es nichts mehr zu essen und etwas zu trinken nur sporadisch in Form von Regenwasser. Die Männer leiden erbärmlich und werden zunehmend schwächer. Kein Land weit und breit. Um nicht voneinander getrennt zu werden und gemeinsam dem Tod ins Auge zu blicken, werden als nächstes die Seeleute aus dem kleinen Boot mit ins größere genommen. So können jetzt insgesamt 30 Riemen und mehrere Segel eingesetzt werden. Doch die Verzweiflung wächst. Dass sich einmal ein paar Möwen und fliegende Fische in die Reichweite der Männer verirren, bringt nur vorübergehende Linderung. Sie werden im Rohzustand herunter geschlungen. Gegen das Durstgefühl kämpfen die zunehmend kraftlosen Männer, indem sie Flintenkugeln lutschen, Meerwasser oder ihren eigenen Urin trinken. Sie sind kurz davor, das letzte Tabu zu brechen. Die Männer diskutieren darüber, erst den Schiffsjungen zu verspeisen, danach den Würfel entscheiden zu lassen. Bontekoe ist entsetzt und kann ihnen noch eine Dreitagesfrist abringen, um bis dahin endlich auf Land zu stoßen.





























