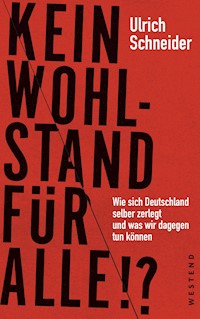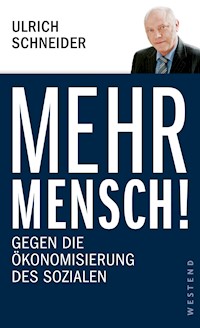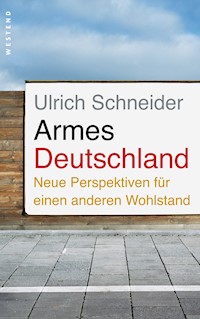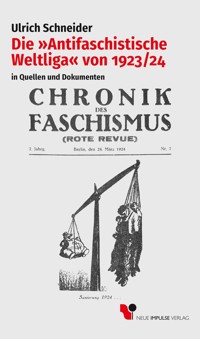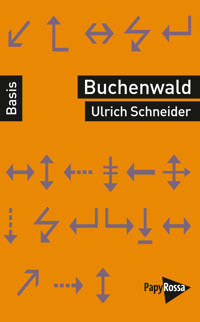
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PapyRossa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Den »Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit« schworen die überlebenden KZ-Häftlinge von Buchenwald, als sie am 19. April 1945 nach der Befreiung auf dem Appellplatz des Lagers zusammenkamen. Hinter ihnen lagen Qualen, Folter und tausendfacher Tod von Mithäftlingen, ›Vernichtung durch Arbeit‹, ausgerichtet auf die Kriegsproduktion; lag der Versuch der SS, jeden Widerstand zu brechen. Errichtet als Lager für politische Gegner und andere Menschen, die außerhalb der ›Volksgemeinschaft‹ verortet wurden, verschleppte man im November 1938 kurzfristig 10.000 jüdische Männer nach Buchenwald. Mit Kriegsbeginn erhielt das KZ eine zentrale Funktion bei der Gefangenschaft von Nazigegnern aus überfallenen Ländern – es wurde international. Derweil kamen mehr als 130 Außenlager hinzu, darunter knapp 30 Frauenlager. Doch Buchenwald ist nicht bloß Sinnbild des NS-Terrors, sondern steht auch für den organisierten Widerstand der Häftlinge, die – flankiert von den herannahenden alliierten Truppen – am 11. April die Selbstbefreiung des Lagers erreichten. Ihre Losung von der »Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln« aus dem ›Schwur von Buchenwald‹ bleibt bis heute Vermächtnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Häftlinge mussten auf der linken Brustseite und dem rechten Hosenbein ein Stoffdreieck tragen, für jede Häftlingsgruppe verschiedenfarbig. Für jüdische Menschen kam ein gelbes Dreieck hinzu. Fluchtverdächtige, 1a-Häftlinge und (ehem.) Wehrmachtsangehörige wurden ebenfalls kategorisiert. Zudem wurde die Häftlingsnummer angebracht. Häftlinge aus dem Ausland kennzeichnete ein Anfangsbuchstabe.
Basiswissen
Politik / Geschichte / Ökonomie
Ulrich Schneider
Buchenwald
Ein Konzentrationslager
Eine Übersicht aller Titel der PapyRossa-Reihe Basiswissen Politik / Geschichte / Ökonomie finden Sie unter shop.papyrossa.de/basiswissen
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-89438-845-4 (Print)
ISBN 978-3-89438-916-1 (Epub)
1. Auflage 2025
© 2025 by PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Köln
Luxemburger Str. 202, 50937 Köln
E-Mail: [email protected]
Internet: www.papyrossa.de
Alle Rechte vorbehalten – ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
Inhalt
Warum dieses Buch?
I. Die Entstehung des KZ Buchenwald
II. Vom Leben und Überleben im Lager bis zum Krieg
III. Das Lager im Krieg
IV. »Vernichtung durch Arbeit«
V. Überlebenskampf und Häftlingswiderstand
VI. Der Weg zur Selbstbefreiung und das politische Vermächtnis
VII. Vom Umgang mit den Tätern
VIII. Mahnungen eines Überlebenden Statt eines Nachworts
Kurze Chronik zum KZ Buchenwald
Literaturhinweise
Warum dieses Buch?
Am 19. April 1945, nach der Befreiung des Konzentrationslagers, formulierten die Überlebenden auf dem Appellplatz ihren bis heute überdauernden »Schwur von Buchenwald« als politisches Vermächtnis: »Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel«. Davor stand der Überlebenskampf, die »Vernichtung durch Arbeit« in einem auf den Krieg ausgerichteten Lager, dessen konkrete Bauplanungen im Frühsommer 1937 auf dem Ettersberg bei Weimar Gestalt annahmen, aber auch der Häftlingswiderstand.
Daran zu erinnern, bleibt eine Aufgabe für heute und morgen. Zwar findet man auf dem Buchmarkt oder in Bibliotheken zahlreiche Bücher, die sich mit dem Thema KZ Buchenwald beschäftigen. Auch in der Gedenkstätte sind Kataloge und Publikationen zu Einzelaspekten der Lagergeschichte zu erhalten. Doch dieses Buch unterscheidet sich in mehrerlei Hinsicht von den vorherigen Veröffentlichungen.
Es erhebt nicht den Anspruch, alle Themenbereiche abzudecken. Das ist bei dem gewählten Reihenformat weder möglich noch geplant. Es geht vielmehr darum, einen ersten substanziellen Überblick zur Geschichte dieses Konzentrationslagers zu vermitteln. Der Band ist so angelegt, dass er zur Vorbereitung auf einen Besuch der Gedenkstätte Buchenwald genutzt werden kann. Es gilt auch bei Gedenkstättenfahrten der Satz: »Man sieht nur, was man weiß.«
Der wesentliche Unterschied dieses Buches gegenüber anderen verdienstvollen wissenschaftlichen Veröffentlichungen besteht darin, dass die Darstellung des Lagers aus der Perspektive der ehemaligen Häftlinge erfolgt. Über die historischen Fakten hinaus ist gerade die Geschichte eines Konzentrationslagers vielfach geprägt durch die Sichtweise der Betroffenen. Aus biologischen Gründen ist die Ära der Zeitzeugen faktisch abgelaufen. Diejenigen, die von Beginn an das Lager und seine Strukturen politisch bewusst wahrgenommen haben und die den Nachgeborenen in den 1980er und 1990er Jahren umfänglich als Zeitzeugen ihre Sicht auf Buchenwald nahegebracht haben, leben nicht mehr. Manchmal haben sie ihre Erfahrungen verschriftlicht, es wurden zahlreiche (Video-)Interviews mit ihnen gemacht, die teilweise substanziell, teilweise oberflächlich, manchmal aus einem spezifischen Erkenntnisinteresse nur Einzelbereiche behandelten. So wertvoll solche Videos auch sind, für Nachgeborene können sie nur eingeschränkt das Fehlen der Zeitzeugengeneration ersetzen. Insbesondere können sie nicht auf Fragen, die von jüngeren Generationen gestellt werden, Antworten geben.
Im Archiv der Gedenkstätte finden sich viele Zeitzeugenberichte, die in Veröffentlichungen eingeflossen sind, etwa in »Konzentrationslager Buchenwald – Bericht des Internationalen Lagerkomitees Buchenwald« (1945), in die Dokumentation »Buchenwald. Mahnung und Verpflichtung« (1960), in den »Buchenwald-Report«, herausgegeben von David Hackett (1945, veröffentlicht 1995) oder in den Band »Buchenwald. Ein Konzentrationslager« (2000). Sie sind als Quelle für Kundige eine wahre Fundgrube, als Einführung in die Lagergeschichte jedoch nur schwer nutzbar, weil sie ihre eigene Entstehungsgeschichte und ihren jeweiligen historischen Kontext haben, ohne den sich ihre Aussagekraft nur schwer erschließt. Immer wieder ist es bei Nachgeborenen zu erleben, dass sich ihnen dieser Kontext auch deshalb nicht mehr erschließt, weil ihnen das Korrektiv bzw. der Kommentar eines Zeitzeugen fehlt. Dass in der Retrospektive selbst Zeitzeugen einander widersprechende Aussagen machten, konnte man vor einigen Jahren bei einer Befreiungsfeier erleben, wo ein über Hundertjähriger glaubte, einen verstorbenen deutschen Mithäftling öffentlich kritisieren zu müssen.
Was bedeutet unter diesen Voraussetzungen die »Perspektive der Überlebenden«?
Zunächst geht die Darstellung von den Schilderungen der Häftlinge aus, weniger von den Materialien und Dokumenten, die auch auf Seiten von der SS zu finden sind. SS- und Lager-Dokumente waren »Herrschaftsakten«, selbst wenn sie von den Gefangenen in der Häftlingsschreibstube erstellt wurden. Gleichzeitig haben die inzwischen in den Arolsen Archives zu findenden Transportlisten ihre ganz eigene Geschichte, die sowohl von der Rettung als auch vom Tod berichten.
Als Schilderungen der Häftlinge sind nicht nur Einzelberichte, sondern insbesondere kollektiv erstellte Darstellungen von Bedeutung. Jeder einzelne Häftling konnte nur einen kleinen Ausschnitt der Lagerwirklichkeit sehen. Pierre Durand1 sprach davon, es hätte viele Buchenwalds auf dem Ettersberg gegeben. Von Zeit zu Zeit entstanden daraus Fehleinschätzungen und – nach der Befreiung – auch Anschuldigungen gegenüber Mithäftlingen, die nach 1990 als »Quellen« zur »wissenschaftlichen« Denunziation der »roten Kapos« missbraucht wurden.
Im Kollektiv der Überlebenden entwickelten sich in den Jahren nach der Befreiung tragfähige Einschätzungen, auch wenn die Bereitschaft, sich mit schwierigen Themen öffentlich zu beschäftigen, angesichts des Ost-West-Konflikts und geschichtspolitischer Kontroversen nur eingeschränkt vorhanden war. Denn die Gedenkstätte Buchenwald war nicht nur ein Ort, den die DDR als Ausdruck ihres antifaschistischen Selbstverständnisses gestaltete, auch seitens der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft wurde die Gedenkstätte für ideologische Angriffe und als Referenzfolie für Geschichtspolitik genutzt. Wer zum Beispiel in den 1980er Jahren aus Westdeutschland mit Jugendgruppen nach Buchenwald fuhr, war Diffamierungen durch die CDU ausgesetzt. Verleumdungen der Gedenkstätte hat es nach dem Ende der DDR 1989/90 weiterhin gegeben. Nicht allein die Bild-Zeitung tat sich mit Denunziationen der »roten Kapos« bei der Erinnerungsarbeit hervor, Forderungen nach »Abwicklung des Antifaschismus« und Umschreibung der Geschichte wurden auch von Politikern erhoben. In dieser Zeit war es insbesondere den Überlebenden des Lagers Buchenwald aus dem In- und Ausland zu verdanken, dass sie mit ihrer persönlichen Integrität derlei haben verhindern können.
Der Verfasser hatte das Glück, an Tagungen und Begegnungen mit Überlebenden – insbesondere der bundesdeutschen Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora – teilzunehmen und deren intensive Diskussion zu kontroversen Themen verfolgen zu können. Zudem lernte er im Laufe der Jahre überlebende Frauen und Männer aus verschiedenen anderen Ländern persönlich kennen, aus den Niederlanden, aus Frankreich und Italien, aus Israel, Österreich und Ungarn. Ihre Perspektive war noch einmal eine gänzlich andere, war sie doch mit dem eigenen Patriotismus2 und der spezifischen Verfolgung als Zwangsarbeiter, als Kind im Lager und mit anderen Erlebnissen verknüpft.
Diese Erfahrungen des inhaltlichen Austausches mit solchen Zeitzeugen, ihren Berichten und Perspektiven, ihrem jeweiligen Fokus in der Beschäftigung haben dazu beigetragen, dass der Verfasser eine vielschichtige Sichtweise auf die Wirklichkeit des Lagers entwickeln konnte. Das ist keine »Multiperspektivität«, wie sie in der heutigen Geschichtsdidaktik gerne hochgehalten wird. Was in dieses Buch keinen Eingang findet, ist die Sicht der SS und der »Volksgemeinschaft«, der Mehrheitsgesellschaft außerhalb des Lagerzauns also. Es ist stattdessen eine Vielschichtigkeit, die von den unterschiedlichen Perspektiven der Häftlinge ausgeht und die Zeugnisse der Überlebenden in den Mittelpunkt stellt.
11923-2002, Kommunist, Kämpfer in der Résistance, französischer Häftling, langjährig Präsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos – IKBD.
2Der Begriff »Patriotismus« bzw. »Patriot« mag heute für Irritationen sorgen. Jedoch verstanden sich fast alle Frauen und Männer im Widerstand in den okkupierten Ländern als Patrioten, die – unabhängig von ihrer jeweiligen politischen Überzeugung – für die Freiheit ihrer Heimat kämpften. Der Begriff steht dabei nicht im Widerspruch zum Internationalismus. So lautet der Titel eines Films über Peter Gingold und andere Deutsche in der französischen Résistance »Frankreichs fremde Patrioten«.
I.Die Entstehung des KZ Buchenwald
Warum ein Lager auf dem Ettersberg?
Im Rahmen der Umstrukturierung des faschistischen Lagersystems, d. h. der Auflösung kleinerer Lager, zum Beispiel des KZ Lichtenburg und anderer, und der Schaffung größerer Konzentrationslager, die für eine dauerhafte Unterbringung von Gefangenen angelegt waren, wurden ab 1936 die Lager Sachsenhausen (1936), Buchenwald (Juli 1937), Flossenbürg (Mai 1938), Mauthausen (August 1938, dem »Anschluss« Österreichs) und, als Frauenkonzentrationslager, Ravensbrück (Mai 1939) geschaffen. Zusammen mit Dachau, das ohne Unterbrechung seit 1933 in Betrieb war, und Neuengamme bildeten sie das System der Lager in der Phase der Kriegsvorbereitung.
Die Hauptfunktion dieser Lager war die Möglichkeit der längerfristigen Ausschaltung politischer Gegner, Anhänger der Arbeiterparteien und Gewerkschaften, linker Intellektueller und christlicher Nazigegner, in Vorbereitung auf den geplanten Krieg. Aus der Sicht der Nazis war der Erste Weltkrieg durch die Unruhen an der Heimatfront verloren worden (»Dolchstoßlegende«). Das sollte nicht noch einmal passieren.
Gleichzeitig ging es um eine Normierung der faschistischen »Volksgemeinschaft«. Dazu wurden »volksschädliche Elemente«, wie es in der Nazidiktion hieß, interniert, um sie aus der »Volksgemeinschaft« auszuschließen. Neben den politischen Gegnern gehörten zu den »Volksfeinden« auch sogenannte »Arbeitsscheue«, Menschen, die sich nicht in das System der militarisierten Arbeit einzwängen ließen. Fahrende, aber auch sesshaft gewordene Sinti und Roma, wurden darunter gefasst. Auch »befristete Vorbeugehäftlinge« (BVer), im Nazijargon »Berufsverbrecher«, gehörten zu dieser Gruppe. Das konnten Schwerkriminelle sein, oftmals waren es aber Menschen, die bloß mehrfach mit der Justiz in Konflikt geraten waren, etwa wegen Eigentumsdelikten oder Verstößen gegen Vorgaben des NS-Regimes. Selbst Menschen, die sich aus religiösen Gründen der Einordnung in das Regime und seiner Kriegsvorbereitung verweigerten, wie die »Bibelforscher«, galten als »Volksfeinde«. Für all diese Menschen wurden nun Haftstätten geschaffen, die eine langfristige Ausschaltung ermöglichen sollten.
Diese zentralen Lager waren damit eine präventive Maßnahme gegen jegliche innenpolitischen Unruhen auf dem Wege zum geplanten Krieg. Während auf der einen Seite mit dem »Vierjahresplan« die deutsche Wirtschaft kriegs- und die Reichswehr angriffsfähig gemacht werden sollte, war das System der zentralen Konzentrationslager der Schritt, auf innenpolitischer Ebene die Kriegsfähigkeit zu sichern. Dort, wo die Propaganda mit Reichskriegertagen und anderen Inszenierungen nicht wirkte, sollte der politische Terror »Ruhe an der Heimatfront« herstellen.
Die Verteilung der Lager von Nord nach Süd entsprach der geplanten »Zuständigkeit« für die Inhaftierungsorte. Nach Buchenwald, dem Lager »im Herzen Deutschlands«, kamen Häftlinge aus Thüringen, Teilen Sachsens, aus Hessen und dem Ruhrgebiet.
Es waren nicht allein funktionale Überlegungen bei der Errichtung dieses KZ auf dem Ettersberg bei Weimar. Die Neustrukturierung des Lagersystems traf auf das Geltungsbedürfnis des NSDAP-Gauleiters und Reichsstatthalters Fritz Sauckel, der seinen Sitz in Weimar hatte. Schon im Mai 1936 setzte er sich in Berlin dafür ein, dass in seinem Gau als Zeichen seiner Macht und seiner Rolle in der NS-Hierarchie ein eigenes Lager errichtet werden solle. Die damit verbundene Stationierung einer größeren Einheit der SS und Waffen-SS sollte die politische Bedeutung Sauckels zusätzlich demonstrieren.
Die Suche nach einem geeigneten Gelände zog sich einige Monate hin, bevor ein zusammenhängendes Waldgebiet auf dem Nordhang des Ettersbergs für die Errichtung des Lagers gefunden werden konnte. Im Frühsommer 1937 begannen die konkreten Bauplanungen. Und wie bei Baumaßnahmen üblich, gingen die Pläne für das KZ über die Schreibtische des Wasserwirtschaftsamtes, des Bauamtes, der Elektrizitätswerke, des Landrates und weiterer städtischer und Kreisgremien. Sie alle waren an den Planungen, an der Genehmigung und der baulichen Umsetzung beteiligt und sie taten ihr Bestes, um einen möglichst zügigen Baubeginn zu realisieren. Offensichtlich hatte man sich jedoch nur unzureichend mit den Bedingungen des Berges vertraut gemacht, so dass manche Pläne (z. B. die Lage der Baracken) wegen der örtlichen Gegebenheiten verändert werden mussten. Augenfällig wurde dies in Zusammenhang mit der Goethe-Eiche im Lagerkomplex. Beim Einmessen und Roden des Lagergeländes wurde offenbar, dass ein Baum, der im Selbstverständnis der Weimarer Bevölkerung als »Goethe-Eiche« galt, sich mitten im Lager befand. Daraufhin wurden zum Erhalt des Baumes – zur »Pflege der Zeugnisse der Deutschen Klassik« – die Pläne für ein an der Stelle geplantes Wirtschaftsgebäude verändert.
Überhaupt ließ man in Weimar auf die Bewahrung des kulturellen Erbes der Goethezeit nichts kommen. Als in der Stadtgesellschaft bekannt wurde, dass das neue KZ den Namen »K. L. Ettersberg« tragen sollte, regte sich Widerspruch – nicht gegen das Lager selber, sondern gegen seinen Namen. Am 24. Juli 1937 musste Theodor Eicke, der Inspekteur der Konzentrationslager, an Heinrich Himmler vermelden, dass die angeordnete Bezeichnung nicht verwendet werden könne, »da die N.S.-Kulturgemeinde in Weimar hiergegen Einspruch erhebt, weil Ettersberg mit dem Leben des Dichters Goethe im Zusammenhang steht. Auch Gauleiter Sauckel hat mich gebeten, dem Lager eine andere Benennung zu geben.«
Bereits vier Tage später konnte Lagerkommandant Koch den neuen Namen offiziell verkünden: »K. L. Buchenwald, Post Weimar«. Dieser letzte Zusatz war nicht nur eine geografische Erläuterung, sondern besonders wichtig für alle SS-Angehörigen, die in diesem Lager Dienst taten. Für sie ergab sich daraus, dass ihr Wohngeldzuschuss nach dem höheren Satz der Stadt Weimar und nicht nach dem niedrigen Satz des Dorfes Hottelstedt berechnet wurde.
Nun hatten jedoch Weimarer Druckereien bereits Brief- und Geschäftspapiere sowie Häftlingskarteikarten mit dem Namen »K. L. Ettersberg« angefertigt. So kam es, dass die SS die Registrierung österreichischer Juden, die im Frühsommer 1938 nach Buchenwald verschleppt wurden, noch auf Karteiblättern des K. L. Ettersberg vornahm.
Die »Architektur« des Lagers
Das Häftlingslager erstreckte sich am Nordhang des Ettersbergs auf einem Gelände von etwa 40 Hektar. Für das Verständnis der Geschichte ist es wichtig zu wissen, dass das Lager in der Form, wie es auf den großen Bildtafeln in der Gedenkstätte zu sehen ist, nie gleichzeitig bestanden hat. Das Lager wurde in den Jahren seiner Existenz immer wieder erweitert, teilweise wurden Einrichtungen aufgelöst oder mit anderen Funktionen verbunden.
Die sichtbarsten Erweiterungen ergaben sich mit dem Bau der Gustloff-Werke auf dem Ettersberg, der Buchenwald-Bahn und der Errichtung des »Kleinen Lagers«. Ursprünglich gab es 35 Baracken aus Holz, 15 zweistöckige Steinblocks, die Anlage des Häftlingskrankenbaus, die Küche, die Wäscherei, die Kantine, das Kammergebäude, Werkstätten der Lagerhandwerker, eine Desinfektion, eine Gärtnerei, verschiedene andere Einrichtungen und dazu ab 1940 ein eigenes Krematorium. Das Ganze war umgeben von einem meterhohen Stacheldraht- und Elektrozaun, jeweils unterbrochen von einem der 23 Wachtürme. Der Wachturm Nr. 1 thronte auf dem Haupteingang. Vom Lager aus gesehen befanden sich neben dem Eingang rechts der Bunkerbau, das »Gefängnis im KZ«, mit 26 Arrestzellen, links die Blockführerstuben der SS. Vom Haupteingang leicht abfallend erstreckte sich der große Appellplatz, auf dem die Häftlinge zweimal am Tag, morgens und abends, antreten mussten. An das untere Ende des Platzes schlossen sich die Häftlingsbaracken an, die ersten sechs Reihen mit ebenerdigen Holzbaracken, dann drei Reihen mit den zweistöckigen Steinbauten. Östlich davon erhoben sich Wirtschaftsgebäude, Magazine und Lagerwerkstätten der Deutschen Ausrüstungswerke (DAW, ein SS-Unternehmen). Unterhalb der Barackenreihen, in einem gewissen Abstand, befand sich das Revier, der Häftlingskrankenbau, bis Ende 1939 aus zwei Holzbaracken bestehend.
Hinter der untersten Reihe des Steinblocks erstreckte sich quer durch das ganze Lager vom Revier im Westen bis zur Gärtnerei und der Kläranlage im Osten in späteren Jahren das Kleine Lager, für die Masse der Häftlinge wohl die furchtbarste Einrichtung.
Außerhalb des Zauns war die SS stationiert. In südlicher Richtung befanden sich die Kommandantur-Gebäude, die Adjutantur, die Politische Abteilung (Gestapo), das Führerkasino sowie die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude, Garagen und Kasernen des Kommandantur-Stabes. Weiter in südlicher Richtung lagen, im Laufe der Jahre immer größer werdend, die Gebäude der hier in Garnison liegenden Einheiten der SS. Es handelte sich um Kasernen, Garagen, Reparaturwerkstätten, Waffenmeisterei, Schießstände, SS-Revier, Fernheizwerk, Kantine, Wirtschaftsgebäude, Pferdestall, Hundezwinger und Reithalle.
Bei Buchenwald bleibt stets das Gesamtgebiet zu bedenken, das ausschließlich der SS unterstellt war, jedoch aus mehreren unterschiedlichen Teilen bestand. Innerhalb des Stacheldrahts mit seinen Wachtürmen befand sich das eigentliche Häftlingslager, außerhalb desselben der SS-Bereich mit Kasernen etc. Von Bedeutung für den Alltag der Häftlinge waren die im Umkreis gelegenen Arbeitsstätten der Häftlinge, wie Steinbruch, die Deutschen Ausrüstungswerke, die Fabriken und das verbliebene Waldgelände. Das insgesamt riesige Gebiet wurde jeden Morgen durch eine schwerbewaffnete Postenkette der SS gesichert, die erst wieder abrückte, wenn beim Abendappell festgestellt wurde, dass kein Gefangener fehlte. Schon ein Schritt durch die Postenkette galt als »Flucht«: Der Gefangene wurde sofort erschossen, der Schütze wurde mit Tabak und Sonderurlaub belohnt.
Für alle Bereiche verfügte die SS über ein klar strukturiertes Befehls- und Hierarchiesystem. An der Spitze des Gesamtkomplexes KZ Buchenwald stand der SS-Kommandant, ihm zur Seite die Adjutantur. Vorgesetzte für das Häftlingslager waren die Schutzhaftlagerführer, anfangs zwei, später immer drei. Die Verbindung zwischen Lagerführung und Häftlingslager, d. h. den SS-Blockführern, stellte der jeweilige Rapportführer dar. Zum SS-Apparat gehörten noch die Verwaltungs-, die Arbeitsdienst- und die Arbeitseinsatzführer. Unabhängig von der Lagerführung, aber zur Kommandantur gehörig, war die Politische Abteilung, die auf ihre Weise neben der SS-Kommandantur über Leben und Tod der Häftlinge entschied.
Beim »Truppenbereich« handelte es sich anfangs um die 3. SS-Totenkopfstandarte »Thüringen«. Später, vor allem nach Kriegsbeginn, befanden sich dort Ausbildungseinheiten der Waffen-SS, die vor ihrem Fronteinsatz »durch die Schule des KZ« gehen sollten.
Die Errichtung des Lagers
Am 15. Juli 1937 traf auf dem circa 9 km von Weimar entfernten Ettersberg, der damals noch unberührtes Waldgelände war, das erste Vorkommando ein. Es bestand aus 149 Häftlingen, unter ihnen 52 politische aus dem KZ Sachsenhausen. Am 20. und 27. Juli folgten Häftlinge aus dem KZ Sachsenburg, das aufgelöst wurde. Am 31. Juli und im August trafen Transporte aus dem KZ Lichtenburg ein. Am 19. August folgte die letzte Gruppe der verbliebenen Häftlinge aus dem KZ Sachsenburg. Die Gesamtzahl der 1937 eingelieferten Häftlinge betrug 2.912 Mann, von denen am 1. Januar 1938 bereits 49 ums Leben gekommen waren.
In ihren eindrucksvollen Erinnerungsberichten schildern die Überlebenden den Aufbau von 1937 bis 1939 als Zeit besonderer Grausamkeiten. In täglich 14- bis 16-stündiger schwerster körperlicher Arbeit, unter ständiger Lebensgefahr durch knüppelschwingende, tretende und schießende SS-Leute, entstanden aus einem freigewachsenen Wald in kaum zwei Jahren das Lager selbst und die dazugehörigen SS-Unterkünfte, Verwaltungsgebäude und Villen für die höheren SS-Offiziere.
Trotz der Eile und der endlosen Arbeitszeit wurden dabei kaum technische Hilfsmittel verwendet. Mit der Picke wurden die Steine gebrochen und auf den Schultern in immer wiederholten Märschen, oft im Laufschritt, an die Stelle getragen, an der sie gebraucht wurden. Eineinhalb Jahre lang musste jeder Häftling nach Arbeitsschluss einen Felsbrocken mit ins Lager tragen. Im Sommer 1937 musste das ganze Lager sonntags »zur Freizeit« Steine schleppen, vom Steinbruch zum Lager, vom Steinbruch zu den Wachtürmen, vom Steinbruch zu den SS-Kasernen. Wehe, wenn ein Stein den aufsichtführenden SS-Leuten zu klein erschien. Dann setzte es Prügel oder »Sport«, d. h. Exerzieren bis zum Umfallen für den Häftling oder für die ganze Kolonne, bei der er arbeitete.
Zum Ausschachten des Untergrundes für die zahllosen Gebäude, zum Planieren des Geländes zwischen den Gebäuden wurden keine Bagger verwendet. Das Erdreich wurde ausgehoben und zum großen Teil mit Hilfe von Tragen abtransportiert. Diese waren viereckige, oben offene Holzkästen, an denen zwei Tragstangen so befestigt waren, dass sie von zwei Häftlingen transportiert werden konnten. Für Strafkolonnen wurden Kästen in besonders großem Format hergestellt. Überlebende berichteten, man habe versucht, sich die schwere Last dadurch zu erleichtern, dass Stricke oder Drähte an den Stangen befestigt wurden, die sie über Schultern und Nacken legen konnten, um die Last mit dem ganzen Körper zu tragen, wenn die Hände die Stange nicht mehr halten konnten und die Arme förmlich aus den Gelenken zu reißen drohten. Aber das wurde unter Androhung strenger Strafen verboten. SS-Leute bis hinauf zum Lagerführer sorgten dafür, dass bei längeren Transportwegen die Tragen unterwegs nicht so oft abgesetzt wurden. Nur an den Baustellen, an denen größere Erdmassen bewegt werden mussten, wurden Kipploren und in seltenen Ausnahmefällen – und immer nur für wenige Wochen – Zugmaschinen für die Loren verwendet. Die Regel war, dass die Loren von den Häftlingen selbst geschoben werden mussten, Berge hinauf durch Dreck und Schlamm, der oben in die Schuhe hineinlief; bei glühender Hitze im Sommer und eisiger Kälte im Winter, während die Hände an den kalten Eisenteilen anklebten.
Eine geologische Besonderheit erschwerte die Arbeiten in diesen Anfangsjahren noch zusätzlich. Auf dem Ettersberg gibt es keinen Sandboden, sondern mit vielen großen Steinen durchsetzten Muschelkalk. Willy Schmidt1, der als Häftling des KZ Lichtenburg die Aufbauphase miterlebte, erinnerte sich besonders an den Schlamm. Dieser klebte an den Händen und am Werkzeug. Er verbreitete sich von da über die Hosenbeine und Jacken; beim Tragen der Steine über die Schultern, Mützen, dann über die Schuhe an die Hosenbeine, in die Socken. Die Sachen mussten nach der Arbeit ausgebürstet werden, falls sie bei Regenwetter überhaupt getrocknet werden konnten. Wenn sie am nächsten Morgen an der Arbeitsstelle ankamen, waren die Häftlinge schon wieder bis an die Knie verspritzt und