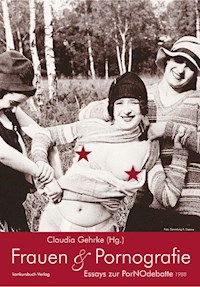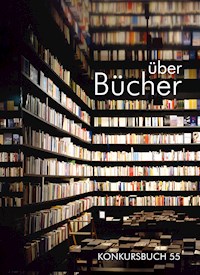
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sachtexte, Bilder und eine Vielfalt an Anekdoten und essayistischen Betrachtungen über das Lesen und die Arbeit an und mit Büchern und das persönliche Verhältnis zum Buch. Autor*innen, Verleger*innen, Buchhändler*innen, Lektor*innen, Fotograf*innen, Druckereimitarbeiter*innen schreiben ihre schönsten, traurigsten, lustigsten, persönlichsten, aufschlussreichsten Geschichten, die sie mit Büchern und dem Lesen verbinden, mit Gedichten und Romanen und Buchcovern, mit Büchermachen, Papiersorten, E-Books, mit Verlagen, Lesungen und Buchhandlungen und dem Wandel der Technik. Geschichten von heute und vor 40 Jahren und dazwischen. Der Konkursbuch Verlag wird vierzig Jahre alt. Vierzig Jahre Büchermachen. Ein guter Anlass, um darüber nachzudenken, was Bücher, Büchermachen und das Lesen heute eigentlich bedeuten. "Ein reicher und substanzieller Band, der seinem großen Titel „über Bücher“ wohltuend gerecht wird. ... einige Höhepunkte des Bandes sind die oft episch ausgefallenen Berichte und Beichten nicht der textlich, sondern der handwerklich Beteiligten in Herstellung, Vertrieb, Einzelhandel." (Marcus Jensen, Am Erker 76, Dezember 2018)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Konkursbuch 55
über Bücher
(Hg. Claudia Gehrke & Florian Rogge)
Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zum Buch
Liebeserklärungen, Erinnerungen, Ausblicke in die Zukunft. Was machen Bücher mit uns? Wie werden Bücher gemacht? Erfahrungen mit Buchcovern, Papiersorten und E-Books. Heiteres und zum Nachdenken Anregendes aus dem Innenleben von Verlagen, Buchhandlungen, einer Auslieferung, Verlagsvertretern, einer Druckerei, von Leserinnen, Rezensenten und Sammlern. Einblicke in den Nachmittag einer Lektorin und den Abend einer Autorin. Gedanken über das Sehen und das Lesen, kulturhistorische Betrachtungen.
Pressestimmen:
„Ein im besten Sinne zauberhaft kurzweiliges und heiteres Lesebuch der vielen Blickwinkel.“ (Till Schröder in „Marginalien, Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie“, 2019.)
„... man wird sich nicht erst am Ende Claudia Gehrkes Worten anschließen: „Es ist das Gefühl des Außersichseins, was mich an Büchern fesselt.“ (Ulla Steuernagel, Schwäbisches Tagblatt)
„Ein reicher und substanzieller Band, der seinem großen Titel ‚über Bücher‘ wohltuend gerecht wird.“ (Marcus Jensen, Am Erker 76)
Mit Beiträgen von Peter Butschkow, Frederike Frei, Claudia Gehrke, Dorothea Keuler, Regina Nössler, Kali Drische, Hermann-Arndt Riethmüller, Axel Schock, Yoko Tawada, Jürgen Wertheimer, Anya Sunita Sukhana, Thomas Leon Heck, Thomas Wörtche und von vielen anderen.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
Vorwort
Yoko Tawada: Bücher im Kopf
Dorothea Keuler: Wie die Literatur mich fast verdorben, dann aber doch gerettet hat
Axel Schock: Mit Büchern leben. Momentaufnahmen aus einer Leserbiografie
Kali Drische: Risiken und Nebenwirkungen
Henrike Lang: Bücher
Litt Leweir: Das kleine Mädchen, der Tod und die Bücher
SAID
Frederike Frei: Ingeborg Bachmann
Volker Surmann: Wer hat Angst vorm Herren Schmidt?
Regina Nössler: 15.06 Uhr. Nachmittag einer Lektorin
Eike Gebhardt: Der Aberglaube an die Wirklichkeit
Regina Nössler: 22.56 Uhr. Abend einer Autorin
Ingeborg Görler: Fast sowas wie Neid
Thomas Wörtche: Too much book
Volker Surmann: Ich bin der, vor dem ich mich immer gefürchtet habe ...
Ines Witka: Ein Blick durchs Schlüsselloch in meine Schreibwerkstatt
Frederike Frei: Das Wörtchen ‚und‘
Peter Butschkow: Der Druckereipraktikant
Das Buch bei Claudia Gehrke
Jammern im Alltag
Robert Kump: Episoden aus fünfzig Jahren als Drucker (der auch viele Bücher des Konkursbuch Verlags druckte)
Uve Schmidt: Blood, Sweat and Tears
Fritz Franz Vogel: Lobgesänge auf das Altpapier
Ingeborg Görler: Unterlassung
Sam Balducci: Volk und Gesundheit, VEB 1972
Anne Bax: Tausend und meine Nacht
Franz Spengler: Bekenntnisse eines Raublesers
Helmut Richter: Die SoVA
Hermann-Arndt Riethmüller: Das verlorene Paradies? Randbemerkungen zu vierzig Jahren Buchhandel in Tübingen
Jörg Sundermeier: Bibliodiverse Träume
Britta Jürgs: Konstante Überraschungen
Claudia Gehrke: Lustobjekt Buch
Doris Hermanns: Bücherleidenschaft und Entdeckungslust
Wolfgang Zwierzynski: Quichotte
Das erste Mal Buchmesse:
Jürgen Foltz: Vertreter auf Reisen
Petra Troxler: Vertreterin auf Reisen
Traude Bührmann: Speisen & Spesen
Jan Gympel: Vom Zauber des Bücherbesprechens oder: Brause und Bier gingen gar nicht
Norbert Tefelski: Dem Nichtleser
Hans-Peter Willi: Augenspiegel
Erik Grawert-May: Mein Unheimliches Auge. Ein Monogramm
Jürgen Wertheimer: Bücherverbrennung
Lena Höft: Historisch getreu oder erzählerisch ergeben? Sachbücher des ‚Dritten Reiches‘ und ihre Neuauflagen in der Bundesrepublik
Isabelle Holz: Genet, Flaubert und die RAF
Christa Karpenstein-Eßbach: Wo alles aufhörte, wo alles anfing. Rückblick auf die Achtzigerjahre
Johann A. Makowsky: Ich packe meine Bibliothek aus
Jan Gympel: Im Gnadenhof der Bücher
Sigrun Casper: Verschafen
Florian Rogge: Bibliotheken: Mythos und Metapher
Thomas Leon Heck: Ein Anheckdotenkranz aus meinem Leben mit Büchern
Tzveta Sofronieva: Phantomschmerz
Martin Knepper: Paketpost
Sunita Sukhana: Ein Buch wie ein Leben
Tina Stroheker: Bücher
Autorinnen und Autoren
Alle Ausgaben von Konkursbuch
Zum Weiterlesen
Impressum
Vorwort
„DES VIELEN BÜCHERMACHENS ist kein Ende …“
Wie oft mag dieser rund zweieinhalb Jahrtausende alte biblische Stoßseufzer jeden Tag von übermüdeten Verlegerinnen, Lektoren, Druckern, Schriftstellerinnen, Rezensenten wiederholt werden?
2018 feierte der konkursbuch Verlag seinen 40. Geburtstag. Seit 1978 sind im Verlag 666 Bücher erschienen. Wie viele Arbeitsstunden stecken darin? Zählten wir die Arbeitsstunden aller Beteiligten zusammen, erhielten wir eine so ungeheure Zahl, dass sie sich in mehrere Menschenleben umrechnen ließe. Bücher leben, führen oft seltsame Eigenleben, beeinflussen und prägen die Lebensläufe der Menschen, die mit ihnen zu tun haben.
Bücher entstehen aus Büchern. Den unaufhaltbaren Vermehrungsdrang der Bücher kennt jeder Sammler, jede Bibliothekarin, jede Buchhändlerin, jede Leserin, jeder, der mit Büchern zu tun hat. Bücher regen, wenn sie gut sind, zum Nach- und Weiterdenken, zum Fort- und Neuschreiben an. Selbst schlechte Bücher können immerhin noch zu Widerspruch und Gegenrede provozieren. Ein Buch trägt oft unzählige andere Bücher in sich. Jedes Buch ist so gesehen eine eigene Bibliothek, vergleichbar vielleicht mit dem immer wieder erstaunlichen Kunststück, bei dem nach und nach eine niemals für möglich gehaltene Anzahl gelenkiger Artisten aus einen Kleinwagen steigt. Allein in diesem Konkursbuch werden knapp fünfzig Bücher mit vollem Titel angeführt, nicht eingerechnet die Bücher, die nur zitiert oder anzitiert, aber nicht namentlich erwähnt werden, ganz zu schweigen von den Büchern, die als Lektüre den jeweiligen Schreibprozessen vorausgegangen und sie, sei es inhaltlich oder stilistisch, beeinflusst haben. Wollten wir dieser Spur nachgehen und alle Bücher zusammentragen, die in diesem Konkursbuch enthalten sind, hätten wir rasch einen ansehnlichen Stapel beisammen.
Andererseits ließe sich ein Vielfaches der Textmenge dieses Stapels problemlos auf einem USB-Stick speichern und für einen E-Book-Reader machte es keinen Unterschied, wenn wir den kleinen Bücherturm noch um die rund 70 000 Neuerscheinungen erweitern würden, die allein 2017 in Deutschland veröffentlicht wurden. Der E-Book-Leser hingegen würde vielleicht schon einen Unterschied bemerken: schließlich bedeutet die digitale Standardisierung auf ein Dateiformat auch einen Bedeutungs- und Beziehungsverlust, Bücher bestehen nicht nur aus Text. Doch es wäre falsch, die Digitalisierung zu verdammen – sie prägt bereits heute auch die Produktion „richtiger“ Bücher mit Papier und Umschlag. Und auch vor dem Zeitalter der Bücher gab es Erzählungen, mündlich weitergegeben, handschriftlich fixiert und schließlich zu einem Buch geworden, die wir noch heute kennen. Der „feste Buchstab“ (Hölderlin) sorgte dafür, dass frei flottierende Texte nicht ineinander verschwinden.
„Niemals werden wir Bücher so nötig haben wie Karotten“, schrieb Joseph Roth einmal und wehrte sich damit gegen eine ihm unbehagliche Überhöhung und Aufladung des Buches. Tatsächlich kann die Funktionalisierung des Buches als kulturelles Prestigeobjekt, sein Einsatz als elitäre Distinktionswaffe auf die Nerven gehen. Andererseits lässt sich nicht leugnen, dass Bücher einen kaumu unterschätzenden Einfluss auf unser Leben, unser Bild von der Welt und unser Vorstellungsvermögen haben. Man muss kein verbissener Ideologiekritiker sein, um zu erkennen, dass Bücher, und die in ihnen kodifizierten Geschichten, Figuren, Ideen, auch etwas mit Macht zu tun haben. Bücher können Herrschafts- und Unterdrückungsinstrumente sein – man denke an die unheimliche Wucht „Heiliger Schriften“ oder auch an Shakespeares „Der Sturm“, wo Prospero quasi mit einer Handvoll Bücher die außereuropäische Welt unterwirft. Andererseits können Bücher befreiend, subversiv wirken, indem sie Prozesse und Strukturen sichtbar machen, die sonst nicht zu erkennen wären. Bücher als unser Auge zur Welt.
„Des vielen Büchermachens ist kein Ende …“ – , in dieses Buch über Bücher hätten noch viele weitere Beitragende Eingang finden können. Es gibt Bücher, die sind nie wirklich fertig. Historisch-kritische Ausgaben geben einen Eindruck davon, wie oft manche Bücher geschrieben wurden, bis sie die Gestalt annahmen, in der sie schließlich veröffentlicht wurden. Und selbst nach der Veröffentlichung verändern sich manche Bücher von Auflage zu Auflage, von Übersetzung zu Übersetzung. Das Vorwort schreibt sich ganz am Schluss und das letzte Wort ist erst der Anfang eines neuen Buches.
Florian Rogge & Claudia Gehrke
Das Buch wächst, übersehene Schreibfehler werden weniger, von der Printausgabe erschien soeben die dritte Auflage (zum dritten Mal 666 Exemplare). Neue Textbeiträge sind hinzugekommen, neue Bilder, Korrekturen … Wir freuen uns sehr – trotz der Überflutung von Rezensentinnen und Rezensenten mit Büchern (nachzulesen im Text von Thomas Wörtche ab S. 61) – dass schöne Besprechungen „über Bücher“ erschienen sind. Wir danken allen Leserinnen & Lesern, ohne die wir nicht existierten.
Yoko Tawada: Bücher im Kopf
WO IN MEINEM KOPF IST DAS Wort „Siebenmeilenstiefel“ aufbewahrt? Es ist sicher nicht in die Hirnmasse direkt hineingeschrieben. Ich muss zuerst in meiner Vorstellung ein imaginäres Buch öffnen und darin finde ich das Wort. Dieses Buch heißt in meinem Fall „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“. Andere Menschen haben dasselbe Wort, „Siebenmeilenstiefel“, sicher in einem anderen Buch aufbewahrt, zum Beispiel in einem Märchenband, der nur noch in ihrer Erinnerung existiert. Das Originalbuch aus Papier war schon an der Schwelle zur Pubertät verschwunden oder lag eine Zeit lang noch in einer staubigen Kiste auf dem Dachboden des Elternhauses und danach landete es im Lagerhaus eines Entrümplers.
Ich weiß nicht, ob die Hirnforscher eines Tages die Materie entdecken werden, aus der die imaginären Bücher im Kopf bestehen. Sie können heute schon feststellen, wie klein der Unterschied zwischen einem Menschen- und Affenhirn ist. Aber die Bücher im Kopf sind im Labor noch nicht messbar und somit bleibt der Mensch als Büchertier weiter unerforscht.
Ich habe das deutsche Wort „Affe“ in einem imaginären Buch im Kopf aufbewahrt, das „Ein Bericht für eine Akademie“ heißt. Denn es war der erste Ort, wo ich dieses Wort kennenlernte. Das japanische Wort mit der gleichen Bedeutung, „saru“, lernte ich schon als kleines Kind in einem Bilderbuch.
Manche denken, dass wir ein Bild vom Affen im Kopf haben würden und alle Wörter, die „Affe“ bedeuten, sei es „monkey“ oder „saru“, an dieses Bild direkt angebunden seien. Bei mir beobachte ich aber ganz andere Verhältnisse. Denn um das Wort „monkey“ herauszuholen, muss ich in meinem Kopf das Buch „Curious George“ öffnen. Ich sehe die Hochhäuser in Manhattan und einen kleinen Affen, der von Fenster zu Fenster springt. Er kann auch aus dem Buch herausspringen. Denn kein Affe ist in seiner Nationalsprache eingesperrt. Er ist auch nicht ein Gefangener bei einem Autor. Kafkas Affe muss nicht immer bei ihm bleiben, sondern kann die Bären in „Atta Troll“ besuchen. Wenn die Bücher im Kopf aufgeschlagen werden, können vertraute und fremde, alte und junge Wörter aus dem Kontext herausspringen und miteinander verkehren. Und es geht mir beim Schreiben deshalb darum, im Kopf so viele Bücher wie möglich geöffnet zu halten.
Dorothea Keuler: Wie die Literatur mich fast verdorben, dann aber doch gerettet hat
ICH LESE ÜBER MEINE VERHÄLTNISSE. Schon die Märchen meiner Kindheit waren von Prinzen und Prinzessinnen bevölkert, und selbst das unscheinbare Aschenputtel kriegte seinen Königssohn. Die Heldinnen meiner Jugendbücher, allesamt Gutsherrentöchter, hielten Pferde – ach, Pferde! – und konnten reiten. Auch die Groschenhefte, die ich als Teenager verschlang, spielten unter Blaublütigen, die vom hohem Ross auf die Welt herabschauten. Zwar habe ich bald kapiert, dass in meinem eher kleinbürgerlichen Milieu die Verhältnisse nicht so waren, aber das würde der Märchenprinz – in welcher Gestalt er auch käme – schon richten.
Dann wurde ich erwachsen und der Märchenprinz totgesagt. Wir schrieben die Siebzigerjahre und lasen Alice Schwarzer „Der kleine Unterschied“, Verena Stefan „Häutungen“, Anja Meulenbelt „Die Scham ist vorbei“. Ich versenkte mich in die Briefe und Tagebücher von Caroline Schlegel-Schelling, Rahel Varnhagen, Bettine von Arnim und Franziska zu Reventlow – verdammt, schon wieder eine Gräfin! Die wilde Schwabinger Bohemienne glänzte als Mittelpunkt eines verruchten Dichterkreises und wurde das unerreichte Vorbild meiner verlängerten Jugend. Während meines Studiums entwickelte ich ein Faible für Campus Novels und weibliche Bildungsromane, vorwiegend anglo-amerikanischer Herkunft. Deren Heldinnen legten – in Oxford, Cambridge, Harvard, wo denn sonst – glänzende Abschlüsse hin, machten Karriere an der Uni. Und ich? Schrieb Bewerbung um Bewerbung, aber der Traumjob ließ auf sich warten, und als er sich schließlich doch einstellte, fehlte ihm der Glamour. In den Büchern, die ich las, strebten Schriftstellerinnen, Malerinnen, Schauspielerinnen ihrer künstlerischen Vollendung entgegen, feierten Erfolge, ernteten Ruhm. Für mich kein Aufstieg zu strahlenden Höhen! Da stimmte doch was nicht!
„Dr Weiss, at forty, knew that her life had been ruined by literature“, lautet der erste Satz in Anita Brookners Roman „A Start in Life“, der mein Weltbild schließlich zurechtrückte. Mit vierzig begriff die Unglückliche, dass sie gleichsam im falschen Film gefangen war, dass sie ihr Leben an einem Plotmuster ausgerichtet hatte. Ich war dreißig und lernfähig und erkannte: Das Leben funktioniert nicht wie ein Roman*. Das Leben kümmert sich keinen Deut um Plots. Es kommt, wie es kommt. Zu meiner Überraschung wirkte diese Einsicht befreiend. Ich konnte es also entspannt angehen lassen, als Akteurin von mittlerem Talent mit mäßigen Erfolgen. Mittelmäßig eben. Inzwischen bin ich über sechzig und blicke, nicht unzufrieden, auf eine Patchwork-Karriere an der Peripherie des Literaturbetriebs zurück. Gelegentlich lese ich immer noch gern über meine Verhältnisse, aber es ist nicht meine Welt. Und das ist auch gut so.
* Viele Jahre später bestätigte Michael Rutschky mich in dieser Erkenntnis. In seinem Essayband Lebensromane (1998) schildert er das tragikomische Scheitern von ZeitgenossInnen, die ihr Leben nach dem Modell einer Romangattung formten.
Axel Schock: Mit Büchern leben. Momentaufnahmen aus einer Leserbiografie
I.
IN JUNGEN JAHREN HAT MAN sich so manches beibringen lassen, das einige Übung, manchmal auch etwas Ausdauer erfordert. Aber dafür – so wurde es einem zugesichert – würde man es auch bis zum Lebensende nicht mehr verlernen. Bei Latein hat das nicht funktioniert, beim Fahrradfahren, Schwimmen und Schnürsenkelbinden schon eher. Und wenn nicht, könnte ich notfalls auch ohne Schwimmbad und Radeln durchkommen. Mit Lesen aber verhält es sich anders. Diese Fähigkeit ist ein solch selbstverständlicher Bestandteil meines Lebens geworden, so existenziell und grundsätzlich, dass ich mir nicht vorzustellen vermag, wie es aussehen sollte: ein Leben ohne Lesen.
Und dabei gab es bereits eine solche Zeit und sogar eine klare Erinnerung daran – und das Gefühl, das etwas ganz Entscheidendes fehlte. Ich mag vielleicht fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Ein Sonntag auf der Wohnzimmercouch der Tante und die Fernseh-Illustrierte auf den Knien. Ein farbiges Foto im TV-Programm hatte mein besonderes Interesse geweckt: ein Knäuel von Menschen in fleischfarbenen Trikots. Sie wirkten nackt und waren doch komplett angezogen. Das Bild faszinierte und beschäftige mich; nicht, weil ich mich für Ballett interessiert hätte (und um ein Szenebild eben einer Tanzaufzeichnung handelte es sich), für mich hatte das Foto eine deutlich sexuelle Konnotation, ohne dass ich das damals schon hätte benennen können. Zu gerne hätte ich gewusst, was in dem Text zu diesem Bild steht. Aber die Tante fragen, das ging nicht. Mein ganz spezielles Interesse hätte etwas von mir verraten können. Was genau, wusste ich nicht. Aber ich hielt es instinktiv für besser, meine Neugierde für mich zu behalten – und ich ärgerte mich, auf Erwachsene angewiesen zu sein und nicht das zu können, was für sie so selbstverständlich war: lesen.
II.
Der Leseunterricht war eine perfide Hinhaltetaktik. Jeder Buchstabe des Alphabets wurde der Reihe nach zunächst auf vorlinierten Zeilen nachgemalt und dazu der entsprechende Laut geformt. Erst allmählich wurden zwei, drei, vier dieser Buchstaben zu kurzen Wörtern verbunden. Meine Schrift war zwar (schon damals) ungelenk und krakelig, aber ich war mit großem Eifer dabei.
Und dann hatte ich mein erstes Buch, ein „Schneider-Buch in Schreibschrift“: „Nüsse vom Purzelbaum“. Ein Titel, wie ihn sich nur Erwachsene ausdenken können. Das Cover zeigte drei Kinder, die auf einen Baum klettern, an dem bunt angemalte Walnüsse mit Schnüren an den Ästen festgebunden sind. Also irgendetwas zwischen Klettergerüst und Weihnachtsbaum. Acht kurze Geschichten gab es in diesem kleinen Band. Wir hatten in der Schule gerade alle Buchstaben durch, jetzt also konnte es losgehen. Ich wusste die Methode und kannte die Lettern; ich wusste, für welche Laute sie stehen, wie man sie miteinander verbindet und damit diesen Buchstabenkombinationen den darin verborgenen Sinn entlockt. Und dann das: Ich scheiterte bereits beim ersten Wort. So sehr ich mich auch mühte, es funktionierte nicht. Ich konnte die einzelnen Laute noch so laut und deutlich vor mich hinsprechen und ineinander gleiten lassen: Was ich da zusammenmurmelte, blieb eine scheinbar wahllose Aneinanderreihung von Sprachlauten. Ich war zutiefst enttäuscht. An dieser Stelle hätte das Abenteuer eine womöglich fatale Wendung und mir ein für alle Mal die Lust an der Sache nehmen können, aber ich machte einfach weiter mit dem nächsten Wort. Und noch einem. Und noch einem – und ich hatte einen Satz: „Bertrams Mutter hat Geburtstag“. Einen richtigen Satz, aus dem sich dann auch das fatale erste Wort erschloss. Bertram war also ein Vorname. Ich kannte niemanden, der so hieß, mehr noch: Ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Mit meinem ersten gelesenen Wort hatte ich bereits, ohne es zu ahnen und zu erwarten, meine damals noch so kleine Welt erweitert.
III.
Die „Nüsse vom Purzelbaum“ war nicht nur meine erste Lektüre, sondern in gewisser Weise auch der Start zu meiner eigenen Bibliothek. Die blieb freilich in den ersten Schuljahren sehr überschaubar. Auch sonst gab es in unserer Familie – ich habe einen sogenannten bildungsfernen Hintergrund – kaum Bücher. Ich kann mich an exakt drei erinnern: ein Werk des Heimatvertriebenenverbands, dem mein Vater angehörte; „Dr. Oetkers Backbuch“ – ein schon damals mit Mehl- und Fettspuren verziertes Exemplar (das bis heute ein treuer Küchenhelfer ist) und als drittes „Die Frau als Hausärztin“. Als Lektüre war dieser gewichtige Wälzer für mich damals wenig interessant, umso mehr die farbigen Abbildungen: monströs wirkende Fotos von Pusteln, Abszessen und Ausschlägen, von entzündeten Augen, deformierten Gelenken und von Karies zerfressenen Zähnen. Ich war erstaunt, worüber eine Frau so alles Bescheid wissen musste.
Einen gefüllten Bücherschrank wie in anderen Familien gab es also nicht. Meinen Lesestoff musste ich daher anderweitig beziehen und ich hatte zum Glück sehr schnell die Stadtbücherei für mich entdeckt, und die lag passender Weise sogar auf dem Weg zur Grundschule. Sie war eng und die Regale waren vollgestopft, aber das konnte mir nur recht sein. Das versprach einen nicht enden wollenden Vorrat und öffnete im besten Sinne des Wortes Welten. Weil es nur einen Bibliothekar gab – ein so ruhig vor sich hinarbeitender Mann, dass er allein durch sein Wesen für absolute Ruhe im Raum sorgte – machte mit ihm auch die Bücherei zwangsläufig Sommerferien. Das wurde für mich zu einer logistischen Herausforderung: Es musste frühzeitig ausreichend Vorrat nach Hause geschleppt werden. Der Gedanke, ein paar Tage ohne ein Buch auskommen zu müssen, schien mir damals schon unerträglich.
IV.
„Bücherfresser“, „Leseratte“ – die Bezeichnungen für Vielleser sind eigentlich nicht sehr schmeichelhaft. Als Kind beschämten sie mich aus anderem Grund, schwang darin unterschwellig doch noch etwas ganz anderes mit: nämlich irgendwie sonderbar zu sein. Lesen war etwas, das machten Einzelgänger und Nerds. Das waren Kinder, mit denen die anderen, aus welchen Gründen auch immer, nicht viel zu tun haben wollten. Ich habe später viel darüber nachgedacht, was mich zum Vielleser machte, aber meinen Bruder zum Beispiel nicht. Wie kommt es, dass man die Welt, aber auch sich selbst, in einem ganz besonderen Maße über den Umweg des Buches erkundet?
Für mich als Kind war die Lektüre ganz sicherlich auch eine Flucht. Um die Verhältnisse zu beschreiben, in denen ich aufgewachsen bin, soll das Wort „prekär“ genügen. Nach der Schule blieben mir nur sehr wenig freie Zeit, wenig Freiraum und damit auch nur begrenzte Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern. Lesen allerdings konnte man allein, eigentlich sogar nur allein, und zudem immer und überall. Und man konnte es beliebig unterbrechen und fortsetzen. Lektüre im Allgemeinen und Bücher im Besonderen wurden zu meinem ständigen Begleiter, keine freie Minute blieb ungenutzt. Ich hatte Techniken entwickelt, wie ich auf längeren, langweiligen Fußstrecken beim Gehen lesen konnte, ohne mit Straßenlaternen, anderen Passanten oder dem Verkehr zusammenzuprallen. Kurzzeitig experimentierte ich auch mit der Kombination Fahrradfahren und Lesen (was aber zu keinem befriedigenden Ergebnis führte). Bücher waren zum Überlebensmittel geworden. Mit ihnen konnte an jedem Ort, und sei es nur ein paar Seiten lang, die unmittelbare Gegenwart ausgeblendet werden. Für ein paar Minuten oder eine lange Lesenacht lang abtauchen in eine literarische Realität, den Kopf füllen mit anderen Geschichten als der eigenen; mit anderen Gedanken, als jenen, die einen sonst umtrieben. Dieses Suchtverhalten hat sich festgebrannt. Auch heute verlasse ich nur selten das Haus, ohne Lesestoff eingepackt zu haben, und sei es nur für drei Stationen mit dem Bus.
V.
Lesen verändert den Menschen. Es sind nicht nur neue, andere Gedanken, denen wir in Büchern begegnen und die womöglich mit unserer bisherigen Sicht der Welt kollidieren, sie in Frage stellen oder unseren Horizont erweitern. Bücher zu „fressen“ bedeutet bisweilen auch: sie sich einzuverleiben. Was sie in sich tragen, was sie uns bedeuten, das bleibt und wird ein Teil von uns.
Das Lesen von (guter) Literatur bewirkt zudem noch etwas anderes: Fremderfahrungen mit den eigenen abzugleichen und sich zu eigen machen. Und lernen, wie man Erfahrungen reflektiert, wie man über das Denken, Fühlen und Wollen spricht. Das Lesen erweitert nicht nur durch ein differenzierteres Vokabular die sprachlichen Möglichkeiten, das eigene seelische Empfinden nuancierter in Worte zu fassen und zu kommunizieren. Indem wir in der Literatur andere Existenzen, Lieben oder Konflikte vorgeführt und ausgeführt bekommen, erhalten wir Zugang zu anderen Denk- und Lebensweisen. Und haben die Chance, uns auch im eigenen Leben offener uns auf (noch) fremde Welten einzulassen und uns in sie einzufühlen.
Manchmal lösen Bücher wiederum einen Widerhall aus, der sich erst nach Jahren halbwegs erklären lässt. Es mag wie ein Klischee klingen, aber eines der ersten solcher existenziellen Leseerlebnisse war für mich Franz Kafkas „Verwandlung“. Ich war sechzehn und auf einem Rucksacktrip. Um Gewicht zu sparen hatte ich mir vom Bücherregal meiner älteren Schwester deren Reclam-Schullektüren geschnappt. Den Namen Kafka hatte ich bis dahin noch nie gehört. Als ich das gelbe Heftchen nach einer rauschhaften, pausenlosen Lektüre zuschlug, hatte ich mir nicht nur einen Sonnenbrand geholt, ich war auf euphorisierende Weise aus der Bahn geworfen. Was zum Teufel ist das für eine Geschichte? Wie kommt jemand dazu, so etwas zu schreiben? Und warum fühle ich mich diesem offenbar etwas verstörten Typen so nahe?
Den Rest des Sommers fraß ich mich durch Kafkas Gesamtwerk. Ein solches Hochgefühl, nämlich etwas ganz Entscheidendes für sich entdeckt zu haben, erfährt man als Leser wahrscheinlich nur wenige Male im Leben. Es entwickeln sich daraus geradezu zwangsläufig Bindungen fürs Leben. Mag man auch in regelmäßigen Abständen aus Platzgründen die Bücherregale lichten, diese Autoren wird man in jedem Fall verschonen. Für deren Bücher wird es immer einen Platz geben, und sei die Wohnung noch so klein.
VI.
Lektüre kann einen Menschen nicht nur verändern, sie kann uns gleichermaßen auch bestärken: in unseren Wünschen, Träumen und Hoffnungen und in unserer Identität.
Der Begriff Empowerment war in meinen Jugendjahren zwar noch nicht geläufig, aber trifft doch ziemlich genau, welche Wirkung bestimmte Romane und Biografien auf mich hatten: mich als jungen schwulen Mann mit meinen Gefühlen nicht mehr allein und exotisch, sondern verstanden und als Teil einer, wenn auch noch recht wenig greifbaren, Gemeinschaft zu fühlen.
Das Internet war lange noch nicht erfunden und schwule Vorbilder im Film kaum zu finden. Ein recht aseptischer Steven Carrington in der TV-Serie „Denver Clan“ war das Schwulste, was seinerzeit im Fernsehen vorstellbar war. Umso gieriger stürzte ich mich auf das, was ich an Büchern fand: Ronald M. Schernikaus „kleinstadtnovelle“ etwa, die ersten Ralf-König-Comics. Und dann, erst als Auszug in der ZEIT, dann in Buchform (im Konkursbuchverlag!) Hubert Fichtes Essay „Deiner Umarmungen süße Sehnsucht“. Wenn es ein Schlüsselwerk gibt, das meine nunmehr Jahrzehnte lange Beschäftigung mit schwuler Literatur entfacht hat, dann dieser kluge und zugleich hochpoetische Text über August von Platen und die Geschichte der Empfindungen dieses homosexuellen Dichters. Fichte zu lesen war für eine solche Erweiterung meines literarisch-ästhetischen Horizonts wie kurz danach, auf ganz andere Weise, Thomas Bernhard. Eine Prosa mit so ganz eigenem Sound, durchrhythmisiert und pointiert, dass ich bei der Lektüre mit dem Anstreichen kaum hinterherkam. Was Fichte anhand von Platens Tagebüchern deutlich machte, war just das, was mich an den Werken anderer schwuler Autoren so faszinierte, selbst wenn es in ihren Romanen, Erzählungen oder Dramen keine explizit schwulen Protagonisten oder Handlungsstränge gibt. Es ist dieser ganz spezielle, meist distanzierte, „andere“ Blick auf die Gesellschaft, mit dem diese Texte auf die eigenen Erfahrungs- und Gefühlswelten zu antworten scheinen und der Autor uns zu seinem Verbündeten macht.
VII.
Rund fünfundvierzig Jahre ist es nun her, dass ich mich durch das Wort B-E-R-T-R-A-M und die „Nüsse vom Purzelbaum“ buchstabierte. Auch nach einigen Tausend Büchern hat sich die Lust am Lesen noch nicht verflüchtigt. Die es besonders verdient haben, dürfen sogar bei mir wohnen oder besser: Ich darf sie um mich haben. Die Liste der Schriftsteller, deren Werk man treu verfolgt, wächst unaufhörlich. Man hat Verlage zu schätzen gelernt, vertraut dem Geschmack bestimmter Übersetzer und Herausgeber, und hat seine Spezialinteressen gefunden. Die Leseliste wächst dadurch unaufhörlich. Und während man in jungen Jahren ungestüm und unbeachtet in Buchhandlungen, Bibliotheken (und nicht zu vergessen, in Antiquariaten) fast wahllos zugriff und sich ins Lese-Abenteuer stürzte, beginnt man mittlerweile sorgfältiger auszuwählen. Womit verschwende ich vielleicht unnötig die knapp werdende Lese-Zeit? Zeit, die mir womöglich für ein anderes, viel wichtigeres Buch verlorengeht? Längst dämmert die Erkenntnis, dass man niemals alle Bücher, die einem wichtig erscheinen oder wichtig werden könnten, tatsächlich auch wird lesen können. „So many books, so little time.” – Wie sehr trifft Frank Zappa doch mit diesem Satz das ganze Dilemma! Das Tröstliche dabei aber ist: Es wird immer noch mindestens ein Buch geben, das unbedingt gelesen werden will. Und so lange liest man einfach weiter.
Kali Drische: Risiken und Nebenwirkungen
ALS ICH KLEIN WAR, FANDEN alle, dass ich mehr spielen sollte. Und zwar mit anderen. Es war mir ein Gräuel.
Ich war der klassische Stillleselbstbeschäftigungstyp. Insekten suchen, Bilder malen, Schatten beobachten. Dagegen war das gemeinschaftliche Spiel erstens unattraktiv und zweitens mit unklaren und wenig lohnenswert erscheinenden Risiken behaftet. Ich war auf andere Abenteuer aus.
Und eines dieser Abenteuer wurde mir konsequent vorenthalten: Lesen und Schreiben.
– Spielen sei in meinem Alter wichtiger als Lernen.
Ich sollte nicht meinen älteren Bruder beschämen, der anfänglich ernsthafte Schwierigkeiten mit dieser Kulturtechnik hatte.
– Ich würde mich in der Schule langweilen, wenn ich das schon jetzt lernte.
– Etc., blablabla.
Immerhin langweilte ich mich jetzt gerade. Wieso sollte späteres Langweilen irgendwie schlimmer sein als das gegenwärtige? Gegenwärtige Langeweile ist schließlich immer die Allerschlimmste. Ob man sich später langweilen würde, konnte man schließlich noch gar nicht wissen. Und wenn, dann könnte man sie wenigstens mit Lesen überbrücken. Dieses Risiko wollte ich gerne eingehen.
Ich scharwenzelte also immer in gehörigem Abstand um meinen Bruder herum, wenn versucht wurde, diesem das geschriebene Wort nicht nur schmackhaft, sondern auch verständlich zu machen. Kam manchmal unter einem Vorwand direkt an den Tisch, quengelte rum, ich wolle ein Eis oder mir sei langweilig oder etwas in der Art. Nebenbei konnte ich kurz einen Blick auf die wundersamen Zeichen werfen, und sie mit dem Gehörten verknüpfen. Das Ganze war mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Und um erfolgreich zu sein, musste der Zufall mein Freund werden. Ein anstrengender Freund. Launisch, unzuverlässig und immer für eine Überraschung gut.
Zu oft durfte ich auch nicht um diese Lernsituation herumschleichen, sonst wurde ich unweigerlich und unverzüglich zum Spielen geschickt. In einem für dieses Alter schier unermesslichem Zeitraum gelang es mir, einen soliden Grundstock des Alphabets zu ergaunern und auszubauen. Schließlich fehlte mir nur noch das kleine „m“. Auf einen bestimmten Buchstaben zu warten, war aber wirklich zu langwierig. Da müsste der Zufall schon extrem gute Laune haben, dass ich ausgerechnet den abspicken können würde. Es bestand außerdem die Möglichkeit, dass mein Bruder bei genau diesem Buchstaben gar kein Problem hatte. Da könnte der Zufall auch nichts dafür, dass ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, also dem Schulbeginn in knapp zwei Jahren, warten müsste.
Ich musste also zu anderen Maßnahmen greifen. Und da erschien mir nur eine zielführend: die Schmeichelei.
Ich sagte meiner Mutter, dass ich so wahnsinnig gerne wüsste, wie man „Mami“ schreibt. Bitte, bitte, bitte. Und schaute recht goldig drein. Die Ambivalenz meiner Mutter war deutlich, hatte sie doch meiner Vorschullehrerin versprochen, mich nicht weiter mit Buchstaben zu füttern. Doch dann siegte die honigsüße Stimme der Eitelkeit. Ich bekam mein kleines „m“. Und triumphierte im Stillen.
Tatsächlich sind mir Lesen und Schreiben auch in der Zukunft nie langweilig geworden. Aber darüber hinaus hatte ich noch etwas gelernt: erstens, dass meine Interessen im Zuge der Pädagogik keine Rolle spielen, und dass zweitens, nur Heimlichkeit und Verschlagenheit zum Erfolg führen.
Henrike Lang: Bücher
Meine Mutter las.
Ich wollte mit ihr reden
aber sie las.
Vor ihr die Wochenzeitung
ein Kilo „ZEIT“
ein knisternder Blätterwald
über den sie sich lustvoll beugte.
Eine Zigarette und eine Tasse Kaffee.
Ein schwarzer Rollkragenpullover
und ein dunkler Lockenkopf.
Sie war wunderschön
und immer woanders.
Mir blieb nichts übrig als zu lesen
wollte ich bei ihr sein.
Mit fünf konnte ich es.
Lustvoll saßen wir gemeinsam im Wohnzimmer
jede in ihrer Ecke,
jede mit einem knisternden Blatt.
Aus der „ZEIT“ fielen Bücher
wenn man sie schüttelte
Feuilleton
Dann lief Mutter zur Buchhandlung
Bücher waren ihre Götter
politische Bücher, verbrannte Dichter
Geist war der Stoff, mit dem sie lief
Ihr Körper ein einziges Gehirn.
Ich hatte keine Wahl als zu lesen.
Das erste Buch war von Ceram
Götter, Gräber und Gelehrte
Bücher haben ihre Zeit
Damals war es magisch
im staubigen Arbeitszimmer meines Vaters
in dem er nie saß, weil er auf See floh.
„Marek“ heiße Ceram eigentlich, erklärte meine Mutter
Alle Buchstaben einfach verdreht
ooooh, wie raffiniert, dachte ich
mit meinen fünf Jahren.
Meine Mutter liebte
Fontane
Tucholsky
Tucholsky
Fontane
Ich wuchs auf getränkt in
europäischer Humanität
diese elend kurzen Friedenszeiten
wer weiß was folgt
Ich hatte Kinderbücher von
Dick Bruna, Ali Mitgutsch
Tomi Ungerer, Christine Nöstlinger
Otfried Preußler, Michael Ende
und Astrid Lindgren.
Wer von uns nicht?
Für Miffy gäbe ich Günter Grass her.
Ich bekam jedes lieferbare Buch
das ich mir wünschte
von meiner sonderbaren
wunderbaren
Mutter.
Und später
als die Kindheit verblasste
und die qualvolle Pubertät kam
und meine Mutter mir gar nicht mehr helfen konnte:Oscar Wilde
Virginia Woolf
Marcel Proust
und, Königsdisziplin, James Joyce.
In meinem Mädchenzimmer die Welt.
Und das Bewusstsein: Ich bin in meiner Qual
nicht allein. Es gab lauter Schriftsteller
die haben gelitten wie ich
und haben ihre Qual
adeln können.
Der Preis
für gute Kunst
ist Qual. Ich wäre lieber
glücklich, aber ich kann nicht
ich kann bestenfalls
manchmal schreiben.
Und heute
stehen die Bücher meiner Mutter im Regal
tot wie sie
lebendig wie ich.
Litt Leweir: Das kleine Mädchen, der Tod und die Bücher
ES WAR EINMAL ein kleines Mädchen, das lebte in einem Haus ohne Bücher.
Eines Abends klopfte der Tod an die Tür und sagte zu den Eltern: „In einem halben Jahr komme ich euer kleines Mädchen holen.“
Und der Tod setzte sich auf eine Bank vor das Haus und wartete.
Die Eltern hatten furchtbare Angst. Das kleine Mädchen war doch noch nicht einmal fünf Jahre alt. Viel zu jung für den Tod. Sie beteten und hofften, dass der Tod es sich doch noch einmal anders überlegen würde. Der Vater war sogar so verzweifelt, dass er eines Tages selbst mit dem Tod mitgehen wollte. Der Pfarrer kam und überredete ihn, doch noch zu bleiben. Es gab noch ein zweites kleines Mädchen, das war noch nicht einmal ein Jahr alt, das brauchte doch seinen Vater. Und die Mutter, die alle Last auf ihren Schultern trug und selbst noch wahnsinnig jung war, auch die brauchte doch ihren Mann.
Das halbe Jahr verging und der Tod klingelte nicht noch einmal an die Tür. Auch nach einem Jahr kam er das Mädchen nicht holen. Und so verging Jahr um Jahr und nach fünf Jahren dachten alle, dass der Tod es sich wohl anders überlegt hatte und das kleine Mädchen bleiben ließ. Doch sicher konnten sie nicht sein und sie fürchteten weiter, dass der Tod vielleicht doch noch einmal klingeln würde. Zwar saß er nicht mehr vor der Tür, aber sein Schatten blieb. Und die Eltern waren nie wieder so unbeschwert und glücklich wie vorher, sie trugen ihr Leben lang eine schwere Last.
Dem kleinen Mädchen verschwiegen sie, dass der Tod sie holen wollte. Sie meinten es gut, sie wollten dem kleinen Mädchen keine Angst machen. Doch das kleine Mädchen sah den Schatten des Todes und spürte die Angst und Verzweiflung, die ihre Eltern wie eine große schwarze Wolke umgaben. Und sie sah ihre Eltern fast daran zerbrechen. Doch sie wusste nicht, was das alles bedeutete und sie hatte selbst große Angst. Doch wenn sie mit ihren Eltern darüber sprechen wollte, wiegelten sie ab. „Du brauchst keine Angst zu haben, es ist doch alles gut!“, sagten sie. Aber das passte alles nicht zusammen. Der merkwürdige Schatten draußen, die schwarze Wolke um die Seelen ihrer Eltern und die Angst, die sie selbst spürte, widersprachen den Worten der Eltern. Und all das Dunkle und Düstere lastete zentnerschwer auch auf ihr. Aber weil niemand mit ihr darüber sprechen wollte, verstummte sie allmählich.
Im Haus des Mädchens gab es keine Bücher. Doch das Mädchen hatte eine Großmutter, der Bücher wichtig waren. Und das kleine Mädchen verbrachte viel Zeit bei der Großmutter und dem Großvater. Die Großmutter kaufte dem kleinen Mädchen eine Schultafel und Kreide. Und sie brachte dem Mädchen das Lesen und Schreiben bei, bevor sie in die Schule kam. Der Großmutter war es sehr wichtig, dass das kleine Mädchen etwas lernte. Sie hatte selbst nicht lange in die Schule gehen können, musste früh arbeiten gehen, war Spinnerin in einer Fabrik. Sie schenkte dem kleinen Mädchen auch das erste Buch. Es war in Schreibschrift und hieß „Leopold, das blaue Schwein“. Jürgen Neven DuMont hat es geschrieben. Später schenkte sie dem Mädchen auch noch andere Bücher, „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner zum Beispiel. Die Großeltern hatten auch ein dickes Buch von Wilhelm Busch, in dem das kleine Mädchen gerne las. Nach der Schule lag sie oft auf dem Sofa der Großeltern und las darin. Das waren schöne Momente.
Es gab auch Zeiten, die waren nicht so schön. Das Mädchen dachte oft an den Tod und sie hatte große Angst. Manchmal war die Last so schwer, dass das Mädchen fast daran zerbrochen wäre. Und sie konnte noch immer mit niemandem darüber reden.
Aber sie ist nicht daran zerbrochen. Denn der liebe Gott hatte dem Mädchen zwei ganz wichtige Gaben geschenkt. Sie konnte richtig gut Lesen und Schreiben. Und sie konnte sich Geschichten ausdenken. In ihrer Phantasie entstanden ganze Welten. In ihrer Phantasie war sie groß und stark und trotzte dem Tod. Sie war eine Prinzessin, die in einer Sänfte durch die Straßen getragen wurde. Sie war eine Olympiaschwimmerin, die Goldmedaillen gewann. Sie war Superwoman, die durch die Lüfte schwebte und Menschen rettete ...
Sie lebte in zwei Welten, aber sie konnte die eine sehr gut von der anderen unterscheiden. Es ist gut, eine zweite Welt zu haben, wenn die erste schrecklich ist. Und es ist gut, den Kopf zu heben und in die Ferne zu sehen, über die eigene Angst hinweg. Und Bücher halfen ihr dabei.
Sie fand sehr viel Trost in den Geschichten anderer. Manchmal fand sie sich selbst darin, manchmal weiteten sie ihren Blick. Zu sehr für ihre Eltern, die sie nicht verstanden. Manche Bücher machten dem kleinen Mädchen auch Angst und es gibt einige, die sie nicht zu Ende lesen konnte. Oder erst viele Jahre später. „Das Drama des begabten Kindes“ von Alice Miller zum Beispiel.
Sie las nicht nur Geschichten, sie begann auch Geschichten zu schreiben. Das ging aber viel schwerer als das Lesen, wenn auch leichter als das Reden. In der Grundschule wünschte sie sich eine Schreibmaschine. Sie bekam keine, durfte dann aber die ihrer Mutter benutzen. Schreiben kam ihr immer ziemlich schwer vor, manchmal war es eine richtige Qual. Nur, nicht zu schreiben war noch schlimmer.
„Es war einmal ein kleines Mädchen“, das klingt, als wäre diese Geschichte ein Märchen. Aber sie ist wahr, sie ist tatsächlich so passiert. Auf dem Foto seht ihr das Mädchen, wie sie aussah, als der Tod sie holen wollte. „Es war einmal“, ist eigentlich falsch, denn das kleine Mädchen lebt immer noch. Sie lebt in der Seele einer erwachsenen Frau, die Bücher schreibt und immer noch nicht so gut reden kann. Ihre ersten Geschichten waren harte Brocken, schwer verdaulich. Mit den Jahren begann ihr Schreiben aber immer mehr zu fließen, aber so richtig flüssig ist es erst in den letzten Jahren geworden. Mittlerweile ist es immer noch harte Arbeit, aber zugleich eine große Freude, selbst wenn sie über düstere Dinge schreibt. Dass der dunkle Schatten der Tod ist, hat sie schon längst verstanden. Manchmal sieht es so aus, als schriebe sie über den Tod. Aber das stimmt nicht. Sie schreibt darüber, wie es ist, gut zu leben mit dem Tod vor der Tür. Und wie man nicht daran zerbricht.
Sie liest immer noch viel. Lesen macht einfach Spaß. Man kann sich in Geschichten verlieren und zugleich darin finden. Geschichten können den Kopf weit machen. Wenn man sie willkommen heißt, wie sie sind, statt ihnen mit den eigenen Erwartungen den Weg zu versperren ...
Der Tod sitzt immer noch vor der Tür, nicht nur sein Schatten. Er sitzt vor jeder Tür. Immer. Manchmal finden sie das noch immer sehr schwer zu akzeptieren, die Frau und das kleine Mädchen. Ab und zu unterhalten sie sich mit ihm. In ihren Geschichten zum Beispiel. Manchmal finden sie ihn dann gar nicht mehr so grimmig. Dann wieder fürchten sie sich ganz schrecklich vor ihm. Oft ist er ihnen egal.
Der Tod hat schon ein paar Mal geklingelt. Erst hat er den Großvater mitgenommen, dann fünfundzwanzig Jahre später die Großmutter und nicht einmal zwei Monate später den Vater. Irgendwann wird er auch die Frau und das kleine Mädchen abholen. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht morgen, vielleicht ist es noch eine Weile hin ... Wenn er kommt, wird die Frau das kleine Mädchen an der Hand halten, damit sie keine Angst haben muss, das hat sie sich fest vorgenommen. Vielleicht warten sie dann alle auf sie, die Groß-eltern, der Vater, vielleicht auch die beiden Kater, die der Tod auch schon mitgenommen hat. Vielleicht auch nicht. Aber bis der Tod kommt, will sie noch ganz viele Bücher schreiben. Denn Bücher sind Geschichten und Geschichten retten Leben.
SAID
münchen, den 6. juni 1998
heute habe ich die ersten exemplare von meinem kinderbuch erhalten. „es war einmal eine blume“, mit illustrationen von kveta pacovska. auf diesen tag habe ich 24 jahre gewartet.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
paris, den 3. oktober 2003
meine übersetzerin nimmt mich mit auf den empfang der deutschen botschaft.
die musik laut und unmelodisch; das buffet gigantisch.
madame bary stellt mich georges-arthur goldschmidt vor, dessen buch über die flucht aus hitler-deutschland ich sehr gerne gelesen habe.
herr goldschmid fragt mich sofort, wie ich zwischen zwei sprachen lebe. dann fügt er hinzu:
„ich bin seit dem 11. lebensjahr in frankreich und spreche akzentfrei französisch, aber ich zähle noch immer auf deutsch.“
während wir uns unterhalten, holt goldschmidt aus seiner tasche eine halbe breze, beißt hinein und steckt den rest wieder in die tasche.
er ist der deutsche flüchtling geblieben, unbestechlich.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5. september 05
„ja, prosa soll es sein, keine dichtung – die nimmt man hier nicht mehr an, die ist jetzt nur wechselgeld.“
aus dem brief meines rumänischen übersetzers.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20. april 2006
an seine exzellenz paul freiherr von maltzahn, botschafter der bundesrepublik deutschland in iran
exzellenz,
zu meiner überraschung und freude erfahre ich von dem abend am 24. april, den sie in teheran zu meinen ehren veranstalten; der anlaß ist wohl die verleihung der goethe-medaille an mich. daß gerade in meiner stadt meine gedichte vorgetragen werden, ehrt mich besonders.
persisch ist die sprache meiner kindheit, die mich bis zum heutigen tag zu träumen beflügelt, die die furt meines lebens bestimmen. deutsch ist die sprache meiner freiheit. sie hat mich als flüchtling aufgenommen und mir die möglichkeit geschenkt, mich auszudrücken. und nun trägt die sprache meiner freiheit mich nach hause und verbindet mich mit meiner stadt – nach 41 erzwungenen jahren der abwesenheit.
diese ehrung ist die größte, die mir in meinem leben widerfahren ist.
ich bitte sie, exellenz, meinen verbindlichen dank entgegenzunehmen und meine stadt zu grüßen.
münchen, den 20. april 2006
Frederike Frei: Ingeborg Bachmann
ES HIEß, DIE GROßE DICHTERIN kommt. Nach Hamburg! Ich hin. Ich war ein dreister Ausbund in Stulpenstiefeln, erstes Semester Germanistik, immer etwas grob gestrickt im Mittelpunkt, aber mit einem fein ziselierten Binnenleben, von denen die wenigsten etwas ahnten. Doch die Dichterin hätte einen Blick dafür, das wusste ich. Gehörte sie doch zur Spezies der Göttinnen. Da sie Hamburg besuchte, würde sie auch m i c h kennenlernen wollen, ich dichtete ja auch. Ich musste der Dichterin nur die Gelegenheit dazu verschaffen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Sie wird sich meinen Wohnort mit Bedacht ausgesucht haben, mutmaßte ich, um hier Mitdichterinnen zu treffen wie mich, die hinter ihr stehen. Warum begibt sich sonst eine so gefeierte Dichterin ausgerechnet aufs Pflaster der Pfeffersäcke, wenn sie nicht ahnte, dass sie dort lyrische Geister fände, die sich ebenso wie sie hinreißen ließen von Buchstaben, diesen filigranen, immer unausgefüllten Lesezeichen, von Wörterwiesen und Satzketten? Sie wird erleichtert sein zu erfahren, dass sich hier im Norden noch so eine findet wie sie selbst, denn ich war eine, die sie wirklich verstand und zu ihr hielt, sobald einer sie in Zweifel ziehen wollte. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, mich ihr in einem stillen Tête-à-Tête als zukünftige Kollegin zu entdecken. Heimlich hoffte ich dabei auf eine Neuauflage dieser unvergessenen Szene, die ich bei Joseph Conrad gelesen hatte, in der er als Kapitän auf hoher See einem einsilbigen Passagier zum ersten Mal in seinem Leben seine Manuskripte zeigte mit der Bitte um ein Urteil, da er sich frage, ob er weiter schreiben solle. Der Fahrgast habe nur ein einziges „Unbedingt!“ hinter seiner Pfeife hervorgepresst nach der Lektüre. Träumerisch hatte ich über dieser Textstelle im Buch gehangen.
Für den Fall, dass mir die hochverehrte Dichterin ein paar Worte aufschreiben wollte, hatte ich mir herrengraues Briefpapier besorgt und stellte mir nun vor, dass sie inständig aus mir herausfragte, ob auch ich dichte. Leicht wollte ich es ihr nicht damit machen. Erst sollte sie mich bitten, dann drängeln mit dieser Hartnäckigkeit, mit der mir meine Mutter früher mal das Geständnis eines Groschendiebstahls zu entlocken wusste, und im Voraus ersehnte ich schon die gleiche Erleichterung wie nach meiner damaligen Offenbarung.
Heute Abend war es so weit!
Ich prüfte mein Aussehen im Spiegel wie sonst nur den Wortlaut meiner Gedichte im Tagebuch. Wie ich an Zeilen und Satzzeichen herumbastelte, bosselte ich jetzt an Scheitel und Haarklemmen. Nicht zu früh, nicht zu spät würde ich ankommen. Gefasst bis ins Mark machte ich mich auf den Weg zu meinem ersten literarischen Stelldichein.
Vor dem Hauptgebäude der Hamburger Universität gerate ich überraschend in eine aufdringliche Menschenmenge, die nicht von meiner Seite weicht. Von überallher strömt es in den bereits gefüllten Hörsaal. Ein Gerangel, Geschurre, Gerufe! Schock. Lauter Fremde. Was wollen die hier? Mein persönliches Verhältnis zur Dichterin geht niemanden etwas an. Die Poetin in spe schrumpft zur Studentin, die die Wahl hat zwischen einem Stehplatz an der Wand oder einem Sitzplatz hinter der Säule.
Auf den Schreck muss ich mich erst einmal setzen. Nun lauere ich auf eine günstige Gelegenheit, um einen Blick aufs Podium in die Tiefe des Hörsaals werfen zu können. Während wer ein paar kurze einführende Worte spricht, die ich schon damals sofort vergaß, ranke ich mich um die Säule herum wie die Schlange um den Äskulapstab, linse an aufgestellten Hemdblusenkragen und runden Kinnpartien vorbei, bis ich die Angehimmelte endlich im Blick habe. Aber was ich sehe, ist auch nicht viel mehr. Wie bei einer Schülerin, die beim Vorlesen mit der Nase ins Buch kriecht, verdeckt ihr blonder Haarvorhang ihr halbes Gesicht. Und von seiner anderen Hälfte sehe ich auch nur die Nasenspitze, aber immerhin kann ich mich am Haarvolant gütlich tun, er schwingt leicht mit dem Kopf mit, und jetzt kommt dazu das Wunder ihrer Stimme. Seltsam leise, fast schüchtern, brüchig, sogar etwas leierig auf die Dauer, aber dunkel und samten, denn es ist ja die Dichterhimmelskönigin auf Erden, die liest.
Zu meiner Verwunderung liest sie keine Gedichte, sondern den Anfang ihres ersten Romans, dessen Titel mir überhaupt nichts sagt. Er klingt nach einer Gottheit auf den Osterinseln. Malina. Warum durchschreitet sie nicht als Diva den Raum? Erhebt ihre Stimme in alle Welt? Endet vielleicht mit ein paar Späßen und landet unweigerlich wie von ungefähr bei mir? Wenn wir uns dann gegenüberstehen … darüber hinaus versagen meine Sinne.
Weil ich den Putz dieser Säule vor mir nun schon kenne, betrachte ich den Widerschein meines Idols auf den Gesichtern. Das Publikum scheint alles zu begreifen, tut so, als stünde es mit der Dichterin auf Du und Du oder eher auf Sie und Sie und hält es für völlig normal, anwesend zu sein und Platz genommen zu haben wie bei jeder besseren Vorlesung.
Ob sie alle wie ich seit Wochen auf diesen Termin hinjieperten, davon geben sie nichts preis. Mit denen muss ich nun meine Angebetete teilen. Dabei gibt es die Dichterin doch nur als Solitär in meinem Herzen eingeschlossen, etliche Karat, ganz für mich allein.
Es fällt mir schwer, zuzuhören, wenn immer derselbe Ton ins Ohr dringt. Sie liest, als wäre es nicht ihr Text, als lieferte sie nur eine Hausaufgabe ab. Ich höre zwar hin, aber nicht zu. Zu sehr bin ich abgelenkt von ihr selber. Außerdem verstehe ich sowieso nicht so viel. Brav sitzt sie da. Sie könnte doch die versammelte Zuhörerschaft wie eine Urmutter in die Arme schließen. Alles hängt ja an ihren Lippen, jedenfalls ich hier oben hinter der Säule.
Geht es ihr vielleicht nicht gut? Ist sie verschnupft, dass so viele gekommen sind? Kann ich ihr nachfühlen! Sicher hat ihr jemand den Roman schlechtgemacht, sodass sie nun gar nicht mehr zu ihm stehen mag? Hat sich die Kritik zu sehr zu Herzen genommen? Ich rätsele und forsche. So wird es sein: Sie will ihn überhaupt nicht vorlesen. Er ist ihr viel zu schade für uns. Aber wenigstens für mich könnte sie sich doch anstrengen. Warum liest sie ihn überhaupt vor? Wir können doch alle selber lesen. Ich werde immer ungeduldiger.
Da ist das Ende gekommen! Schon ist die Lesung vergessen, und ich stürme in die Nähe der wieder heiß umschwärmten Lyrikerin, kämpfe mich durch den sich von unten langsam heraufwälzenden Besucherstrom die zahllosen Stufen hinab, in den Händen mein Briefpapier und mein Lieblingsbuch, ihre Gesammelten Gedichte, ein großer, gebundener Band.
Man kommt gar nicht an sie heran.
Nachdem ich mich im Menschenpulk endlich in ihre Nähe gespielt habe, können sich meine Augen noch immer nicht über sie hermachen. Wie sie vorher am Pult klebte und las, so sitzt sie jetzt an den Büchertisch gepresst und schreibt Autogramme in einen schmaleren Auswahlband ihrer Gedichte, den fast jeder hier mit sich führt. So kenne ich sie schon von Fotos. Sie ist mir im Herzen vertrauter als in Wirklichkeit. Wenn wir uns aber bald von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen …
Plötzlich wendet sie sich um und nimmt mir, ohne ein Wort zu verlieren, ungefragt mein Buch weg, das ich ihr überhaupt nicht gereicht habe, das ich aber natürlich immer wie eine Monstranz vor mir hertrage, und schickt sich an, etwas mit Füller hineinzuschreiben. Obwohl ich dabei endlich einen Blick auf sie erhaschen kann, den mir ihr Haarvorhang aber gleich wieder versperrt, bin ich völlig entsetzt. Zum einen jage ich keinem Autogramm nach wie alle anderen hier, zum anderen tut es mir Leid um das hochheilig gepflegte und gehegte Buch. Es gehört ihr doch gar nicht. Und nun mit Tinte beschmiert. Darf sie das denn? Bücher muss man schonen, haben mir meine Eltern beigebracht. Kläglich wedele ich mit dem Briefpapier, aber bleibe stumm. Ach, die Dichtergöttin hat ja keine Ahnung, was sie mit diesem Eintrag in ihr Poesiealbum anrichtet.
Ich halte still. Sie schreibt mir! Ich wundere mich allerdings, woher sie so rasch weiß, was. Sie wird schon wissen, wen sie hier vor sich hat. Endlich setzt sie den Stift ab, sieht auf, und ich kann diesen winzigen, zerbrechlichen Moment nutzen, ihr mit brennenden Augen ins zarthäutige, mir landschaftlich ganz unbekannte Gesicht zu blicken, dessen flirrende Wimpern wie verlegen wirken über der wasserfarbenen Iris. Die Meisterin muss mich jetzt ansprechen und ausfragen, so lautet mein Szenario. Auf die umgekehrte Idee komme ich gar nicht. Doch als Antwort auf meinen höchstpersönlichen Redeschwall in Form eines ausgefüllten Schweigens gibt sie mir lediglich mein Buch zurück, und schon schiebt ihr ein anderer sein aufgeschlagenes Exemplar unter das Handgelenk. Ich werde von den Nachdrängenden erbarmungslos aus der Mitte herausgestrudelt, ziehe mich mit meinem Buch zurück, schlage es kurz auf, überfliege die Worte in Tinte, klappe den Buchdeckel aber ebenso rasch wieder zu, als könne die Nachricht verloren gehen. Ich will sie mir für seligere Momente aufheben. Und nun harre ich wie ein leidenschaftlicher Liebhaber mit fiebriger Stirn in ihrer Nähe aus, damit die Schar der Fans abnimmt und mir Gelegenheit gibt, mich der Dame meines Herzens erneut zu nähern.
Sie hat mich angelächelt. Wir uns. Es gab da jedenfalls diesen Moment hauchfeiner Übereinstimmung. Aber ich habe mich ihr noch gar nicht vorgestellt, ihr nicht ausgemalt, wie allnächtlich ich als Geist über ihren Gedichten schwebe. Auch meine Freundinnen muss sie noch kennenlernen, am besten mit nach Blankenese kommen, meine Wörterwelt in allen Winkeln ausleuchten, so wie ich schon seit langem die ihre. Bisher ist unsere Beziehung viel zu einseitig verlaufen.
Langsam tröpfelt es nur noch an ihrem Tisch.
Jetzt könnte sie auf die unauflösliche Verbindung zwischen uns zurückkommen … Sie erhebt sich! Steht da mit den Veranstaltern oder anderen Herrschaften am Pfeiler, zum Anfassen nah. Die Kleidung etwas altmodisch wie die von Tante Gisela.
Im Kreise meiner Verwandten werde ich oft gefragt, wie es mir geht, sodass es mir schon zu viel wird. Wir, sie und ich, sind aber doch auch verwandt, seelenverwandt. Und doch steh ich hier fremd herum wie im Kaufhaus und muss mich anstrengen, ihre Aufmerksamkeit von den Betreuern auf mich umzulenken.
Jetzt! könnte ich auf sie zutreten, sie den andern abspenstig machen, mich mit ihr unter vier Augen treffen. Schon zucken die Zehen – doch da bauen sich urplötzlich Luftmauern auf, ganze Felsbrocken aus nichts, zu steil für mich aus dem Stand. Ich empfinde ihre körperliche Anwesenheit als Übermacht von etwas Fremdem und Andersartigen wie Gestein aus dem Weltraum, das ich einmal stundenlang Pore für Pore in einer Vitrine des Geologischen Instituts musterte und doch nicht begriff. Die Ereignisse sind nicht mehr aufzuhalten, der Star wendet sich zum Gehen, entschwindet die flachen Treppenstufen hoch am Arm zweier sicher sehr belesener Herren.
Nahtlos schließt die Welt auf Papier an die reale an, wenn die letztere zu wünschen übrig lässt. Sie hielt mein Buch in Händen! Ich blättere darin wie wild nach ihren Worten. Und während ich auf die tintenblaue Schreibschrift starre, jede Buchstabenschlinge, jede Zacke eine heilige Spur ihrer Gegenwart, wird mir klar, dass wir beiden durchaus miteinander gesprochen haben, nur ohne Worte, und dass wir uns jetzt noch austauschen, sogar mit Worten: schriftlich. Anders ließ sich unsere Begegnung wohl nicht bewerkstelligen.
Die große Fracht des Sommers ist verladen … steht da. Eine Geheimbotschaft, exklusiv für mich, doch ich bin augenblicklich enttäuscht. Den kenne ich doch, den Satz, maule ich mit ihr, man liest und hört ihn ja überall. Es ist der Titel und die Anfangszeile eines ihrer Gedichte. Trotzdem mag ich ihn nicht. Fachausdrücke aus dem Berufsleben finde ich unpoetisch, teile ich ihr telepathisch mit. Das muss sie doch auch spüren. Aber sie bleibt bei ihrer Aussage. Und warum so schief geschrieben? Wie in Eile. Abwärts driftet der Satz mit etlichen Entgleisungen. Darf man ihn überhaupt so verstümmeln? Er geht doch weiter. Einfach aus dem Gedicht heraus gebrochen. Er steht da wie geklaut.
Die große Fracht des Sommers ist verladen …! Und warum die drei Pünktchen? Will sie mir damit etwas unter die Nase reiben? Oder hatte sie nur keine Lust, weiter zu schreiben? Der Satz klingt wie eine Meldung. Aye, aye Sir, die Fracht des Sommers ist verladen! Aber was hab ich damit zu tun? Ich bin doch nicht ihr Chef. Kurz zuckt mir durch den Sinn, wie sie unten am Kai bei den Baumwollballen mit anpackt und ich erlebe sofort mit, wie viel Aufsehen das erregt. Die nehmen sie doch gar nicht, das hat sie auch nicht nötig. Im Hafen jobbt höchstens so jemand wie mein Bruder.
Die große Fracht des Sommers ist verladen. Sie redet wie meine große Schwester, die mir auch immer vorhält, alles allein tun zu müssen im Haushalt und eigentlich nur Gründe sucht, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Beklagt sie sich zwischen den Zeilen, dass sie groß den Sommer verfrachten muss, während ich in ihren Büchern herumschmökere und es mir mit ihnen gemütlich mache? Ich wusste doch nicht, wie viel sie zu ackern hat! Immer soll man alles von selber merken. Ich hätte ja mitgeholfen. Wahrscheinlich will sie mir nur von Hausfrau zu Hausfräulein stecken, dass man gut und gerne auch ohne mich auskommt. Wie hat sie das bloß rausgekriegt, dass ich faul bin oder lieber woanders fleißig. Ich fühle mich ertappt.