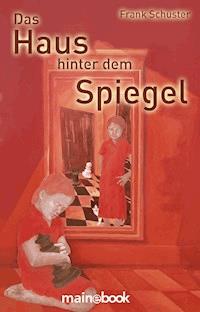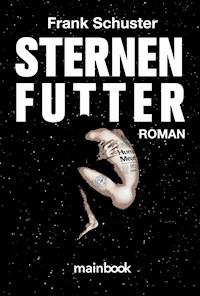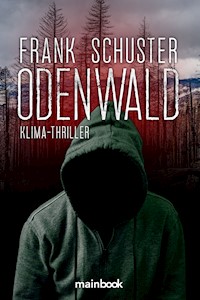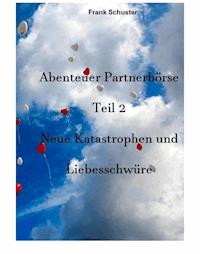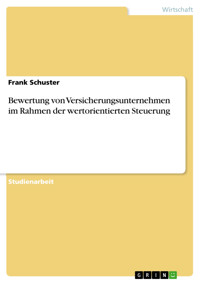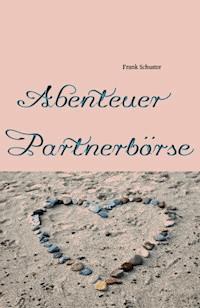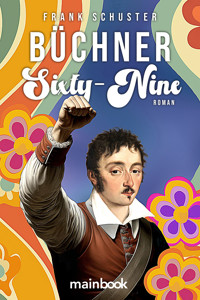
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Demonstrierende Schüler handelten im Geiste Büchners" (Schlagzeile Darmstädter Tagblatt, 2.10.1969) "Büchner Sixty-Nine" beruht auf wahren Begebenheiten. Erzählt wird ein vergessenes Kapitel: Ende der 60er gingen nicht nur die Studierenden auf die Straße, sondern auch die Schüler. In Darmstadt nahmen sie sich ein Vorbild am jungen Revolutionär Georg Büchner. Der Roman lässt die gesellschaftlichen Umbrüche hautnah miterleben und zeigt Parallelen zu den heutigen Protesten von Jugendlichen auf. In der Tradition von "Unterm Rad" und "Der Club der toten Dichter" erzählt "Büchner Sixty-Nine" vom Aufbegehren der Jugend. Michael, Thomas und Marion schließen sich den Protesten gegen die Entlassung eines beliebten Lehrers an. Mit seinem vom 68er-Geist geprägten Unterricht eckte er im spießigen Schulsystem an. Schüler treten in den Streik, attackieren Lehrer, blockieren die Innenstadt, eine Straßenbahn geht zu Bruch, schließlich stören sie die Verleihung des Büchnerpreises. Die Schulleitungen setzen die Jugendlichen unter Druck und drohen mit Schulverweis. Die Liebe und Freundschaft zwischen Michael, Marion und Thomas wird auf eine harte Probe gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Schuster
Büchner Sixty-nine
Roman
eISBN 978-3-911008-25-9
Copyright © 2025
mainbook Verlag
Sophienstraße 77
60487 Frankfurt
Alle Rechte vorbehalten
Coverdesign und Umschlaggestaltung: Florin Sayer-Gabor –
www.100covers4you.de unter Verwendung von Grafiken von
Creative Fabrica.
Bei einigen verwendeten Grafiken wurde Künstliche Intelligenz
als Hilfsmittel eingesetzt. Diese KI-Grafiken wurden für
das Coverdesign weiter verändert und bearbeitet. Das Cover ist
KEIN reines Erzeugnis Künstlicher Intelligenz.
Auf der Verlagshomepage www.mainbook.de finden Sie weitere
spannende Bücher.
Inhalt
Prolog
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
Zweiter Teil
6.
Dritter Teil
7.
8.
9.
10.
11.
Epilog
Nachbemerkung
Dank
Anmerkungen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Epilog
Das Buch
Der „Fall Lüdde“ sorgte 1969 für Schlagzeilen: die Entlassung eines Frankfurter APO-Lehrers von der Georg-Büchner-Schule in Darmstadt. Aus Protest blieben die Schüler dem Unterricht fern und gingen zum Demonstrieren auf die Straßen. Der Roman „Büchner Sixty-Nine“ spielt vor dem Hintergrund der damaligen Ereignisse. Es treten fiktive neben realen Personen auf. Das Buch beruht auf Gesprächen mit Zeitzeugen und Archivrecherchen, die im Anhang erläutert werden. In einer bewegten Zeit, als Pädagogen noch schlugen und Sexualkunde umstritten war, forderten die Schüler weniger Autorität, mehr Freiheiten und eine Auseinandersetzung mit dem NS-Erbe – auch dem ihrer eigenen Lehrer.
Der Autor
Frank Schuster, geboren 1969, lebt in Darmstadt. Er arbeitet als Redakteur des „Darmstädter Echo“ und ist Mitglied der südhessischen Literaturgruppe Poseidon. Er hat Germanistik, Anglistik, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt, Marburg und Oxford studiert. Jüngste Veröffentlichungen im mainbook Verlag: „Odenwald“ (Klima-Thriller, 2023) und „Sternenfutter“ (Dystopie, 2018). Näheres auf seiner Homepage: www.frankschuster.blog
Aber noch erhabner ist es, den Menschen zu sehen im Kampfe mit seinem Schicksale, wenn er es wagt, einzugreifen in den Gang der Weltgeschichte, wenn er an die Erreichung seines Zwecks sein Höchstes, sein Alles setzt. Wer nur einen Zweck und kein Ziel bei der Verfolgung desselben sich vorgesteckt, gibt den Widerstand nie auf, er siegt, – oder stirbt.
„Rede zur Verteidigung des Cato von Utica“ des Schülers Georg Büchner an seiner Schule, dem Alten Pädagog, in Darmstadt
In den Schulklassen dieser Jahre zählte nun die Haarlänge. Deine Haare verrieten, ob du dich deinen Eltern gegenüber durchsetzen konntest oder dich weiter wie einen Sklaven behandeln ließest, ob du aussehen wolltest wie ein deutscher Nazi oder wie John, Paul, George und Ringo.
„Ringo-Variationen“ von Rainer Wieczorek, 1969 Schüler an der Darmstädter Georg-Büchner-Schule, heute Schriftsteller
Prolog
Donnerstag, 19. September 2019: Ein Tag vor dem globalen Klimastreik
Der Anruf kam überraschend.
Eine Journalistin der lokalen Zeitung war dran.
„Morgen, ja, morgen ist der globale Klimastreik“, sagte die Redakteurin. Sie hatte eine junge Stimme. „Und vor fünfzig Jahren, nun, da hatten die Schülerinnen und Schüler in Darmstadt schon einmal gestreikt; wenn auch länger und heftiger – und nicht nur freitags.“ Sie lachte kurz über ihren Nachsatz. „Und, ja, Sie waren dabei, wie mir Marion Diroll erzählte, die mir Ihre Telefonnummer gegeben hat.“
Marion. Der Name versetzte Michaela einen Stich ins Herz. Fast zehn Jahre hatte sie nichts mehr von ihr gehört. Warum hatte sie ihre Nummer an die Zeitung weitergegeben?
Ja, sie war dabei gewesen. Aber wirklich nur dabei. Eine Mitläuferin. Sie hatte bloß eine Nebenrolle gespielt. Damals, als sie noch Michael hieß. Die Anführer waren andere gewesen. Karl und Andel. Und Thomas – ihr bester Freund, der so früh sterben musste.
Warum war Marion überzeugt, dass das, was sie zu sagen hat, interessant für die Zeitung sei?
„Ich würde gerne wissen“, fuhr die junge Redakteurin fort, „welche Erinnerungen an den Herbst 1969 in Ihnen hochkommen, wenn Sie die heute demonstrierenden und streikenden Schüler sehen. Welche Meinung Sie zu Fridays For Future haben. Und vielleicht können Sie Ihren Protest von damals mit dem Protest der Jugend heute in Vergleich zueinandersetzen.“
Die Redakteurin hörte abrupt auf zu reden.
Michaela bemerkte, wie sie schwitzte. Sie dachte angestrengt nach. Verblasste Bilder zogen an ihrem inneren Auge vorbei. Sie musste jetzt schnell antworten. Journalisten haben wenig Zeit.
Schließlich hörte sie sich sagen, dass sie selbst regelmäßig mit der Enkelin einer Freundin auf FFF-Demos gehe und vorhabe, das auch morgen zu tun; dass es, damals wie heute, um die Zukunft der jungen Leute gehe; dass beide Generationen einen Systemwechsel forderten – wenn auch bei den früheren Protesten die Transparente bevorzugt rot und schwarz gewesen seien und heute regenbogenfarben.
Als sie fertig war, fragte sie sich, wie die Redakteurin aus ihren sprunghaften Gedanken einen zusammenhängenden Text hinbekommen sollte. Doch die junge Frau, die vor fünfzig Jahren sicherlich noch nicht auf der Welt gewesen war, schien mehr als zufrieden, als sie sich mit freundlichen Worten verabschiedete und auflegte.
Michaela hängte ebenfalls ein. Und begann, sich zu erinnern.
Erster Teil
1.
Donnerstag, 4. September 1969: Erster Schultag nach den Sommerferien
„Der Lüdde ist weg.“
„So eine Schweinerei.“
„Die haben einfach bis nach den Sommerferien gewartet.“
„Als ob sie gehofft hätten, dass wir ihn bis dahin vergessen haben.“
„Den sehen wir nie wieder.“
„Sein Unterricht war ziemlich gut.“
„Er hatte aber auch radikale Ansichten, findet ihr nicht?“
„Er hat es den Nazilehrern hier allerdings mal so richtig gezeigt.“
Michael saß auf der Treppe und lauschte den Gesprächen auf dem Schulhof. Es machte die Runde, was auch er heute Morgen in der Zeitung gelesen hatte: Sein Sozialkundelehrer, der Studienassessor Heinz Lüdde, der erst seit knapp einem halben Jahr an der Georg-Büchner-Schule unterrichtete, war von der Schule geflogen. „GBS-Lehrer entlassen“, lautete die Schlagzeile im Darmstädter Echo. Es war seltsam, den vollen Namen seines Lehrers in der Zeitung zu lesen. Irgendwie auch unfair – warum hatten sie nicht einfach L. geschrieben?
Jetzt bekamen sie einen neuen Lehrer in Sozi. Konnte nur schlechter werden.
In der Ferne sah Michael, wie die Schüler der zwölften Klasse – Unterprimaner hießen sie hier am Gymnasium – zusammenstanden. Sie hatten sich um Karl versammelt. Bestimmt heckten sie irgendeinen Plan aus, der mit Lüdde zusammenhing.
Wo blieb nur Thomas?
Michael musste sich unbedingt mit ihm über die Neuigkeiten austauschen. Hinter ihm lagen langweilige sechs Wochen Sommerferien. Ihr Tiefpunkt waren eindeutig die zwei Wochen bei seinen Großeltern im Allgäu gewesen. Der Höhepunkt war die Fernsehübertragung der Mondlandung, für die er länger hatte aufbleiben dürfen.
Thomas, der Glückliche, hingegen war mit seinen Eltern an die Adria gefahren. Michael war noch nie in Italien. Er stellte es sich aufregend vor. Sicherlich war da viel mehr los als in Seeg. Mehr als den Schwaltenweiher gab es dort einfach nicht. Sein Wasser war kalt, er war jedoch fast täglich darin baden. Er genoss es, dort allein sein zu können. Seine Eltern und Großeltern waren kein einziges Mal mitgekommen, sie hatten keinen Spaß am Schwimmen. Michael aber liebte es – besonders jene stillen Momente, wenn er seinen Kopf eintauchte, bis seine Ohren knapp unter Wasser waren und die Welt um ihn herum verstummte.
Eine gute Sache hatten die Ferien aber doch gehabt: Er hatte ungestört Gitarre üben können. Mittlerweile spielte er sogar schon das knifflige Intro von Jimi Hendrix' Little Wing ziemlich gut – die schönsten dreißig Sekunden Musik, die Michael kannte.
Während er weiter auf Thomas wartete, erinnerte er sich daran, wie Lüdde ihre Klasse, die 9b, im vergangenen Halbjahr übernommen hatte. Von der ersten Unterrichtsstunde an war klar, dass er einen komplett anderen Stil pflegte als alle anderen Lehrer an der Schule – lockerer, freier, offener, antiautoritärer, ja, rebellischer. Okay, Lüdde sah nicht unbedingt aus wie ein Rockstar oder so. Er trug keine langen Haare wie inzwischen die meisten Jungs in Michaels Klasse. Er trug sie kurz und gescheitelt. Mit seiner strengen Brille sah er eher aus wie ein Liedermacher oder Jazzmusiker. Wäre seine Haut nicht weiß, hätte er eine Ähnlichkeit mit Malcolm X.
In einer der ersten Stunden änderte Lüdde erst einmal die Sitzordnung. Er und die Schüler schoben jeweils drei Tische zusammen. Zwei mit den Längsseiten gegeneinander, den dritten an die Kurzseiten.
„Oh nee, Gruppenarbeit!“, murrten einige.
Michaels Klasse galt als rüder Haufen, der nur schwer zu unterrichten war – sie pufften und schlugen sich häufig. „Vieles von eurer Unruhe“, sagte Lüdde, „und eurer Unfähigkeit, euch zu konzentrieren, stammt einfach daher, dass man vierunddreißig Jungen im Alter von vierzehn bis fünfzehn Jahren in einem viel zu kleinen Raum in Reih und Glied zum Unterricht sitzen lässt.“ So drückte er sich aus und darüber lachten sie – vor allem über das Wort „Glied“. „Mädchen bekommen wir ja leider nicht in eure Klasse“, sprach Lüdde mit einem Grinsen in ihr Gelächter hinein, das sich daraufhin in ein lautes Gejohle steigerte.
Es durften zwar längst Mädchen an die GBS. Die meisten von ihnen zog jedoch weiterhin die Viktoriaschule ab, eine ehemalige Mädchenschule im schicken Paulusviertel. Sie war nur wenige hundert Meter entfernt von der Büchner, die draußen am Böllenfalltor-Stadion lag, in dem der SV Darmstadt 98 in der angelaufenen Saison in der Zweiten Liga Süd alles darum gab, nicht in die Amateurliga Hessen abzusteigen. Noch näher war die Lichtwiese, auf die sich Schüler gerne einmal in Freistunden zurückzogen, um zu kiffen oder zu knutschen.
Lüdde scherte sich wenig um das, was auf dem Lehrplan stand. Stattdessen versuchte er, auf die Schüler einzugehen. „Die gruppendynamischen Probleme könnt ihr durchaus auch im Unterricht ansprechen“, sagte er. Manchmal sprach er schon sehr geschwollen. Seine Unizeit lag noch nicht lange zurück. Zudem war er in der APO. Unter den Schülern raunte man, er habe in Frankfurt bei Adorno studiert.
Als Lüdde mitbekam, dass einige in der Klasse die Schülerzeitschrift Underground lasen, besprachen sie Texte daraus im Unterricht. Ziemlich gewagt, wie sich herausstellte. Denn in jeder Ausgabe verlieh das Magazin, das aus der linken Frankfurter Sponti-Ecke kam, den „Schlagring des Monats“ an einen prügelnden Lehrer. Von dieser Sorte gab es auch an der GBS noch einige. Die Zeitschrift berichtete über Themen wie „Am Arsch der Welt – Jugend in der Kleinstadt“, „Von zuhause weg – aber wohin?“, „Auf nach London! Da gibt's alles umsonst“ oder „So kriegt man Geld für's Demonstrieren.“
Über Sex schrieb das Magazin um einiges freizügiger als die Bravo. Michael hatte gehört, dass die Underground bald nicht mehr am Kiosk erhältlich sein sollte, weil sie als jugendgefährdend eingestuft worden war.
Auch Lüdde redete ziemlich offen über Sex.
Sexualkunde war erst im vergangenen Schuljahr an den Schulen eingeführt worden. Die Lehrer wussten noch gar nicht, wie sie das Thema überhaupt behandeln sollten. Lüdde pfiff auf den Sexualkunde-Atlas. Und er hatte recht – Gefühle kamen in der Schwarte gar nicht vor. Auch sonst nichts von dem, was die Klasse brennend interessierte. Michael war sich gar nicht sicher, ob Lüdde das Thema in Sozi überhaupt hätte ansprechen dürfen und ob es nicht eigentlich für Bio gedacht war.
Manchmal kramte er den Atlas nachts heimlich aus seiner Schreibtischschublade hervor, nur um ihn schnell wieder darin verschwinden zu lassen – abgetörnt von den mechanischen Darstellungen von Geschlechtsorganen. Am besten war noch das Bild vorne auf dem Cover, das aussah, als hätte der Maler es unter Drogen gemalt.
Michaels Eltern hatten ihn nicht aufgeklärt. Und vom Pfarrer wollte er das gar nicht erst werden. Er ging sowieso seit der Konfi nicht mehr in die Kirche.
Und dann kam die Unterrichtsstunde mit den Fragen.
Michael war sich sicher, dass sie es gewesen waren, die Lüdde das Genick gebrochen hatten. Er hatte der Klasse diktiert: „Sollen Jugendliche in Deinem Alter sexuell aufgeklärt werden und wie?“ Und: „Bist Du der Meinung, dass Jugendliche in Deinem Alter schon praktische intime Beziehungen zum anderen Geschlecht haben sollten?“
In der nächsten Stunde präsentierte Lüdde der Klasse seine Auswertung der anonym abgegebenen Antworten. Frage eins hatten alle mit ja beantwortet, das war zu erwarten. Frage zwei hatte der Lehrer systematisch nach einer Skala von einem klaren Ja bis zu einem klaren Nein geordnet.
Michael und seine Mitschüler lasen die Antworten durch – von Johlen und Lachen begleitet oder auch verschämte, schiefe oder wissende Blicke werfend. Die Schüler hatten unter anderem geschrieben: „Warum sollen nur immer die Alten die Erfahrungen sammeln und die Jungen vertröstet werden.“ „Ab sechzehn unbedingt nötig, um spätere Fehler zu vermeiden. Früh übt sich, wer ein Meister werden will.“ „Die Frage ist zu bejahen, da die trockene Theorie zur richtigen Aufklärung nicht ausreicht.“ „Ich persönlich möchte sagen, dass ich durchaus dafür wäre, das in der Praxis durchzuführen. Vorausgesetzt – ein gutes Mädchen.“ „Ich bin eigentlich dafür, denn ich meine, mit fünfzehn oder sechzehn ist doch die schönste Zeit dazu, aber natürlich ohne Kinder. Dagegen kann man ja heutzutage etwas machen.“ „Nun, als kleiner Versuch wäre es vielleicht zu bejahen, doch auf die Dauer sollte man mit intimen Beziehungen noch etwas warten. Doch bis zur Ehe wäre es zu spät.“
Die Befragung hatte bei den Eltern für gehörigen Ärger gesorgt. Michael hatte von der ganzen Sache zuhause erst gar nichts erzählt. Aber er fand den Umgang mit der Sexualität von Jugendlichen scheinheilig: Wenn der Körper so weit war, wieso nicht? Warum sollte die Natur es so eingerichtet haben, den Menschen so lange zu quälen, bis er volljährig oder verheiratet war? Romeo und Julia waren doch auch Teenager gewesen.
Mit Grausen dachte Michael an die Worte über Selbstbefriedigung, die er in dem Ratgeber gelesen hatte, den Onkel Dieter ihm geschenkt hatte: „Sie verschlechtert nicht nur das Blut, sondern sie zerstört die aufbauenden Kräfte und die Geschlossenheit der Seele überhaupt. Sie ist ein fressender Wurm, der das Edlere hinwegnagt. Sie verstärkt den Ekel an Welt und Menschen und sich selbst bis zur völligen Erschlaffung der Glaubenskräfte und der hingebenden Lebensenergien.“
In einer der nächsten Stunden übernahm Referendar Frisch den Unterricht. In einer Lehrprobe diskutierten sie das von Lüdde begonnene Thema munter weiter – und das vor den Augen des Fachleiters und von Direktor Dr. Born, die gekommen waren, um den Referendar zu begutachten.
Michael versuchte, sich die These, über die sie in der Stunde diskutierten, ins Gedächtnis zurückzurufen. Er meinte, sich zu erinnern, dass sie lautete: „Grundlage und Richtschnur aller Sexualerziehung muss die Einsicht sein, dass das augenblickliche Glück des Heranwachsenden nicht einem künftigen aufgeopfert werden darf.“ So oder so ähnlich. Einige in der Klasse waren überzeugt, dass der Satz von Lüdde selbst stammte. Er war jedenfalls schwer zu knacken. Doch die Klasse gab sich reichlich Mühe, sie wollte Frisch und Lüdde nicht hängen lassen.
Auch das gab mächtig Ärger. Obwohl einige Schüler beim Rausgehen aus dem Klassenraum gehört haben wollten, wie der Fachleiter die Stunde als „außerordentlich“, „gut“ und „interessant“ und die Mitarbeit der Klasse als „bemerkenswert“ bezeichnet hatte. Später verriet Lüdde der Klasse, dass Referendar Frisch für seine Lehrprobe eine „2-“ erhalten hatte. Gut, okay. „Benotet werden einerseits die Mitarbeit der Klasse, andererseits die Verarbeitung des dargebotenen Stoffes“, hörte Michael noch Lüddes Worte im Ohr.
„Biste nicht im Schwaltenweiher ersoffen?“
Thomas' Stimme riss Michael aus seinen Gedanken. Er schaute auf und blickte in das von der Adriasonne gebräunte Gesicht seines Freundes. Sofort hoben beide ihre Fäuste zum revolutionären Gruß und schlugen sie lachend gegeneinander.
Plötzlich verzog sich Thomas' Miene. Er zitierte mit ernstem Gesichtsausdruck, was auch Michael heute Morgen in der Zeitung gelesen hatte: „‚Die Verfügung der Schulaufsichtsbehörde stützt sich auf den Vorwurf, Lüdde habe bei der Unterrichtsgestaltung die Richtlinien des Kultusministers verletzt.‘ Ich wiederhole: ‚des Kultusministers verletzt.‘“ Thomas schüttelte ungläubig den Kopf. „Aha! Fühlten sich also Ihro Majestät, der Kumi, ganz persönlich beleidigt?“ Er schnaubte verächtlich. „Lieber Michael, hundertdreißig Jahre nach Georg Büchners Tod müssen wir also feststellen: Wir leben immer noch in einem Obrigkeitsstaat.“
Thomas hob wieder die Faust zum revolutionären Gruß. Michael schlug ein, während Thomas feierlich sprach: „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ Michael war froh, dass sich sein Freund in den sechs Wochen nicht verändert hatte.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Der Unterricht begann bald. Sie verließen den Pausenhof und ließen sich im Strom der Mitschüler in Richtung Klassenraum treiben. Michael musste sich erst noch daran gewöhnen, dass sie jetzt in der 10b waren.
Im Gehen schielte Thomas zu ihm hinüber und fragte: „Aber nun sag schon, wie war's in den Ferien?“
Michael rümpfte die Nase. „Und bei dir?“
„Italien ist toff.“
Weiter kamen sie nicht. Denn als sie in das Gewusel aus Mitschülern vor dem Klassenraum hineingerieten, schwirrten ihnen von allen Seiten Sätze um die Ohren.
„Stellt euch vor: Jetzt haben wir doch glatt den Meier in Sozi!“
„Ach, du grüne Neune!“
„Habt ihr gehört, der Lüdde soll jetzt rüber in die DDR gemacht haben.“
„Ach, erzähl keinen Quatsch.“
„Mein Papa hat gesagt, der Lüdde stand hier bei uns unter Beobachtung.“
„Warum das denn?“
„Er war ein halbes Jahr, bevor er zu uns kam, vom Kreisgymnasium in Heusenstamm geflogen, weil er da die Schüler rebellisch gemacht hatte. Das stand sogar in den Zeitungen.“
„War er da mit vollem Namen drin?“
„Ja, Lüdde duckmäusert doch nicht. Er ist ein Kämpfer. Bei uns an der GBS bekam er dann eine zweite Chance.“
„Die hat er aber gründlich vergeigt.“
Thomas schielte zu Michael rüber und sagte leise: „Das stimmt jetzt zur Abwechslung mal tatsächlich. Und weißt du, weswegen er das schöne, christliche Heusenstamm verlassen musste?“
Michael schüttelte den Kopf.
„Deswegen.“ Thomas wühlte etwas aus seiner im Aztekenmuster gewebten Umhängetasche hervor und drückte es Michael in die Hand. Es war eine Zeitschrift. Der Spiegel.
„Seite siebenundfünfzig“, sagte Thomas. Sie betraten den Klassenraum und setzten sich schnell nebeneinander auf einen der wenigen noch verbliebenen Zweier in der hinteren Reihe.
„Hast du dich eigentlich immer noch nicht von Reli abgemeldet?“, flüsterte Thomas. Michael brauchte ihm gar nicht zu antworten. Sein Freund wusste auch so, dass seine Eltern ihm das niemals erlauben würden.
Herr Müller, ihr Klassenlehrer, begann, den neuen Stundenplan an die Tafel zu schreiben. Michael schielte für den Rest der Stunde möglichst unauffällig herab auf den aufgeschlagenen Spiegel auf seinem Schoß. Er las den Artikel, mehrfach unterbrochen, bis zum Ende. Er spürte Schweiß an seinen Händen, kostete es jedoch aus, etwas Verbotenes zu tun.
„… doch als Lehrer Lüdde“, las er, „auch noch ein hektographiertes Flugblatt Verlasst massenhaft den Religionsunterricht! verteilte und sich den Zorn der katholischen Kirche zuzog, wurde Lüdde vom Kultusminister aus dem Schuldienst entfernt. … Stets auf dem Sprung gegen ‚autoritäre Opas‘ gedachte der neue Lehrer die ihm anvertrauten Schüler ‚zu viel Selbständigkeit und einem demokratischen Bewusstsein‘ zu erziehen. … Im flapsigen Ton linker Protestierer wurden die Pennäler in dem Flugblatt auf ihre Rechte etwa zum Kirchenaustritt wie zur freien Wahl des Religionsunterrichts hingewiesen. … Die Kirchenvorstände der katholischen Pfarrgemeinden St. Cäcilia und Maria Himmelskron verfassten Protestbriefe, und das Bischöfliche Büro zu Wiesbaden beschwerte sich, der Assessor habe seine Schüler ‚in geradezu unverschämter Weise‘ zum Kirchenaustritt aufgefordert und dadurch das Toleranzgebot verletzt. … Lüdde verteidigte sich damit, er habe die Flugblätter lediglich als Diskussionsmaterial in den Klassen verteilt, und die Zeit habe nicht mehr gereicht, darüber zu reden. Die meisten Lüdde-Schüler stellten sich auf seine Seite. Sie steckten sich selbstgefertigte Meinungsknöpfe mit Aufschriften wie Lüdde wieder her! oder I like Lüdde an. ... Lehrer solidarisierten sich mit ihm. Eltern betroffener Pennäler beschwerten sich beim Landesvater Zinn, ‚dass hier ein Lehrer vom Popanz Öffentlichkeit mundtot gemacht werden soll‘ …“
Je weiter Michael las, desto mehr beschlich ihn das Gefühl, dass Lüdde auch an der GBS Unrecht getan worden war.
Als es zum Stundenende läutete und sie von ihren Stühlen aufstanden, fasste Thomas seinen Freund streng ins Auge. „Mein lieber Michael, ich werde alles darum geben herauszufinden, warum Lüdde gehen musste. Bist du dabei?“
Michael blickte seinen Freund still an.
2.
Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. September 1969: Erstes Teach-in und erste Vollversammlung an der Georg-Büchner-Schule
„You can't always get what you want … You can't always get what you want ...“
Der Refrain drehte sich in Michaels Kopf. Die ganze Nacht und den ganzen Morgen schon. Er hatte sich gestern nach der Schule die neue Single der Rolling Stones, Honky Tonk Women, bei Radio Lorz gekauft. Die A-Seite mochte er nicht besonders. Der Song klang wie schon zigmal gehört von den Stones. Die B-Seite You Can't Always Get What You Want hingegen ließ hoffen, dass die Band nach dem Tod von Brian Jones doch noch was reißen könnte. „Jung gestorben“ sei er, schrieben die Zeitungen, mit seinen siebenundzwanzig Jahren.
Ob Michael jemals so alt werden würde? Das bezweifelte er. Wenn er an all die Kriege und Konflikte auf der Welt dachte. Vietnam, Nigeria, Naher Osten. Und dann die Atomraketen, mit denen sich die USA und die Sowjetunion gegenseitig bedrohten. Wenn da mal nichts schiefging.
„You can't always get what you want … You can't always get what you want ...“
Michael hatte den Song gestern gleich mehrfach auf seinem Plattenspieler abgespielt und mit seiner Gitarre dazu geklimpert. Irgendwann steckte er sich seinen Bottleneck über die Kuppe seines linken Ringfingers und lockte mit dem Metallröhrchen traurig wimmernde Töne auf den Saiten hervor – ein Trick, den auch Brian Jones draufgehabt hatte.
Michael ließ seine Gitarre weinen, bis sein Vater klopfte. „Hör mit dem Gejaule auf!“
Doch anstatt aufzuhören, steckte Michael den Kopfhörer in seinen Verstärker, zog ihn sich fest über beide Ohren und spielte umso lauter weiter. Das geschlossene Hörmuschelset war wie eine Taucherbrille – man konnte mit ihm in eine andere Welt abtauchen.
„Gejaule“, war noch eines der harmloseren Wörter seines Vaters. Sein härtestes Geschütz war „N-Musik“. Michael erinnerte sich, wie seine Eltern und er vor den Sommerferien im Wohnzimmer saßen und die Fernsehnachrichten Bilder vom Konzert im Londoner Hyde-Park brachten, mit dem die Stones Abschied von Brian Jones nahmen. Als der Sänger Mick Jagger in seinem weißen Kleid zu sehen war, rief sein Vater verächtlich aus: „Schaut euch diese kleine Tunte an!“
Das Wort wurde auch Michael schon einmal auf der Straße hinterhergerufen. Haare bis über die Ohrläppchen trugen inzwischen viele Männer. Sogar Fußballspieler. Das war die Mode des Jahres 1969. Doch Michael hatte eine richtige Mähne, so lang wie die Hippies in San Francisco.
„Wie kann ein Mann bloß ein Kleid tragen!“, schloss sich Michaels Mutter dem Ausruf seines Vaters an. „Noch dazu weiß – und das bei einem Trauerkonzert!“ Michael versuchte erst gar nicht, seinen Eltern zu erklären, dass Weiß die Trauerfarbe der Hindus war. Und dass Brian Jones die indische Kultur geliebt, sogar Sitar spielen gelernt hatte.
Michael verlor sich unter seinem Kopfhörer immer tiefer in den Klängen. Wenn er den Bottleneck über die Saiten zog, verwischten nicht nur die Grenzen zwischen den Tönen, es verschwamm alles um ihn herum. Er tauchte ein in eine Welt, in der Kategorien wie Schwarz, Weiß, Hautfarbe, Christ, Hindu, Mann oder Frau keine Rolle mehr spielten.
„You can't always get what you want … You can't always get what you want ...“
Jetzt, zurückgelehnt auf dem Sitz in der Straßenbahn, stand Michael plötzlich ein Bild vor seinen Augen: Mick Jagger im weißen Kleid – und mit schwarzem Lidstrich und rotem Lippenstift, was seine Eltern wohl übersehen hatten. Michael wurde es innerlich ganz heiß. Warum zog ihn das mehr an als jedes Foto von Brigitte Bardot?
Ihm fiel das Mädchen aus dem Herrngarten wieder ein. Marion.
Am letzten Schultag vor den Sommerferien hatten Thomas und er sich mit vielen weiteren Schülern im Park in der Innenstadt getroffen. Sie hingen gemeinsam auf dem Rasen ab. Es war eine laue Julinacht. Michael hatte seine Gitarre dabei und schlug die Akkorde für die Lieder an, die sie gemeinsam sangen. In einer Pause zwischen zwei Songs klimperte er leise vor sich hin. Er versuchte sich an ein paar schwierigen Licks. Und plötzlich bemerkte er, dass ein Mädchen sich neben ihn setzte und ihm versonnen beim Spielen zusah.
„Klingt verdammt gut“, sprach sie ihn an.
Michael spürte, wie seine Finger vor Nervosität anfingen zu zittern. Er hörte auf zu spielen, schaute auf und blickte in ein lächelndes Gesicht.
„Ich bin die Marion.“
„Ich bin der Michael.“
Sie nickten sich zu. Michael zog den Bottleneck aus der Tasche seiner Jeans und steckte seinen Ringfinger hinein. Damit konnte er beim Gitarrespielen unbesorgt weiterzittern – da fiel es nicht so auf. Er wagte sich an die bittertraurigen Töne heran, mit denen Brian Jones No Expectations gewürzt hatte, sein letzter großer Beitrag für die Stones.
„Du spielst schön“, sagte Marion träumerisch. Sie ließ ihre Hände auf dem Rasen nach hinten wandern und lehnte sich zurück.
Nach gut einer halben Minute überlegte Michael, ob er nicht langsam zum Smalltalk übergehen sollte. Doch darin war er noch nie besonders gut gewesen. Er ließ das Griffbrett los, hob den Kopf und sah, dass Marion sich mittlerweile mit ihrem Nachbarn zur anderen Seite unterhielt. Er schnappte auf, wie sie dem Jungen erzählte, dass sie die Viktoriaschule besuche und im nächsten Schuljahr in die zehnte Klasse komme.
Marion gefiel Michael auf Anhieb. Sie trug ihr Haar kurz, ähnlich wie Jean Seberg im Film Außer Atem. Sie hatte jungenhafte Gesichtszüge, genau das zog Michael wie magisch an.
Bevor Michael weiterklimperte, drehte er kurz den Kopf zur anderen Seite – und erhaschte Thomas' Blick. Sein Freund hatte bemerkt, wie er Marion etwas länger als nötig angeschaut hatte. Er zwinkerte ihm lächelnd zu.
Irgendwann fing die Gruppe wieder an, Michael Songtitel zuzurufen, für die er die Akkorde anschlagen sollte. Die üblichen: