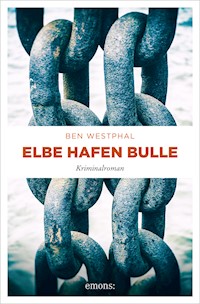Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gerd Sehling
- Sprache: Deutsch
Bulle bleibt Bulle - Fesselnde Ermittlungen im Drogenmilieu von Hamburg bis Barcelona Der pensionierte Rauschgiftfahnder Gerd Sehling lässt sich von seiner Frau zu einem Kurztrip nach Barcelona überreden. Doch schon am Flughafen läuft ihm ein Dealer aus einem alten Fall über den Weg, und es ist vorbei mit der geplanten Auszeit. Eine Lieferung Kokain rollt Richtung Hamburg, und Gerd gerät mitten hinein in ein internationales Netzwerk aus Dealern, Kurieren und skrupellosen Hintermännern. Was als Urlaub beginnt, wird zu einem der gefährlichsten Einsätze seines Lebens. Kenntnisreich, glaubwürdig und hochspannend schildert Bestsellerautor Ben Westphal in Bulle bleibt Bulle die Ermittlungen im Drogenmilieu, hautnah an echten Fällen orientiert. Von der Rauschgiftfahndung in Hamburg bis in die Unterwelt Barcelonas spinnt sich ein dichtes Netz aus Drogengeschäften, Gewalt und Betrug, in dem auch Gerd Sehling um sein Leben fürchten muss. Ein packender Kriminalroman über die Arbeit der Drogenfahnder - so realistisch und authentisch, wie nur ein Insider schreiben kann. »Hautnah den echten Fällen des Rauschgiftfahnders Ben Westphal nachempfunden.« HAMBURGER WOCHENBLATT über »Der Bulle von Hamburg«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Westphal, 1981 in Hamburg geboren, machte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Kriminalbeamten. 2006 wechselte er ins Rauschgiftdezernat. Einige Jahre später begann er, Rauschgift-Krimis mit Hamburg-Bezug zu schreiben – und was als einmaliges Pensionsgeschenk für einen Kollegen begann, wurde zu einer Leidenschaft fürs Schreiben.www.BenWestphal.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/querbeet
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-350-2
Überarbeitete Neuausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationeninsbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäߧ 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für »Holgi«
1
Missmutig blickt Gerd Sehling vom Beifahrersitz auf die emporragenden oberen Geschosse des Hamburger Polizeipräsidiums, während seine Frau Dörte zum dritten Mal versucht, ihren Kleinwagen in eine ausreichend große Parklücke zu manövrieren. In den Fenstern des Gebäudes spiegelt sich das Orange der aufgehenden Sonne und taucht die dunkle Fassade in einen goldenen Schleier. Gerd versucht, sich jegliche Kommentare zu verkneifen, weil er weiß, dass es Dörte nur noch nervöser machen würde. Er versteckt lieber den vom Bart umrandeten Mund und die knollige Nase hinter seiner kräftigen Hand und blickt traurig zum Präsidium. Dorthin, wo er die schönste Zeit seines Lebens verbracht hat.
Inzwischen ist Gerd seit mehreren Monaten Pensionär. Er erinnert sich noch mit Vergnügen an den ersten Tag in Pension, als ein niederländischer Kurierfahrer mit einem Transporter und zehn Kilogramm Kokain gegen das Ortsschild von Dalldorf vor den Toren Hamburgs gefahren ist. Mit Hilfe der ehemaligen Kollegen konnte er an diesem Tag einen großen Dealer-Ring in Hamburg sprengen und sogar den niederländischen Lieferanten festnehmen.
In Gedanken daran beginnt Gerd hinter der schützenden Hand zu lächeln, was sich umgehend in den tiefen Lachfalten seiner Augen widerspiegelt.
»Was gibt es da zu lachen?«, schreit ihn Dörte fahrig von der Seite an. »Ich bin es nun einmal nicht gewohnt, in kleine Parklücken in der Stadt einzuparken. Bei uns in Dalldorf hab ich immer genug Platz. Wir hätten auch ein Taxi zum Flughafen oder einen Parkplatz am Terminal nehmen können.«
»Weißt du, wat wir dafür zahlen müssten, Dörte? Die ganze Reise kostet uns bereits ein Vermögen«, erwidert Gerd und muss dabei unwillkürlich an den Grund der Reise denken. Als er gleich wieder Verbrecher gejagt hat, statt am nächsten Morgen die Reste seiner Pensionsfeier aufzuräumen, und Dörte mit der gesamten Arbeit allein gelassen hat, hat er ihr nach der Rückkehr am späten Abend als Wiedergutmachung eine kurze Städtetour angeboten. Er hatte eigentlich eine Fahrt ins schöne Lüneburg oder zum Schweriner Schloss im Kopf gehabt, aber Dörte hat die Chance beim Schopfe ergriffen und einen Trip nach Barcelona gebucht. Dabei hat sie ihren Mann, der sich für warme Länder, die südländische Kultur, weltberühmte Museen und die mediterrane Küche nicht so recht begeistern kann, vor vollendete Tatsachen gesetzt.
Über die Wahl der Destination wurde zwar kurz gestritten, aber weil die Reise weder stornierbar war noch Gerd die nächsten Wochen Schlechtwetterstimmung im Hause haben wollte, gab er klein bei.
So müssen sie nun hier in Alsterdorf auf seinen ehemaligen Kollegen Tim Dombrowski warten, der sie zum Flughafen fahren will. Dörte setzt bereits zum fünften Versuch an. Dieses Mal klappt es mit dem Einparken.
Beide atmen erleichtert auf, als Dörte endlich den Zündschlüssel aus dem Schloss zieht. Sie lösen die Anschnallgurte und steigen aus. Dörte streckt sich einmal kräftig, als wäre sie Stunden unterwegs gewesen. Währenddessen zieht Gerd die Hose hoch und überprüft, ob das karierte Hemd noch darin steckt. Nachdem er sich die halblangen dunkelgrauen Haare zurückgestrichen hat, setzt er eine gestreifte Schiebermütze auf den Kopf und rückt die schwarze Hornbrille auf dem Nasenrücken nach oben.
»Wo bleibt denn dein Kollege, der uns fahren wollte?«, fragt Dörte schnippisch, die am liebsten jeglichen Kontakt ihres Mannes zu den ehemaligen Kollegen unterbinden würde. »Hat er dich vielleicht versetzt?«
»Dumbo vergisst mich nicht. Der ist immer für mich da.« Während Gerd sich leicht schmollend abwendet, schlendert Otto Kuhnert den Gehweg vom Präsidium hinunter direkt auf die beiden zu. »Der hat nur viel zu tun, aber wir kommen schon rechtzeitig zum Flughafen.«
Otto winkt den beiden zu. Gerd erwidert die Geste mit beiden Armen in der Luft und beginnt, vor Freude breit lächelnd zu glucksen. Unterdessen wuchtet Dörte die beiden Koffer aus dem Kofferraum und stellt sie scheppernd auf dem Gehweg ab.
»Hallo, ihr Lieben. Dumbo hat leider einen Termin in der Untersuchungshaftanstalt. Ich fahre euch zum Flughafen. Ich habe den Dienstwagen am Ausgang abgestellt. Kommt, ich helfe euch mit dem Gepäck«, erklärt Otto und kommt noch einen Schritt näher.
»Das kann Gerd auch alleine tragen«, antwortet Dörte angesäuert und geht an Otto vorbei in Richtung Polizeipräsidium.
Gerd hebt kurz die Schultern und ergreift die Koffer, um sie hinter sich herzuziehen, nachdem er sein inzwischen rausgerutschtes Hemd wieder mühsam zwischen Bauch und Gürtel gestopft hat.
»Wie ihr wollt«, sagt Otto irritiert, aber auch froh, dass er mit seinem schmerzenden Rücken verschont bleibt. »Wir fahren mit dem grauen Kombi dort vorne. Der ist schön groß und geräumig.« Otto drückt auf den Knopf der Zentralverriegelung, sodass die Warnblinklichter des Fahrzeugs kurzzeitig aufleuchten.
Vor Gerd und Otto läuft Dörte mit schnellen kurzen Schritten auf den Wagen zu, dabei wippen ihre kleinen blonden Locken auf und ab. Sie ist extra noch einmal beim Friseur in Geesthacht gewesen, um sich auf die Kulturreise auch optisch perfekt vorzubereiten.
»Ist deiner Frau ’ne Laus über die Leber gelaufen?« Otto starrt Gerd mit seinen kleinen Augen an. Wie Tim Dombrowski, den alle nur Dumbo nennen, ist auch Otto ein langjähriger Kollege von Gerd. Er ernährt sich vornehmlich von Kaffee, Keksen und Zigaretten, was sich an tiefen Augenringen, dem kugelförmigen Bauch und der kehligen Stimme zeigt. »Oder ist die immer so gelaunt?« Otto zieht eine silberne Schatulle mit selbst gestopften Zigaretten aus der Hemdtasche und entnimmt eine.
»Überleg dir gut, was du jetzt antwortest, Gerhard«, ertönt es streng von der Tür des Dienstwagens, an der Dörte bereits angelangt ist. »Ich durfte die letzten Tage den Haushalt schmeißen, einkaufen, die Koffer packen, die ganzen Reiseführer studieren, damit wir unseren Aufenthalt auch gescheit ausnutzen können. Gerd hing nur an seinem Moped und hat alles auseinander- und wieder zusammengeschraubt.« Dörtes Kopf läuft bei der Erinnerung daran rot an, während sich zwischen ihren Augenbrauen eine tiefe Furche bildet. Sie stemmt die Hände in die Hüfte und behält Gerd genau im Auge.
Otto bleibt mit offenem Mund stehen und steckt sich die Zigarette in den Mund.
»Du wirst jetzt ja wohl nicht im Auto rauchen?«, entfährt es Dörte vorwurfsvoll.
»Äh, nein. Natürlich nicht«, antwortet Otto irritiert und lässt das gezückte Feuerzeug sinken.
»Dann steck das Ding wieder ein. Wir müssen los. Unser Flieger geht bereits in vier Stunden. Außerdem ist Rauchen sowieso ungesund.« Ohne eine Antwort abzuwarten, öffnet Dörte die Tür, setzt sich auf die Rückbank und knallt die Tür hinter sich zu.
»Na, das kann ja was werden«, entfährt es Otto. Er öffnet den Kofferraum und wuchtet schnaufend die Koffer hinein.
2
Mit einem gellenden Piepen schließen sich hinter Tim Dombrowski die Türen der silber-orangenen Hamburger U-Bahn. In Fahrtrichtung geht er direkt auf die lange Rolltreppe zu, deren Ende man selbst am Sockel kaum erkennen kann. Die U-Bahn nimmt währenddessen Fahrt auf und zieht einen kühlen Fahrtwind hinter sich her, der Dombrowskis braune Haare aufwehen lässt.
Er stellt sich auf die unterste Stufe und blickt hinauf zum Ende der Treppe, das gemächlich auf ihn zukommt.
Er ist nicht in Eile, denn er ist pünktlich mit der verkehrsunabhängigen Hochbahn zu dem kurzfristig vereinbarten Termin losgefahren. Viel lieber würde er jetzt im Dienstwagen sitzen und seinen alten Kollegen Gerd zum Hamburger Flughafen bringen. Obwohl sie sich immer gut verstanden haben, sehen sie sich in letzter Zeit seltener. Gerd hält offenbar absichtlich Distanz zu seinem alten Leben oder wird vielleicht von Dörte ferngehalten. Und die Arbeit hält Dombrowski selbst auch stets in Atem. Kaum ein Arbeitstag, an dem mal ein wenig Luft zum Verschnaufen bleibt. Der Tag müsste einfach mehr Stunden zur Verfügung haben oder die Woche ein paar mehr freie Tage.
Doch die Rauschgiftfahndung, bei der Dombrowski seit vielen Jahren arbeitet, kennt oft kein Wochenende oder einen Feierabend. Stattdessen orientiert man sich an seinen »Kunden«. Warten, bis sie in den frühen Nachmittagsstunden aus ihrer Lethargie erwachen, und dann eng dranbleiben, wenn sie ihrem illegalen Handel nachgehen.
Der Vormittag ist vollgestopft mit langatmigen Besprechungen, dem Anhören von aufgezeichneten Telefongesprächen und der ausführlichen Berichterstattung für die Staatsanwaltschaft, um Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen oder Haftbefehle für die verfolgten Drogenhändler zu erlangen.
Und dann noch solch ein leidiger Termin, wie er ihm jetzt bevorsteht. Langsam senkt sich sein Blick, und er schaut auf das Ende der Rolltreppe. Er macht einen großen Schritt und geht mit gemäßigtem Tempo in Richtung des Sievekingplatzes, von dem auch die Holstenglacis abgeht.
Direkt am prachtvollen Strafjustizgebäude befinden sich auch die in die Jahre gekommenen, vergitterten grauen Trakte der Untersuchungshaftanstalt. Hier tummeln sich in ihren Einzelzellen die Straftäter, die wegen Flucht- oder Verdunkelungsgefahr im Gefängnis auf ihr Strafverfahren warten. Aber auch Kleinstkriminelle, die Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssen, weil sie die erlassenen Geldstrafen nicht bezahlen können und per Haftbefehl in die Anstalt gebracht werden.
Dombrowski geht am Gebäude entlang, bis er zu einem grauen Metallzaun gelangt, durch dessen geöffnete Tür er hindurchgeht.
Nach mehreren Stufen bleibt er vor einer schweren Metalltür mit einem schlichten weißen Klingelknopf stehen. Er klingelt und wartet dort wie vor einem verruchten Nachtclub. Das surrende Brummen erklingt, während sich die Stahltür ermüdend langsam nach innen öffnet. Dombrowski tritt in den Vorraum. Dort bleibt er vor einer Glastür stehen. Er atmet dabei den Geruch abgestandener Luft ein. Langsam schwingt die Metalltür wieder zu. Sie verschließt sich hinter ihm. Er zieht aus der Jackentasche seinen Dienstausweis, den er gegen die Scheibe der Glastür hält. Die Justizbeamten, die hinter der Tür in einem sicheren Glaskasten sitzen, nicken ihm freundlich zu. Sie öffnen die Tür per Knopfdruck, nachdem die schwere Eingangstür wieder komplett verschlossen ist. Dombrowski geht an dem Glaskasten vorbei durch eine weitere Tür, die ihm mit einem dumpfen Brummen geöffnet wird, um in den Glaskasten der Justizbeamten zu gelangen. Dort verschließt er sein Handy und die Dienstwaffe in einem kleinen Holzfach. Er legt im Anschluss den Dienstausweis vor, damit er in die Gästeliste eingetragen werden kann. »Ich bin hier für Faruk Simsek.«
Während der Justizbeamte mühevoll mittels Einfinger-Suchsystem den Nachnamen in den Computer eingibt, blickt Dombrowski durch die grau gestrichenen Gänge des Traktes. Sie lassen den Besuch für die Verwandten und Bekannten der Insassen sicherlich noch trostloser und entmutigender wirken.
»Gut, Herr Dombrowski. Viel Spaß. Sie werden bereits sehnlichst erwartet«, teilt der Justizbeamte mit und reicht Dombrowski den Dienstausweis zurück.
»Das habe ich befürchtet«, erwidert Dombrowski. »Bis nachher.«
Dombrowski geht über eine kurze Steintreppe in den Warteraum des Besucherzentrums. Die Gummisohlen seiner Turnschuhe quietschen auf dem frisch gewischten Boden. Mehrere Stuhlreihen sind im Wartebereich aufgebaut. Vereinzelt sitzen dort Frauen, zum Teil voll verschleiert, zum Teil aufgedonnert, als würden sie direkt im Anschluss feiern gehen und dabei der Männerwelt den Kopf verdrehen wollen.
In der hintersten Ecke sitzt die junge Frau, die unbedingt noch heute einen Besuchstermin haben wollte, weil sie dann ins Krankenhaus muss. Vorher wollte sie dringend noch einmal ihren Geliebten sehen. Sie konnte nicht sagen, wann sie wieder dazu in der Lage sein würde.
Mitgefühl hat sich bei ihrem Anruf in Dombrowski breitgemacht und ließ ihn erweichen. Wer weiß, welch ein Leiden sie plagt? So ist er ihr entgegengekommen und hat widerwillig für heute diesen Besuchstermin vereinbart.
Sie trägt ein knappes Shirt mit Spaghettiträgern und eine weite dunkle Jogginghose. Dazwischen drücken sich Bauch und Taille wulstig heraus. In den Ohrläppchen hängen bierdeckelgroße goldene Ringe, die auf ihren schmalen Schultern aufliegen. Ihre ausgetretenen Turnschuhe hat sie nicht richtig zugebunden, und so zieht sie die offenen Schnürsenkel mit jedem Schritt über den Boden, während sie auf Dombrowski zugeht.
»Moin moin, Frau Schulze, dann wollen wir mal. Sie kennen ja die Regeln. Keine Gespräche über das Verfahren. Keine Berührung, ansonsten muss ich leider direkt wieder abbrechen«, erklärt Dombrowski freundlich, aber bestimmt gegenüber der unschuldig dreinschauenden jungen Frau.
Er versucht, sich den Groll nicht anmerken zu lassen, den er hegt, seitdem sie ihre Aussage gegen Cemal Sarikaya zurückgezogen hat. Dabei war diese ausschlaggebend, um ihn als Kopf der vor einigen Monaten festgenommenen Bande hinter Gitter bringen zu können. Inzwischen ist er gegen eine ansehnliche Kaution wieder auf freiem Fuß. Sein Anwalt hat dem gnädigen Haftrichter aufgezeigt, dass sich sein Mandant von der Betäubungsmittelszene abgewandt habe und ein gut laufendes Café in Harburg betreiben würde. Die als unglaubwürdig einzuschätzende Zeugin ließe zudem Zweifel am dringenden Tatverdacht aufkommen, und bevor Dombrowski davon Wind bekam, war der Haftbefehl gegen Cemal bereits aufgehoben.
Charleen Schulze ist jedoch nicht wegen Cemal hierhergekommen, sondern wegen ihrer großen Liebe Faruk. Er sitzt auch weiterhin in Untersuchungshaft, nachdem er im letzten Frühjahr in einem Auto voller Marihuana und Kokain festgenommen wurde. Da hat es ihm auch nicht geholfen, dass er inzwischen bei seiner Freundin amtlich gemeldet ist und sie ihm somit zu einem festen Wohnsitz verholfen hat.
Dombrowski und Charleen kommen an der Holztür zur Besucherzelle an. Sie wird ihnen durch einen dickbäuchigen Schließer mit langem Vollbart und Nickelbrille geöffnet.
Es ist ein kleiner, fensterloser Raum, dessen Wände weiß sind, jedoch lange nicht mehr gestrichen wurden. Je tiefer man an den Wänden herabschaut, desto mehr Verschmutzungen erkennt man.
Im Raum steht ein Tisch, der im Fußraum mit Holzplatten und auf der Tischfläche durch Plexiglasscheiben in der Mitte getrennt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite sitzt Faruk Simsek. Seine langen, pomadigen Haare hängen ihm bis auf die Schultern. Der lange Bart ist grob gekämmt und an der Spitze verzwirbelt. Faruk sitzt breitbeinig in einem dunkelblauen Jogginganzug auf dem harten Holzstuhl und blickt geradezu durch Dombrowski hindurch zur Tür.
Dombrowski belehrt Faruk über die Regeln und lässt sich mit den letzten Worten auf einen Bürostuhl neben der Plexiglasscheibe am Kopf des Tisches fallen. Er verschränkt die Hände ineinander und blickt ein erstes Mal auf die Wanduhr, deren Sekundenzeiger quälend langsam vorwärts springt.
»Schaaatz, oh Schatz«, ruft Charleen hysterisch zur Begrüßung und läuft an den Tisch heran, als würde sie durch die Scheibe hindurchspringen wollen. »Schatz, ich vermisse dich so. Was machst du, wie geht es dir?«, fragt sie sichtlich besorgt, wobei ihr erste Tränen in die dunkel geschminkten Augen treten. Sie rollen kurz darauf über die falschen Wimpern und fallen auf ihre mit Rouge verzierten Wangen.
»Baby, was soll ich sagen? Knast halt. Viel wichtiger: Hast du mir Geld hier rein überwiesen? Morgen ist Einkauf. Dann erst wieder nächste Woche.« Faruk lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Er betrachtet seine Freundin mit gleichgültigem Gesichtsausdruck. Ein Kaugummi kaut er hektisch und lässt es immer wieder zwischen seinen Zähnen aufblitzen.
»Ja, Schatz. Ich habe gerade gestern Geld vom Amt bekommen. Eigentlich sollten hundert Euro auf deinem Konto eingegangen sein. Ich habe das nicht richtig verstanden, aber dein Anwalt ist voll korrekt. Der hat das für mich gemacht. Kriegst du sonst nichts zu essen hier?«, antwortet Charleen mit besorgtem Gesichtsausdruck. Sie tupft sich mit einem Papiertaschentuch kurz die Tränen von den Wangen, sodass nur die dunklen Streifen von der verflossenen Wimperntusche zurückbleiben.
»Doch, Baby, aber was soll ich sagen, Baby? Das würdest du nicht einmal deinem Hund zu essen geben, was die einem hier geben. Das ist der letzte Dreck. Was ist mit Playstation, Baby? Hast du mir eine reingeschickt? Und hast du mir DVDs geschickt?«, fragt Faruk mit Nachdruck und neigt sich dabei vor. Mit verschränkten Armen lehnt er sich auf den Tisch.
»Schatz, die muss man auch bezahlen können. Ich habe gerade erst Geld bekommen. Und Shakira und ich müssen auch den ganzen Monat noch davon leben. Die erste Kreditrate wird auch direkt nach der Operation nächste Woche fällig.« Dombrowski schaut irritiert zu Charleen. Hat sie gerade wirklich gesagt, dass sie für die Operation zahlen muss und dafür einen Kredit aufgenommen hat? Ihm schwant, welche Art von Operation geplant ist. Sein Ärger darüber, für diese Besuchsüberwachung Gerd abgesagt zu haben, steigt wieder in ihm auf und lässt das vorhandene Mitgefühl umgehend erlöschen.
»Die Kita hat mir auch gekündigt. Nur, weil ich ab und zu krank war und deswegen nicht zur Arbeit kommen konnte. Voll scheiße, Schatz«, presst Charleen heraus, wirft Sorgenfalten auf ihre Stirn, lässt den Kopf leicht hängen und beginnt, ihre aufgeklebten langen Fingernägel zu betrachten.
Faruk hebt seinen Kopf und zieht die Augenbrauen so sehr zusammen, dass sich zwischen ihnen zwei Zornesfalten bilden. »Das interessiert mich nicht. Dann geh zu Hakan oder Musti. Die schulden mir noch Geld. Sollen sie dir geben. Weißt du, wie scheiße langweilig das hier drinnen ist? Dreiundzwanzig Stunden Einschluss am Tag. Nur Fernsehen und Schlafen. Eine Stunde darf ich mal raus und wie ein Affe im Kreis laufen. Digger. Auf meiner Station sind nur Junkies und Asoziale. Die schnorren mich immer nur an. Wollen Tabak oder so, Digger«, schimpft Faruk mit gedämpfter Stimme. Dabei fuchtelt er zunächst gestikulierend mit den Händen durch die Luft und streicht anschließend die ins Gesicht fallenden Haarsträhnen zurück.
»Oh, Schatz. Ich kümmer mich. Ich werde mir bei meiner Mutter Geld leihen«, versichert Charleen mit mitfühlendem Blick. »Aber vielleicht kommst du ja auch bald raus. Cemal ist ja auch draußen und treibt sich schon wieder mit komischen Gestalten herum«, ergänzt sie unbekümmert. Dieser Name holt Dombrowski sogleich aus der Lethargie. Jetzt könnte es ja doch noch interessant werden.
»Baby, das ist was anderes. Rede nicht darüber«, unterbricht Faruk seine Freundin mit stechendem Blick. »Ich komme hier nicht so schnell raus. Aber mein Anwalt macht das schon. Vielleicht vier, fünf Jahre, Baby.« Sofort schluchzt Charleen kräftig auf, während ihr noch größere Tränen in die Augen steigen. »Beruhig dich, Baby. Die nächsten Monate Untersuchungshaft sind hart, aber dann, nach dem Urteil, zwei, drei Monate, dann bin ich wieder draußen. Mein Anwalt regelt das, weißt du? Offener Vollzug, Baby. Dann muss ich nur noch im Knast schlafen und bin die übrige Zeit bei dir. Am Wochenende bin ich ganz zu Hause mit Hafturlaub. Dann können wir heiraten und eine Familie gründen«, sagt Faruk schmalzig. Er ergreift das Revers seiner blauen Joggingjacke und rückt es kurz zurecht.
»Ich will ein kleines Baby von dir, Schatz. Okay?«, antwortet Charleen unter leichtem Schluchzen mit säuselnder Stimme. Dombrowski verdreht die Augen und lässt die Aufmerksamkeit wieder zunehmend sinken. Er kann das Gerede zwischen den beiden einfach nicht ertragen. Mit flehendem Blick schaut er auf den Sekundenzeiger der Wanduhr, den er innerlich nahezu anbettelt, doch endlich schneller zu laufen.
3
Am dunstigen Himmel lässt die aufsteigende Sonne mit ihren wärmenden Strahlen letzte dünne Wolken verschwinden und taucht den Himmel in ein sattes Blau. Wabernde Nebelschwaden lösen sich langsam auf dem Gelände des Ohlsdorfer Friedhofs auf. Der Parkfriedhof zählt zu den größten Europas. Sogar eine eigene Buslinie verkehrt auf dem Gelände. Breite Straßen durchziehen das Areal, das früher von vielen Hamburgern genutzt wurde, um dem alltäglichen Stau des Berufsverkehrs auf den Hauptverkehrsadern auszuweichen. In einer langen Schlange standen die Fahrzeuge mit laufenden Motoren vor dem Ausgangstor des Friedhofs am westlichen Ende. Die Fahrer hofften darauf, eine der nächsten Ampelphasen zu nutzen, um auf die Fuhlsbüttler Straße zu gelangen. Inzwischen steht in der Mitte des Friedhofs eine Schranke, welche die Durchfahrt für Unbefugte versperrt. Nur noch wenige suchen daher eine Zufahrt zum Friedhof.
Durch das westliche Eingangstor fährt ein dunkler Mittelklassekombi. Am Steuer sitzt ein Mann mit schütterem grauem Haar, der sich strecken muss, um über das Lenkrad zu schauen. Er umfasst es mit beiden Händen und lässt den Blick über die Wege entlang der Straße gleiten. Mehrere Fahrräder kommen ihm entgegen. Die Mehrzahl von ihnen ist elektrisch angetrieben. Ihre Fahrer haben häufig Kopfhörer in den Ohren stecken, hören vermutlich Podcasts oder ihre Lieblingsmusik, anstatt die Ruhe des Parkfriedhofs zu genießen.
Der Fahrer des dunklen Kombis hat sein Radio ausgestellt. Er fährt den verbliebenen Berufspendlern auf ihren Fahrrädern entgegen und rauscht die Allee hinauf zur Kapelle Nummer 9, wo er in eine Sackgasse abbiegt und langsam in einer Haltebucht rückwärts einparkt. Er bleibt zunächst sitzen und beobachtet die Umgebung.
Eichhörnchen jagen über die Rasenflächen und an den Baumstämmen der schattenspendenden Kastanien entlang. Vereinzelt lassen Lücken zwischen den großen Rhododendronbüschen einen Blick auf die Grabsteine zu.
Ganz allein steht der Wagen auf der Parkfläche. Die anderen Buchten sind noch nicht besetzt. Am frühen Morgen sind offenbar noch keine Bestattungen in der Kapelle, und auch Besucher treffen erst langsam auf dem weitläufigen Gelände ein, um die Gräber ihrer Angehörigen zu pflegen.
Harry Goldutt, der Chef des Hamburger Rauschgiftdezernats, stößt die Autotür auf. Ein anonymer Anruf mit unterdrückter Rufnummer am frühen Morgen hat ihn hierhergelockt. Der Anrufer habe ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Er sprach flüsternd in gebrochenem Deutsch, die Sätze schienen nicht einstudiert und wirkten glaubwürdig auf Harry. Nachfragen konnte er keine mehr stellen, so schnell hat der Anrufer wieder aufgelegt. Es könnte auch ein Wichtigtuer oder Spinner sein, aber das Bauchgefühl rät ihm, dieses konspirative Treffen wahrzunehmen.
Harry steigt aus, stellt sich neben sein Fahrzeug und schließt die Tür. Er schaut sich aufmerksam um. Sein Blick fällt auf den vereinbarten Treffpunkt. Ein dunkler Stein ragt aus dem sattgrünen Rasen vor ihm. In goldener Schrift ist auf dem anthrazitfarbenen Marmor »Gott kennt kein Warum« eingraviert.
Der Satz umgreift Harrys Herz und zieht ihn förmlich an.
Langsam geht er auf den Grabstein zu. Seine Schritte hallen auf dem Asphalt wider. Unterschiedliche Vögel singen von den Bäumen herab ihr Lied, während ein leichter Wind die Blätter der Büsche rascheln lässt.
»Sind Sie alleine?«, fragt eine tiefe Stimme aus einer dichten Hecke hervor.
»So wie verabredet. Was kann ich für Sie tun?«, erwidert Harry mit seriösem, aber freundlichem Grundton, ohne in Richtung des Fragenden zu blicken.
Er hört, wie der Mann mit langsamen Schritten an ihn herantritt.
»Es kommt Laster nach Hamburg. Er hat viel Drogen geladen. Kokain. Viel Kokain. Aus Spanien. Du musst aufhalten«, beginnt der Mann zu erzählen.
»Es kommen viele Laster nach Hamburg. Ein bisschen genauer bräuchte ich es schon«, erwidert Harry und blickt zu dem Mann, der sich seitlich neben ihn gestellt hat.
»Es ist deutscher Laster. Er hat Pinneberger Kennzeichen. Großer Laster. Er bringt Paletten mit Katzenstreu. Ist aber nicht nur Katzenstreu drin.« Der Mann reicht Harry einen Zettel und nickt ihm einmal kräftig zu. »Das ist das Kennzeichen. Ich weiß nicht, wo er hinfährt. Jedes Mal andere Halle, aber immer bei Hamburg.« Sein rundliches Gesicht sieht dabei traurig aus, als würde er jetzt schon bereuen, was er gerade macht.
»Warum helfen Sie uns?«, fragt Harry einfühlsam und nimmt dabei den Zettel entgegen, den er ungesehen in seine Jackentasche steckt. »Angst? Schulden? Rache?« Harry lässt zwischen jedem Wort eine bedeutsame Pause, betrachtet dabei das Gesicht des südländischen Informanten. Doch es bleibt traurig und verschlossen.
»Alles. Leider alles«, antwortet der dunkelhaarige Mann und beginnt, sich von Harry zu entfernen.
»Warten Sie. Für wen ist der Laster bestimmt? Wie kann ich Sie erreichen, wenn ich Fragen habe?«, ruft Harry ihm nach, ohne ihm jedoch zu folgen.
Der Mann blickt sich noch einmal um. »Guckst du auf Zettel in deiner Jacke.« Er deutet auf Harry, der umgehend an sich hinabschaut.
Langsam zieht er den übergebenen Zettel wieder aus der Jackentasche. Er faltet ihn auf und sieht dort ein Pinneberger Kennzeichen. Harry blickt auf, sein Mund steht ihm offen, weil er umgehend noch einmal nach dem Mann rufen will. Doch der ist spurlos im Dickicht der Büsche und Hecken verschwunden. Harry blickt wieder auf den Zettel und wendet ihn. Auf der Rückseite des cremefarbenen Notizzettels steht in geschwungener Schrift »Cemal Sarikaya«.
4
In einer Eppendorfer Altbauwohnung herrscht große Aufregung. Emilia und ihr Vater sind dabei, die Koffer zu packen. Zwei große schwarze Hartschalenkoffer und ein etwas kleinerer Koffer mit jeweils einer großen goldenen Krone auf beiden Seiten liegen auf dem Bett im Schlafzimmer der Eltern. Am Fußende des Bettes sind die verschiedenen Kleidungsstücke aufgestapelt, die mitgenommen werden sollen und darauf warten, in den Koffern verstaut zu werden.
Auf dem Fußboden vor dem Bett türmt Emilia nach und nach ihre gesamten Kuscheltiere und Puppen auf, die sie allesamt mit auf die Reise nehmen möchte, und läuft zurück in ihr Kinderzimmer. Emilia liebt es, zu verreisen, aber sie liebt mindestens ebenso sehr ihre Kuscheltiere.
»Emilia, Prinzessin. Alle kannst du aber wirklich nicht mitnehmen«, ruft ihr Vater, als er mit den Kulturtaschen unter dem Arm aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer kommt.
»Aber Papa, ich kann doch keinen zu Hause lassen«, antwortet Emilia im liebsten bettelnden Tonfall und kommt mit einer Giraffe und einem pinken Schwein ins Schlafzimmer gelaufen, die sie ebenfalls auf den Haufen fallen lässt. Sie stellt sich mit empört verschränkten Armen vor ihren Vater und schaut ihn mit großen, braunen Augen schmollend von unten herauf an.
»Versteh doch bitte, die kriegen wir nicht alle mit, und die müssen hier aufpassen, dass niemand einfach so hereinkommt. Irgendjemand muss ja auf unsere schöne Wohnung achtgeben, wenn wir im Urlaub sind«, versucht ihr Vater beschwichtigend zu erklären und bindet dabei seine langen Haare am Hinterkopf zu einem strengen Zopf zusammen, wodurch die kahlrasierten Seiten zum Vorschein kommen.
»Kommen wieder die Leute in unsere Wohnung?«, fragt Emilia mit ängstlichem Blick. Dem kleinen Mädchen ist noch deutlich in Erinnerung, wie ihr Zuhause ausgesehen hat, als sie vor ein paar Monaten mit ihrer Mutter heimgekommen ist und die gesamte Wohnung auf den Kopf gestellt war. Das war das erste Mal, dass ihr Vater spontan für ein paar Wochen auf Geschäftsreise musste, und dann ist gleich so etwas passiert. Seitdem schläft Emilia immer zwischen ihren Eltern. In ihr Prinzessinnenbett will sie nicht mehr.
»Nein, mein Schatz. Die kommen nie wieder. Das verspreche ich dir. Aber sicherheitshalber bleibt deine Rasselbande hier und passt auf. Einen darfst du dir aber aussuchen, den du mitnehmen kannst. Einverstanden?«, fragt ihr Vater sanft und lächelt seine Tochter liebevoll an, während er sich hinkniet und ihr in die Augen schaut.
»Zwei, sonst fühlen sie sich alleine, wenn wir unterwegs sind«, stellt Emilia ihre Bedingung mit forderndem Blick und Schmolllippe.
»Okay, zwei. Dein Verhandlungsgeschick hast du auf jeden Fall von der Mama«, antwortet er und richtet sich wieder auf.
»Steven, packst du bitte auch meinen Laptop ein? Ich muss im Hotel vielleicht noch ein wenig arbeiten. Im Büro geht es gerade drunter und drüber«, fragt eine schlanke, attraktive Frau, die sich an den Türrahmen lehnt und sich ihre helle Bluse zuknöpft.
»Klar, mache ich. Liegt hier schon bereit«, antwortet Steven. »Lassen wir die Mama schön arbeiten, während wir am Strand ein großes Schloss bauen, oder?« Steven streckt die Hand zu seiner Tochter aus und zwinkert ihr verschwörerisch zu.
»Jawohl. So machen wir es«, ruft Emilia freudig und schlägt in seine Hand ein.
Nachdem Steven die zusammengesuchten Sachen schnell in den Koffern verstaut hat und auch Herr Bär und Prinzessin Smilla ihren Platz gefunden haben, trägt er das Gepäck zu dem vor dem Haus parkenden schwarzen Mustang und legt es in den Kofferraum.
Auch seine Freundin und Emilia kommen nun die Treppen herunter und setzen sich in das Fahrzeug. Mit einem lauten Motorenbrummen startet Steven den Sportwagen und fährt auf die Straße, nachdem er sich versichert hat, dass Emilia auch ordentlich angeschnallt ist.
Nach wenigen Minuten halten sie in der Troplowitzstraße vor dem Polizeikommissariat an. Steven schaut zu dem weiß-blauen Gebäude und dreht sich zu seiner Tochter um. »Weißt du was, Emilia? Ich laufe jetzt schnell bei der Polizei rein und sage denen Bescheid, dass sie die nächsten fünf Tage gut auf unsere Wohnung achtgeben sollen. Was hältst du davon?«
»Super Idee, Papa. Ich komme mit«, antwortet Emilia begeistert.
»Bleib mal lieber hier, Emilia. Papa ist schnell wieder da, und wir wollen doch jetzt zum Flughafen fahren, oder?«, interveniert Emilias Mutter streng und emotionslos.
»Na gut«, antwortet Emilia traurig und lehnt sich schmollend zurück.
»Ach Quatsch. Komm doch mit«, antwortet Steven und erntet umgehend einen skeptisch-wütenden Blick seiner Freundin, den er mit einem beschwichtigenden Lächeln auflöst. »Alles gut. Vertrau mir. Cool bleiben.«
Steven steigt aus dem Wagen und nimmt Emilia bei der Hand. Mit ihr zusammen geht er in Richtung des großen Polizeikommissariats.
»Toll. Wir gehen auf eine richtige Polizeiwache«, freut sich das vierjährige Mädchen, dessen Haare in geflochtenen Zöpfen am Hinterkopf zu einem kleinen Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Mit strahlenden Augen geht es in das Polizeigebäude hinein.
Unmittelbar vor dem Wachtresen bleiben sie stehen, und Steven nimmt Emilia auf den Arm, damit sie besser den uniformierten Beamten bei der Arbeit zuschauen kann.
Ein Beamter kommt auf sie zu und beginnt zu lächeln bei den strahlenden Augen von Emilia, die seine dunkle Uniform von oben bis unten bewundert.
»Hallo, Herr Winter, einmal zur Unterschrift? Ihr Arbeitgeber hat uns bereits bestätigt, dass Sie am Montag nicht erscheinen können, wegen eines auswärtigen Termins«, begrüßt der Beamte Steven, legt ihm ein Dokument auf einem Klemmbrett vor und nickt dabei freundlich dem kleinen Mädchen zu.
»Ja, das ist richtig. Passen Sie bitte gut auf unsere Wohnung auf in meiner Abwesenheit. Emilia hat ein wenig Sorge, dass dort eingebrochen wird«, bittet Steven freundlich.
»Das machen wir. Wir halten die Augen offen, dass niemand in eurer Wohnung Unfug treibt. Ansonsten sperren wir ihn ein. Stimmt doch, Herr Winter?«, antwortet der Beamte und blickt Steven dabei verschmitzt und eindringlich zugleich an.
»Da treibt niemand mehr Unfug. Aber halten Sie bitte die Augen offen. Tschüss. Bis nächste Woche«, erwidert Steven und geht mit seiner Tochter aus der Wache, die er beim Verlassen wieder auf dem Boden absetzt und bei der Hand nimmt.
»Papa, der kannte dich ja sogar. Dann wird der bestimmt gut aufpassen«, sagt Emilia und schaut glücklich zu ihrer Mutter im schwarzen Fahrzeug, die erleichtert aufschaut, als ihre Tochter ihr fröhlich zuwinkt und munter hüpfend an Stevens Hand auf sie zugelaufen kommt.
5
Über die Stadtautobahn am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg fährt ein grauer Kombi mit gemütlicher Geschwindigkeit die Rampe zu den Terminals hinauf. Hinter dem Fahrzeug klettert die Sonne über die Dächer von Hamburg empor und hüllt die Glasdächer der Abflughallen in einen goldenen Schimmer.
Während Otto mit konzentriertem Blick das Lenkrad mit beiden Händen umgreift, erzählt Gerd von alten Geschichten, die er in seinen Zeiten im Polizeidienst erlebt hat. Egal, ob mit der Bereitschaftspolizei oder in verdeckten Ermittlungen, Gerd galoppiert durch die Vergangenheit und lacht immer wieder laut auf vor Seligkeit. Seine Worte überschlagen sich leicht beim Erzählen, während sich Otto an den bereits mehrfach gehörten Geschichten erfreut und Dörte auf der Rückbank vor sich hin grollt.
Im eingeschränkten Halteverbot des Terminals bringt Otto das Auto langsam zum Stehen. Noch bevor der Wagen endgültig anhält, drückt Dörte ihre Tür auf und verlässt die Rückbank fluchtartig.
Gerd schaut auf die Uhr im Armaturenbrett und lässt die Mundwinkel sinken beim Gedanken daran, dass er fast vier Stunden am Terminal verbringen muss, bis der Flieger startet. Noch bevor Otto den Zündschlüssel ziehen kann, ertönt das Klingeln der aktivierten Freisprecheinrichtung. Auf dem Display erscheint in Großbuchstaben »CHEF 2«. Das laute Klingeln schallt aus der offenen Tür im Fahrzeugfond heraus und lässt Dörte vor Schreck zusammenzucken.
»Ist das deine Frau oder Harry?«, fragt Gerd neugierig, als er auf das Display schaut.
»Das is Harry. Meine Frau ist ›CHEF 1‹«, antwortet Otto grinsend.
»Dörte, mach mal die Tür zu. Wir müssen telefonieren«, ruft Gerd salopp durch die Tür zu ihr hinaus.
»Unser Flieger geht gleich, Gerhard«, erwidert Dörte, während ihre Gesichtshaut bereits wieder einen rötlichen Schimmer annimmt, und sie nervös und zornig auf ihre schmale Armbanduhr blickt.
»Die zwei Minuten wird der Flieger noch auf uns warten können«, antwortet Gerd mit spitzbübischem Gesichtsausdruck, aber auch bestimmendem Unterton.
Wortlos fliegt die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss, kurz bevor Dörte mit stechenden Schritten zu den Gepäckwagen marschiert, vor denen sie stehen bleibt, und beginnt, in ihrer Handtasche nach einer Münze zu kramen.
»Dat kann dauern. Willst du nicht langsam mal abnehmen? Nicht, dass er noch auflegt«, drängt Gerd hektisch. Ohne eine Antwort abzuwarten, drückt Gerd auf den grünen Hörer auf dem Display und lehnt sich wieder in seinem Sitz zurück.
»Moin, Otto. Harry hier. Hast du den alten Mann am Flughafen abgegeben?«, begrüßt die vertraute Stimme über die eingebauten Autolautsprecher.
»Der alte Mann hört zu, du Sack«, erwidert Gerd, bevor Otto auch nur Luft zum Antworten holen kann.
»Gerd, mein Lieber. Drängt es dich etwa gar nicht?«
»Hör bloß auf. Ich weiß gar nicht, wat ich da soll. Aber da muss ich jetzt durch. Oder brauchst du mal wieder die Hilfe eines Pensionärs? Alleine kriegt ihr es ansonsten ja nicht gebacken«, antwortet Gerd, während er sich langsam nach vorne lehnt und mit breitem Grinsen auf eine Antwort wartet.
»Passenderweise habe ich heute einen Hinweis erhalten. Cemal Sarikaya erwartet einen Laster mit Kokain aus Spanien, versteckt in Katzenstreupackungen. Otto, ich schicke dir gleich das Kennzeichen. Kümmer dich bitte darum, sobald du wieder im Büro bist. Den lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen«, berichtet Harry Goldutt.
»Und wo ist der Laster jetzt?«, fragt Otto, der Gerd mit seiner Frage zuvorkommt, dem offenbar dieselben Worte auf den Lippen brennen. Neugierig lehnt sich Gerd dem Radio noch mehr entgegen, als würde Harry hinter dem Display sitzen, während sich Otto einmal nervös über die Lippen leckt und sich im Anschluss mit der Hand über den Mund wischt.
»Irgendwas musst du ja auch noch machen. Also, schönen Urlaub, Gerd! Otto muss jetzt an die Arbeit«, erwidert Harry und beendet im Anschluss das Gespräch, ohne eine weitere Verabschiedung. Auf dem Display erscheint wieder ein Hamburger Radiosender, und aus den Lautsprechern tönt die hektische Stimme eines Zuhörers, der gerade versucht, schnelle Antworten auf Fragen des Moderators zu geben.
Gerd hört nicht auf das, was dort gesprochen wird, blickt auf und schaut zu Otto, der seinen Blick erwidert. »Ist jetzt nicht sein Ernst, oder?«
»Ich denke schon. Ich wünsch dir eine gute Reise. Dörte war auch erfolgreich, wie ich sehe«, sagt Otto und nickt über Gerds Schulter hinweg, wo Dörte mit strengem Blick durch die Beifahrerscheibe ins Fahrzeuginnere blickt. »Guten Flug, Gerd. Lass was von dir hören.«
»Haltet mich auf dem Laufenden. Und wehe, ich höre nicht als Erster davon, wenn ihr den Laster kriegt«, antwortet Gerd und fixiert Ottos Augen, bis dieser gnädig zu nicken beginnt.
Gerd wendet sich zögernd von Otto ab und schreckt zurück vor Dörtes Gesicht, die unmittelbar vor seiner Scheibe steht und ihn stechend anblickt.
Erst als Gerd den Türöffner betätigt, weicht sie zurück, und ihre Gesichtszüge entspannen sich zügig zu einer frohlockenden Vorfreude.
Gerd steigt mit leidvollem Stöhnen aus dem tiefen Sitz aus und geht zum Kofferraum, aus dem er die Koffer auf den bereitstehenden Gepäckwagen hebt.
Kaum schließt er die Heckklappe, startet Otto den Motor und fährt mit zweifachem Hupen davon.
Traurig blickt Gerd dem eleganten Dienstwagen nach. Nur zu gerne wäre er sitzen geblieben und hätte die Jagd nach dem ominösen Laster begonnen.
»Kommst du, Gerhard?«, ruft Dörte schrillend aus der großen Drehtür, in die sie in diesem Moment bereits den Gepäckwagen hineinschiebt. Dann verschwindet sie hinter einer mit Werbebannern beschlagenen Glastür.
6
Die tosende Brandung schlägt lang auslaufend auf die Bucht von Canet-en-Roussillon. Von Süden her weht ein scharfer Wind, der den Geruch von Salzwasser und die Rufe der Seevögel an den Strand heranträgt. Dort liegen Touristen und Einheimische im hellen Sand und genießen den erfrischenden Wind, der die ansteigenden Temperaturen an der französischen Mittelmeerküste erträglich macht. Sie beobachten vereinzelte Surfer dabei, wie sie versuchen, sich auf ihren Brettern zu halten und die wilden Wellenberge zu bezwingen.
In einem kleinen, unscheinbaren Bistro am Ende der Strandpromenade, etwas abseits der Touristenpfade, sitzt Capitaine Jaques Lebrédonchel in einem geflochtenen Gartenstuhl. Er schaut auf die glänzende See und die sichelförmig an den Strand gebaute Uferpromenade. Gelegentlich wirft er einen Blick in die Karte des Bistros, in der die Meeresfrüchte als besondere Spezialität angepriesen werden.
Lebrédonchel trägt seine langen lockigen Haare mittig gescheitelt und lässt sie locker über die Ohren fallen. Nur wenn der Wind die Haare zu sehr ergreift, streift er sie seitlich hinter die Ohren, sodass sie ein wenig Halt haben. Die sonnengebräunte Haut sowie die Lachfalten um die Augen herum verleihen ihm eine gesunde und ruhige Ausstrahlung. Unter dem Mund trägt er einen dünnen, leicht struppigen Bart, der kurz vor der Kinnspitze abschließt.
Das lockere weiße Hemd, das er über seiner blauen Leinenhose leicht geöffnet trägt, flattert im Wind und lässt dunkle Brusthaare aus dem Revers hervorscheinen.
»Bonjour, Capitaine. Was darf ich Ihnen heute servieren?«, fragt ein adrett gekleideter Kellner, der von rechts an den Tisch herantritt.
»Bonjour, François. Bring mir bitte eine Bouillabaisse und einen Sauvignon Blanc«, antwortet Lebrédonchel mit einem freundlichen Lächeln. Er reicht die Speisekarte an den Kellner, der ihm bestätigend zunickt.
Warum habe ich mir dieses Leben so lange Zeit aufgespart?, fragt sich Lebrédonchel. Er wendet den Blick wieder zum Meer, während er sich im Stuhl zurücklehnt.
Nach vielen zermürbenden Jahren bei der Police Nationale in Paris hat er sich vor wenigen Wochen zur Gendarmerie nach Perpignan versetzen lassen, um es ein wenig ruhiger anzugehen. Zurück zu seinem Geburtsort im Südwesten Frankreichs, unmittelbar vor der spanischen Grenze, den er damals eigentlich nie verlassen wollte. Doch dann hatte ihn die Sucht nach Verbrechensbekämpfung ergriffen und in die französische Hauptstadt geführt. In seiner Heimat läuft die Arbeit viel gemächlicher als in der pulsierenden Metropole. Niemand wird ihn hier in der wohlverdienten Mittagspause stören.
7
Mit einem lauten Rucken wird Dombrowski aus der Lethargie seiner ungeordneten Gedankenwelt gerissen.
»Die Zeit ist um«, ruft der Schließer in den kleinen Raum hinein. Er bleibt ohne erkennbare Gefühlsregung in der Tür stehen.
»Ist die Zeit etwa schon um? Das kann doch gar nicht sein!«, kreischt Charleen auf, während ihr umgehend Tränen in die Augen schießen, wie schon so oft in dieser für Dombrowski so ewig langen Stunde.
Er springt auf und blickt dankbar zur Uhr. »Ja, dann wollen wir mal, Frau Schulze. Tschüss, Herr Simsek. Bis die Tage.« Nachdrücklich blickt Dombrowski Charleen an, die ihren Blick nicht von Faruk lösen kann.
Widerwillig erhebt sie sich vom Stuhl. Tränen laufen an ihren Wangen herab. »Bis bald, Baby. Ich liebe dich.«
»Denk an die Playstation, Baby. Ist wichtig«, antwortet Faruk und schaut Charleen dabei eindringlich in die Augen.
Doch schon schiebt sich Dombrowski dazwischen und streckt seinen Arm zur Tür hinaus. »Darf ich bitten? Ich hab heut auch noch etwas anderes zu tun«, drängt er Charleen aus dem Raum, die noch versucht, einen letzten Blick auf ihren Geliebten zu erhaschen. Es gelingt ihr jedoch nicht, weil direkt hinter Dombrowski die Tür durch den Schließer geschlossen und mit einem Metallschieber verriegelt wird.
»Wenn Sie mal wieder Zeit haben und einen Termin brauchen, dann können Sie sich ja gerne bei uns melden. Bis dahin alles Gute für Ihre Operation. Tschüss.« Ohne auf eine Reaktion zu warten, schiebt Dombrowski die Metalltür zum Vorraum auf. Er geht schleunigst zum Wachraum im Eingangsbereich, wo er aus dem Schließfach sein Handy und die Dienstwaffe nimmt. Er hebt die Hand, um sich von den Schließern zu verabschieden, und nickt ihnen einmal freundlich zu.
»Bis nächstes Mal«, rufen sie ihm noch mit süffisantem Grinsen hinterher, worauf Dombrowski mit leichtem Lachen in der Stimme ein »Ich hoff nicht so schnell wieder« antwortet.
Das durchdringende Surren der Tür verkündet Dombrowski, dass sich die schwere Metalltür zur Freiheit nun wieder für ihn öffnet. Er kann dieser leidigen Pflichtaufgabe endlich den Rücken zukehren.
Nach den ersten Schritten atmet er tief ein und genießt die frische Stadtluft. Kein billiges Parfüm, kein Geruch von Haarspray und vor allem nicht mehr diese leidigen Gesprächsinhalte, die sich alle fünf Minuten wiederholen.
Was finden diese Frauen bloß an solchen Kerlen? Hat Charleen ihrem Freund tatsächlich die körperlichen Misshandlungen und die versuchte Vergewaltigung aus dem Frühjahr verziehen? Oder hat sie die Taten einfach verdrängt? Warum hält sie ihm derart die Treue?
Dombrowski schlendert den Fußgängerweg in Richtung der U-Bahnhaltestelle entlang. Er blickt in den mit kleinen weißen Wolken geschmückten blauen Himmel und kneift seine Augen zusammen. Und was finden eigentlich solche Kerle an diesen Tussen? Er schüttelt den Kopf und versucht, die Erinnerung an die letzte Stunde gleich wieder zu verwerfen.
Anschließend aktiviert er sein Handy und blickt auf das Display. Überrascht stellt er fest, dass sowohl Otto als auch Harry Goldutt bereits mehrfach versucht haben, ihn anzurufen.
Was da schon wieder los ist? Er wählt die Nummer von Harry. Nach mehreren Klingelzeichen nimmt sein Chef das Telefonat an.
»Dumbo, ich kann gerade nicht, ich bin in einer Besprechung. Ruf Otto an, der weiß Bescheid.« Bevor Dombrowski überhaupt ein Wort erwidern kann, piept sein Handy einmal auf, und das Telefonat ist bereits wieder beendet.
Er wählt die Büronummer von Otto, der sich mit gewohnt kehliger Stimme meldet: »Hallo Dumbo. Hast schon gehört?«
»Nee.«
»Wann bist du hier?«
»Bin gleich in der Bahn. Zwanzig Minuten.«
»Beeil dich. Ich hab Fred am anderen Rohr. Bis gleich.«
Erneut wurde aufgelegt, ohne dass Dombrowski irgendetwas Erleuchtendes erfahren hat. Er schaut völlig irritiert auf sein Mobiltelefon und stolpert dabei über den Absatz der Rolltreppe, dem er keinerlei Beachtung geschenkt hat. Dombrowski beginnt zu grübeln, aus welchem Anlass Otto wohl so dringend mit Fred, dem Leiter ihrer Observationsgruppe, sprechen wollte. Mit lautem Pfeifen und Quietschen fährt währenddessen die Bahn in den Bahnhof Messehallen ein, wo Dombrowski inzwischen angekommen ist. Er steckt sein Handy in die Jackentasche, geht zu den Türen des hinteren Bahnwaggons und öffnet sie per Knopfdruck. Mit mehrfachem Piepen schließen sie sich hinter ihm. Er bleibt im Gang stehen und versucht, sich in Geduld zu üben, während die Bahn langsam mit einem surrenden Brummen wieder anfährt.
8
Vor den Toren Barcelonas liegt der kleine und beschauliche Küstenort Castelldefels, der in Strandnähe und an seinen pittoresken Klippen mit repräsentativen Villen zeigt, dass hier die Schönen und Reichen von Barcelona am Wochenende ihre Ruhe suchen. Weiter im Landesinneren liegt das alte Zentrum der kleinen Stadt. Es bietet ein Zuhause für diejenigen, die sich keinen Wohnraum in der lebendigen Mittelmeermetropole Barcelona leisten können. Steigende Mieten und die Umwandlung von Wohnraum zu Ferienwohnungen für die geldeinbringenden Touristen treiben die arbeitende Bevölkerung vor die Tore der Stadt.
Neben dem Stadtzentrum von Castelldefels liegt ein großes Industriegebiet mit Einkaufsmöglichkeiten, Fabriken, Lagerhallen und Speditionen. Es befindet sich direkt an der Autobahn, über die man in Richtung Süden nach Valencia und Málaga gelangt und nach Norden direkt auf die französische Grenze zusteuert.
Der Verkehrslärm dröhnt über das Gelände der Spedition Portador, in deren Lagerhallen sich Paletten mit verschiedensten Gütern sammeln. Sie sollen mit Zugmaschinen in Richtung Zentral- und Osteuropa transportiert werden.
Vor den Hallen parken Lastkraftwagen aus Skandinavien, den Niederlanden und Deutschland, vereinzelt auch aus dem Baltikum und Polen. Rückwärts eingeparkt stehen sie an den Hallen, wo emsige Arbeiter die Paletten mit Waschmaschinen, Fernsehern, spanischer Keramik oder anderweitigen Produkten mit surrenden elektronischen Hubwagen klappernd auf die Laster transportieren. Auf den Rampen stehen laut dirigierende Vorarbeiter, die auf ihren Klemmbrettern stets nachschauen, welche Paletten auf die jeweiligen Anhänger zu laden sind.
Bevor die Waren verladen werden, bestückt der Vorarbeiter sie mit Barcodeetiketten, die er einscannt, um den Transport später verfolgen zu können.
Die Paletten werden an ihrem Ziel in den jeweiligen Ländern dann bei Partnerspeditionen abgeladen und erneut verladen, falls sie ihren Bestimmungsort noch nicht erreicht haben sollten.
Die noch immer kräftige Spätsommersonne brennt auf die Arbeiter nieder, lässt sie trotz der elektrischen Helfer ins Schwitzen kommen, während sie im Akkordtempo die verschiedenen Paletten in die aufgeheizten Laderäume der Aufleger fahren.
Gerade beladen sie an Luke Nummer vier eine blaue Zugmaschine mit weißem Anhänger, auf dessen Wänden beidseitig in orange-roter Farbe die Silhouette eines Eichhörnchens abgebildet ist.
Über die Zufahrt zum Grundstück der Spedition fahren immer wieder kleine und große Transporter, kleine Laster oder große Zugmaschinen, die zu transportierende Waren anliefern oder sich mit ihnen auf die weite Reise durch Europa machen.
Direkt gegenüber von der Spedition Portador, getrennt durch eine breite Straße, stehen auf einer weitläufigen Grünfläche drei blaue Vierzigfußcontainer aneinandergereiht. In die Stahlwände sind große Fenster geschnitten, die einen Blick auf das rege Treiben im Inneren zulassen. Die Ausschnitte sind als schattenspendende Vordächer an die Container geschweißt.
In ihnen arbeiten weiß gekleidete Köche, die durchgehend damit beschäftigt sind, Baguettebrötchen in schmackhafte Bocadillos zu verwandeln oder warme Speisen zu kochen.
Unter den vor den Kochcontainern als Sonnensegel aufgespannten, im Wind schwankenden Planen sitzen auf den verteilten Bänken die spanischen und ausländischen Lastwagenfahrer. An hellen Tischen lassen sie sich das spanische Essen schmecken. Ein letzter Genuss, bevor sie wieder in ihre Fahrzeuge steigen, zum Teil für lange Zeit einsam in ihren Fahrerkabinen sitzen und zum vorgegebenen Ziel fahren.
Hier tauscht man sich aus über Fahrtrouten und Baustellen, über Erlebnisse auf den Autobahnen Europas oder über verschiedene Sportarten und ihre Ergebnisse.
An einem der Tische sitzt Pawel Kaminski, vor sich eine große Schale mit einem Eintopf aus Kartoffeln, Paprika und Tomaten, Chorizo und mediterranen Kräutern. Er rührt gemächlich mit einem hellen Brot durch die tiefrote scharfe Soße. Gelegentlich beißt er aufschmatzend ein Stück von dem weichen, vollgesogenen Brot ab.
Auf der hohen Stirn, die von wilden gräulichen Haaren umrandet ist, und auch auf der Oberlippe stehen vereinzelte Schweißperlen, die er gelegentlich mit einem Stofftaschentuch abtupft. In die Stirn hängt ein schmaler Haarstrang hinab, dessen Spitze feucht in den tiefen Falten klebt. Auf der Nase trägt Pawel eine Brille, die ihn seit vielen Jahren durchs Leben begleitet und seine blauen Augen mit einem dünnen grauen Stahlrahmen einfasst. Unter der schlanken Nase lässt er sich einen schmalen Schnurrbart stehen, der kurz getrimmt ist und seitlich bis in die Mundwinkel reicht.
Der aufsteigende Dampf trägt den herrlich würzigen Essensgeruch in seine Nase, während er die nächsten Bissen zerkaut.
Pawel sitzt etwas abseits der übrigen Gäste. Er mag die Einsamkeit, die ihm durch den Beruf des Fernfahrers täglich gegeben ist. Er scheut die Gesellschaft und genießt den Moment der Ruhe.
Immer wieder taucht er das Brot in die Soße, beißt ein Stück ab, bis der Eintopf spürbar abgekühlt ist, sodass er endlich zum Löffel greifen kann.
Ein leichter Bauchansatz drückt sich über den eng gezogenen Gürtel der blauen Jeans, die lässig auf den dunklen Turnschuhen aufliegt.
Nach wenigen Minuten hat er die Schüssel leer gegessen. Er greift nach dem Bocadillo, das er sich vorsorglich für den Abend gekauft hat, und steht auf.
Sein Geschirr lässt er stehen, wischt sich noch einmal den Mund ab und wirft die benutzte Papierserviette in die Schale hinein.
Mit schnellen Schritten läuft Pawel über die Straße zur Einfahrt der Spedition Portador und geht ein wenig langsamer, sobald er das Gelände betreten hat.
Nach kurzer Zeit kommt er an der Luke vier an, wo er vor einer guten Stunde seine Zugmaschine geparkt hat, um die zu transportierenden Güter verladen zu lassen. Auf die Zusammenstellung der Paletten nimmt er hierbei keinen Einfluss. Er achtet nur darauf, dass er das Gesamtgewicht nicht überschreitet und die Ladefläche möglichst sinnvoll mit Europaletten genutzt wird.
Zufrieden blickt er in den Anhänger, der zwischenzeitlich voll beladen wurde. Der Vorarbeiter tritt an ihn heran und überreicht ihm das Klemmbrett mit den Ladepapieren. Pawel unterschreibt an der Stelle, die ihm der Vorarbeiter mit leichtem Brummen und einem blauen Kreuz markiert hat. Er reißt das Original für sich ab und übergibt den Durchschlag samt Klemmbrett an den Vorarbeiter.
»Gracias. Adiós«, sagt er in ruhigem Tonfall die einzigen spanischen Worte, die er beherrscht. Seit Jahren fährt er immer wieder von Deutschland nach Spanien und zurück. Dennoch hat er es nie für nötig gehalten, sich ein paar mehr Wörter anzueignen, um sich auch hier verständigen zu können. Ihn freut es, dass er Polnisch und Deutsch sprechen kann. Das ist völlig ausreichend für sein Leben.
»Hasta luego«, antwortet der Vorarbeiter und wendet sich von Pawel ab. Er widmet sich dem nächsten Fahrer, der eine Luke weiter steht und ebenfalls auf die entscheidenden Transportpapiere wartet.
Pawel schließt bereits die Ladetüren, um endlich aufbrechen zu können. Er steigt von der Rampe, geht zum Führerhaus, öffnet die Tür und steigt zum Sitz hinauf. Auf seinem Fernfahrerthron fühlt er sich wie ein kleiner König der Straßen Europas.
Mit lautem Brummen startet der Motor der Zugmaschine, und er legt den ersten Gang ein. »Auf geht’s«, ruft er freudig und lässt die Kupplung langsam kommen. Allmählich setzt sich sein Sattelzug in Bewegung.
9
Südlich der Elbe, direkt neben dem größten Einkaufszentrum Harburgs, verläuft die zweispurige Wilstorfer Straße. Der belebte Verkehr lässt die warme Luft im Sonnenschein nach Abgasen riechen. Die Motorengeräusche dröhnen in den Ohren der Gäste vom Café International. Sie sitzen vor den Milchglasscheiben des Cafés an mehreren kleinen Holztischen, die Cemal aufgrund des guten Wetters vor den Laden stellen ließ, und unterhalten sich lautstark miteinander.
Es wird gelacht, teilweise sogar laut aufgebrüllt vor Freude und Heiterkeit. Einige Besucher stehen um die sitzenden Gäste herum und beteiligen sich an den Gesprächen, die zum Teil in mehreren Sprachen gleichzeitig gestenreich geführt werden.
An einem der Tische sitzt auch Cemal Sarikaya. Seine frisch rasierte Glatze leuchtet im Sonnenschein. Das weiße Hemd lässt seinen Teint noch gebräunter erscheinen. Die dunkle Stoffhose und die schwarzen Lederschuhe lassen ihn zwischen seinen Freunden und Gästen deplatziert wirken. Sie tragen zumeist Trainingshosen, Sportschuhe und luftig geschnittene T-Shirts.
Die Mehrzahl von ihnen hat einen mehr oder weniger langen Vollbart. Auch Cemal hat einen dunklen Bart, den er gerade erst am Morgen beim nebenan eröffneten Barbershop zurechtstutzen lassen hat.
»Cemal, Digger, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen.«
»Die sollen dich endlich in Ruhe lassen.«
»Digger, was denken die eigentlich?«, reden seine Gäste auf Cemal ein. Er sitzt stoisch auf seinem Stuhl, hat die Finger ineinander gefächert, wobei er die Zeigefinger ausgestreckt hält und mit den Fingerspitzen immer wieder gegen seine Nasenspitze tippt.
Grübelnd blickt er zu einem in Sichtweite geparkten Van, dessen Heckscheiben abgedunkelt sind.
»Du musst denen jetzt mal zeigen, dass sie nicht alles mit dir machen können. Du bist ein freier Mann.«
»Die können hier doch nicht ewig rumlungern«, ergänzen die nächsten beiden Gäste.
»Lasst sie doch im Kofferraum sitzend schwitzen. Irgendwann werden die schon das Interesse an uns verlieren«, erwidert Cemal ruhig. Er trinkt einen kleinen Schluck schwarzen Tee aus einer gläsernen Tasse, die er im Anschluss auf einem Blechtablett abstellt.
»Diggi, Bruder. Ich hänge hier nicht länger ab, wenn die hier immer sind. Das macht keinen Sinn.«
Mit jedem Kommentar der Anwesenden wird Cemal ruhiger und schaut mit gestochenem Blick zu dem Fahrzeug hinüber. Die Stirn wirft er dabei in Falten. Zwischen den Augenbrauen bildet sich eine tiefe Furche. Immer mehr baut sich Spannung in seinem Körper auf. Mit jeder weiteren Äußerung steigert sich in ihm die Aggression über die unerwünschten Beobachter.
»Bro, ich mach hier keine Geschäfte mehr. Ich geh ab morgen wieder in Neugraben ins Café«, äußert sich ein dickbäuchiger Südländer, der direkt neben Cemal sitzt.
Cemal beginnt zu blinzeln, als die Sonne hinter einer Wolke hervortritt, sich in dem Tablett vor ihm widerspiegelt und das Licht auf sein Gesicht wirft.
»Schluss jetzt«, gibt er entschlossen von sich. Er steht von seinem Stuhl auf. Mit schnellen Schritten schreitet er in sein Café und geht unmittelbar auf seine Angestellte zu. Sie steht hinter dem Tresen und stellt gerade die Getränkewünsche der Gäste bereit.
Er greift hinter die Theke und spürt das kalte Metall an seinen Fingerspitzen, das er sogleich umfasst und hervorzieht.
»Was machst du da?«, fragt Svetlana, die neue Angestellte von Cemal.
»Konzentrier dich auf deinen Kram«, antwortet Cemal scharf und wendet sich von ihr ab.
Unweit vom Café sitzt im Kofferraum eines abgedunkelten Vans der Leiter der Observationsgruppe vom Rauschgiftdezernat. Trotz seiner Führungsposition in der Gruppe liebt er es, noch immer in erster Reihe zu stehen und möglichst gute Fotos und Videos von Treffen oder Übergaben zu machen. Immer wieder drückt er den Auslöser seiner Kamera und filmt die Bewegungen vor dem Café International. Das Hauptobjekt seiner Beobachtung hat vor Kurzem das Café betreten. So nutzt er den Moment, um die Kamera abzulegen und seine Brotdose zu öffnen. Er will sich kurz stärken für die nächsten Stunden der geplanten Observation.
In Freds Jackentasche vibriert plötzlich sein Handy. Auf dem Display erscheint der Name von Otto.
»Hallo, mein lieber Otto«, antwortet Fred mit gedämpfter Stimme. »Wie geht’s, wie steht’s?«
»Bist du noch bei Cemal?«, fragt Otto sogleich, ohne eine Begrüßung oder Antwort auf die Frage nach dem Wohlbefinden.
»Mir geht es auch super. Und ja, ich sitze hier noch immer in meinem Backofen, schwitze wie ein Iltis und warte darauf, dass etwas Interessantes passiert. Bislang ist hier alles ruhig. Relativ viele Gäste sind anwesend, aber es wird nur herumgealbert. Ich konnte noch nichts Aufregendes feststellen«, erzählt Fred mit vollem Mund, nachdem er kräftig von seinem Käsebrot abgebissen hat.
»Mmh. Schade. Wir haben einen Hinweis auf Cemal bekommen. Wir müssen da dranbleiben. Er soll einen Laster mit Pinneberger Kennzeichen nutzen, um Kokain in Katzenstreupackungen nach Hamburg zu transportieren. Falls ihr also einen entsprechenden Lastkraftwagen oder Katzenstreupackungen seht, dann sagt mir bitte Bescheid«, erklärt Otto sein Anliegen.
»Ja. Ich meld mich, wenn was passiert. Warte mal. Cemal kommt gerade aus dem Laden. Was hat der denn vor? Warte mal, Otto. Hier passiert vielleicht was. Ich glaube, der kommt direkt auf mich zu.«
Mit entschlossenem Gang marschiert Cemal durch seine Freunde und Gäste hindurch. Erstaunt über diese Reaktion auf ihre Einflussnahme, blicken sie ihm nach.
Durch große, schnelle Schritte gelangt Cemal zu dem dunklen Van, den sie nun bereits seit mehreren Stunden im Auge behalten haben. Als Farid, der seit vielen Jahren ins Café International kommt, am Morgen beobachtet hat, wie der Wagen in Sichtweite abgestellt wurde, jedoch keine Person ausgestiegen ist, war ihm gleich klar, was sich dort abspielt. Das Café war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet, doch Farid wohnt direkt nebenan im zweiten Stock und hat gerade aus seinem Fenster geschaut.
Am Van angekommen, ergreift Cemal den Griff der Schiebetür und reißt sie mit einem lauten Knallen auf. Aufgeschreckt blickt der im Kofferraum sitzende Fred zu Cemal auf, der ihm direkt ins Gesicht schaut und seine rechte Hand in Freds Richtung erhebt. Fred sieht es in der Hand leicht aufblitzen, doch er schaut gebannt in Cemals Augen.
»Wollen Sie vielleicht einen Tee, Herr Kommissar?«, fragt Cemal plötzlich aufgesetzt freundlich. Er wandelt die in seinem Gesicht stehende, furchteinflößende Strenge in ein verschmitztes Grinsen und schaut kurz auf das Tablett in seiner Hand. Ohne auf eine Antwort zu warten, stellt er es auf der Rückbank ab, zwinkert dem noch immer regungslos dasitzenden Fred zu und schließt die Seitentür vom Van mit einem metallischen Rauschen.
»Otto, ich glaube, wir sind aufgeplatzt«, spricht Fred emotionslos in sein Handy und beendet das Gespräch. Sein Blick bleibt bei Cemal, der selbstbewusst auf die johlende Gesellschaft vor seinem Café zuschreitet.
10
Am Flughafen in Hamburg sammeln sich nach und nach die Menschen, die an den Check-in-Schaltern warten und ihr Gepäck aufgeben oder ihre Familienangehörigen begleiten, um sich von ihnen zu verabschieden. Kinder laufen um die Gepäck-Trolleys ihrer Eltern in Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub. Andere Reisewillige stehen in den Duty-Free-Geschäften, um sich für die Reise mit Spirituosen, Zeitschriften, Süßigkeiten oder Zigaretten einzudecken. Jeder achtet vornehmlich auf sich selbst und seine Verwandten und Bekannten. Das wilde Treiben bewegt sich stumm voreinander her, weil die endlos hohen Dächer der Abflughalle die Stimmen und Geräusche schlucken.
»Seh ich etwa so aus, als würde ich ein Flugzeug entführen wollen?«, raunzt Gerd seiner geliebten Ehefrau genervt zu, während sie sich von der Sicherheitsschleuse zu den Abfluggates entfernen. Mühsam pfriemelt er den Gürtel unter seinem leicht überstehenden Bauch in die Schlaufen an seiner Jeans. Dabei stopft er sein Hemd wieder in die Hose.
Weil er vergessen hat, sein Kleingeld aus den Hosentaschen zu nehmen, und seine Halskette nicht abgenommen hat, hat der Scanner rot aufgeleuchtet. Gerd hat längere Zeit in einer Art Badekabine hinter dem Apparat verbringen müssen. Dort hat er die Gegenstände dann erst einmal abnehmen müssen und wurde in dem engen Raum im Anschluss von einem beleibten Sicherheitsbeamten per Hand abgescannt.
»Als ich damals noch beim Grenzschutz war, da hat es so wat noch nicht gegeben. Wir haben genau gewusst, wen wir rausziehen mussten. Der hat mir sogar dreist an den Hintern gepackt. Selbst meine Schuhe musste ich ausziehen.« Noch immer läuft Gerd mit hochrotem Kopf hinter Dörte her, die ihm beim Meckern jedoch keinerlei Beachtung schenkt. Vielmehr bleibt sie mitten auf dem breiten Flur stehen und schaut mit freudigem Lächeln auf die große Anzeigetafel, um herauszufinden, zu welchem Gate sie müssen. Dort will sie mit Gerd endlich ihren Flug in die Sonne antreten.
»Mannomann, Dörte. Du kannst mir Sachen antun. Mir ist jetzt schon warm. Wie soll dat erst in Spanien werden? Die können ja alle auch gar kein Deutsch sprechen«, mosert Gerd weiter herum, während er ein rotes Stofftaschentuch aus der Hosentasche zieht und sich die Stirn abtupft.
»Wir müssen zu Gate A 42. Unser Flug geht schon in drei Stunden«, erwidert Dörte, ohne den Worten von Gerd Beachtung zu schenken.
»Schon in drei Stunden? Mann, Mann, wat solln wir denn die ganze Zeit machen? Ich muss erst einmal auf’n Pott«, antwortet Gerd. Er geht, ohne eine Antwort von Dörte abzuwarten, auf einen Zugang zu, neben dem ein großes Männchen abgebildet ist.
Dörte trägt währenddessen das Handgepäck zu einer Bank bei ihrem Gate und lässt sich auf ihr nieder. Aus einer Seitentasche zieht sie einen ihrer Reiseführer über Barcelona heraus, schlägt die Seite mit der Sagrada Família auf und beginnt auf den folgenden Seiten zu stöbern.
Mit einem schweren Ächzen lässt sich Gerd kurze Zeit später auf die Bank neben seiner Frau fallen. Dörte schaut kurz zu ihm auf und blickt sogleich wieder in ihren Reiseführer.
Gerd betrachtet verwundert die Monitoranzeige an ihrem Abfluggate. Er rückt seine Brille auf der Nase zurecht und kneift die Augen zusammen. »Dörte?«, ruft er fragend, doch Dörte antwortet ihm nicht. »Dörte. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Da steht ›Zürich‹ auf dem Monitor.«
»Wir sind hier richtig, Gerhard. Wir haben schon den nächsten Flieger an diesem Gate. Guck mal, alle Leute, die hier sitzen, werden gleich in die Schweiz fliegen. Ist das nicht spannend?«, erwidert Dörte mit strahlenden Augen.
»Na ja, geht so, näh?«, antwortet Gerd wortkarg und blickt auf die Uhr. Sie verrät ihm, dass er noch immer fast drei Stunden auf den Abflug warten muss. Er streckt seine Beine aus, verschränkt die Arme und senkt leicht den Kopf. Das frühe Aufstehen hilft ihm jetzt dabei, eine innere Ruhe zu finden. Er hört nur noch Wortfetzen seiner Frau, wie »Antoni Gaudí«, »Gran Teatre del Liceu«, »Casa Milà müssen wir« und »Park Güell ist einfach sehenswert«, doch den Wörtern kann und mag er nicht weiter folgen. Lieber ergibt er sich seiner Müdigkeit und lässt seinen Geist für die nächsten Stunden bis zum Abflug ruhen.
11
Im leichten Wind aus Nordosten schwankt eine rote Schaukel an blauen Seilen, die an einem Holzgerüst befestigt sind. Der leichte Plastiksitz schwingt von allein und lässt die Haken leise quietschen. So leise, dass man es im Wind kaum hören kann.
Hinter der Schaukel, am Ende eines gepflegten Rasens, liegt eine Doppelhaushälfte, verklinkert mit roten Backsteinen. Die weißen Fenster sind geputzt. Die Küchenfenster werden von den feinen Blättern einer Harlekinweide verdeckt.
Von der Schaukel aus kann man im hell erleuchteten Wohnzimmer zwei Männer sehen. Einer von ihnen sitzt mit einer Lederjacke bekleidet zurückgelehnt auf dem beigen Sofa. Er schaut hinauf zu dem vor ihm stehenden Mann.
Dieser redet offenbar auf ihn ein und gestikuliert dabei wild mit seinen Armen. Er trägt keine Jacke, lediglich ein T-Shirt und eine Jogginghose. Dabei läuft er barfuß auf dem Kirschholzparkett auf und ab.
»Flo, du musst das wieder mitnehmen. Das ist keine A-Ware. Alle beschweren sich. Nur Kopfschmerzen wegen dem Stein. Der Block sieht fest aus, aber wenn man aufmacht, dann bröselt der. Die Leute geben wieder zurück, Digger. Ich habe sogar ohne Gewinn versucht zu geben, aber niemand will«, beklagt sich der stehende Mann aufgeregt, reibt das gut gebräunte Gesicht mit seiner tätowierten Hand und kratzt sich im Anschluss am kahlrasierten Hinterkopf. »Ich kann das nicht auf Menge abgeben. Vielleicht kann jemand das für euch klein-klein verkaufen, aber das ist nicht mein Geschäft, Digger. Ihr habt A-Ware versprochen. Direktware, Digger. Das ist safe gestreckt. Ich habe es gekocht. Das hat weniger als achtzig Prozent. Ich habe es dir wieder verpackt. Du kannst es direkt mitnehmen.«