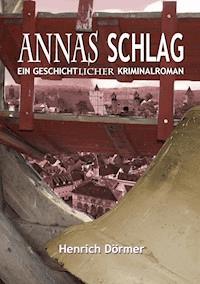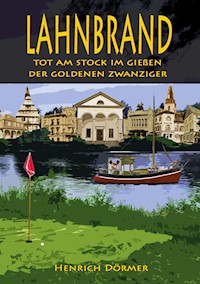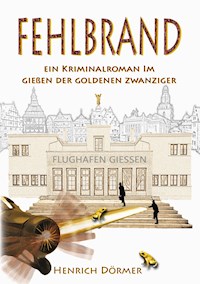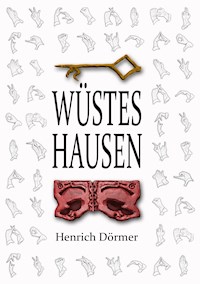Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im oberhessischen Golf- und Countryclub Lindental ereignet sich ein tragischer Unfall: Der Grundstücksgutachter Theodor Müller wird von einem Golfball tödlich am Kopf getroffen. Zunächst scheint der Fall klar. Doch dann kommen bei Unfall-Ermittler Martin Benedikt Cervinus Zweifel auf. Niemand hat genau gesehen, wer den tödlichen Golfball wirklich geschlagen hat. Auch der geheimnisvolle Schäfer nicht, der von seiner Weide aus freien Blick auf den Unfallort hatte. Wenige Tage später wird der neue Eigentümer des Golfclubs, Joachim R. Hartmann, in einem Sandbunker niedergeschlagen und schwer verletzt. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen? Erst als Tom Keller von der Mordkommission Cervinus bei den Ermittlungen rund um die mittelhessische Metropole Gießen unterstützt, treten die Hintergründe ans Licht und die Schatten der Vergangenheit zu Tage. Ermittelt wird unter anderem in oberhessischem Dialekt sowie auf "Manisch", einem Soziolekt, der durch den Einfluss unterschiedlichster Kulturen entstand und heute noch fast ausschließlich in einigen Gießener Bezirken verbreitet ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Louisa, Hannah, Victoria und Katharina
Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sie finden ab Seite → ein kleines Golf-Lexikon für die Begriffe, die in diesem Roman in kursiver Schreibweise dargestellt sind.
Ebenso werden auf Seite → die Wörter in manischer Sprache ins Deutsche übersetzt.
Auf den Seiten → und → finden Sie eine Übersichtskarte des beschriebenen Golfplatzes.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
Golflexikon
Manisch-Deutsch
Der Golfplatz
Danke
Über den Autor
Prolog
Arbeitslager 15/LT
am Abend des 6. Dezember 1944.
«Kimm Boabche, dou host heit scho genuch geärwet, loss mich de' Ofe leermache, leg dich hie, moan git's wirrer freu luus.» August Ziegler, ein siebenundsechzig Jahre alter Motoreningenieur aus Marburg, der selbst heute schon sechzehn Stunden lang an den Treibstoffleitungen gefeilt, gebohrt und gefräst hatte, nahm dem Zwölfjährigen den Kohleneimer aus der Hand und öffnete den kleinen Brikettofen. Trotz der Feuerstelle war es bitterkalt in dem engen Seitenstollen, der den Insassen als Schlafgelegenheit diente. An den lehmigen Wänden rann das eiskalte Wasser des fünf Meter darüber auf den Boden fallenden Niederschlags herab. Zwei kleine Steigerlampen dienten als einzige Beleuchtung des fünfzehn Meter langen Stollens. Die Decke war so niedrig, dass man sich nicht gerade aufrichten konnte. An beiden Seiten des Ganges waren über die gesamte Länge Holzgestelle mit zwei Holzböden, die als Betten dienten, aufgestellt. Das Bettzeug und die Matratzen bestanden aus Kartoffelsäcken, die mit Stroh befüllt waren. Diese Gruft war seit nunmehr zwei Jahren das Gefängnis für zweiunddreißig Gefangene. Es stank entsetzlich nach allen erdenklichen menschlichen und unmenschlichen Gerüchen.
«Danke, leiwer Gust, owwer es git schuu», sagte der ausgemergelte, für sein Alter viel zu kleine Junge mit der unter dem rechten Oberarm eintätowierten Häftlingsnummer 967934. Er kniete sich zu August Ziegler auf den Boden vor den Kanonenofen und scharrte mit einer kleinen Schaufel die Asche aus dem Rost. Über den beiden verdunkelte sich plötzlich der ohnehin schon spärliche Schein der Grubenlampe, als sich direkt neben Ziegler eine mächtige Gestalt aufbaute. Eine heisere und zugleich röhrende Stimme erdröhnte über den beiden knienden Häftlingen:
«Ziegler, du Schwachkopf, du Nichtsnutz, denkst du wirklich, du kannst mich verarschen? Die Treibstoffleitung ist schon beim ersten Test verreckt, die ganze Pumpe wär' mir beinahe um die Ohren geflogen. Weißt du was? Du bist ein wertloses Stück Scheiße, weniger wert als eine halb verhungerte Sau!» Das Totenkopf-Abzeichen an der schwarzen Uniform des SS-Obersturmführers schimmerte diabolisch im schwachen Schein der Lampe. Der Lager-Kommandant packte mit der rechten Hand den dünnen Hals des mit unbewegter Mine auf den Ofen schauenden alten Mannes und drückte ihm mit der linken Hand einen stählernen Lauf an die Schläfe. Der immer noch neben August Ziegler kniende Junge erstarrte vor Angst, der Magen dreht sich ihm um.
«Einen solch nutzlosen Unrat wie dich kann ich nicht mehr brauchen», schrie der Kommandant. Ein dumpfer Knall ertönte, dessen Nachhall wie in Zeitlupe durch den Stollen kroch und sich für immer in das Gedächtnis des Jungen einbrannte. August Ziegler fiel über die rechte Seite in den Schoß des Zwölfjährigen, Blut rann aus der Wunde an der Schläfe und tropfte auf den Boden. Er war sofort tot. Der erst zweiundzwanzig Jahre alte, in diesem Moment überlebensgroß erscheinende SS-Offizier trat einen Schritt zurück.
«Steh auf, bring ihn» – er meinte den Toten – «zum Ausgang!», raunte er leise dem Jungen zu, der immer noch den leblosen Körper von August Ziegler in seinen Armen hielt.
In diesem Moment eilte ein weiterer Mann in der grauen, verschmutzten Lagerkleidung durch den Stollen und rief am Ende des Ganges in Richtung Lager-Kommandant und jungem Häftling:
«Warum … warum hast du das getan?» Der Angesprochene entgegnete mit ruhiger, aber fester Stimme:
«Er hat versagt, er hat die Chance, die ich ihm geboten habe, nicht genutzt. Dieser Nichtsnutz hat lange genug meine Ressourcen verbraucht.»
«Er war dein Nachbar, um Himmels willen, er hat dir erst deine Fahrräder und dann dein Motorrad repariert, er war wie ein Onkel für dich!», antwortete der zweiundvierzig Jahre alte Mann, der mit seinen eingefallenen Wangen, seinen grauen Schläfen und schütteren Haaren fast genau so alt wirkte wie der soeben ermordete August Ziegler. Der Kommandant erhob seine Stimme wieder zu diesem unmenschlichen Kreischen und schrie:
«Er war Kommunist und ein Geschwür für das deutsche Volk, das früher oder später sowieso herausgeschnitten werden musste. Und dir Karl, rate ich …», die Stimme des dunkelhaarigen Mannes raunte nun wieder leise,
«… die vier restlichen Motoren nun endlich fertig zu kriegen, sonst bist du der Nächste!» Der angesprochene Häftling ließ sich nicht einschüchtern.
«Was ist nur aus dir geworden? Mein Gott, denkst du denn nicht darüber nach, was deine Mutter zu dir sagen würde? Wo ist der Junge, der noch vor nicht einmal zehn Jahren dankbar dafür war, wenn er sich um unsere Tiere kümmern durfte? Der die Milch bei uns geholt hat?», antwortete er. Der Kopf des Angesprochenen lief nun rot an und drohte schier zu explodieren. Seine schwarzen Augen traten hervor und erhielten eine blutrote Korona.
«Halt's Maul, du Sozen-Sau, halt dein dreckiges rotes Maul, und hilf deinem Sohn, deinen Kommunisten-Freund zu entsorgen!», donnerte seine Stimme durch den schmalen Stollen. Der Häftling Karl beugte sich zu der Leiche von August Ziegler herunter, schloss dessen noch offen stehende Augenlider und packte ihn unter den Armen. Leise sagte er zu seinem nun lautlos weinenden Sohn, aus dessen blauen Augen kleine Tränen die fahlen Wangen herab liefen:
«Kimm mein Boab, nimm die Bee, mir müsse 'en rausbringe» und flüsterte dann:
«Der kricht sei Stroof noch, irgendwann, das v'rsprech eich dir.» Der Zwangsarbeiter Karl und sein Sohn trugen den leblosen Körper zum Eingang des Seitenstollens. Links der Einmündung zum Schlaftrakt verlief ein Querstollen, der zu den Fabrikationsbereichen führte. Höhe und Breite des unterirdischen Labyrinths erweiterten sich hier auf drei mal fünf Meter. Drei Seitenstollen vergrößerten sich zu Werkhallen und waren jeweils zwanzig Meter lang. In diesem Bereich war das Licht elektrifiziert und die Wände und Decken waren mit Stahlbeton verstärkt. Winden und Haltekräne waren an der Decke befestigt. Die Montage der Treibstoffpumpen für die V2- Rakete, Hitlers „Wunderwaffe“, sollte effizient und so zügig erfolgen, dass pro Woche fünf Stück fertig gestellt und nach Peenemünde geliefert werden konnten. Genau dazu hatte man den Maschinenbau-Ingenieur Karl hierher gebracht. Und seinen Sohn. Karl war bis vor einigen Jahren Ortsvorsteher von Lindental und überzeugter Sozialdemokrat. Schon als die Nazis 1933 die Macht übernahmen, warnte er seine Parteigenossen:
«Doas giht koa goad Loch enaus!» Wie recht er behalten sollte, erfuhr er schon sehr bald: Bereits 1934 wurde er aus allen öffentlichen Ämtern entfernt und schon drei Jahre später verlor er, gegen den Willen der Geschäftsführung, seinen Arbeitsplatz als Betriebsleiter einer Maschinenbaufabrik im zehn Kilometer entfernten Städtchen Grünberg. Danach hielt der Familienvater sich und seinen Sohn mit dem, was sie zu Hause hatten, über Wasser: ein bisschen Landwirtschaft, ein paar Hühner, Ziegen und Schafe. Bis sie mitten in der Nacht vor zwei Jahren von der Gestapo aus ihrem kleinen Haus zunächst in das ebenfalls unterirdische KZ „Dora -Mittelbau“ in Thüringen verschleppt wurden, genauso wie den Motorenbauer August Ziegler, der aufgrund seiner politischen Überzeugung bereits Mitte der dreißiger Jahre von den Nationalsozialisten drangsaliert und 1938 verhaftet wurde. Die Mutter von Karls zwölfjährigem Sohn war da bereits zwei Jahre tot. Sie war an einer Lungenentzündung gestorben. Und nun waren sie beide seit eineinhalb Jahren wieder in ihrer Heimat. Genau gesagt unter ihrer Heimat. Nur wusste von ihrer Anwesenheit tief unter dem darüber liegenden, dicht bewachsenen Waldgebiet keiner der Bewohner des nahe gelegenen Heimatortes. Das Arbeitslager unterlag der höchsten Geheimhaltungsstufe des Reichs. Das Gebiet oberhalb des unterirdischen Labyrinths war bereits seit Jahrzehnten Truppenübungsplatz, zunächst der Reichswehr, dann der Wehrmacht. Niemand aus Lindental ahnte, dass in dem durch Stollengänge erweiterten Keller des schon vor Jahren durch Übungsgranaten zerstörten alten Bauerngehöfts Verwandte und Nachbarn eingekerkert waren. Kein regulärer Wehrmachtssoldat und erst recht kein Zivilist hatte seit mehr als acht Jahren das Areal mehr betreten dürfen. Geknechtet wurden die Zwangsarbeiter durch einen Schergen, dem noch vor sieben Jahren, vor Kriegsbeginn, als freundlichem Metzgers-Sohn und hilfsbereiten Lehrling alle Wege offen standen. Kurz danach hatte er sich für den dunkelsten aller Pfade entschieden. Nun kommandierte er seinen ehemaligen Nachbarn und dessen Sohn durch die eiskalten Gänge seines Schreckensreichs. Ein weiterer Dorfnachbar und vor nicht allzu langer Zeit väterlicher Freund lag tot in den Armen des Jungen. Keiner aus Lindental wusste, wo „Metzgersch' Rudi“ eingesetzt war, nicht einmal sein Vater. Niemand aus dem Dorf rechnete damit, dass er, direkt beauftragt und unmittelbar dem Oberkommando der SS und dem Reichsrüstungsministerium unterstellt, in unmittelbarer Nähe zu ihrem verschlafenen und so idyllisch gelegenen Ort Präzisionsbauteile für die Rakete mit der offiziellen Bezeichnung „Aggregat Typ 4“ montieren ließ. August Ziegler konnte es nicht mehr ertragen, sein eigenes Leben, dessen Schicksal ohnehin besiegelt schien, durch die Mitarbeit an der Höllenmaschine zu verlängern, die schon über 12.000 Menschen bei den Angriffen auf England, Frankreich, Belgien und Holland getötet hatte. 20.000 Zwangsarbeiter waren bereits bei der Entwicklung und Produktion des Vorläufers aller Weltraum- und Interkontinentalraketen umgekommen. Deshalb hatte er heute die Treibstoffleitungen angebohrt und damit unbrauchbar gemacht.
«Los, schneller, bis zum Ausgang! Karl, du darfst heute die Schicht des, wie soll ich sagen, unpässlichen August übernehmen. Sieh zu, dass du in zwei Minuten in Halle drei an der Drehbank stehst, und du Kroppzeug wirst heute noch sämtliche Öfen leeren. Ich werde dich lehren, was der Unterschied zwischen einem fleißigen Nationalsozialisten und einem faulen Sozialdemokraten ist», schrie der Obersturmführer hinter den beiden her. Er verschwand in Richtung der Montage-Hallen. Der Zwangsarbeiter und sein Sohn schleppten den leblosen Körper ihres Freundes aus dem Schlaftrakt nach rechts in den Hauptstollen, der zum Eingang des Arbeitslagers führte. Den Eingang, den kein Häftling mehr lebend seit eineinhalb Jahren in die auswärts weisende Richtung verlassen hatte. Nach rund dreißig Metern, sie mussten immer wieder absetzen, weil Karls Sohn zwischenzeitlich die Kräfte verließen, erreichten sie die Querstollen mit den Aufenthaltsbereichen des Wachpersonals. Das Licht war hier so hell, dass es den beiden Zwangsarbeitern in den Augen brannte. Wände und Decken waren weiß verputzt. Es war geradezu klinisch sauber in diesem Abschnitt. Ein Aufseher, vielleicht noch keine zwanzig Jahre alt und ebenfalls in schwarzer Uniform mit dem Totenkopf an der Mütze, erwartete sie bereits mit geschultertem Gewehr. Die beiden unfreiwilligen Totenträger setzten kurz ab. Die so furchteinflößende Uniform konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der junge, blonde und hochgewachsene Soldat vom Anblick des toten Häftlings erschreckt war. Er versuchte, seine Unsicherheit zu überspielen, in dem er so fest er nur konnte rief:
«Los, bringt ihn hoch!»
Während Karl und sein Sohn kurz Kraft sammelten, um dann den Leichnam wieder aufzunehmen, hörten sie ein leises Brummen, das allmählich lauter wurde und beständig aber unaufhaltsam das gesamte Bunkersystem füllte. Der junge Soldat schaute unbewusst zur Decke. Das immer mächtiger werdende Geräusch kam nicht aus den Stollen des Arbeitslagers, es kam von oben! SS-Schütze Max Heinrich wurde unruhig, feine Schweißperlen traten ihm in Sekundenschnelle auf die Stirn.
«Los, hochbringen, schnell», befahl er. Häftling Karl und sein Sohn nahmen den Leichnam wieder auf und gingen den Gang weiter, der ab jetzt in einer aufwärts gerichteten Schräge verlief. Der Wachsoldat folgte den beiden und nahm sein Gewehr von der Schulter, um es vor sich mit beiden Hände zu greifen. Er sah auf seine Armbanduhr. Sie zeigte 20.32 Uhr.
Rund zwanzig Kilometer entfernt von dem unterirdischen und der strengsten Geheimhaltung unterliegenden Arbeitslager hatten die Staffeln der „5th Bomber Group“ der Royal Air Force mit über zweihundertvierzig Lancaster-Bombern soeben das Zentrum Oberhessens, die Universitätsstadt Gießen, in Schutt und Asche gelegt. Die Stadtkirche, die historischen Fachwerkhäuser am „Seltersweg“ und rund um den Marktplatz sowie weitere neunzig Prozent der Innenstadt hatten aufgehört zu existieren. Die zweite Angriffswelle hatte sich ihrer tödlichen Fracht aus Brand- und Sprengbomben gerade erst entledigt und sich danach sofort gen Nordosten auf den Rückflug nach England gemacht.
Als der junge SS-Schütze Heinrich und die beiden Häftlinge den Bunkereingang, der von außen perfekt mit Grassoden und Efeu getarnt und so nicht erkennbar war, nach weiteren dreißig Metern erreichten, wurde das Brummen ohrenbetäubend. Soldat Heinrich wühlte mit nervösen Fingern in seiner Hosentasche, um den Schlüssel für das Tor hervorzukramen. Er ging an den beiden Häftlingen vorbei und drehte den Schlüssel im Schloss um.
«So, Tor auf! Karl, du bleibst hier, der Junge bringt den alleine raus. Und du Hosenschisser machst keine Mätzchen, sonst liegst du gleich neben dem da!» befahl er mit mittlerweile maximaler Lautstärke, um sich gegen das Dröhnen durchzusetzen. Der Junge mit der Häftlings-Nummer 967934 ließ die Beine des August Ziegler los und ging langsam zu seinem Vater hinüber, der immer noch den Toten unter den Armen hielt. Karl übergab den Leichnam bewusst umständlich seinem Sohn, um ihm, als beide Kopf an Kopf aneinander waren, so leise wie möglich ins Ohr zu flüstern:
«Wenn dou drauße bist, lääfste luus, ich lenk'n ab. Bleib nejt stieh!» Sein Sohn nickte für den Wärter unmerklich, sah seinem Vater noch einmal in die himmelblauen Augen, die er von ihm geerbt hatte, und hob die Leiche unter den Armen an. Sein Vater öffnete das schwere Tor. Das Brummen wurde nun ohrenbetäubend. In der einem Wasserfall gleich hereinströmenden Frischluft lag Brandgeruch. Genau in diesem Moment erklang ein immer lauter werdender hochfrequenter Ton, der in einem brachialen Knall endete. Dem Jungen platzte sofort das rechte Trommelfell. In einem Bruchteil einer Sekunde wurde er durch eine gewaltige Druckwelle gegen die seitliche Erdwand des Stolleneingangs geschleudert. Hinter ihm wurden sein Vater und Max Heinrich rücklings von den Beinen gerissen. Doch hinter den beiden im Tunnelgang Verbliebenen stürmte eine andere Gestalt die schräge Ebene hoch: der Lagerkommandant. Heinrich schrie ihm, noch nicht wieder auf den Beinen, entgegen:
«Herr Obersturmführer, wir werden bombardiert! Wir müssen evakuieren.» Das Entsetzen stand dem jungen Soldaten ins Gesicht geschrieben. Doch sein Vorgesetzter brüllte ihn, noch gute acht Meter entfernt, an:
«Einen Dreck muss ich!» Just zu diesem Zeitpunkt schmiss sich Häftling Karl auf den immer noch halb liegenden jungen Max Heinrich und griff nach dessen Gewehr.
«Laaf, mein Boab, laaf!», schrie er zeitgleich in Richtung Ausgang. Der Junge vernahm die Stimme aufgrund des immer stärker werdenden Dröhnens der Lancaster-Bomber und seinem zerfetzten rechten Trommelfell zwar nur wie aus einer anderen Sphäre, aber er verstand. Er stand auf und lief los. Nach fünf Metern schaute er zurück zum Eingang und sah zu seinem Entsetzen den Lager-Kommandanten mit Vornamen Rudolf auf seinen Vater und den jungen Max Heinrich mit gezogener Pistole zustürzen. Er rannte weiter und hörte verschwommen den jungen SS-Schützen und seinen Vater etwas rufen. Dann vernahm er drei Schüsse, Schreie, gefolgt durch einen weiteren, jedoch tausendfach lauteren Knall, genau über dem Eingangsbereich des Lagers, den er mittlerweile um rund achtzig Meter hinter sich gelassen hatte. Der Waldboden erbebte, brach über dem unterirdischen Stollensystem ein und senkte sich drei Meter tiefer über die eingestürzten Gänge und Hallen. Die Einschläge der britischen 250-Kilobomben ließen Erdbrocken durch die Luft fliegen und kurz hinter dem Jungen herabregnen. Mehrmals strauchelte er, fiel kurz hin, fing sich jedoch schnell wieder und rannte weiter. Nur für einen kurzen Moment glaubte er, bei einem weiteren flüchtigen Blick zurück eine große, schemenhafte Gestalt mitten durch den dichten Qualm und Rauch huschen zu sehen. Die Lancaster 239-Besatzung des „463. Squadron“ hatte gerade die restlichen vier Sprengbomben ausgeklinkt, um Gewicht loszuwerden und den benötigten Treibstoff für den Rückflug nach England zu sparen. Zufällig eben genau über einem Ort, der ein wichtiges Angriffsziel der Alliierten gewesen wäre, wäre er enttarnt worden.
Der Junge erfüllte seines Vaters letzten Wunsch und rannte weiter. Und weiter. Und er blieb während der gesamten folgenden Nacht, die mittlerweile von der zwanzig Kilometer entfernten Feuerwand über Gießen glutrot erleuchtet wurde, nicht mehr stehen.
1. Kapitel
70 Jahre später
Es war ein herrlicher Juni-Morgen. Die Sonne hatte noch nicht alle Winkel des engen Tals mit ihren sanften ersten Strahlen des Tages berührt, als die Greenkeeper bereits die Grüns nach der allmorgendlichen Platz-Pflege verlassen hatten. Der Chef der Landschaftspfleger, Head-Greenkeeper Morton Woodcroft, hatte gerade erst seinen Rundgang beendet, um das in seinen Augen unterdurchschnittliche Ergebnis zu begutachten, das seine Mitarbeiter nach dem Mähen und Walzen der Grüns erzielt hatten. Auch wenn Woodcroft nicht zufrieden gestellt werden konnte – das konnte er fast nie – genoss auch er diesen ruhigen Sommer-Morgen. Am achtzehnten und damit letzten Grün angekommen, betrachtete er zuerst die Schnittkanten zwischen Grün, Vorgrün und First Cut und blickte dann über die gesamte Anlage: Direkt vor dem Clubhaus des Golf- und Countryclubs Lindental lagen die erste und die letzte Spielbahn direkt vor ihm. Beide Fairways schmiegten sich, in jeweils entgegengesetzter Spielrichtung, um einen See, dessen Wasser durch eine Fontäne in der Mitte schon so früh am Morgen fröhlich in Bewegung gehalten wurde. Das achtzehnte Grün wurde vom rechten, vorderen Ufer des Teichs begrenzt. Der mit zwei gelben, Handballgroßen Markierungen versehene Herren-Abschlag des ersten Lochs wartete von hier aus vierzig Meter weiter links auf auf seine nächsten Gäste. Die weiteren Spielbahnen folgten dem ersten Grün zunächst wieder in entgegengesetzter Spielrichtung und auf eher ebenem Gelände links des zentralen Sees. Danach schmiegten sich die Spielbahnen an die Hänge der westlichen Talseite. Ab der siebten Spielbahn kreuzten die Fairways wieder die Mitte des Tals hinter dem großen Teich. Wie bei einem klassischen Golfplatz üblich, endete das neunte Grün vor der dem Clubhaus. Die zweite Hälfte des Platzes mit den Spielbahnen Zehn bis Achtzehn wiederholte diesen Verlauf durch das Tal, in dem sie mal vor, mal hinter den davor liegenden Fairways und Grüns mäanderten. Die schon fleißig zwitschernden Spatzen nahmen dieses abwechselnd hellund dunkelgrüne Fleckchen Erde als Kessel wahr, der fast gänzlich von Wäldern und Wiesen umkränzt wurde. Vor zwanzig Millionen Jahren hatten die Lavaströme des Vogelsberg-Vulkans diese heute so liebliche Landschaft aus Feuer und Basalt geboren. Nur die südliche Seite des Tals war durch eine kleine Stichstraße bis zum Innenhof des Golf- und Countryclubs befahrbar, dessen Stirnseite durch das Clubhaus, das Herrenhaus eines über dreihundert Jahre hier befindlichen Gestüts, gekrönt wurde.
Morton Woodcroft legte seinen Stimpmeter, ein rund ein Meter langes Gerät, das wie die Hälfte einer längs aufgeschnittenen Röhre aussah, mit dem einen Ende auf das Grün, hielt das andere Ende in seiner rechten Hand und legte mit der linken einen Golfball an den oberen Rand. Der Golfball rollte die Vorrichtung hinab auf die fünf Millimeter kurz gemähte Fläche und kam auf dem Grün nach rund drei Metern zum Stehen. Woodcroft maß die Entfernung von Ball zu Stimpmeter und murmelte in seinen rötlich schimmernden Vollbart hinein:
«Just ten, bullshit!» Der Head-Greenkeeper nahm in einer blitzartigen Geschwindigkeit, die man seinem kleinen, leicht rundlichen und sechsundfünfzig Lenze alten Körper gar nicht zugetraut hätte, Golfball und die Vorrichtung zur Messung der Grüngeschwindigkeit auf. Er zog aus seiner grünen Latzhose sein fünfzehn Jahre altes Siemens C30 Handy. Ein paar Tastendrucke später raunte er in unverwechselbarem Südstaaten-Slang in sein Telefon:
«Hey Bill, are you kidding? I wanted eleven, and what i've got? A bloody damn'd slow acre with just teen feet! You now swing your fucking ass around and fix it!» Bill raste vom anderen Ende des Golfplatzes mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit seines Sitz-Mähers zu seinem Boss, um sich den Rest des Anpfiffs in kompletter Länge und Deutlichkeit abzuholen (er verstand sofort, trotz des manchmal schwer verständlichen Louisiana-Singsangs seines Chefs, dass die Grüngeschwindigkeit nicht wie von Woodcroft gewünscht elf, sondern nur zehn Fuß betragen hatte und er um umgehende Nachbesserung ersucht wurde). Doch als er am achtzehnten Grün ankam, war sein Boss bereits wieder verschwunden.
Während dessen ertönte Bernd Grüners Handy. Es erklang die Melodie von Elvis Presleys „a little less conversation“.
Grüner griff in die linke Seite seiner über zwanzig Jahre alten dunkelbraunen ledernen Golftasche, fingerte das Mobiltelefon heraus und nahm ab.
«Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Herr Grüner. Sind Sie im Büro?» erklang eine weiche, etwas nasale Stimme. Der Angerufene schaute mit seinen dunkelbraunen Augen halb auf das vor ihm liegende Fairway, halb in den strahlend blauen Himmel und antwortete etwas unsicher:
«Äh, Morgen, äh, nein, ich bin auf dem Platz.» Der Anrufer fasste nach:
«Wo genau befinden Sie sich?» Grüner nannte seine genaue Position auf dem Golfplatz.
«Ich wollte nur schnell neun Löcher gehen», ergänzte er. Der Gesprächsteilnehmer mit der sonoren Stimme antwortete:
«Ah ja, schön. Ich rufe an, um Sie zu bitten, um zwölf Uhr im Restaurant zu sein. Es gäbe noch einiges zu besprechen. Könnten Sie sich das einrichten?» Grüner zog seine schwarzen Augenbrauen unter seinen ebenso dunklen Locken zusammen.
«Ja, natürlich, das geht. Ich bin dann da.»
«Hervorragend. Und nun wünsche ich Ihnen noch ein schönes Spiel!» Der Gesprächspartner legte auf. Grüners unrasiertes Gesicht verfinsterte sich und legte seine Stirn in Falten. Der Dreiundfünfzigjährige steckte sein Telefon wieder zurück in die Seitentasche, nahm einen mit einer „8“ bezifferten Eisenschläger aus der Tasche und sein Ziel ins Visier.
Joachim Hartmann verstaute sein Smartphone mit dem Logo in Form eines angebissenen Apfels auf der Rückseite zurück in der speziell hierfür vorgesehenen Seitentasche seiner Golftasche. Diese war auf einem eleganten, aus Karbon gefertigten und Akku betriebenen Ultraleichtgestell befestigt. So ein Trolley der Marke „Luxury-Electro-Cad“ war nicht unter tausend Euro zu bekommen. Die Golftasche schmiegte sich in Form und Größe perfekt in seinen fahrbaren Untersatz ein und korrespondierte hervorragend in ihrer grün-weißen Farbgebung mit Hartmanns Outfit. Er trug eine weiße Stoffhose, hellbraune Golfschuhe eines italienischen EdelDesigners aus feinsten Leder und einen dunkelgrünen Kaschmir-Pullunder. Hartmann wandte sich mit seiner großen, schlanken Gestalt seinem Mitspieler zu. Dieser hatte den bisherigen Diskretionsabstand zu Hartmann nun wieder aufgelöst, nachdem Hartmann sein Telefonat beendet hatte.
«Ich finde es sehr nett Joachim, dass Sie die Runde mit mir trotzdem zu Ende spielen, das ist nicht selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, wie viel Sie heute noch zu tun haben.» Der Mitspieler mit dem deutlichen Bauchansatz keuchte etwas, nachdem er den erhöhten Abschlags-Bereich der fünfzehnten Spielbahn neben Hartmann erreicht hatte. Auch wenn die Temperatur an diesem Morgen mit rund achtzehn Grad noch angenehm kühl war, hatten sich auf dem hellblauen Poloshirt des nur einen Meter fünfundsechzig kleinen Flightpartners von Hartmann Schweißstreifen gebildet.
«Doch, doch, mein lieber Theodor, das ist selbstverständlich, ich habe noch nie eine Golfrunde vorzeitig beendet, das verstieße ja gegen jede Etikette.» Hartmann schaute Theodor Müller dabei freundlich aus seinen etwas eng aneinander stehenden dunkelbraunen Augen an.
«Was wäre das für ein Frevel, diesen perfekten Morgen nicht mit einer perfekten Runde unseres schönen Spiels zu ehren. Außerdem sind Sie ja gerade so hervorragend in Fahrt, da möchte ich schon sehen, wie viele Birdies Sie noch reinbringen!» Der Angesprochene fühlte sich geschmeichelt. Ein Birdie hatte er an diesem Morgen auf den bisherigen vierzehn Löchern noch nicht geschafft, aber er war doch recht zufrieden mit seiner spielerischen Leistung, zumal er noch nie zuvor in Lindental gespielt hatte: Bis hierhin hatte Müller für kein Loch mehr als neun Schläge gebraucht, gleich auf der zweiten Bahn, einem Par 3, gelang es ihm, mit nur drei Schlägen das Grün zu treffen und dann mit lediglich zwei Putts einzulochen. Für einen Spieler mit Handicap -42 war das eine ordentliche Vorstellung.
Mittlerweile hatte auch der dritte Spieler der Gruppe aufgeschlossen: Thomas Ranft, ein drahtiger, 25-jähriger junger Mann mit blondem, kurz geschnittenem Stacho. In seiner knallroten Chino-Hose und dem sonnengelben Polohemd hatte er gerade noch den Bunker am zuletzt gespielten Grün gerecht, nachdem sein Mitspieler Theodor Müller dort gerade zwei eimergroße Krater in den weißen Sand geschlagen hatte.
«Sie haben die Ehre, Chef», sagte er mit ausdruckslosem Blick zu Hartmann. Dieser nahm dies als Impuls, den Schläger mit dem größten schwarz lackierten Metallkopf aus seinem Bag zu ziehen, die gestrickte weiß-grüne Schlägerhaube mit ebenso grün-weißer Bommel mit einer eleganten Bewegung vom Schlägerkopf zu entfernen und den Abschlag zu betreten. Hartmann strich sich durch seine mit silbernen Strähnen durchsetzten schwarzen Haare, zog dann ein hölzernes Tee aus seiner Hosentasche und steckte es vor den gelben Abschlagsbegrenzungen in den Boden. Danach nahm er einen Golfball aus der Hosentasche und legte ihn auf das Holzstäbchen. Hartmann sah zu Müller herüber, der am Rand des Tees darauf wartete, dass er abschlug.
«Theodor, ein kleiner Hinweis, da der Verlauf der Spielbahn von hier aus nicht gut einsehbar ist: Bei diesem Loch sollte man sich eher links halten. Auf der rechten Seite des Fairways verläuft ein Bach, in dem ich schon unzählige Bälle versenkt habe, und ich habe noch nie auch nur einen wieder gefunden. Diese Spielbahn geht wirklich ins Geld!», sagte er. Der Angesprochene nickte nur leicht mit verschränkten Armen und kratzte sich mit angestrengter Miene in seinem dunkelblonden Lockenschopf. Hartmann schwang seinen Driver in einer kompakten Bewegung kurz nach hinten und wieder nach vorn, um einen Probeschwung durchzuführen und stellte sich dann noch ein paar Zentimeter näher an den Golfball heran. Er schaute noch einmal kurz von sich aus nach rechts in die Richtung, in die er den Ball schlagen wollte und führte dann den vollen Golfschwung aus. Sein Schläger traf auf den Golfball mit einem krachenden, metallischen Geräusch und schwang über der rechten Schulter Hartmanns aus. Er war noch nicht in einer normalen Standposition zurückgekehrt, da hob er schon seinen linken Arm in Verkehrspolizisten-Manier.
«Fore Links!!!"», schrie er so laut, dass seine beiden Mitspieler zusammenzuckten.
«Tja, wenn man schon „Fore“ ruft, sollte man es schon so deutlich tun, dass man auch gehört wird», ergänzte er mit einem Lächeln seinen Urschrei in Richtung von Müller und Ranft. Hartmann schaute beim Verlassen des Abschlag-Bereichs nicht eine Sekunde auf die Senke links von der Spielbahn, dem Ort, in dem sein Golfball nach einer ästhetisch wunderbar anzusehenden, aber sehr ausgeprägten Linkskurve liegen musste.
«Sie sind dran, lieber Theodor, den finden wir schon», forderte er seinen Mitspieler auf, als Nächster abzuschlagen. Müller überlegte kurz: Er hatte auf dem vorherigen Loch mit fünf Schlägen ein für ihn überdurchschnittlich gutes Bogey geschlagen. Dabei hatte er mit dem Abschlag das Fairway mittig getroffen und mit dem zweiten Schlag seinen Ball in den Grünbunker gejagt. Obwohl er zwei Schläge benötigte, um die Sandfläche wieder zu verlassen, schaffte er es mit nur einem Putt ins Loch. Das Adrenalin dieses Erfolges ließ ihn immer noch auf Wolke Sieben schweben.
Der Dritte im Bunde, Thomas Ranft, der Hartmann nur mit „Chef“ oder „Boss“ ansprach, hatte mit einem Doppelbogey einen Schlagversuch mehr benötigt als Müller. Hartmann hatte ein Par gespielt. Somit hatte Joachim „die Ehre“, als Erster abzuschlagen und nun war Theodor Müller selbst an der Reihe. Allerdings hatte er nun ein trickreiches Par fünf vor sich: Das gesamte Gelände vor ihnen fiel von rechts nach links schräg in Richtung des Tals ab. Zusätzlich war das Fairway so angelegt, dass man einen „blinden Schlag“ vor sich hatte. Dort, wo der Golfball nach einem durchschnittlichen Abschlag zu liegen kam, ragte eine Kuppe wie ein riesiger Elefantenrücken aus dem Fairway. Dadurch war die linke Seite der Spielbahn vom Tee aus nicht einsehbar. Zu allem Überfluss war die rechte Seite der Spielbahn durch einen Bach begrenzt, vor dem Joachim Hartmann gerade noch seine Mitspieler gewarnt hatte. Müller scheute ein Wasserhindernis so sehr wie der Teufel das Weihwasser und dachte daher: lieber ins Unbekannte hinein als in den blöden Graben rechts – und Hartmann hatte Recht: Bälle waren teuer.
Als Müller sich für den Abschlag bereitgemacht, seinen Ball aufgeteet und sich davor gestellt hatte, zielte er deutlich links der Fairway-Mitte. Er führte seine gewohnten zwei Probeschwünge aus und schlug dann den Ball. Zunächst blickte er durchaus zufrieden dem Ball hinterher, bevor auch er so laut er konnte mit seiner ansonsten eher leisen Stimme «Fore!» rief. Sein Ball war soeben in kerzengerader Linie nach links in derselben Senke verschwunden, in der auch der Ball von Joachim zu vermuten war.
«Der macht nichts kaputt, Theodor. Da liegen wir beide nah beieinander. Thomas, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich schon mal mit Theodor vorgehen, um nach den Bällen zu suchen, dann sparen wir etwas Zeit. Du weißt ja, ich bin etwas spät dran mit meinem ersten Termin heute. Du wirst sicher nicht auch noch nach links schlagen wollen», wandte sich Joachim Hartmann an Thomas Ranft. Dieser war einverstanden.
«Klar, geht ruhig schon mal. Ich warte dann, bis ihr vorne angekommen seid.» Ranft hatte während der letzten Löcher auch schon mehrmals auf seine Armbanduhr geschaut und sich insgeheim über das sehr langsame Spieltempo von Müller geärgert. Nicht nur, dass dieser Theodor vor jedem Abschlag gleich zwei Probeschwünge machte. Auch auf den Grüns verbrachte Müller schier Ewigkeiten, Grüngeschwindigkeit und die richtige Puttlinie zu „lesen“. Viel eingebracht hatte es ihm in den Augen von Ranft auch nicht: Meistens brauchte er drei oder mehr Putts, bis der Ball endlich ins Loch fiel. Zwar hatte auch Ranft erst ein Handicap von -36, aber er hatte auch erst vor einem Jahr, nachdem sein Chef Joachim Hartmann ihm einen Schnupperkurs geschenkt hatte, mit dem Golfen angefangen. Auf den Grüns war er schon richtig gut unterwegs. Pro Loch benötigte er selten mehr als zwei und immer öfter nur einen Putt, auch aus einigen Metern Entfernung. Demgegenüber war dieser langweilige und eher unsportlich wirkende Theodor für Ranft eine Schnecke. Dennoch wollte er jetzt keinem die Stimmung an diesem sonnigen Morgen verderben und blieb ruhig. Gegen eine Beschleunigung des Spiels hatte er aber auch nichts einzuwenden.
Bevor sich Joachim Hartmann mit Müller auf den Weg zu den rund einhundertfünfzig Meter entfernten Bällen machte, ging er nah an Thomas Ranft vorbei und flüsterte ihm noch etwas zu. Ranft war klar, dass Joachim Hartmann um die größte Schwäche in seinem Golfspiel wusste: So gut er auf den Grüns auch war, so schlecht war er beim Abschlag. Auf den letzten fünf Löchern hatte er das Fairway nicht ein einziges Mal getroffen. Jedes Mal flog der Ball links ins Rough oder ins Aus, so wie bei der letzten Spielbahn. Das Resultat hieraus waren zwei Strafschläge und das gegenüber Theodor Müller verlorene Loch. Dass Hartmann das Loch eigentlich gewonnen hatte, stand außer Frage. Aber das gegenüber „Schnecke“ Theodor schlechtere Ergebnis wurmte Thomas Ranft sehr viel mehr. Hartmann und Müller waren mittlerweile kurz vor der Kuppe auf dem Fairway angekommen. Joachim hob rund einhundertvierzig Meter weiter vorne den Arm, um Thomas Ranft zu bedeuten, dass sie bald in der Senke verschwunden wären und er gleich abschlagen konnte. Sogleich waren nur noch der schwarze, gegelte Schopf von Hartmann und der Lockenkopf Müllers zu sehen und einen Augenblick später gar nicht mehr.
Thomas Ranft stand auf dem Abschlags-Bereich und wartete sicherheitshalber noch eine Minute. Er sah oben rechts am Waldrand eine Schafherde friedlich auf einer Wiese grasen. Weit vorne links unten im Tal schien das Clubhaus noch gar nicht richtig wach, es schien, als würde der weiß getünchte Fachwerk/Backsteinbau sich noch einmal in seinem gemütlichen grünen Bett umdrehen. Auch wenn ihm der sportliche Wettkampf-Aspekt beim Golf sehr viel wichtiger war, als permanent verträumt durch die Landschaft zu laufen, diesen wunderschönen und majestätischen Anblick genoss auch er. Dann überlegte er wieder: Wenn er sich etwas mehr nach rechts ausrichten würde, hätte er mit der linken Seite der Spielbahn gar nichts mehr am Hut. Zudem sagte er leise vor sich hin, als er sich bereits hinter dem Ball aufgebaut hatte:
«Nicht nach links … nicht nach links … nicht nach links … okay … genau …» Thomas Ranft griff den Driver etwas fester als sonst, stellte sich, wie er es sich vorgenommen hatte, etwas stärker nach rechts blickend auf und bewegte den Schläger zur Probe nur kurz einmal nach hinten und wieder nach vorne. Kurz bevor er zum Schlag ausholen wollte, hörte er ein Geräusch wie das Bellen eines Hunds in der Ferne. Blöder Köter, dachte er für einen kurzen Moment. Er setzte ab, trat noch einmal einen Schritt zurück und wiederholte seinen Probeschwung. Angestrengt und viel zu fest presste er den Schlägergriff in seine Hände, holte aus und schlug ab. Der Golfball startete diesmal in der idealen Richtung etwas rechts von der Mitte des Fairways. Allerdings begann der Ball nach der Hälfte der gewöhnlichen Flugdauer eine abrupt beginnende Flugkurve nach links anzunehmen, die mit zunehmender Flugdauer umso stärker wurde und dazu führte, dass Ranft seinen Ball links hinter der Kuppe aus den Augen verlor. Er schickte der ungewollten Flugbahn seines Balles ein geschrienes «Fore links» hinterher, so laut, dass die weit oben rechts entfernte Schafherde für kurze Zeit ihre blökende Konversation unterbrach. Thomas Ranft horchte noch ein paar Sekunden in die milde morgendliche Brise vor ihm hinein, dann steckte er den Driver zurück in seine Golf-Tragetasche, nahm sie mittels der Schultertragegurte auf den Rücken und marschierte Richtung linkem Fairwayrand rund einhundertfünfzig Meter vor ihm los. Als er auf der Kuppe in der Mitte des Fairways angekommen war und von hier in die Senke blicken konnte, blieb Thomas Ranft für Sekunden die Luft weg, als hätte eine Lokomotive seinen Brustkorb gerammt: fünfzehn Meter vor ihm lag Theodor Müller leblos auf dem Bauch liegend im hohen Rough links des Fairways. Über ihm kniete Joachim Hartmann und blickte nun zu Ranft hinüber:
«Ich fürchte Thomas, das war ein Volltreffer.»
2. Kapitel
«Hallo Martin McFly, jemand Zuhause?! Hey, dein Handy brummt! Entweder du machst's aus oder der Fischer stopft's dir gleich in dein Buhl!» Jemand stupste Martin Benedikt Cervinus mit dem Ellenbogen in die Seite und flüsterte nun schon eine gefühlte Ewigkeit auf ihn ein. Er hatte Schwierigkeiten, aus den Tiefen seines Tagtraumes in die Niederungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Gießener Schiffenberger Tal zurückzufinden. Eben noch war er in den blauen Augen von Bernadette, nur durch die Gläser ihrer Nerd-Brille von ihm getrennt, versunken. Und nun saß er wieder in der letzten Reihe des Konferenzraums und sah in die buschigen Augenbrauen und auf den grauen, breiten Vollbart des Kriminaloberrats Fischer. Der unterbrach seinen Vortrag über die anstehenden Budget-Kürzungen, um Cervinus und den neben ihm sitzenden Kollegen Tom Keller mit einem Blick zu bedenken, der einem Schuss aus seiner Dienstwaffe gleichkam. Keller versuchte nun genauso teilnahmslos und ungerührt nach vorne zu blicken wie Cervinus. Fischer fuhr fort:
«Diese Zersplitterung der Ermittlungseinheiten muss aufhören … die Prozesse sind zu verschlanken … die Schnittstellen besser definieren …»
Cervinus traute sich nun nicht mehr, auf sein Mobiltelefon zu sehen. Er war überzeugt, dass Bernadette ihn gerade mit Kurz-Nachrichten zuschüttete, wie geil es doch heute Nacht war, dass sie den Wahnsinn des vergangenen Abends unbedingt gleich heute wiederholen müssten und wie sehr sie sich auf ihn freue. Und er hatte keinerlei Lust darauf, dass Tom Keller, dieser dreißigjährige Kriminaloberkommissar aus der Mordkommission, auch nur ein Wort davon mitbekommen würde, denn sonst konnte er Bernadettes SMS gleich ins Präsidiums-interne Intranet setzen.