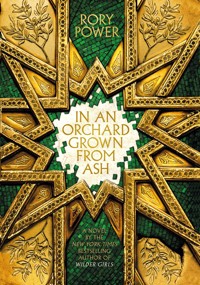9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schon immer war Margot mit ihrer Mutter allein. Kein Vater, keine Geschwister, keine Verwandten – und ihre Mutter verweigert jede Auskunft über sie. Als ein altes Foto Hinweise auf ihre Großmutter liefert, bricht Margot in den verschlafenen Ort Phalene auf. Hier scheint es zunächst nicht viel zu geben außer Sommerhitze, Staub und Maisfelder, doch dann passiert etwas Schreckliches: Eines der Felder geht lichterloh in Flammen auf. Mittendrin ein Mädchen, das Margot zum Verwechseln ähnlich sieht. Margots Mutter hatte offenbar gute Gründe, aus der Stadt zu verschwinden. Aber wollte sie ihre Vergangenheit verbergen? Oder wollte sie Margot vor dem schützen, was immer noch dort lauert? »›Burn Our Bodies Down‹ ist ein Meisterwerk … eine unfassbar nervenaufreibende Mystery-Geschichte, die sich heimlich, wie durch die labyrinthartigen Maisfelder im Roman, an einen heranschleicht.« – Holly Jackson, Autorin von »A Good Girl's Guide to Murder«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Burn Our Bodies Down« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Bottlinger
Copyright © Rory Power 2020
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Burn Our Bodies Down«, Delacorte Press, New York 2020
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Elena Masci
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Inhaltswarnung
Zitat
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Danksagung
Inhaltswarnung
(Achtung, Spoiler!)
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Burn Our Bodies Down enthält Themen, die triggern können. Deshalb findet ihr am Ende dieses Buches eine Inhaltswarnung[1].
Achtung: Diese beinhaltet Spoiler für die gesamte Geschichte. Wir wünschen euch allen ein bestmögliches Leseerlebnis.
I was so proud not to feel my heart.
Waking means being angry.
– Eliza Griswold, »Ruins«
Eins
Das Aufschnappen und Ratschen des Feuerzeugs, eine Flamme erwacht zwischen meinen Fingern. Es ist zu warm dafür, jetzt im späten Juni, die Sonne nah und wachsam. Trotzdem bin ich hier. Die Flamme flackert, stark und schwach, stark und schwach.
Die Kerze, die ich heute Morgen angezündet habe, steht auf dem Couchtisch. Sie duftet nach Nelken und Kiefernnadeln. Mom hat sie letztes Jahr von der Arbeit gestohlen und wir haben sie aufgehoben, haben alles andere angezündet, was wir sonst finden konnten. Eine Schale Teelichter – hell und klar –, eine Gebetskerze, die sie aus der Kirche hat mitgehen lassen. Aber unsere Vorräte gehen zur Neige, und dieser Weihnachtskram war das Einzige, was ich noch in der Kiste unter Moms Bett gefunden habe. Zu süß, zu stark. Aber die Regeln sind wichtiger. Sie sind immer wichtiger.
Lass ein Feuer brennen, das Feuer wird dich retten. Der Anfang, das Ende, der Mittelpunkt von allem. Das hat sie mir beigebracht, kaum dass ich alt genug war, ein Feuerzeug zu halten. Flüsterte es mir in der Dunkelheit zu. Drückte es mir an die Stirn anstelle eines Kusses. Früher habe ich sie nach dem Grund gefragt, denn für mich ergab das sogar weniger als gar keinen Sinn. Aber wenn man Jo Nielsens Tochter ist, lernt man schnell: Man bekommt entweder Antworten oder man bekommt sie, nicht beides. Also sollte man sich lieber gründlich überlegen, welches davon es sein soll.
Ich habe sie gewählt. Dennoch sehe ich an den meisten Tagen nicht viel von ihr.
Mit einer Hand prüfe ich den Luftzug, der durch das Fenster kommt, an dem ich sitze. Er ist kaum vorhanden, aber ich will sichergehen, dass die Kerze nicht erlischt. Sie tut so, als wäre ihr das inzwischen egal, sagt, dass das Wichtige das Licht sei – und das ist es, das ist es wirklich. Jeden Morgen sieht sie mir dabei zu mit diesem Ausdruck im Gesicht, den ich nie verstehen werde. Dennoch. Ich erinnere mich an den Streit, den wir hatten, als sie das erste Mal heimkam und der Docht schwarz und dunkel war. Das wird nicht noch mal vorkommen, wenn ich es verhindern kann. Vor allem nicht an diesen Tagen, an denen Mom launisch ist und angespannt wie eine Falle, die gleich zuschnappt.
Ich stehe von der Fensterbank auf und gleite zu Boden, neige den Kopf, damit er im Schatten liegt. Die Dielen kleben an meinen Schenkeln und ich schmecke Salz auf der Zunge. Über mir kann ich sehen, wie sich der Rauch sammelt, blau vor der rissigen Decke. Kein Grund zur Sorge. Die Rauchmelder wurden vor Ewigkeiten unbrauchbar gemacht. Mom hat sie selbst heruntergerissen, hat die Feuerwehr dafür bezahlt, damit sie nicht mehr vorbeikommen. Im selben Monat haben sie uns den Strom abgestellt, aber das war es wert. Für sie zumindest. Ich, ich ging zur Schule, kam nach Hause und machte meine Hausaufgaben mit einer Taschenlampe zwischen den Zähnen. Richtete mir in dem Chaos im Kopf meiner Mutter ein Leben ein, wie ich es immer tat.
Ich glaube, ich würde alles geben, um zu erfahren, was passiert ist, dass sie so geworden ist. Solange es nicht auch mir droht.
Die Sonne ist gesunken und der Raum ist dämmrig, als ich den Kombi draußen vorfahren höre. Mom kommt von ihrer Schicht im Beerdigungsinstitut zurück. Sie arbeitet am Empfang, nimmt all die Anrufe entgegen, sagt Leuten Bescheid, wenn der Sarg, den sie bestellt haben, zu kurz ist, und hilft ihnen dabei, genug Whiskey für die Beerdigung zu bestellen.
Schritte auf der Treppe, aber ich stehe nicht auf. Mein gesamter Körper ist träge und schwer, die feuchtwarme Luft drückt mich nieder. Mom kann die Einkäufe selbst tragen.
Als sie eintritt, sieht sie fertig aus. Ihre Frisur hat sich gelöst, Strähnen kleben an ihren Lippen, am Kragen ihres Hemdes ist ein Kaffeefleck. Wir sehen uns so ähnlich, dass die Menschen uns immer als Schwestern ansprechen, aber nicht auf eine schmeichelhafte Art. Wir haben denselben ernsten Mund, dieselben grauen Strähnen an unseren Schläfen. Meine sind früh gekommen, so früh, dass ich mich nicht mehr erinnere, wie ich ohne sie ausgesehen habe.
Manchmal erwische ich Mom dabei, wie sie mich anstarrt. Manchmal sehe ich, wie sie kurz davor ist zu weinen. Früher habe ich gedacht, dass ich sie vielleicht an meinen Vater erinnere – den Mann, über den sie nie redet, der mir irgendetwas mitgegeben haben muss. Aber dann habe ich aufgehört, darüber nachzudenken. Mich stattdessen gefragt, woher Mom überhaupt kam. Wer ihr das Gesicht verliehen hat, das so sehr wie meines aussieht.
»Hey«, sagt sie und sieht mich über die Einkaufstüte hinweg aus zusammengekniffenen Augen an. Im Winkel ihres linken Auges ist irgendetwas verschmiert, knapp über der Narbe, die sich von dort wulstig ausbreitet und die älter ist als ich. Immerhin eine Sache, die wir nicht gemeinsam haben.
Ich löse meine Beine von den Holzdielen und ziehe die Knie an die Brust. Bisher verlief der Tag gut. Wir haben uns nicht gesehen, wir haben uns nicht gehört – es sind die Gespräche, die alles ruinieren werden.
»Hey«, sage ich.
»Willst du mir helfen?«
Sie stellt die Einkäufe auf den wackeligen Tisch neben der Tür. Ich kann sehen, wie sie sich in der Wohnung umschaut. Alles ist so, wie sie es mag, die Kerze brennt hell in der Mitte des Raumes, dennoch verzieht sie das Gesicht.
»Hättest du nicht das Fenster zumachen können?«, fragt sie. Ich antworte nicht, während sie hinübergeht und ihr Knie meine Schläfe streift, weil ich immer noch auf dem Boden sitze. Ich höre, wie sie das Fenster in den Rahmen hebelt, bis es schließt. Es waren nur ein paar Zentimeter. Wenige Zentimeter. Wenn sie die Mutter von jemand anderem wäre, wäre es ihr egal. Sie würde es nicht bemerken, hätte diese Regeln überhaupt nicht. Aber sie hat recht. Ich hätte es schließen sollen.
Dennoch könnte es schlimmer sein. Sie hakt die Finger zwischen meine und zieht mich auf die Füße. Bei der Berührung zieht sich mein Magen zusammen. Manchmal berühren wir uns wochenlang nicht und ihr Körper zuckt zurück, wenn ich ein oder zwei Meter an sie herankomme.
»Hilf mir«, sagt sie noch einmal, und ihr Lächeln wirkt so angestrengt, dass es fast schmerzhaft ist. »Du kannst vor dem Kühlschrank stehen.«
In der Küche ist es noch heißer und Fruchtfliegen, die wir nicht loswerden können, bedecken die Glühbirnen unter den oberen Schränken. Mom kratzt sich das Haar aus dem Gesicht und beginnt ihre Arbeitsbluse aufzuknöpfen, während ich die Einkaufstüte hole. Ich kann nicht alles sehen, was darin ist, aber was ich erspähe, wirkt nicht gerade vielversprechend. Sie hat nie gelernt, wie man richtig einkauft, und wenn sie alleine loszieht, kommt sie mit Melba Toast und Kirschtomaten nach Hause oder mit Sprudel und Käse aus der Tube. Wenn ich Glück habe, reicht es für uns beide.
Es ist nicht so, als würde sie mich vergessen. Ich denke wirklich nicht, dass es daran liegt. Es ist eher so, dass Mom nur genug Energie hat, um sich um eine Person zu kümmern, und diese Person ist immer sie selbst.
Es ist einfacher, wenn ich in der Schule bin. Mittagessen in der Cafeteria, Leute, die sich als meine Freunde bezeichnen, solange ich direkt vor ihnen stehe, und die langen Blicke der Lehrer, die bemerken, dass ich im tiefsten Herbst immer noch Sommerkleidung trage. Ich kann so tun, als wäre Mom wie die anderen Eltern, kann so tun, als hätte ich mehr als diese Wohnung, mehr als das Warten darauf, dass sie mich wiederhaben will.
Denn manchmal will sie das. Zieht mich dicht an sich und flüstert: »Niemand, nur du und ich.« Das ist gut, weil sie beschlossen hat, mich zu lieben. Und schlecht, weil die Widerhaken, die wir jeweils in den anderen gebohrt haben, zu tief stecken, als dass wir sie jemals loswerden könnten, egal wie fest wir ziehen. Aber das ist mir egal. Ich und Mom und die ganze Welt, genau hier.
Heute hat sie ein Sixpack Sprudel und eine Tüte Baby-Paprika mitgebracht. Ich weiß, was sie sagen würde, wenn ich so einkaufen würde – wir haben Leitungswasser zu Hause und frisches Gemüse ist zu teuer – aber ich habe sie im Supermarkt beobachtet. Habe gesehen, wie sie erstarrt und ihre Augen blicklos werden. Ich sage nichts und räume alles in den Kühlschrank zu den Hotdogs und dem Scheiblettenkäse von ihrem letzten Trip.
»Was sollen wir machen?«, frage ich. Ich stelle mir uns beide zusammen an der Arbeitsplatte vor, das Abendessen eklig und merkwürdig zusammengestellt, aber unseres.
Das ist mein Fehler. Vielleicht hätte es an einem anderen Tag keinen Unterschied gemacht, aber ich kann beobachten, wie es passiert. Sehe, wie sich ihr Kiefer anspannt, sich ihre Augen verengen.
»Machen?«, fragt sie.
Ich kann es noch retten. Ich kann es herumreißen. »Ja«, sage ich und nehme die Hotdogs aus dem Kühlschrank, ignoriere dabei das eklige Schwappen der Flüssigkeit in der Verpackung. Ich muss ihr zeigen, dass ich meinte, ich kann es für uns beide machen. Dass ich nicht mehr von ihr erwarte als das, was sie bereits gegeben hat. »Ich könnte die Paprika dünsten oder …«
»Wenn das, was ich heimgebracht habe, nicht gut genug ist«, fährt Mom mich an, »kannst du selber noch mal losgehen.«
Sie zieht die Autoschlüssel aus ihrer Tasche und wirft sie auf die Arbeitsplatte. Ich zwinge mich, still zu bleiben. Wenn ich die Schlüssel nehme, beginnt der Streit, und ich werde ihn nicht beenden können, ohne ins Auto zu steigen und an der nächstbesten Tankstelle eine Tüte Brezeln zu kaufen. So ist Mom. So bin ich – ich habe es von ihr gelernt. Ziehe es bis zum Ende durch – egal, was passiert.
»Nein«, sage ich vorsichtig. »Es ist alles gut.«
Aber sie gerät in Rage. »Nimm dir auch was von meinem Geld und hol dir, was auch immer du möchtest.« Sie lehnt sich gegen mich, drückt die Schlüssel gegen meine Brust. »Geh schon. Wenn du nicht fahren willst, dann kannst du auch laufen.«
Ich verschränke die Finger ineinander, drücke fest zu, damit ich den Köder nicht schlucke und mir die Schlüssel schnappe. Sie fühlt sich schuldig, deshalb sucht sie Streit. Aber nur weil ich das verstehe, fühle ich mich nicht besser dabei.
»Wirklich«, sage ich. »Es war nicht so gemeint.«
Das ist nicht, was sie von mir will. Ich weiß es. Aber wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, mich aus dieser Situation zu winden, ohne ihr entgegenzukommen, dann werde ich es tun.
»Willst du, dass ich dir einen Teller davon mache?«, frage ich stattdessen. Ich kann diesen Streit beenden. Das kann ich. Ich habe es früher schon getan. »Ich habe keinen Hunger.«
»Seit wann spielt es eine Rolle, was ich will?«, fragt Mom. Sie wendet sich von mir ab und geht zur Spüle hinüber. Sie dreht den Hahn auf, bis Wasser über ihre Handgelenke fließt, ihr Gemüt kühlt.
»Es spielt immer eine Rolle.« Und okay, okay, wenn es uns aus dieser Pattsituation herausbringt, gebe ich ein Stück weit nach. Ich werde mir mal wieder die Schuld zuweisen lassen – Schuld ist das Einzige, was je wirklich mir gehört. »Es tut mir leid«, sage ich. »Es war meine Schuld.«
Einen Moment lang reagiert sie nicht auf meine Worte.
Dann schaut sie auf und ihre Augen sind leer, als wäre ich eine der Leichen auf ihrer Arbeit. Das Wasser läuft über ihre papierne Haut, bis ich an ihr vorbeigreife und es abdrehe.
Sie blinzelt. Streckt die Hand aus, um meine Wange zu berühren, streicht über die Stelle, wo bei ihr die Narbe ist. Ihre Handfläche ist kalt und nass, dennoch fühle ich, wie mein Gesicht heiß wird, wie meine Augen zufallen.
Da bewegt sie sich und etwas zieht an meinem Haaransatz. Sie hält ein langes graues Haar zwischen den Fingern. Mom ist etwa in meinem Alter grau geworden, etwas später als ich, aber ich kann mich nicht erinnern, wer mir das erzählt hat. Plötzlich kommt es mir so vor, als könnte nicht sie es gewesen sein.
»Oh«, sage ich und blinzle gegen einen kurzen Schwindel an. Ich sehe zu, wie sie das Haar um ihren Finger wickelt, so fest, dass die Haut rot wird.
»Eine Schande«, sagt sie, mehr zu sich selbst.
Sie überlässt es mir, mich um mein eigenes Abendessen zu kümmern, und verschwindet in ihrem Zimmer. Die ganze Nacht durch lässt sie das Badewasser laufen. Zuerst denke ich, sie tut es, um sich abzukühlen, aber als ich später ins Bad gehe, um mir die Zähne zu putzen, ist der Spiegel beschlagen und die Wasserhähne sind heiß.
Wie man ein Feuer in Gang hält. Wie man aus Streit entstandene Wunden so flickt, dass nur Narben übrig bleiben. Das sind die Dinge, die man mit einer Mutter wie meiner lernt. Größtenteils aber lernt man, wie man geliebt werden kann, ohne dass es einen Beweis dafür gibt. Siebzehn Jahre sind es nun und ich kriege es immer noch nicht richtig hin.
Zwei
Mom weckt mich, bevor sie zur Arbeit geht. Mein Zimmer liegt direkt neben ihrem, wobei es nicht mal richtige Zimmer sind. Eine fleckig beige Trennwand, die wir in einem Bürobedarfsladen gekauft haben, teilt den Raum in zwei Hälften, und auf der anderen Seite steht ihr Bett. Nun, im grauen Morgenlicht, hockt sie am Fußende meines Bettes, die Kerze von gestern in beiden Händen.
Ich setze mich auf, reibe mir den Schlaf aus den Augen und taste auf dem Nachttisch nach dem Feuerzeug. Der Tag ist bereits zu heiß, das Laken klebt an meinen Beinen.
»Los geht’s«, sagt Mom. »Ich bin spät dran.«
Ihr Haar ist feucht vom Duschen und Wasser tropft auf ihre fliederfarbene Arbeitsbluse. Im Auto wird sie das Fenster runterkurbeln, und wenn sie im Beerdigungsinstitut ankommt, wird es trocken sein.
»Sorry«, sage ich. »Okay.«
Die Flamme erwacht und brennt stetig und stark. Früher hat meine Hand dabei gezittert, aber das hat sich gelegt. Keine Nervosität, während ich das Feuer an den Docht halte, bis es überspringt. Keine Furcht, während ich das Feuerzeug verlöschen lasse und mich vorlehne, um die Hitze auf meiner Haut zu spüren.
Dieser Teil ist Mom sehr wichtig. Mich zu beobachten. An guten Tagen wird das mit einem Kuss auf die Schläfe begleitet, während sie mir ihre Lieblingsregel ins Ohr flüstert. Meistens bekomme ich gar nichts dafür. Nur das Gefühl, dass dies ein Test ist und ich ihn irgendwie nur gerade so bestanden habe.
»Na gut.« Sie steht auf und das Licht der Flamme sammelt sich unter ihrem Kinn. »Schlaf weiter.«
Sie lässt die Kerze auf meinem Nachttisch zurück. Ich lege mich wieder hin, wende ihr den Rücken zu. Eines Tages wird das Feuer uns beide niederbrennen, und ich weiß nicht mal, ob es mir etwas ausmacht.
Es ist später Morgen, als ich wieder aufwache. Ich mache mir nicht die Mühe, auf mein Handy zu schauen. Mein Datenvolumen ist aufgebraucht und es will ohnehin niemand was von mir. Nun, da Sommerferien sind, habe ich nichts zu tun und niemanden, mit dem ich nichts tun kann. Zu viele Tage, die sich hintereinander aufreihen. Nichts, um sie zu füllen. Früher hat Mom mich auf die Arbeit mitgenommen. Sie versteckte mich unter ihrem Schreibtisch, und ich beobachtete, wie ihr Bauch sich bewegte, wie sie ihn einzog, wenn das Telefon klingelte. Die Lücken zwischen den Knöpfen, die Blässe ihrer Haut und die Falten, die sich rot hineindrückten. Für eine Weile war es das, was mir in den Kopf kam, wenn ich sie mir vorgestellt habe. Dieser Schatten und diese Rundung und der Geruch des Beerdigungsinstituts, Puder, Rosen, Staub.
Ich stehe auf. Der Teekessel pfeift. Nur leise, aber das Geräusch ist da. Ich lehne mich aus der Tür, sehe durchs Wohnzimmer bis zur Küche. Der Herd ist noch an. Sie muss vergessen haben, ihn auszuschalten. Ich kann sie mir vorstellen, wie sie sich beeilt, eine Tasse schwachen Tee hinunterstürzt. Kein Frühstück, weil sie die falschen Lebensmittel eingekauft hat. Ich schließe die Augen, ignoriere den Stich in meiner Brust.
Ich liebe sie so viel mehr, wenn sie nicht hier ist.
Der Streit gestern war nichts Neues. Wir hatten schon Hunderte derselben Art und wir werden noch Hunderte mehr haben. Aber immer noch fühle ich mich nach jedem Streit krank, immer noch versuche ich jedes Mal, dieser Stadt etwas abzugewinnen, etwas, was sich wie eine Wiedergutmachung anfühlt, weil ich weiß, dass ich das von ihr nie bekommen werde. Aber von Calhoun ist auch nicht viel zu erwarten. Warum sich Mom entschieden hat, dass wir uns hier niederlassen, entzieht sich meinem Verständnis, aber wahrscheinlich würde ich das über jeden Ort sagen. Ich habe noch keine Sekunde erlebt, in der Mom so ausgesehen hat, als wäre sie irgendwo, wo sie sein wollte.
Ich schalte das Gasfeld aus. Ziehe mich schnell an, streife mir ein Paar Shorts und ein T-Shirt über, kämme mein Haar zurück, um es zu flechten. Mittendrin halte ich einen Moment lang inne, denke an die grauen Strähnen an meinen Schläfen, denke daran, wie deutlich sie in dieser Frisur zu sehen sein werden. Mom mag es nicht, wenn ich mein Haar so trage. Aber ich tue bereits genug für sie.
Ich schlüpfe in meine Sneaker und mache mich auf den Weg nach unten. Durch die offene Tür schlüpft eine kühle Brise von der Straße herein. Dennoch ist da die Hitze, anhänglich und mit einem eigenen Puls. Bis ich draußen auf der Straße stehe, hat sich bereits Schweiß an meinem Haaransatz gesammelt.
Wir leben über einem leer stehenden Laden, dessen Fassade grell türkis gekachelt ist. Das Wort Eingang an der Tür ist alles, was von den Schildern übrig ist, die dort gehangen haben. Der Großteil von Calhoun sieht ähnlich aus, Lücken, wo es einst Leben gab, wo die Zeit einfach stehen geblieben ist. Neben unserem Haus gibt es einen Friseur, der wie immer offen hat, aber in dem wie immer niemand ist. Auf der anderen Straßenseite steht ein leeres Lagerhaus, die Fenster sind zerbrochen, die Ziegel voll mit Graffiti. Während ich vorbeigehe, entdeckte ich meinen Lieblingsspruch. Du bist längst tod teilt mir ein neonpinker Schriftzug mit. Ich setze meinen Weg fort, die Augen zum Schutz gegen die Sonne beinahe vollständig geschlossen.
Ich gehe in Richtung dessen, was in Calhoun als Zentrum durchgeht, einen Block entfernt von dem Highway, der die Stadt teilt. Zu dieser Morgenstunde ist die Stadt leer. Sogar in Redman’s Diner ist es zwischen den Mahlzeiten ruhig. Nur ein Kunde lehnt an der Theke und starrt in eine Tasse Kaffee. An manchen Abenden schlage ich dort die Zeit tot, wenn Mom wirkt, als wäre sie mit ihrer Geduld am Ende. Ich beobachte meine Klassenkameraden beim Kommen und Gehen, umgeben von Rauch, ihre Blicke voller Langeweile und Sehnsucht.
Die meisten von ihnen leben im Norden der Stadt, wo die Häuser weiter auseinanderstehen und dazwischen Rasen wächst. Früher waren einige dieser Kinder meine Freunde, und ich verbrachte Nachmittage auf ihren Sofas vor ihren Fernsehern, während ich ihr Essen aß. Aber dann fragten sie, wo ich wohne, und ich dachte an mein Zuhause mit dem süßlichen Geruch und dem leeren Kühlschrank, und dann war es vorbei. Nun sehe ich dieselben Gesichter im Unterricht, sehe ihre gebrauchten Autos vor dem Kino, das sich kaum über Wasser halten kann und Filme von vor einem Jahr zeigt.
Die Frau, der das Kino gehört, ist unsere Vermieterin, aber wir haben sie seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen, und Mom hat aufgehört, die Miete zu bezahlen, was auch keinen Unterschied macht. Je mehr Geld sie behält, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie merkt, dass ich welches gestohlen habe.
Ich tu das nicht zum Spaß. Ich gebe es nicht aus, schaue es nicht einmal an. Ich stopfe das Bargeld einfach in einen Umschlag, den ich unter meiner Matratze verstecke. Versuche zu ignorieren, wie sich mein Magen verkrampft, wenn ich über Möglichkeiten nachdenke, Mom zu verlassen, wenn ich mir vorstelle, was sie tun würde, wie sie in einer leeren Wohnung aufwacht. Würde sie nach mir suchen? Oder würde sie sich endlich entspannen können, weil es vielleicht das ist, was sie schon immer wollte?
Es ist nicht so, als hätte ich nie versucht wegzulaufen. Manchmal bin ich nah dran. Manchmal gehe ich sogar zur Tür hinaus, und es ist mir egal, dass ich erst siebzehn bin und noch ein Schuljahr vor mir liegt. Aber dann höre ich es – Nur du und ich, niemand sonst. Wie ein Fluch, den wir nicht abschütteln können. Also bleibe ich bei Mom, weil sie alles ist, was ich habe, weil sie sagt, dass ich hierhergehöre. Vielleicht ist es Trotz, vielleicht ist es Liebe, ich kann es nicht mehr auseinanderhalten.
Das hält mich nicht davon ab, einen anderen Weg zu suchen. Wenn ich nicht die Entschlossenheit aufbringen kann, aus eigenem Antrieb zu gehen, brauche ich jemand anderen, der mich will. Einen anderen Nielsen. Eine weitere Chance auf eine Familie.
Ich habe Mom einmal danach gefragt. Nur ein Mal. Ich war zehn und ein Mädchen kam mit Cupcakes in die Schule, die ihre Großmutter für sie gebacken hatte. Und ich wusste über Großeltern Bescheid und über Väter, aber sie stellte den Cupcake vor mir ab und ich musste mich in den Mülleimer beim Lehrerpult übergeben. Später fragte mich die Schulkrankenschwester, ob ich krank sei. Ich sagte ja, weil das einfacher schien, als es zu erklären. Einfacher, als ihr zu sagen, dass ich gerade erkannt hatte, dass es eine Lücke in meinem Leben gab.
Als ich heimkam, fragte ich Mom, woher unser Name stammt. Ich begann mit meinem Vater, weil es einfacher schien, weniger zu bedeuten schien – und ich hatte recht, denn es prallte einfach von ihr ab. Aber meine Großeltern. Das war das erste Mal, dass ich Mom nicht wiedererkannte.
Zuerst sagte sie gar nichts. Dann stand sie auf und verschloss die Wohnungstür, setzte sich aufs Sofa und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Wir bewegen uns nicht vom Fleck«, sagte sie schließlich, ihre Stimme ausdruckslos, der Blick fest auf mich gerichtet, »bis du versprichst, nie wieder danach zu fragen.«
Ich erinnere mich, dass ich gelacht habe, denn natürlich hatte sie das nicht wirklich so gemeint. Wir würden aufstehen, zu Abend essen, uns bettfertig machen, schlafen. Aber das Lachen blieb mir in der Kehle stecken, als ich sie ansah.
»Nicht einen Zentimeter«, sagte sie. »Wir werden genau hier sterben, Margot. Es ist mir gleich. Außer du versprichst es mir.«
Fände dieses Gespräch heute statt, ich könnte mich nicht dazu durchringen, sie gewinnen zu lassen. Wir würden dort bis in den tiefsten Winter sitzen, bis eine von uns aufgeben würde. Aber ich war klein und hungrig und ich sagte: »Ja.« Ich sagte: »Es tut mir leid.« Ich sagte: »Ich verspreche es.«
Also machte ich mich auf die Suche, sobald ich die Chance dazu erhielt. Ich kaufte ein Notizbuch im Supermarkt, schrieb meinen Nachnamen auf die erste Seite und begann, die Computer in der Bibliothek zu durchforsten, blätterte durch die Zeitungen im Archiv. Aber alles, was ich je ausgrub, waren Einträge im Telefonbuch mit nicht mehr funktionierenden Telefonnummern oder verwirrten Nielsen-Familien, die noch nie von einer Josephine oder einer Margot gehört hatten.
Ich gab auf. Es gab wichtigere Dinge, die ich im Auge behalten musste. Mom und mich zum Beispiel. Darum geht es nun in diesem Notizbuch, das neben dem Geld unter meiner Matratze steckt. Streit, den wir hatten, Wort für Wort. Momente, in denen sie mich angesehen hat, als wolle sie mich dahaben. Alles davon ist der Beweis, dass die Dinge so passiert sind, wie ich sie in Erinnerung habe. Bei jemandem wie Mom, bei jemandem, der mehr darüber streitet, ob Dinge passiert sind, als darüber, ob sie wehgetan haben, braucht man das.
Niederzuschreiben, was gestern passiert ist, lohnt sich allerdings nicht. Bevor der Sommer endet, wird es noch ein Dutzend weiterer solcher Tage geben. Wir zerbrechen und zerbrechen und fließen wieder zusammen. So läuft das mit uns.
Und wenn ich es beschleunigen kann, dann tue ich das. Deshalb steckt ein Teil des gestohlenen Geldes zusammengefaltet in meiner Tasche, deshalb sind meine Augen auf den Laden auf der anderen Straßenseite fixiert. Heartland Cash for Gold, wo Frank die Hälfte der Besitztümer meiner Mom in einer Vitrine liegen hat. Es läuft in Phasen ab: Mom gibt zu viel für Lebensmittel aus, die sie nicht isst, verkauft Frank ein Schmuckkästchen voller unechter Goldohrringe, spart das Geld bei der Miete ein und kauft die Hälfte der Ohrringe zurück. Es ist lächerlich. Der Rückkaufpreis steigt jedes Mal, und es ist nicht so, als müsste sie sie vor jemand anderem retten. Sie könnte den Schmuck ein halbes Jahrhundert lang in dieser Pfandleihe liegen lassen und niemand würde ihn anrühren. Aber das will sie nicht hören.
Ich weiß nicht, was ich für die Scheine in meiner Tasche bekommen kann, aber was auch immer es ist, ich werde es ihr bringen und mir ein paar Tage Frieden erkaufen. Ein paar Tage, in denen es sich nicht wie eine falsche Entscheidung anfühlt, zu bleiben.
Ich überquere die Straße, der Asphalt brennt unter meinen Schuhsohlen, und eile in die Pfandleihe. Die Glocken an der Tür bimmeln leise, als ich sie vorsichtig hinter mir schließe. Hier drinnen ist es dunkel und kühl dank des Ventilators, der in einer Ecke unermüdlich arbeitet. Einen Moment lang denke ich darüber nach, mich einfach auf diesen ranzigen grauen Teppich zu setzen und mich nie wieder zu bewegen. Aber dann ertönt im hinteren Teil des Ladens ein Geräusch und ich höre Franks tiefes tonloses Summen.
Er trägt eines seiner kurzärmeligen Hemden. Schweiß hat Flecken an den Achseln hinterlassen und färbt dort das Karomuster dunkler, welches besser in die Weihnachtszeit gepasst hätte. Frank ist nett. Er schickt Mom nie fort, wenn sie etwas zum Verkaufen bringt, obwohl das Zeug der reinste Schrott ist. Er macht ihr auch keinen guten Deal, wenn sie es zurückkaufen will, aber das würde ich auch nicht tun, wenn ich er wäre.
»Margot«, sagt er und winkt mich zum Tresen hinüber, wo er durch einen Stapel Kassenzettel blättert. »Kommt deine Mom vorbei?«
Auch wenn es eigentlich keine Regel ist wie die mit der Kerze, sollte ich nicht ohne Mom hier sein. Immerhin lagert hier ihr Leben in Kisten, ihr Leben, bevor ich ins Spiel gekommen bin. Ich zögere, frage mich, ob ich einfach nach Hause gehen sollte. Aber nein, ich tu etwas Nettes für sie. Sie wird es zu schätzen wissen. Ich werde ein Paar Ohrringe für sie zurückkaufen oder alte Kleidung, die sie zum Schneider bringen und erneuern lassen kann.
»Heute nicht«, antworte ich und durchquere den Laden. An jeder Wand verläuft ein Vitrinenschrank und der Raum wird mittig durch zwei Regale geteilt, in die Gegenstände wahllos hineingestopft wurden. Die Preisschilder flattern leicht im Luftzug des Ventilators. Ein Windhauch erfasst einen handgeschriebenen Preis, der durchgestrichen und unter den eine niedrigere Zahl geschrieben wurde.
Ich trete an den Vitrinenschrank an der Rückwand heran, an dessen einem Ende die Kasse steht. Dahinter sitzt Frank auf einem Hocker. »Wie geht es Ihrer Frau?«
»Immer noch tot«, sagt Frank, wie er es immer tut, und er wartet darauf, dass ich lache, obwohl ich das nie tue. »Geht’s dir gut?«
Ich verdrehe die Augen. »Besser als je zuvor.« Ich frage mich, ob ich es je so meinen werde.
Frank legt die Kassenzettel zur Seite und beugt sich vor, stützt die Arme auf die Vitrine. »Also«, sagt er, »was darf’s sein?«
Ich hätte mein Geld draußen zählen sollen, aber ich habe es vergessen. Meine Taschen werde ich nicht vor Frank ausleeren. Wahrscheinlich sind darin zwei Zwanziger – Mom zahlt unsere Miete nicht mehr in Eindollarscheinen – aber ich werde mich hüten, das Frank sehen zu lassen.
»Bin mir noch nicht sicher«, sage ich, trete zurück und schlendere in Richtung der Vitrinen, in denen immer Moms Sachen ausgelegt sind. »Ich schaue mich nur um.«
»Ihr Schrott liegt nicht hier draußen.« Frank kommt um den Tresen herum, um sich neben mich zu stellen.
»Was meinen Sie?« Mit gerunzelter Stirn drehe ich mich um und sehe eine Sammlung abgegriffener Baseballkarten und zwei Ohrstecker mit falschen Diamanten. Dort, wo normalerweise Moms Zeug war.
»Ich meine«, erklärt Frank ungeduldig, »dass ihr zwei die Einzigen wart, die es gekauft haben. Das ist nicht gerade eine große Gewinnspanne für mich, nicht wahr?«
»Wo haben Sie’s hingetan?« Ich kann die Panik in meiner Stimme nicht verbergen, der Streit setzt sich bereits in meinem Körper fest. Wenn es fort ist, wenn er es weggeworfen hat, dann wird das auf irgendeine Weise meine Schuld sein.
Er wirft mir denselben Blick zu wie die meisten Leute in der Stadt, sobald sie meine Mutter getroffen haben. Unglauben und ein wenig Sorge – was ich mehr als alles andere hasse, denn welches Recht haben sie, sich Sorgen um mich zu machen? Sie ist meine Mutter, und wenn ich leide, weiß ich, dass sie es auch tut. »Ich hab’s nur nach hinten geräumt, das ist alles«, sagt er und weist mit dem Kinn zur Tür hinter der Kasse. »Beruhig dich.«
»Sorry.« Ich schlucke schwer und zwinge mich, mich zu entspannen. »Kann ich es sehen?«
Er bedeutet mir, ihm zu folgen, und geht in Richtung Hinterzimmer. Dort stapelt sich das Gerümpel so hoch, dass es wahrscheinlich das ganze Gebäude stützt. Klamotten, Bücher, genug Uhren, um meine beiden Arme bis hoch zu den Ellenbogen zu bedecken. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums steht ein Tisch, der antik aussieht, aber wahrscheinlich aus Spanplatten besteht. Darauf stapeln sich fünf oder sechs verbeulte Kartons, deren Seiten sich langsam voneinander lösen. Auf allen steht mit verblasster schwarzer Tinte Nielsen geschrieben.
»Da«, sagt Frank. »Hab’s dir ja gesagt.«
»Danke.« Ich trete von einem Fuß auf den anderen. Plötzlich ist mir kalt. »Sie müssen nicht hier hinten bleiben.«
»Damit du die Hälfte von diesem Zeug unter deinem T-Shirt rausschmuggeln kannst?« Er klingt, als würde er scherzen, aber er lehnt sich gegen den Türrahmen, verschränkt die Arme vor der Brust. Irgendwas an der Art, wie seine Knie unter den Cargoshorts hervorschauen, sorgt dafür, dass mir übel wird. »Überleg dir, was du willst. Preise sollten immer noch dranstehen.«
Ich schiebe mich zum Tisch hinüber und versuche, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich nervös bin. Das sind Moms Besitztümer, Dinge, von denen sie beschlossen hat, sie nicht mehr zu brauchen. Ich bin die Sachen noch nie durchgegangen – das macht sie immer selbst, während ich für gewöhnlich dort warten muss, wo Frank jetzt steht. Und wann auch immer ich ohne sie hier war, war es für mich. Normalerweise, um herauszufinden, ob Frank bereit ist, mir ein besseres Handy für die Hälfte des Marktpreises zu verkaufen. Das ist er nie.
»Nun mach schon«, sagt er und greift sich eine der Uhren mit den Preisschildern, um ungeduldig daraufzutippen.
»Es ist nicht so, als würde ein Haufen Kunden auf Sie warten«, sage ich. Das ist gemeiner, als er es verdient hat, aber meine Nerven liegen blank und außerdem ist es die Wahrheit. »Geben Sie mir einfach eine Minute.«
Ich öffne den ersten Karton und spähe hinein. Er ist größtenteils leer, abgesehen von einer Ansammlung alten Silberbestecks und einer Pfanne, die mit irgendetwas bedeckt ist, was bestialisch stinkt. Ich huste und meine Augen tränen. Hinter mir lacht Frank amüsiert.
»Das erwischt einen kalt«, sagt er, während ich mich wegdrehe, um frische Luft zu schnappen.
»Warum zur Hölle haben Sie ihr das abgekauft?«, frage ich. »Ich hatte Sie nicht für die Wohlfahrt gehalten.«
»Das zeigt, wie wenig du weißt.« Frank streckt stolz die Brust raus. »Ich bin der netteste Kerl der Welt.«
Ich schaue wieder die Kartons mit Moms Zeug an. Falls in den anderen das Gleiche drin ist, hat Frank vielleicht recht. Es ist Schrott. Alles davon ist Schrott. Und das ist traurig. Wirklich. Das Leben meiner Mutter. Fünfunddreißig Jahre. Und das ist alles, was davon übrig geblieben ist? Sie hat mich bekommen, als sie noch sehr jung war – das weiß ich. Aber ich vergesse es manchmal, was nicht verwunderlich ist, wenn so eine Kluft zwischen uns ist. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass sie in den achtzehn Jahren, bevor es mich gab, kaum eine Chance hatte, überhaupt zu leben.
Ich ignoriere den Kloß in meinem Hals und ziehe die kleinste von den Kisten zu mir heran. Diese hier habe ich vorher noch nie gesehen. Darin sind hauptsächlich Stoffe, und zuerst denke ich, dass es Kleidung ist, die wir vielleicht zum Schneider bringen könnten, so wie ich es vorhatte. Aber dann ziehe ich etwas aus dem Knäuel heraus und es ist keine Kleidung. Es ist eine Decke. Klein und weich und in einem sanften, frischen Pink.
»Willst du die?«, fragt Frank. »Die ist billig genug, schätze ich.«
Ich antworte nicht. Ich kann nicht antworten. Das war meine Decke. Das muss meine gewesen sein. Es gibt keine Initialen in der Ecke, keinen Namen, wie man sie auf die kleinen weißen Waschzettel schreibt, aber mir ist klar: In diesem Karton sind meine Babysachen. Die Kehle wird mir eng, meine Augen brennen. Der Anfang meines Lebens, verpackt und verkauft. Sie konnte es nicht behalten, aber sie konnte es auch nicht loswerden. Genauso wie mich.
»Die nicht«, sage ich, meine Stimme heiser und leise.
»Na gut. Dann beeil dich.«
Ich lege die Decke zur Seite und wühle mich durch den Rest des Kartons. Dort ein Bilderbuch, in kräftigen Farben und ohne Text, mit von Feuchtigkeit gewellten Kanten. Hier ein T-Shirt, das zerschnitten wurde, um daraus einen unglaublich winzigen improvisierten Strampler zu machen. Für dich, sage ich mir selbst, das war für dich. Aber es schmerzt zu sehr, bei diesem Gedanken zu verweilen. Das hier war eine schlechte Idee. Ich sollte gehen.
Bevor ich aufgebe, erlaube ich mir einen letzten Blick. Etwas Helles, ganz am Boden des Kartons, reflektiert das schwache Licht. Ich greife hinein und ziehe es vorsichtig heraus. Eine Bibel, die Worte golden auf dem weißen Umschlag. Sie sieht nicht so aus wie die Exemplare, die ich immer gesehen habe, wenn ich mich verpflichtet gefühlt habe, mich mal wieder auf die hinteren Bänke eines Gottesdienstes zu schleichen. Diese hier ist größer, schicker, ein Muster rahmt den Buchdeckel, die Seiten sind dick und die Schnittkanten mit Gold versehen. Ich schlage die erste Seite auf und der Buchrücken knarzt. Dort steht in blauer, verschlungener Handschrift eine Nachricht geschrieben.
Ist’s möglich, so gehe dieser Kelch von mir;
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
– Für meine Tochter zu ihrem zwölften Geburtstag.
In aller Liebe, deine Mutter. 8. 11. 95
Ich habe eine lange Zeit damit verbracht, nach einem Beweis dafür zu suchen, dass es jemanden vor Mom gab. Dass wir irgendwie auf irgendeine Weise eine Familie hatten. Das ist der erste Hinweis, den ich gefunden habe. Jemand hat das geschrieben. Meine Mutter war mal ein Kind. Das war mir klar, natürlich war mir das klar, aber nicht auf diese Art.
»Das hier«, sage ich. »Wie viel kostet das?«
»Du könntest auf das Preisschild gucken«, grummelt Frank, aber er kommt zu mir herüber und greift nach der Bibel. Ich gebe sie ihm nicht. Ich drehe nur den Rücken in seine Richtung, damit er den Preis sehen kann. »Das?« Er hebt die Augenbrauen, und ich gebe mir Mühe, meine Miene ausdruckslos zu halten. »Seltsame Wahl.«
»Wollen Sie es verkaufen oder nicht?«
»Ich sag ja nur.« Er hebt das Cover an und späht in Richtung des Preises, der in der oberen Ecke der Titelseite steht. »Das sind vierzig.«
Ich sollte feilschen, aber ich halte es hier nicht eine Minute länger aus. Ich fische die Scheine aus meiner Tasche – tatsächlich habe ich nur zwei Zwanziger – und drücke sie ihm in die Hand, bevor ich zur Tür hinauslaufe. Der Ledereinband der Bibel klebt an meiner Brust und die Sonne ist zu hell. Ein Fehler, sage ich mir immer und immer wieder. Das war ein Fehler.
Drei
Ich kann nicht nach Hause gehen. Was soll ich dort auch machen – warten, bis Mom heimkommt? Das ist zu viel und gleichzeitig nicht genug. Schließlich lande ich bei Redman’s am hintersten Tisch.
Vor mir steht ein Glas Wasser, und ich habe kein Geld, um irgendetwas zu bezahlen. Wenn hier mehr los wäre, würden sie mich rauswerfen. Aber im Moment sind hier nur ich, die Kellnerin und ein Kerl, der über dem Tresen hängt und von dem ich mir fast sicher bin, dass er noch lebt.
Ich beobachte einen Tropfen Kondenswasser, der an der Seite des Glases hinunterläuft und auf dem Tisch eine Pfütze bildet. Nun, da ich nicht mehr mit Moms ganzem Zeug konfrontiert werde, lässt die Panik langsam nach. Aber da ist noch immer ein ungutes Gefühl in meinem Magen, ein saurer Geschmack auf meiner Zunge, den ich nicht ganz hinunterschlucken kann. Mir ist nämlich klar geworden, warum ich das hier tue.
Manchmal dauert es eine Weile. Es zu verstehen. Da es mir etwas bedeuten würde, ein Geschenk von meiner Mutter zu haben, muss es ihr auch etwas bedeuten, eines von ihrer zu haben. Das habe ich mir in Franks Laden eingeredet. Aber Mom hat mein ganzes Leben damit verbracht, uns vor ihrer Vergangenheit zu verbergen, und das hier ist kein Geschenk. Ich bestrafe sie. Ich versuche ihr wehzutun.
Ihrer Meinung nach tue ich das oft. Normalerweise will ich ihr nicht wehtun, aber diesmal ist es Absicht, auch wenn ich ein wenig gebraucht habe, um das zu erkennen. Ich werde ihr die Bibel zeigen und sagen: »Schau, was ich gefunden habe. Ich habe die ganze Zeit die Regeln gebrochen. Du kannst mich nicht ewig von meiner Familie fernhalten.«
Ich schlage das Buch wieder auf und fahre den handgeschriebenen Text mit den Fingerspitzen nach. Der zwölfte Geburtstag. Ich kann mir Mom gar nicht so jung vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie die Bibel liest. Hat ihre Mutter sie in die Kirche mitgenommen? Hat sie ihr die Heilige Schrift vorgelesen, während sie sich bettfertig machte?
Ihre Mutter. Ich presse die Handballen gegen meine Augen und atme tief durch. Meine Großmutter. Das ist meine Großmutter. Mein Name und mein Blut – sie stammen von ihr. Es gab sie wirklich. Und vielleicht gibt es sie immer noch.
Ich muss sie nur finden.
Ich blättere ein paar Seiten weiter. Hier und dort entdecke ich handschriftliche Anmerkungen am Rand. Abschnitte wurden unterstrichen und ein Drei-gewinnt-Spiel wurde über eine Überschrift gekritzelt.
»Kann ich dir sonst noch etwas bringen?«, fragt mich die Kellnerin.
Ich zucke zusammen, klappe die Bibel zu und klemme mir dabei die Finger ein. »Nein, danke«, sage ich.
Sie blickt demonstrativ den leeren Tisch vor mir an, wo eigentlich ein Teller Essen stehen sollte. Ich setze ein Lächeln auf. »Vielleicht etwas Wasser.«
Sie hebt mein volles Glas an und stellt es wieder ab. »Bitte schön.«
Sobald sie fort ist, schlage ich die Bibel wieder auf. Irgendetwas darin hat sich gelöst und lugt nun heraus wie ein Lesezeichen. Vorsichtig blättere ich zu der Stelle, an der es steckt, weit hinten im Buch.
Ein Foto. Die Kanten sind scharf, aber die glänzende Oberfläche ist mit Fingerabdrücken bedeckt, als hätte jemand viel Zeit damit verbracht, die Umrisse der abgebildeten Gegenstände nachzufahren. Ich beuge mich darüber. Es ist ein Haus darauf zu sehen, oder ein Teil von einem Haus. Die weiße Farbe hebt sich frisch und stolz vom Himmel ab, und die Sonne scheint so hell, dass alles um sie herum wie weggewaschen ist. Schneebedeckte Felder erstrecken sich in die Ferne, verschwommen sieht man Bäume am Horizont. Aber da steht ein Mädchen im Vordergrund. Es ist jung, das Gesicht noch rund und voll, ohne Narben und glatt, und es lächelt so breit, dass man die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen sehen kann.
Mom, denke ich. Es sieht aus wie sie. Wie ich, als ich in diesem Alter war. Mom muss dort aufgewachsen sein.
Vorsichtig ziehe ich das Foto zwischen den Seiten hervor. Die Bibel kann sie haben, aber das hier behalte ich. Und ich werde ihr nicht davon erzählen. Sie war einst wie ich, aber ich werde nicht wie sie sein.
Ich drehe das Bild um, will es zusammenfalten und in meine Tasche stecken. Aber da ist wieder diese Handschrift. Dieselbe wie die von der Widmung auf der Titelseite. Dies hier muss von derselben Person geschrieben worden sein. Von meiner Großmutter.
Fairhaven, 1989, Nielsen Hof. Gefolgt von: Erinnerst du dich, wie es war? Ich warte auf dich. Komm, wann immer du es schaffst.
Und dahinter – so viel Glück hatte ich noch nie – steht eine Telefonnummer.
Ich lächle, beinahe entkommt mir ein Lachen, bevor ich es verhindern kann. All die Jahre habe ich gesucht und gesucht und es war die ganze Zeit hier. Jemand ruft mich nach Hause.
Es gibt nur eine Telefonzelle in Calhoun, direkt in der Mitte des Orts. Ich würde lieber mein eigenes Handy verwenden – ein altes ohne Touchscreen und ohne Anrufererkennung –, aber es ist Prepaid und ich habe mein Guthaben aufgebraucht, als ich einen ganzen Nachmittag in der Bibliothek mit einem Spiel verbracht und dabei vergessen habe, mich ins WLAN einzuloggen. Also muss ich die Telefonzelle direkt vor dem Einkaufszentrum nehmen, und zwar jetzt, während Mom noch auf der Arbeit ist und die Straßen leer sind. Wenn ich Glück habe, wird mich niemand sehen und ich kann mein Geheimnis noch etwas länger vor Mom verbergen.
Als ich dort ankomme, ist die Telefonzelle leer, wie immer. Also schiebe ich mich hinein, lege die Bibel auf die Plastikablage unter dem Telefon und ziehe das Foto aus meiner Tasche, entfalte es vorsichtig. Auf der Rückseite steht immer noch die Telefonnummer. Ich habe sie mir nicht eingebildet.
Es kann doch nicht so einfach sein, oder? Ein Foto in einem Buch, ein Vierteldollar, den ich aus dem Trinkgeldglas im Diner gestohlen habe, und am anderen Ende der Leitung meine Familie.
Vielleicht existiert die Nummer nicht mehr. Vielleicht ist es ein anderer Nielsen, dem mein Name nichts sagt. Aber vielleicht sind es auch die Eltern meiner Mutter, die gewartet und gewartet haben und sich nach mir sehnen.
Einen Moment lang schließe ich die Augen, nehme die Schultern zurück. Hör auf, Zeit zu schinden, sage ich mir. Tu das, weswegen du hergekommen bist. Das Leben mit Mom wird sich nicht ändern und du hast eine Chance auf etwas anderes.
Aber ich kann ihre Stimme hören, immer noch, während ich nach dem Hörer greife, ihn von der Gabel nehme. Nur du und ich, niemand sonst. Niemand, niemand, niemand.
Der Hörer ist zu schwer und rutschig in meinen schweißnassen Händen, deshalb verstärke ich den Griff. Der Vierteldollar, den ich von Redman gestohlen habe, liegt in meiner Tasche. Meine Familie wartet darauf, dass ich sie finde. Jetzt, Margot. Es muss jetzt sein, bevor Mom zurückkommt, bevor die Tür, die du aufgestoßen hast, wieder zufällt.
Ich schiebe die Münze in den Schlitz und wähle die Nummer. Atme tief durch und warte darauf, dass die Verbindung hergestellt wird.
Einen Moment lang passiert nichts. Sorge durchfährt mich – die Nummer ist zu alt, sie funktioniert nicht mehr, ich werde meine Familie nie finden, niemals –, aber sie legt sich wieder, als es in der Leitung klickt und das Freizeichen erklingt. Einmal. Wieder. Wieder und wieder, bis endlich …
Stille. Etwas, das nach einem langsamen Atemzug klingt. Dann die Stimme einer Frau. Eine reale Stimme an meinem Ohr. »Nielsen-Haus, Vera am Apparat.«
Ich öffne den Mund. Warte darauf, dass Worte herauskommen, aber sie tun es nicht. Ich hätte üben sollen, ich hätte mir zurechtlegen sollen, was ich sagen will. Aber wie hätte ich mich hierauf vorbereiten können? Auf eine andere Nielsen am Telefon, die Antwort auf das, wonach ich gesucht habe, seit ich zehn Jahre alt bin?
»Hallo?«
Ich kann nicht antworten, und in die Stille, die folgt, sagt am anderen Ende der Leitung die Frau – Vera, ihr Name ist Vera: »Josephine? Bist du das?«
Mein Herz wird schwer. Werde ich je irgendwo sein, wo nicht meine Mutter zuerst gewesen ist?
»Nein«, sage ich. Ich richte mich gerade auf, versuche mich wieder zu sammeln. »Hier ist …«
»Wer ist das? Wenn Sie einer von diesen Telefonverkäufern sind, dann tut es mir leid, aber ich werde Ihnen nichts abkaufen.« Ungeduld und Dringlichkeit schwingen in ihrer leisen Stimme mit, die rau vom Alter ist. Sie klingt wie meine Mutter, aber mit einem Stahlkern, den Mom nie hatte. Sie muss es sein. Die Frau, die die Widmung geschrieben hat, die Mom ihre Telefonnummer hinterlassen hat – meine Großmutter.
Ich sollte es ihr einfach sagen, einfach meinen eigenen Namen aussprechen. Aber ich will, dass mich meine Großmutter kennt, dass sie meine Stimme erkennt. Ich will, dass ich meiner Mutter genug bedeutet habe, dass sie anderen Leuten von mir erzählt hat. Selbst wenn es Leute sind, die sie mir mein ganzes Leben lang vorenthalten hat.
»Ich bin’s«, ist alles, was ich zustande kriege. Bitte, bitte, mach, dass sie mich erkennt. Bitte.
»Oh.« Ich höre einen stotternden Seufzer. Ich weiß nicht, ob es meiner oder ihrer ist. »Margot. Du bist Margot.«
Etwas setzt sich hinter meinem Brustkorb fest. Zieht so fest an mir, dass ich es im ganzen Körper spüren kann. So fühlt es sich an, zu bekommen, was man möchte.