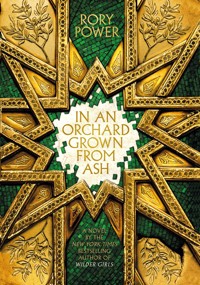9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit achtzehn Monaten steht das Mädcheninternat von Raxter Island unter Quarantäne, denn eine gefährliche Seuche hat sich ausgebreitet: Bei den Schülerinnen löst sie grausige Mutationen aus, die Lehrerinnen starben eine nach der anderen. Die Natur auf der Insel ist wild und unberechenbar geworden. Zum Überleben braucht man Freundinnen, die alles für einen tun würden – so wie Hetty und Reese für Byatt. Denn als Byatt verschwindet, beginnen die beiden eine verbotene Suche, bei der sie auf grausamere Wahrheiten stoßen, als sie es sich je hätten ausmalen können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Wilder Girls« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Wilder Girls enthält Themen, die triggern können. Deshalb findet ihr am Ende dieses Buches eine Inhaltswarnung[1]. Achtung: Diese beinhaltet Spoiler für die gesamte Geschichte. Wir wünschen euch allen ein bestmögliches Leseerlebnis.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Bottlinger
Copyright © Rory Power 2019
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Wilder Girls«, Delacorte Press, New York 2019
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München, nach einem Entwurf von Regina Flath
Covermotiv: © Aykut Aydoğdu 2019
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Hetty
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Byatt
Kapitel 7
Kapitel 8
Hetty
Kapitel 9
Kapitel 10
Byatt
Kapitel 11
Kapitel 12
Hetty
Kapitel 13
Kapitel 14
Byatt
Kapitel 15
Kapitel 16
Hetty
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Danksagung
Inhaltswarnung
(Achtung, Spoiler!)
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meine Mutter
und für mich;
und für die Versionen von uns,
die nie gedacht hätten,
dass wir das hier zusammen erreichen würden
All things counter,
original,
spare,
strange
– gerard manley hopkins, »pied beauty«
Hetty
Kapitel 1
Irgendetwas. Weit draußen im Weiß-Dunkel. Es bewegt sich zwischen den Bäumen, zwischen Schwärmen von Gebüsch. Man kann vom Dach aus sehen, wie sich das Dickicht ringsum teilt, während es raschelnd Richtung Meer strebt.
Der Größe nach zu urteilen, muss es ein Kojote sein, einer von den großen, die einem bis zur Schulter gehen. Mit Zähnen, die wie Messer in meine Handfläche passen. Das weiß ich, weil ich einmal einen Zahn gefunden habe, der durch den Zaun hindurchragte. Ich habe ihn mitgenommen und unter meinem Bett versteckt.
Noch ein Knacken im Gebüsch, dann ist die Stille zurück. Am anderen Ende der Dachterrasse senkt Byatt ihr Gewehr, legt den Lauf auf dem Geländer ab. Die Straße ist frei.
Ich behalte meine Waffe im Anschlag, nur für den Fall, das Visier an meinem linken Auge. Mein anderes Auge ist tot, während eines Schubs erloschen. Das Augenlid verschlossen, während irgendetwas darunter wächst.
So ist es bei uns allen hier. Krank, seltsam, und wir wissen nicht warum. Dinge brechen aus uns hervor, Teile fehlen, Stücke fallen ab. Und dann verhärten wir, und die Wunden verheilen.
Durch die Visierung sehe ich den Wald, der sich gebleicht von der Mittagssonne bis zum Rand der Insel erstreckt. Dahinter liegt das Meer. Die Kiefern stehen dicht wie immer, überwuchern das Haus. Hier und dort gibt es Lücken, wo Eichen und Birken ihre Blätter abgeworfen haben, aber der Großteil des Blätterdachs ist undurchdringlich, die Nadeln steif vom Frost. Nur die Funkantenne ragt hindurch, nutzlos, nun, da es kein Signal mehr gibt.
Auf der Straße ruft jemand, und zwischen den Bäumen kommt der Bootsdienst heim. Es gibt nur wenige, die das schaffen: den ganzen Weg über die Insel, dorthin, wo die Navy Rationen und Kleidung an die Seebrücke liefert, wo früher die Fähren fuhren. Der Rest von uns bleibt hinter dem Zaun und betet, dass sie sicher nach Hause kommen.
Ms Welch, die am größten ist, hält am Zaun und macht sich am Schloss zu schaffen, bis das Tor endlich aufschwingt. Der Bootsdienst stolpert herein, die Wangen rot von der Kälte. Alle drei sind zurück, und alle drei laufen gebeugt unter dem Gewicht der Dosen und des Fleisches und der Zuckerwürfel. Welch dreht sich um und schließt das Tor. Sie ist nur fünf Jahre älter als die Mädchen aus dem höchsten Jahrgang und damit die Jüngste unter den Lehrerinnen. Vorher schlief sie auf unserem Flur und drückte ein Auge zu, wenn jemand nicht pünktlich vor der Ausgangssperre zurück war. Nun zählt sie uns jeden Morgen, um sicherzugehen, dass in der Nacht niemand gestorben ist.
Sie winkt, um zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist, und Byatt winkt zurück. Ich bin für das Tor zuständig, Byatt für die Straße. Manchmal tauschen wir, aber mit meinem Auge kann ich nicht gut so weit schauen, also bleibt es nie lange dabei. Dennoch schieße ich immer noch besser als die Hälfte der Mädchen, die meinen Platz einnehmen könnten.
Das letzte Mädchen vom Bootsdienst tritt unter das Vordach und gerät außer Sicht, und das ist das Ende unserer Schicht. Die Gewehre entladen. Die Munition in die Kiste legen für das nächste Mädchen. Eine Patrone in die Tasche stecken, nur für den Fall.
Von der Dachterrasse aus neigt sich das Dach sacht nach unten, vom zweiten in den ersten Stock. Von dort schwingen wir uns über die Kante und durch das offene Fenster ins Haus. In den Röcken und Strümpfen, die wir früher getragen haben, war das schwieriger. Da war die Stimme in uns, die uns sagte, dass wir die Knie beisammenhalten sollen. Aber das ist lange her. Nun, in unseren zerrissenen Jeans, gibt es diese Sorge nicht mehr.
Byatt klettert hinter mir hinein und hinterlässt dabei weitere Kratzer am Fensterrahmen. Sie wirft ihr Haar über die Schulter. Es ist glatt, wie meines, und von einem hellen lebendigen Braun. Und sauber. Auch wenn es kein Brot gibt, es gibt immer Shampoo.
»Was hast du gesehen?«, fragt sie mich.
Ich hebe die Schultern. »Nichts.«
Zum Frühstück hat es nicht viel gegeben, und ich fühle den Hunger in meinen Gliedern. Ich weiß, dass es Byatt genauso geht, also eilen wir nach unten zum Mittagessen, ins Erdgeschoss, in die Halle mit ihrer hohen Decke. Verschrammte, schiefe Tische; ein Kamin; und hochlehnige Sofas, deren Polster herausgerissen wurden, um sie zu verheizen. Und wir, wir alle, geschäftig und lebendig.
—
Als es begann, waren wir ungefähr hundert Mädchen und zwanzig Lehrerinnen. Zusammen füllten wir beide Flügel des alten Hauses. Inzwischen brauchen wir nur noch einen.
Die Boot-Mädchen kommen durch die Vordertür gestapft, lassen ihre Taschen fallen, und es gibt Gedränge, als sich alle auf das Essen stürzen. Größtenteils schicken sie uns Dosen, manchmal Packungen mit Trockenfleisch. So gut wie nie irgendetwas Frisches und nie genug für alle. An den meisten Tagen bestehen Mahlzeiten daraus, dass Welch in der Küche die Vorratskammer aufschließt und die kleinsten Rationen ausgibt, die die Welt je gesehen hat. Aber heute ist Liefertag, neue Vorräte sind auf den Rücken der Boot-Mädchen gekommen – und das heißt, dass Welch und die Schulleiterin sich raushalten und uns jeweils eine Sache erkämpfen lassen.
Byatt und ich, wir müssen nicht kämpfen. Reese steht direkt bei der Tür und schafft eine Tasche für uns beiseite. Wäre sie jemand anders, gäbe es Beschwerden. Aber es ist Reese, mit den scharfen schuppigen Fingern an der linken Hand, also sagt niemand etwas.
Sie war eine der Letzten, die krank wurden. Ich dachte, vielleicht würde es sie nicht erwischen, aber dann fing es an. Die Schuppen, jede von einem ständig wechselnden Silber, krochen aus ihrer Haut, als kämen sie aus ihrem Inneren. Dasselbe geschah mit einem anderen Mädchen aus unserem Jahrgang. Sie breiteten sich über ihren ganzen Körper aus und kühlten ihr Blut herunter, bis sie nicht mehr aufwachte, also dachten wir, es sei auch für Reese vorbei. Sie brachten sie nach oben, warteten darauf, dass es sie töten würde. Aber das tat es nicht. Erst war sie im Krankentrakt versteckt, aber dann war sie von einem auf den anderen Tag wieder da, ihre linke Hand wild und gefährlich, aber immer noch ihre.
Reese reißt ihre Tasche auf und lässt mich und Byatt sie durchwühlen. Mein Magen krampft sich zusammen, Speichel dick um meine Zunge. Alles, ich würde alles nehmen. Aber wir haben eine schlechte Ladung erwischt. Seife. Streichhölzer. Eine Schachtel Stifte. Eine Schachtel Munition. Und dann, ganz am Boden, eine Orange – eine echte Orange, die gerade erst angefangen hat zu schimmeln.
Blitzschnell greifen wir zu. Reese’ Silberhand ist an meinem Kragen, Hitze unter den Schuppen, aber ich werfe sie zu Boden, ramme ihr das Knie seitlich gegen das Gesicht. Ich werfe mich nach vorne und klemme Byatts Hals zwischen meine Schulter und meinen Unterarm. Eine von ihnen tritt, ich weiß nicht wer. Sie erwischt mich am Hinterkopf, und ich schlittere auf die Stufen der Treppe. Meine Nase trifft die Kante mit einem Krachen. Weißer Schmerz flammt auf. Um uns herum rufen die anderen Mädchen, umringen uns.
Jemand greift in mein Haar, ballt die Faust, reißt, reißt es aus. Ich drehe mich und beiße dort, wo die Sehnen sich unter ihrer Haut abzeichnen. Sie wimmert. Mein Griff lockert sich. Ihrer auch, und wir kriechen voneinander fort.
Ich schüttle das Blut aus meinem Auge. Reese liegt auf halber Höhe der Treppe mit der Orange in der Hand. Sie gewinnt.
Kapitel 2
Wir nennen es Tox, und während der ersten paar Monate haben sie versucht, Unterricht daraus zu machen. Virusausbrüche in der westlichen Welt: Eine Geschichte. »Tox« als Wurzel in romanischen Sprachen. Arzneimittel-Regularien im Staat Maine. Schule wie immer. Lehrerinnen, die mit Blut an der Kleidung vor der Tafel standen, Tests vorbereiteten, als wären wir eine Woche später alle noch am Leben. Die Welt endet nicht, sagten sie, und genauso wenig sollte es eure Ausbildung.
Frühstück im Speisesaal. Mathe, Englisch, Französisch. Mittagessen, Schießtraining. Sport und Erste Hilfe. Ms Welch verband Wunden, während die Schulleiterin uns mit Nadeln pikte. Gemeinsames Abendessen, und dann wurden wir eingeschlossen, damit wir die Nacht überstanden. Nein, ich weiß nicht, was euch krank macht, sagte uns Welch. Ja, es wird alles gut werden. Ja, ihr könnt bald nach Hause.
Das hörte schnell auf. Eine Unterrichtsstunde nach der anderen fiel aus, als die Tox eine Lehrerin nach der anderen erwischte. Regeln lösten sich auf und verschwanden, bis nur noch das Grundgerüst übrig war. Aber wir zählen noch immer die Tage, und das Erste, was wir morgens nach dem Aufwachen machen, ist, den Himmel nach Kameras oder Lichtern abzusuchen. Die Leute auf dem Festland sorgen sich um uns, das ist, was Welch immer sagt. Sie haben sich der Sache angenommen, von der Sekunde an, als die Schulleiterin Camp Nash angerufen und um Hilfe gebeten hat. Und sie suchen nach einem Heilmittel. Mit der ersten Vorratslieferung, die der Bootsdienst zurückbrachte, kam eine Nachricht. Unterschrieben und gedruckt auf Papier mit dem Briefkopf der Navy.
VON: Marineminister, Verteidigungsministerium
Kommandierender Offizier Chemical/Biological Incident Response Force (CBIRF), Direktor von Camp Nash, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
AN: Raxter Mädchenschule, Raxter Island
BETREFF: Vom CDC empfohlene Quarantänemaßnahmen
Vollständige Isolation und Quarantäne wird mit sofortiger Wirkung verhängt. Personen haben sich zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr zu jeder Zeit auf dem Schulgelände aufzuhalten. Der Aufenthalt jenseits des Zauns der Schule verstößt gegen die Quarantäneregeln. Ausnahme: autorisiertes Team zur Abholung von Versorgungslieferungen (siehe unten).
Telefon- und Internetverbindung werden in Kürze abgeschaltet. Jegliche Kommunikation hat über offizielle Funkkanäle zu erfolgen. Alle Informationen fallen unter die Geheimhaltung.
Versorgungslieferungen werden an westlicher Anlegestelle deponiert. Datum und Uhrzeiten werden über den Camp-Nash-Leuchtturm festgelegt.
Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten in Entwicklung. Das CDC arbeitet mit örtlichen Einrichtungen zwecks Heilmittel zusammen. Erwarten Sie Lieferung.
Warten und am Leben bleiben, und wir dachten, das würde einfach werden – gemeinsam hinter dem Zaun, sicher vor dem Wald und den Tieren, die hungrig und fremdartig geworden waren. Aber es starben immer mehr Mädchen. Krankheitsschübe zerstörten ihre Körper so sehr, dass sie nicht mehr atmen konnten, ließen Wunden zurück, die nicht mehr heilten. Manchmal überkam es sie auch wie ein Fieber, und sie richteten gewalttätige Ausbrüche gegen sich selbst. Es geschieht immer noch. Aber inzwischen haben wir gelernt, dass alles, was wir tun können, ist, auf uns und die unseren aufzupassen.
Reese und Byatt, sie gehören zu mir, und ich gehöre zu ihnen. Wenn ich am Schwarzen Brett vorbeigehe und mit den Fingern die vergilbte Nachricht der Navy streife, die dort immer noch hängt, dann sind sie es, für die ich bete. Die Nachricht ist ein Talisman, eine Erinnerung an das Versprechen, das sie uns gegeben haben. Es wird ein Heilmittel geben, wenn wir nur am Leben bleiben.
Reese gräbt einen silbernen Fingernagel in die Orange und beginnt, sie zu schälen. Ich zwinge mich wegzuschauen. Wenn es frisches Essen gibt, dann kämpfen wir darum. Sie sagt, es ist die einzig faire Art, es aufzuteilen. Keine Almosen, kein Mitleid. Sie würde nie etwas nehmen, wenn es sich nicht anfühlte, als hätte sie es verdient.
Ringsum versammeln sich die anderen Mädchen unter hellem Gelächter und durchwühlen die Kleidung, die aus jeder Tasche quillt. Die Navy schickt genug für die volle Anzahl an Schülerinnen. Blusen und winzige Schuhe, zu klein für irgendjemanden von uns.
Und Jacken. Sie hören nie auf, Jacken zu schicken. Nicht, seit der Frost das Gras überzieht. Es war gerade erst Frühling, als die Tox ausgebrochen ist, und über den Sommer ging es uns gut in unseren Schuluniformröcken und Blusen. Aber der Winter brach an, wie er es immer tut in Maine, lang und bitterkalt. Feuer brannten bei Tageslicht, und die Generatoren der Navy liefen bei Nacht, bis ein Sturm sie zerstört hat.
»Du hast da Blut«, sagt Byatt zu mir.
Reese schneidet ein Stück aus dem Saum ihrer Bluse und wirft es in Richtung meines Gesichts. Ich drücke es drauf. Meine Nase macht ein schmatzendes Geräusch.
Ein Kratzen ertönt über uns, es kommt aus dem offenen Zwischengeschoss über der Haupthalle. Wir schauen hinauf. Es ist Mona aus der Klassenstufe über uns, rotes Haar und herzförmiges Gesicht. Sie ist zurück aus der Krankenstation im zweiten Stock. Seit dem letzten Ausbruch war sie ewig dort oben, und ich glaube nicht, dass irgendwer damit gerechnet hat, dass sie je wieder herunterkommt. Ich erinnere mich, wie ihr Gesicht an diesem Tag dampfte und aufplatzte, wie sie unter einem Tuch hinaufgetragen wurde, als wäre sie bereits tot.
Jetzt verläuft ein Geflecht aus Narben über ihre Wangen, und ihre Haare haben einen leichten Schimmer, als würde eine Aura sie umgeben. Reese hat das auch – dieses Leuchten, das die Tox ihrem Haar gegeben hat. Es ist so sehr zu ihrem Erkennungszeichen geworden, dass es seltsam ist, es bei Mona zu sehen.
»Hey«, sagt sie, unsicher auf den Beinen.
Ihre Freundinnen rennen zu ihr, lächeln und gestikulieren aufgeregt, halten aber Abstand. Wir fürchten uns nicht vor Ansteckung – was auch immer es ist, wir haben es alle. Es ist das Auseinanderbrechen, das wir fürchten. Das Wissen, dass es irgendwann uns allen passiert. Das Wissen, dass wir nicht mehr tun können als hoffen, es zu überstehen.
»Mona! Gott sei Dank geht es dir gut«, rufen ihre Freundinnen, aber ich sehe, wie sie das Gespräch schnell versanden lassen, sehe dabei zu, wie sie nach und nach ins letzte Tageslicht hinauswandern und Mona allein auf der Couch zurücklassen, wo sie auf ihre Knie starrt. Mona hat keinen Platz mehr unter ihnen. Sie haben sich daran gewöhnt, dass sie nicht da ist.
Ich schaue zu Byatt und Reese hinüber, die nach demselben Splitter in der Treppe treten. Ich glaube nicht, dass ich mich je daran gewöhnen könnte, ohne sie zu sein.
Byatt steht auf, die Stirn gerunzelt. »Wartet hier«, sagt sie und geht zu Mona hinüber.
Die beiden reden einen Moment lang, Byatt beugt sich vor, damit ihre Stimme direkt Monas Ohr erreicht, der Schein von Monas Haar badet Byatts Haut in rotem Licht. Und dann richtet sich Byatt auf, und Mona drückt den Daumen gegen die Innenseite von Byatts Unterarm. Sie sehen beide verunsichert aus. Nur ein bisschen, aber ich bemerke es.
»Guten Abend, Hetty!«
Ich drehe mich um. Es ist die Schulleiterin, ihr Gesicht noch kantiger als früher. Graues Haar ist in einem festen Dutt hochgesteckt, ihre Bluse bis zum Kinn zugeknöpft. Und da ist ein Fleck um ihren Mund, leicht pink von dem Blut, das ständig zwischen ihren Lippen hervorquillt. Die Tox wirkt anders auf sie. Und auf Welch. Sie bringt sie nicht um wie die anderen Lehrerinnen, sie verändert nicht ihre Körper wie bei uns. Stattdessen öffnet sie nässende Wunden auf ihren Zungen und lässt ihre Glieder ohne Unterlass zittern.
»Guten Abend«, grüße ich die Schulleiterin. Sie drückt bei vielem ein Auge zu, aber nicht bei schlechten Manieren.
Sie deutet mit dem Kopf zur anderen Seite des Raums, wo sich Byatt immer noch über Mona beugt. »Wie geht es ihr?«
»Mona?«, frage ich.
»Nein, Byatt.«
Byatt hatte seit dem Spätsommer keinen Schub mehr, und bald ist der nächste an der Reihe. Sie kommen in regelmäßigen Abständen, jeder schlimmer als der davor, bis wir es nicht mehr aushalten. Aber nach dem letzten Mal kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Sie sieht nicht anders aus – sie ist nur ständig heiser, und entlang ihrer Wirbelsäule verläuft eine gezackte Reihe an Knochen, die hier und dort durch die Haut lugen. Aber ich erinnere mich an jede Sekunde dieses Schubs. Wie Byatt durch unsere alte Matratze blutete, bis es auf den Boden unter dem Bett tropfte. Wie sie vor allem verwirrt aussah, als die Haut über ihrer Wirbelsäule aufriss.
»Byatt geht es gut«, sage ich. »Aber es ist bald Zeit.«
»Das tut mir leid zu hören«, sagt die Schulleiterin. Sie beobachtet Mona und Byatt noch ein wenig länger mit gerunzelter Stirn. »Ich wusste nicht, dass ihr Mädchen mit Mona befreundet seid.«
Seit wann interessiert sie sich für so etwas? »Wir verstehen uns, schätze ich.«
Die Schulleiterin blickt mich an, als wäre sie überrascht, dass ich noch immer dort stehe. »Entzückend«, sagt sie und geht durch die Haupthalle und in den Gang, in dem ihr Büro liegt.
Vor der Tox haben wir sie jeden Tag gesehen, aber seitdem tigert sie entweder in der Krankenstation auf und ab oder schließt sich in ihrem Büro ein, wo sie die ganze Zeit am Funkgerät hängt, um mit der Navy und dem CDC zu reden.
Es gab hier noch nie Handyempfang – laut Broschüre stärkt das den Charakter –, und am ersten Tag der Tox haben sie die Festnetzverbindung gekappt. Zwecks Geheimhaltung. Aber immerhin konnten wir über das Funkgerät mit unseren Familien sprechen und hören, wie unsere Eltern um uns weinten. Bis wir auch das nicht mehr durften. Es machte zu viel die Runde, sagte die Navy, Maßnahmen waren erforderlich.
Die Schulleiterin gab sich keine Mühe, uns zu trösten. Es war längst alles viel zu trostlos.
Ihre Bürotür fällt hinter ihr zu und wird von innen abgeschlossen, gerade als Byatt zu uns zurückkehrt.
»Was war das?«, frage ich. »Mit Mona.«
»Nichts.« Sie zieht Reese auf die Füße. »Lasst uns gehen.«
Raxter liegt auf einem großen Grundstück am östlichen Ende der Insel. Die Schule ist an drei Seiten von Wasser umgeben, an der vierten liegt das Tor. Dahinter erstreckt sich der Wald mit den gleichen Kiefern und Fichten wie auf dem Gelände, nur dass sie dicht aneinanderstehen und miteinander verflochten sind. Neue Stämme winden sich um alte. Unsere Seite des Zauns ist ordentlich und sauber wie zuvor – nur wir sind anders.
Reese führt uns über das Gelände an die Spitze der Insel. Die Felsen wurden vom Wind glatt geschliffen und schichten sich übereinander wie der Panzer einer Schildkröte. Nun sitzen wir dort Seite an Seite, Byatt in der Mitte. Der kalte Wind weht ihr offenes Haar zwischen uns nach vorne. Heute ist es ruhig, der Himmel ist von einem klaren Nicht-Blau, und in der Ferne ist nichts zu sehen. Jenseits von Raxter wird das Meer tiefer, verschluckt Sandbänke und entwickelt reißende Strömungen. Keine Schiffe, kein Land am Horizont, keine Erinnerung daran, dass die Welt immer noch dort draußen ist, sich ohne uns weiterdreht, alles noch so, wie es war.
»Wie geht es dir?«, fragt Byatt. Sie fragt, weil die Narbe über meinem blinden Auge vor zwei Tagen aufgegangen ist. Sie ist ein Überbleibsel von den Anfängen, als wir noch nicht verstanden, was mit uns passierte.
Mein erster Schub zerstörte mein rechtes Auge und versiegelte es, und ich dachte, das wäre alles, bis irgendetwas darin zu wachsen begann. Es tat nicht weh, es juckte nur schrecklich, aber ich konnte fühlen, wie sich etwas bewegte. Deshalb habe ich versucht, es aufzureißen.
Das war dumm. Die Narbe ist Beweis genug dafür. Ich erinnere mich kaum noch an irgendetwas, aber Byatt sagt, ich hätte mitten in meiner Schicht beim Waffendienst das Gewehr fallen lassen und angefangen, mir das Gesicht zu zerkratzen, als ob ich besessen wäre. Ich habe die Fingernägel zwischen meine verkrusteten Augenlider geschoben und an meiner Haut gerissen.
Die Narbe ist größtenteils verheilt, aber hin und wieder geht sie auf, und Blut fließt über meine Wange, pink und wässrig vom Eiter. Wenn ich Waffendienst habe, bin ich mit genug anderen Dingen beschäftigt, aber nun kann ich meinen Herzschlag auf meiner Haut spüren. Vielleicht hat es sich entzündet. Allerdings ist so etwas die geringste unserer Sorgen.
»Kannst du es zunähen?« Ich versuche nicht nervös zu klingen, aber sie bekommt es trotzdem mit.
»So schlimm?«
»Nein, aber …«
»Hast du es wenigstens ausgewaschen?«
Reese gibt einen zufriedenen Laut von sich. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht offen lassen.«
»Komm her«, sagt Byatt. »Lass mich sehen.«
Ich rutsche auf den Felsen herum, sodass sie vor mir kniet und ich das Kinn zu ihr anhebe. Sie fährt mit den Fingern an der Wunde entlang, und etwas darunter zuckt zurück.
»Sieht aus, als würde es wehtun.« Sie zieht Nadel und Faden aus ihrer Tasche. Sie hat sie immer dabei, seit mein Auge zum ersten Mal vernarbt ist. Von uns dreien ist sie diejenige, die zuerst siebzehn wird, und in Momenten wie diesem merkt man das. »Okay, nicht bewegen.«
Sie sticht die Nadel hinein, und es tut weh, aber nicht sehr, die kalte Luft trägt den Schmerz davon. Ich versuche ihr zuzublinzeln, um sie zum Lächeln zu bringen, aber sie schüttelt den Kopf, und eine Falte bildet sich zwischen ihren Brauen.
»Ich sagte, nicht bewegen, Hetty.«
Alles ist gut, Byatt und ich, sie starrt mich an, so wie ich sie anstarre, und ich bin in Sicherheit. In Sicherheit, weil sie hier ist. Dann sticht sie mit der Nadel etwas zu tief, und ich bäume mich auf. Mein ganzer Körper krampft sich zusammen. Der blendende Schmerz ist überall.
Die Welt ringsum ist wasserverschleiert, und ich kann fühlen, wie Blut in mein Ohr läuft.
»O Gott!«, ruft Byatt. »Hetty, geht es dir gut?«
»Es sind doch nur ein paar Pikser«, sagt Reese. Sie liegt auf dem Rücken auf den Felsen, hat die Augen geschlossen. Ihre Bluse ist hochgerutscht, sodass ich einen blassen Streifen ihres Bauches sehen kann, ein starker Kontrast zum verschwommenen Rest. Ihr ist nie kalt, nicht einmal jetzt, während unser Atem Wolken in der Luft bildet.
»Na ja«, sage ich. Reese’ Hand macht ihr nie Ärger, nicht so wie mein Auge bei mir. Ich wische ein wütendes Knurren von meinen Lippen. Es gibt genug Grund zum Streiten, ohne dass man hier dran rührt. »Mach weiter.«
Byatt setzt an, etwas zu sagen, als ein Ruf aus der Nähe des Gartens ertönt. Wir drehen uns um, um zu sehen, ob jemand seinen ersten Ausbruch hat. Auf die Raxter School gehen Schülerinnen von der sechsten Klasse bis zur Highschool, oder zumindest war das mal so, also sind die jüngsten Mädchen inzwischen dreizehn. Als die ganze Katastrophe begann, waren sie elf. Und nun fängt es an, sie auseinanderzunehmen.
Aber es ist alles in Ordnung, es ist nur Dara aus unserer Jahrgangsstufe, das Mädchen mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern, die dort steht, wo die Felsen beginnen.
»Schießtraining!«, ruft sie. »Miss Welch sagt, es ist Zeit zum Schießen.«
»Komm.« Byatt verknotet den Faden und steht auf, reicht mir ihre Hand. »Ich mache den Rest nach dem Abendessen.«
—
Wir hatten schon vor der Tox Schießtraining, eine Tradition, die aus den Anfängen der Schule übrig geblieben war. Aber da war es anders als jetzt. Nur die Mädchen aus dem höchsten Jahrgang – und Reese, beste Schützin auf der Insel, ein Naturtalent, wie sie ein Naturtalent in allem war, was Raxter betraf – durften mit Mr Harker in den Wald gehen und auf Getränkedosen schießen, die er auf dem Boden aufgereiht hatte. Der Rest von uns erhielt eine Lektion im sicheren Umgang mit Feuerwaffen, die meistens zu einer Freistunde wurde, wenn Mr Harker mal wieder spät dran war.
Aber dann wurde Mr Harker von der Tox geholt. Und Reese’ Hand von ihr so verändert, dass sie den Abzug nicht mehr bedienen konnte. Das Schießen war kein Schießen mehr, sondern wurde zu Zielübungen. Denn nun gab es Dinge, die wir töten mussten. Alle paar Abende, wenn die Sonne untergeht, feuern wir, eine nach der anderen, so lange, bis wir mitten ins Schwarze treffen.
Wir müssen bereit sein, sagt Welch. Uns zu beschützen, andere zu beschützen. Während des ersten Winters hatte es ein Fuchs durch den Zaun geschafft. Er war zwischen den Stäben hindurchgeschlüpft. Später sagte das Mädchen vom Waffendienst, er habe sie an ihren Hund zu Hause erinnert, weshalb sie nicht abdrücken konnte. Deshalb hatte es der Fuchs bis zur Terrasse geschafft. Deshalb hatte er das jüngste noch lebende Mädchen in eine Ecke drängen und ihm die Kehle herausreißen können.
Wir üben im Stall, nahe der Spitze der Insel. Die Schiebetüren bleiben offen, sodass Fehlschüsse ins Meer fliegen. Es gab hier Pferde, vier von ihnen, aber früh während des ersten Zyklus fiel uns auf, dass die Tox sie genauso befiel wie uns. Die Knochen schoben sich durch die Haut der Tiere, dehnten ihre Körper, bis sie schrien. Also führten wir sie hinab zum Wasser und erschossen sie. Nun ist der Stall leer, und wir strömen hinein und warten darauf, dass wir mit dem Schießen an der Reihe sind. Man muss auf das Ziel feuern, und man darf nicht aufhören, bis man ins Schwarze getroffen hat.
Ms Welch hat die meisten Waffen in einem Schrank im Haus weggeschlossen. Genauso wie die Munition, die die Navy uns schickt, seit sie von den Tieren erfahren hat. Daher gibt es nur eine Schrotflinte und einen Karton mit Patronen für uns alle. Sie liegen auf einem Tisch aus zwei Holzböcken und einer dünnen Sperrholzplatte. Ganz anders als die Gewehre, mit denen wir beim Waffendienst schießen. Aber Welch sagt, eine Waffe ist eine Waffe, und jedes Mal zuckt dabei ein Muskel in Reese’ Kiefer.
Ich hieve mich auf die Tür einer Box und fühle, wie sie unter mir schwingt, als Byatt neben mir hinaufspringt. Reese lümmelt sich zwischen uns. Wegen ihrer Hand darf sie nicht schießen, aber sie ist trotzdem jeden Tag hier, beobachtet angespannt und schweigend das Ziel.
Irgendwann mal haben wir uns in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt, aber nun, da wir alle etwas verloren haben – Augen, Hände und Nachnamen –, kommen die ältesten Mädchen als Erste dran. Es geht schnell voran, die meisten sind gut genug, dass sie die Mitte nach wenigen Versuchen treffen. Julia und Carson brauchen zwei, danach eine endlose, beschämende Wartezeit, während Landry es öfter versucht, als ich zählen kann. Und schließlich ist unser Jahrgang dran. Byatt schafft es beim dritten Mal. Nicht schlecht, aber es gibt einen Grund, warum sie uns beide zur selben Waffenschicht einteilen. Wenn sie das Ziel nicht trifft, tue ich es.
Sie reicht mir die Schrotflinte, und ich hauche in meine Hände, um wieder Gefühl hineinzubekommen, bevor ich ihren Platz einnehme. Ich hebe die Flinte an meine Schulter und ziele. Einatmen, konzentrieren, ausatmen, den Finger krümmen. Das Geräusch vibriert durch mich hindurch. Es ist einfach. Es ist das Einzige, worin ich besser bin als Byatt.
»Gut, Hetty!«, ruft Welch. Irgendjemand hinten in der Menge imitiert lachend unsere Lehrerin. Ich verdrehe mein Auge, lege die Flinte auf den improvisierten Tisch und geselle mich wieder zu Reese und Byatt bei der Stalltür.
Normalerweise kommt Cat als Nächste dran, aber Unruhe entsteht, ein Wimmern ist zu hören, und dann wird Mona in die Mitte geschubst. Sie stolpert ein, zwei Schritte, dann fängt sie sich, sucht in den Gesichtern der Mädchen ringsum nach einem Anflug von Mitleid. Sie wird keines finden – dieser Tage heben wir es uns für uns selbst auf.
»Kann ich für heute passen?«, fragt sie an Welch gewandt. Auf Monas Gesicht zeichnet sich wächserne Ruhe ab, aber ihr Körper zittert. Fast hätte sie es geschafft, wäre fast nicht drangekommen. Aber der Rest von uns lässt das nicht zu. Genauso wenig wie Welch.
»Ich fürchte nicht.« Welch schüttelt den Kopf. »Auf geht’s.«
Mona sagt noch irgendetwas, aber es ist zu leise, als dass es irgendjemand verstehen könnte. Sie geht zum Tisch hinüber. Die Waffe liegt dort. Alles, was Mona tun muss, ist zielen und schießen. Sie nimmt die Schrotflinte auf, hält sie in den Armen wie eine Puppe.
»Wann immer du so weit bist«, kommt es von Welch.
Mona richtet sie auf das Ziel aus und legt einen Finger auf den Abzug. Wir sind alle still. Ihre Hände zittern. Irgendwie schafft sie es, weiterhin zu zielen, aber die Anstrengung setzt ihr zu.
»Ich kann nicht«, wimmert sie. »Ich bin nicht … Ich kann nicht.« Sie lässt die Flinte sinken und blickt in meine Richtung.
Das ist der Moment, in dem sie sich öffnen. Drei tiefe Schnitte an der Seite ihres Halses wie Kiemen. Kein Blut. Sie pulsieren nur mit jedem Atemzug, und irgendetwas bewegt sich unter der Haut.
Mona schreit nicht. Gibt keinen Laut von sich. Sie fällt einfach um. Flach auf den Rücken, schnappt mit offenem Mund nach Luft. Sie sieht mich immer noch an, ihre Brust hebt und senkt sich langsam. Ich kann nicht wegschauen, auch nicht, als Welch hinübereilt, sich neben Mona kniet und ihren Puls fühlt.
»Bringt sie in ihr Zimmer«, befiehlt Welch. In ihr Zimmer, nicht auf die Krankenstation, weil dort nur die schlimmsten Fälle landen. Und Mona war schon kränker als jetzt. Wir alle waren schon kränker.
Die Mädchen vom Bootsdienst, die man an den Messern erkennt, die sie in ihren Gürteln tragen dürfen, treten aus der Menge und nehmen Monas Arme. Es sind immer sie, die das übernehmen. Sie richten Mona auf und führen sie fort, zurück zum Haus.
Gemurmel und eine Pause. Als wir folgen wollen, räuspert sich Welch.
»Meine Damen«, sagt sie und zieht das Wort in die Länge wie sie es früher bei ihrem Schlafsaal-Kontrollgang getan hat. »Habe ich euch erlaubt zu gehen?« Niemand antwortet, und Welch hebt die Flinte auf, gibt sie dem Mädchen, das als Nächstes an der Reihe ist. »Wir fangen noch mal von vorne an.«
Niemand ist überrascht. Wir haben vergessen, wie das geht. Also stellen wir uns auf, warten und schießen. Und wir fühlen die Wärme – Monas Wärme –, die aus der Waffe in unsere Hände fließt.
—
Beim Abendessen sind wir vereinzelt und verstreut. Normalerweise schaffen wir es zumindest, im selben Raum zu sitzen, aber heute sind wir auseinandergegangen, sobald wir unsere Rationen von Welch bekommen haben. Einige sitzen hier in der Halle, andere in der Küche rings um den alten Holzofen, in dem der letzte Vorhang brennt, um sie warm zu halten. Nach Tagen wie diesem und Mädchen wie Mona driften wir auseinander und fragen uns, wer als Nächste dran ist.
Ich sitze auf der Treppe und lehne mit dem Rücken am Geländer. Wir drei haben heute als Letzte unser Essen bekommen, und es war kaum mehr etwas Gutes übrig: Nur die Kanten eines schimmligen Brotlaibs. Byatt sah aus, als wollte sie weinen, als das alles war, was ich mitbrachte. Keine von uns hat etwas zum Mittagessen bekommen, nachdem die Orange fairerweise an Reese ging. Aber zum Glück hat Carson vom Bootsdienst mir ein wenig abgelaufene Suppe gegeben. Wir warten auf den Dosenöffner, damit wir anfangen können zu essen. Bis dahin liegt Reese auf dem Boden und versucht zu schlafen, während Byatt nach oben schaut, dorthin, wo eine Tür die Treppe zum Krankentrakt im zweiten Stock versperrt.
Damals, als das Haus erbaut wurde, lagen dort die Dienstbotenquartiere. Sechs Zimmer in einem schmalen Gang, darüber die Dachterrasse und darunter die zwei Stockwerke hohe Halle. Man gelangt nur über die Treppe im Zwischengeschoss hinauf, und die liegt weggeschlossen hinter einer niedrigen, schiefen Tür.
Ich hasse es, diese Tür anzusehen, ich hasse es, an die kränksten Mädchen zu denken, die dort versteckt werden, ich hasse es, dass dort kein Platz für alle ist. Und ich hasse es, wie jede Tür dort oben von außen verriegelt werden kann. Wie man, wenn man wollte, jemanden dahinter einsperren könnte.
Stattdessen starre ich durch die Haupthalle zu den Glaswänden des Speisesaals hinüber. Lange leere Tische, die zu Feuerholz gemacht wurden, das gute Silber, das ins Meer geworfen wurde, damit wir keinen Zugang zu Messern haben. Früher ist das mein liebster Raum im ganzen Haus gewesen. Nicht an meinem ersten Tag, als ich nicht wusste, wo ich mich hinsetzen sollte, aber an jedem Tag danach, als ich zum Frühstück herunterkam und Byatt sah, die mir einen Platz frei hielt. In unserem ersten Jahr hatte sie ein Einzelzimmer, und sie stand gerne früh auf, um auf dem Gelände spazieren zu gehen. Ich traf sie immer im Speisesaal, wo sie mit Toast auf mich wartete. Vor Raxter habe ich Toast mit Butter gegessen, aber Byatt hat mir beigebracht, dass Marmelade besser ist.
Cat fängt über die Halle hinweg meinen Blick auf und hält den Dosenöffner hoch. Ich stoße mich vom Geländer ab und gehe zu ihr hinüber, weiche dabei vier Mädchen aus, die in einem Viereck auf dem Boden liegen. Ihre Köpfe ruhen auf den Bäuchen der jeweils anderen, und sie versuchen einander zum Lachen zu bringen.
»Du hast also Carson zum Nachgeben gebracht«, sagt Cat, als ich näher komme. Sie hat dunkles Haar – so glatt und fein –, dunkle, aufmerksame Augen und eine der schlimmsten Formen der Tox. Wochenlang lag sie in einem Krankenzimmer, die Hände gefesselt, damit sie nicht ihre eigene Haut aufkratzen konnte, die kochte und blubberte. Sie hat die Narben noch, weiße Male wie von den Pocken am ganzen Körper und Beulen, die mit jedem Zyklus neu entstehen und bluten.
Ich löse den Blick von einer frischen an ihrem Hals und lächle. »War nicht schwierig.« Sie gibt mir den Dosenöffner, und ich stecke ihn in meinen Hosenbund, ziehe die Bluse darüber, sodass niemand ihn mir auf dem Weg zurück zur Treppe stehlen kann. »Geht’s euch gut? Habt ihr es warm genug?« Sie trägt nur das abnehmbare Innenfutter der Jacke ihrer Freundin Lindsay. Die beiden hatten kein Glück bei der letzten Auslosung der Kleidung, und niemand schafft es, eine Decke lange zu behalten, außer man lässt sie nie aus den Augen.
»Uns geht’s gut«, sagt Cat. »Danke, dass du fragst. Und hey, wegen der Suppe, pass auf, dass der Deckel der Dose nicht gewölbt ist. Wir haben genug Sorgen, ohne dass jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt.«
»Ich gebe es weiter.«
Das ist Cat, freundlich auf ihre eigene Art. Sie ist aus unserem Jahrgang, und ihre Mutter ist in der Navy, genau wie mein Vater. Raxter und Camp Nash verkörpern hier oben meilenweit die einzige Zivilisation, und über die Jahre haben sie sich so miteinander verbunden, dass Raxter Stipendien an Navy-Mädchen vergibt. Das ist der einzige Grund dafür, warum ich hier bin. Der einzige Grund, warum Cat hier ist. Am Ende jedes Quartals nahmen wir zusammen den Bus zum Flughafen, sie auf dem Weg zur Basis in San Diego und ich auf dem Weg zur Basis in Norfolk. Sie hat mir nie einen Platz frei gehalten, aber wenn ich mich neben sie setzte, hat sie immer gelächelt und zugelassen, dass ich an ihrer Schulter einschlafe.
Ich nehme gerade wieder neben Byatt Platz, als bei der Vordertür Unruhe entsteht. Dort, wo sich einige von Landrys Mädchen zusammengefunden haben. Man kann uns alle in vielleicht elf oder zwölf Gruppen aufteilen – einige größer, andere kleiner –, und die größte Gruppe hat sich um Landry gesammelt, zwei Jahre über mir und aus einer alten Bostoner Familie, die sogar älter als Byatts ist. Sie konnte uns noch nie besonders leiden, vor allem nicht, seit Reese ihr einmal auf ihre Beschwerde hin, dass es keine Jungs auf der Insel gebe, mit ausdruckslosem Gesicht geantwortet hat: »Aber mehr als genug Mädchen.«
Es ließ etwas in meiner Brust hüpfen, etwas, das ich immer noch nachts fühlen kann, wenn Reese’ Zopf sein unstetes Leuchten an die Decke wirft. Eine Sehnsucht. Ein Wunsch.
Aber sie ist zu weit weg. Sie war schon immer zu weit weg.
Jemand schreit auf, und wir sehen zu, wie Bewegung in die Gruppe kommt und sie sich zu einem Ring verstrickt, der sich dicht um einen Körper drängt, der am Boden liegt. Ich lehne mich vor und versuche einen Blick zu erhaschen. Schimmerndes braunes Haar, die Gestalt zerbrechlich und kantig.
»Ich glaube, es ist Emmy«, sage ich. »Sie hat ihren Ersten.«
Emmy war in der sechsten Klasse, als die Tox kam. Die Schülerinnen in ihrem Jahrgang sind eine nach der anderen Hals über Kopf in die Pubertät gestürzt; deren erste Schübe sind kreischend explodiert wie Feuerwerk. Nun ist schließlich Emmy dran.
Wir lauschen ihrem Wimmern, während ihr Körper zittert und krampft. Ich frage mich, was sie wohl bekommt. Kiemen wie Mona, Beulen wie Cat, Knochen wie Byatt oder eine Hand wie die von Reese. Aber manchmal gibt einem die Tox nichts, sondern nimmt und nimmt. Lässt einen ausgelaugt und vertrocknet zurück.
Endlich ist Ruhe. Die Gruppe um Emmy löst sich langsam auf. Sie selbst sieht okay aus für ihren ersten Ausbruch. Ihre Beine sind wackelig, als sie wieder aufsteht. Und selbst von hier kann ich die Adern in ihrem Hals sehen, die sich wie Blutergüsse dunkel von ihrer Haut abheben.
Vereinzelt gibt es Applaus, als Emmy den Staub von ihrer Jeans klopft. Julia, ein Mädchen vom Bootsdienst, reißt ein Stück aus ihrem trockenen Brötchen und wirft es Emmy zu. Irgendjemand wird heute Nacht ein Geschenk unter Emmys Kopfkissen schieben. Vielleicht ein paar Haarspangen oder eine rausgerissene Seite aus einem der Magazine, die immer noch die Runde machen.
Landry umarmt sie, und Emmy strahlt, so stolz, so gut hindurchgekommen zu sein. Ich denke, später, wenn der Adrenalinschub nachlässt und Landry nicht da ist, wird es sie wirklich treffen. Der wahre Schmerz. Die Veränderung.
»Ich bin immer noch traurig«, sage ich. »Niemand hat mir irgendetwas für mein erstes Mal geschenkt.«
Byatt lacht. Mit flinken Fingern öffnet sie die Suppendose, und sie gibt mir den Deckel. »Hier, mein Geschenk an dich.«
Ich lecke die Gemüsepampe ab, die am Deckel klebt, und ignoriere dabei das Prickeln der Säure. Byatt nimmt einen Schluck Suppe. Sobald sie ein Drittel getrunken hat, wird sie sie an mich weitergeben. Reese kommt immer als Letzte dran. Anders kann man sie nicht dazu bringen zu essen.
»Wann, glaubt ihr, pinnen sie die neue Liste für den Bootsdienst an?«, fragt Byatt laut. Sie redet mit mir, aber eigentlich fragt sie für Reese – Reese, die praktisch von Beginn an in den Bootsdienst wollte.
Ihre Mutter hat Raxter verlassen, bevor ich herkam, aber ich kannte ihren Vater, Mr Harker. Er war der Gärtner, Hausmeister und Mädchen für alles, und er lebte in einem Haus außerhalb des Geländes, am Rand der Insel. Zumindest bis die Tox kam und ihn die Quarantäne und die Navy zu uns schickte, um bei uns zu leben. Das tut er nicht mehr. Als die Tox bei ihm anfing, ist er in den Wald gegangen, und seitdem versucht Reese, ihm zu folgen.
Der Bootsdienst ist der einzig mögliche Weg. Der einzige Weg, um auf die andere Seite des Zaunes zu gelangen. Normalerweise sind es immer dieselben drei Mädchen, bis eines von ihnen stirbt, aber vor ein paar Tagen gab das dritte Mädchen, Taylor, bekannt, dass dies ihre letzte Schicht sein würde. Sie ist eine der Ältesten hier, sie hat sich immer gekümmert, alle getröstet und jeden wieder zusammengenäht. Wir verstehen nicht, was dafür gesorgt hat, dass sie aufhören will.
Es gibt ein Gerücht, das besagt, dass es etwas mit ihrer festen Freundin Mary zu tun hat, die letzten Sommer wild geworden ist. Am einen Tag war Mary noch hier, und am nächsten war sie fort – nur die Tox war noch übrig in ihrem Körper, kein Licht mehr in ihren Augen. Taylor war an diesem Tag bei ihr, hat sie niedergerungen und ihr in den Kopf schießen müssen. Alle denken, dass sie deswegen den Bootsdienst verlassen will, aber als Lindsay sie gestern danach gefragt hat, hat Taylor ihr mit dem Handrücken ins Gesicht geschlagen, und seitdem hat es niemand mehr erwähnt.
Aber das hält uns nicht davon ab, uns Gedanken zu machen. Taylor sagt, es gehe ihr gut, dass alles normal ist, aber den Bootsdienst aufzugeben, das ist nicht normal. Welch und die Schulleiterin werden bald einen dritten Namen anpinnen müssen, jemanden, der ihren Platz einnimmt.
»Vielleicht morgen«, sage ich. »Ich kann fragen.«
Reese öffnet die Augen. Ihre silbernen Finger zucken. »Mach das nicht. Du verärgerst Welch nur.«
»Na gut«, sage ich. »Aber mach dir keine Sorgen. Du bekommst den Platz.«
»Wir werden sehen«, sagt Reese. Das sind nicht die nettesten Dinge, die wir je zueinander gesagt haben, aber sie kommen schon nah dran.
In dieser Nacht stellt Byatt die Naht über meinem Auge fertig, und danach kann ich nicht schlafen. Ich starre die Unterseite von Reese’ Bett an, dorthin, wo Byatt ihre Initialen eingeritzt hat. Sie macht das überall. BW. BW. BW. Am Bett, auf ihrem Tisch in jedem Klassenraum, in dem wir waren, an den Bäumen in dem Gehölz nahe beim Wasser. Sie markiert damit Raxter als ihres, und manchmal denke ich, wenn sie mich fragen würde, dann würde ich sie dasselbe mit mir machen lassen.
Die Stille zieht und zieht sich, bis sie schließlich um Mitternacht herum von zwei Schüssen durchbrochen wird. Ich spanne mich an, warte, aber es dauert nur einen Augenblick, bis die Rufe vom Waffendienst herunterwehen: »Gesichert!«
Über mir schnarcht Reese. Sie hat das obere Bett, Byatt und ich teilen das untere, so dicht aneinandergepresst, dass ich ihre Zähne knirschen hören kann, wenn sie träumt. Die Heizung ist vor einer Weile ausgefallen, und wir schlafen so dicht wie möglich beisammen, in unseren Jacken, in allem. Ich kann in meine Tasche greifen und die Patrone dort fühlen, die glatte Oberfläche ihrer Hülle.
Wir haben davon gehört, kurz nachdem Welch den Waffendienst eingerichtet hatte. Die erste Schicht hatte etwas vom Dach aus gesehen. Sie konnten sich nicht einigen, was es war – das eine Mädchen sagte, es habe undeutlich geschimmert und sich fast wie ein Mensch bewegt, in einem langsamen und gemessenen Schritt. Ein anderes Mädchen sagte, dafür sei es zu groß gewesen. Aber es erschreckte sie genug, um alle Mädchen vom Waffendienst im kleinsten Zimmer im ersten Stock zu versammeln und uns beizubringen, wie wir eine Patrone öffnen, wie wir das mulmige Gefühl in unseren Mägen ignorieren und wie wir das Schießpulver als Gift schlucken. Für den Fall, dass wir irgendwann mal sterben müssen.
In manchen Nächten wandern meine Gedanken zu dieser Sache, fragen sich, was es gewesen sein könnte, was sie gesehen haben könnten. Es hilft, die glatte Patrone in meiner Hand zu spüren, zu wissen, dass ich sicher bin, vor was auch immer sie gesehen haben und wovor auch immer sie Angst haben. Aber heute Nacht kann ich nur Mona sehen – Mona, die die Flinte hält, und Mona, die aussieht, als würde sie sich selbst in den Kopf schießen wollen.
Bevor ich nach Raxter kam, hatte ich noch nie eine Waffe in der Hand gehalten. Bei meinen Eltern gab es eine im Haus, wenn mein Vater da war – die Pistole, die er von der Navy hatte –, aber er schloss sie immer weg. Byatt hat zuvor noch nicht mal eine in echt gesehen.
»Ich bin aus Boston«, hat sie sich verteidigt, als Reese und ich lachten. »Wir haben da unten nicht so viele wie ihr hier.«
Ich erinnere mich daran, weil sie ansonsten fast nie von ihrem Zuhause sprach. Sie erwähnte es nie beiläufig, wie ich das oft mit Norfolk tat. Ich glaube nicht, dass sie ihr Zuhause je vermisst hat. Raxter erlaubt keine Handys, das hieß, wenn wir zu Hause anrufen wollten, dann mussten wir uns während der Freizeitstunde am Nachmittag für das Festnetztelefon im Büro der Schulleiterin anstellen. Ich habe sie nie dort gesehen. Nicht ein einziges Mal.
Ich drehe mich um und schaue sie an, ausgestreckt neben mir. Sie döst bereits. Wenn ich aus einer Familie wie ihrer stammen würde, blaues Blut und viel Geld, dann hätte ich es vermisst. Aber das ist der Unterschied zwischen uns. Byatt hat noch nie irgendetwas gewollt, das sie nicht schon hatte.
»Hör auf, mich anzustarren.« Sie pikt mir in die Rippen.
»Sorry.«
»So eine Spannerin«, grummelt sie, aber sie verhakt ihren kleinen Finger mit meinem und dämmert wieder weg.
Ich muss danach eingeschlafen sein, denn für eine Weile ist da nichts, dann blinzle ich, und dann knarzen die Dielen, und Byatt liegt nicht mehr bei mir im Bett. Sie steht an der Schwelle und schließt die Tür hinter sich, als sie reinkommt.
Wir dürfen unsere Zimmer nachts nicht verlassen, nicht einmal, um am anderen Ende des Flurs auf die Toilette zu gehen. Die Dunkelheit ist zu allumfassend, Welchs Ausgangssperre zu streng. Ich stemme mich auf die Ellenbogen hoch, aber ich liege im Schatten, und sie sieht mich deshalb wahrscheinlich nicht. Stattdessen hält sie am Fuß des Betts inne und klettert die Leiter hinauf zu Reese.
Eine von ihnen seufzt, und Stoff raschelt, als sie es sich gemütlich machen. Reese’ gelb-weißer Zopf hängt von ihrem Bett und schwingt sacht über mir hin und her. Er bewegt sich federleicht und zeichnet ein sachtes Lichtmuster an die Decke.
»Hetty schläft?«, fragt sie.
Ich weiß nicht warum, aber ich atme langsamer, stelle sicher, dass sie nicht merken, dass ich sie hören kann.
»Ja.«
»Was ist los?«
»Nichts«, sagt Byatt.
»Du bist rausgegangen.«
»Ja.«
Es schmerzt. Warum hat sie mich nicht mitgenommen? Und warum ist es Reese, die davon erfährt? Es ist nicht vorgesehen, dass Byatt in Reese irgendetwas sieht, das sie nicht in mir finden kann.
Eine von ihnen bewegt sich, wahrscheinlich Byatt, die sich an Reese kuschelt. Byatt schläft gerne eng angekuschelt. Ich wache immer mit ihren Händen in den Taschen meiner Jeans auf.
»Wohin bist du gegangen?«, flüstert Reese.
»Spazieren«, antwortet sie, aber ich weiß, wie eine Lüge klingt. Niemals würde sie sich hinausschleichen, nur um sich die Beine zu vertreten. Das tun wir jeden Morgen lang genug. Nein, tief in ihrer Stimme verborgen liegt ein Geheimnis, und normalerweise teilt sie sie mit mir. Was ist jetzt anders?
Reese antwortet nicht, und Byatt redet weiter. »Welch hat mich auf dem Rückweg erwischt.«
»Verdammt!«
»Es ist okay. Ich war nur unten in der Halle.«
»Was hast du gesagt?«
»Ich hab gesagt, dass ich eine Flasche Wasser hole wegen Kopfweh.«
Reese’ Silberhand zieht ihren Zopf aus meinem Blickfeld. Ich kann mir das verschlossene Glimmen ihrer Augen vorstellen und den harten Zug um ihren Mund. Oder vielleicht ist sie im Dunkeln weicher. Vielleicht öffnet sie sich ganz, wenn sie glaubt, unbeobachtet zu sein.
Ich habe sie zum ersten Mal an dem Tag getroffen, an dem ich nach Raxter kam. Ich war dreizehn, aber nicht wirklich dreizehn, nicht dreizehn mit Brust und Hüften und gefletschten Zähnen. Ich hatte Byatt schon auf der Fähre vom Festland zur Insel getroffen, und das war kurz und knapp gewesen. Sie wusste genau, wer sie war und wer ich sein sollte, und sie passte genau in all die Stellen von mir, die ich selbst nicht füllen konnte. Reese war anders.
Sie saß auf der Treppe in der Haupthalle, ihre Uniform zu groß, ihre Kniestrümpfe bis zu den Knöcheln hinuntergerutscht. Ich weiß nicht, ob sie da schon Angst vor ihr hatten oder ob es etwas anderes war; ob die Tatsache, dass sie die Tochter des Hausmeisters war, für die anderen etwas anderes bedeutete als für mich. Aber die anderen Mädchen in unserem Jahrgang hatte sich am Kamin versammelt, so weit weg von ihr wie möglich.
Byatt und ich gingen auf unserem Weg zu den anderen an ihr vorbei, und daran, wie Reese mich ansah – damals schon wütend, damals schon voller Feuer –, erinnere ich mich wie an nichts anderes.
Für eine Weile danach gab es nichts zwischen uns dreien, was uns verband. Nur der Unterricht und hin und wieder ein Nicken im Flur auf dem Weg zu den Duschen. Dann brauchten Byatt und ich eine dritte Person für unser Gruppenprojekt in Französisch, und Reese war die Klassenbeste – sie hatte ein paar Tests zuvor Byatt überholt. Also wählten wir sie.
Mehr war nicht nötig. Reese saß beim Essen neben uns, Reese saß bei Schulversammlungen neben uns. Falls ich mich daran erinnerte, wie sie mich an jenem ersten Tag angeschaut hatte oder wie mein Magen jedes Mal flatterte, wenn sie meinen Namen sagte, dann spielte es keine Rolle. Das tut es immer noch nicht. Näher werde ich ihr nie kommen – sie im Bett über mir, ihre Stimme sanft in der Dunkelheit, während sie mit jemand anders redet.
»Denkst du«, sagt sie nach einer Weile, »dass es schlimmer wird?«
Ich kann förmlich hören, wie Byatt mit den Schultern zuckt. »Wahrscheinlich.«
»Wahrscheinlich?«
»Ich meine, ich weiß es nicht«, sagt Byatt. »Sicher. Aber nicht für alle.« Für einen Moment ist Stille, und dann ertönt wieder ihre Stimme, so leise, dass ich mich anstrengen muss, um etwas zu verstehen. »Hör mal, wenn du irgendetwas weißt …«
Ein Scharren von Reese’ Schuhen, als sie sich wegdreht. »Geh runter. Du nimmst mir zu viel Platz weg.«
Manchmal frage ich mich, ob sie anders war, bevor ihre Mutter gegangen ist. Ob sie zugänglicher war. Aber ich kann mir eine solche Reese gar nicht vorstellen.
Ende der Leseprobe