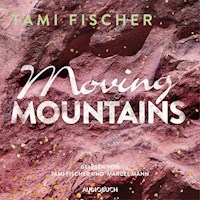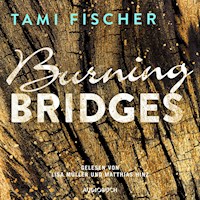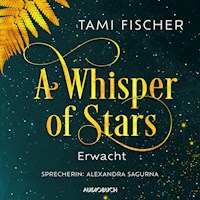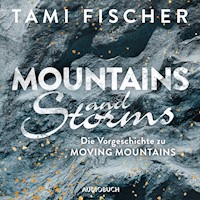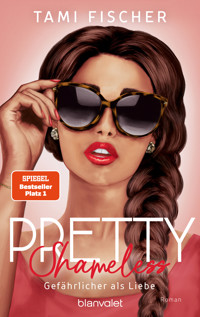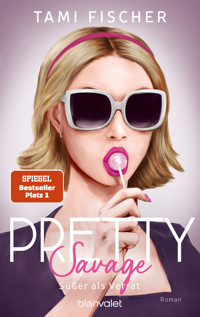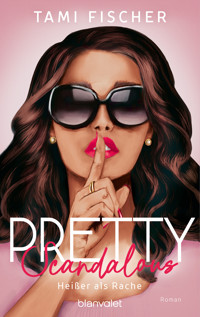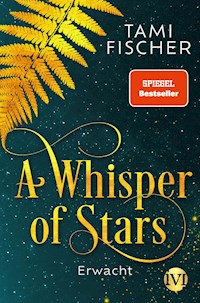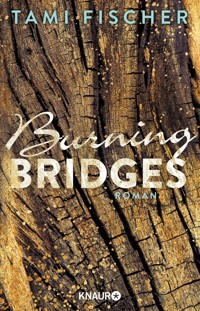
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Serie: Fletcher University
- Sprache: Deutsch
Im New Adult Liebesroman »Burning Bridges« von Spiegel-Bestseller-Autorin Tami Fischer trifft die Studentin Ella auf den geheimnisvoll-attraktiven Ches. Was sie nicht weiß: Er lebt im Untergrund, nur dort ist er vor seiner Vergangenheit sicher. Und je näher sie ihm kommt, desto größer wird die Gefahr, in die sie sich begibt … Ein gefühlsintensiver, mitreißender, romantischer Liebesroman, der dich nicht mehr loslassen wird. Wenn wir aufeinandertreffen, sprühen keine Funken. Wenn wir aufeinandertreffen, gehen wir in Flammen auf. Sein Name lautete Ches. Das war alles, was ich wusste. Keine Vergangenheit und keine Identität. Alles an ihm strahlte Gefahr aus, doch ich schaffte es einfach nicht, mich von ihm fernzuhalten. Ich war Metall und er der Magnet, welcher mich anzog. Doch nicht nur mich zog er an; auch Dunkelheit und Ärger und Geheimnisse begleiteten ihn wie Motten das Licht. Ich war vielleicht gebrochen, aber wenn er mich für schwach hielt, machte er einen Fehler. Ich würde jedes seiner Geheimnisse lüften. Und wenn ich brennen musste, um seine Dunkelheit zu vertreiben, würde ich jede Sekunde im Feuer genießen. Tami Fischer ist Buchhändlerin, Buch-Bloggerin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie liebt romantische Geschichten und hat mit »Burning Bridges« ihre erste eigene gefühlvolle und spannende Romance geschrieben. Es handelt sich um Teil 1 einer Reihe, die in den USA an der Fletcher University spielt und sich rund um Ellas Clique dreht. In den Folgebänden der Fletcher-University-Reihe wird jeweils eine Freundin von Ella im Mittelpunkt stehen. Entdecke doch gleich Teil 2 der Reihe, den Spiegel-Bestseller »Sinking Ships«, in dem Carla für ihre Liebe zu Mitchell ihre größte Angst überwinden muss … Die Bände der College Romance sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Burning Bridges (Ella & Ches) - Sinking Ships (Carla & Mitchell) - Hiding Hurricanes (Lenny & Creed) - Moving Mountains (Savannah & Maxx), mit Kurzgeschichte »Mountains and Storms« - Crushing Colors (Summer & Brigham)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tami Fischer
Burning Bridges
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn wir aufeinandertreffen, sprühen keine Funken. Wenn wir aufeinandertreffen, gehen wir in Flammen auf.
Sein Name lautete Ches. Das war alles, was ich wusste. Keine Vergangenheit und keine Identität. Alles an ihm strahlte Gefahr aus, doch ich schaffte es einfach nicht, mich von ihm fernzuhalten. Ich war Metall und er der Magnet, welcher mich anzog. Doch nicht nur mich zog er an; auch Dunkelheit und Ärger und Geheimnisse begleiteten ihn wie Motten das Licht. Ich war vielleicht gebrochen, aber wenn er mich für schwach hielt, machte er einen Fehler. Ich würde jedes seiner Geheimnisse lüften. Und wenn ich brennen musste, um seine Dunkelheit zu vertreiben, würde ich jede Sekunde im Feuer genießen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Epilog
Danksagung
Der Soundtrack von Burning Bridges
Für Leyla
Kapitel 1
Ich holte aus und schleuderte ihm meinen Drink ins Gesicht.
Normalerweise neigte ich nicht zu Wutausbrüchen. Ich würde sogar sagen, dass ich ziemlich friedvoll war und einen kühlen Kopf bewahren konnte. Doch diesmal war es nicht so.
Inbrünstig feuerte ich das Glas hinterher und ließ dabei ein nicht gerade damenhaftes Grunzen erklingen.
»Ella!«, schrie Jason empört und duckte sich gerade noch rechtzeitig. Das Glas zersprang geräuschvoll an der Wand hinter ihm, was das ganze Restaurant verstummen ließ.
»Verschwinde!«, kreischte ich und wich zurück. Meine Wangen brannten vor Scham. Ich konnte spüren, dass alle Augen auf uns gerichtet waren. Auf mich. Das irregewordene Blondchen.
Wütend rieb Jason sich den Long Island Ice Tea aus den Augen und starrte mich so fassungslos an, als wäre ich diejenige gewesen, die soeben die Ich-habe-dich-betrogen-Bombe hatte platzen lassen. »Das ist nicht dein beschissener Ernst, El. Ich dachte, ich bedeute dir etwas!«
Ich ballte die Hände zu Fäusten, um sie daran zu hindern, über den kleinen Tisch zu langen und ihn zu erdrosseln. »Du erzählst mir, dass du mit Erica schläfst, und stellst dann infrage, ob du mir etwas bedeutest?« Knurrend packte ich den Brotkorb und feuerte ihn in sein Gesicht. Diesmal schaffte es Jason nicht, auszuweichen, und fluchte, als der Korb ins Schwarze traf.
»Zur Hölle, Ella! Du bist durchgeknallt!«
»Nein, mit dir zur Hölle! Es ist vorbei!«
»Ich weiß, ich habe ja auch eben mit dir Schluss gemacht!«
Ich zitterte vor Wut und vor Schmerz und hasste mich für die Tränen, die mir in die Augen schossen. Mir war so schlecht. Meine Knie waren weich. »Verschwinde, Jase. Ich will dich nie wiedersehen. Du bist ein krankes, verlogenes –«
Eine Hand packte meinen Arm und ließ mich abrupt verstummen.
Ich blickte auf und schnappte nach Luft. Ein Sicherheitsmann sah finster auf mich hinab und verstärkte seinen Griff. »Miss, ich muss Sie bitten, umgehend das Restaurant zu verlassen.«
Ich biss mir auf die Lippe und blickte verstohlen zu Jason. Es war, als würde ich plötzlich einem vollkommen Fremden gegenüberstehen und nicht meinem Freund – jetzt Ex-Freund.
Er funkelte mich noch immer voller Verachtung an, ein Ausdruck, den ich auf seinem Gesicht noch nie gesehen hatte und der mir glatt das Herz in der Brust in Stücke riss. Krümel klebten ihm in den blonden Haaren, und sein halber Oberkörper war getränkt in Long Island Ice Tea. Ich wünschte, es wäre mir egal gewesen, wie selbst das seiner durchtrainierten Figur schmeichelte. Zur Hölle mit Sportlern! Ich hatte Football sowieso noch nie gemocht. Und das hatte ich jetzt davon – zwei vergeudete Jahre meines Lebens. Zwei!
Er schüttelte angewidert den Kopf. »Das ist allein deine Schuld, Ella. Ich wollte in Ruhe mit dir über die Sache reden, wie Erwachsene das eben so machen. Aber du tickst vollkommen aus. Erica hatte recht, ich hätte dich schon vor Monaten abservieren sollen.«
Seine Worte versetzten mir einen so heftigen Schlag in die Magengrube, dass ich die Zähne zusammenbeißen musste, um nicht zu Boden zu gehen.
Bevor ich etwas erwidern oder noch etwas in sein blödes Gesicht werfen konnte, zerrte der Sicherheitsmann mich auch schon zum Ausgang. Von jedem Tisch, den wir dabei passierten, und vom Barbereich musterte man mich, als wäre ich eine Verbrecherin oder so was. Es war der wohl erniedrigendste Augenblick meines Lebens.
Ich liebte das Black Birch. Jason und ich waren einmal im Monat hergekommen, und wir kannten die Speisekarte in- und auswendig. Seitdem ich einundzwanzig war, kamen wir sogar her, um an der Bar Drinks zu trinken. Hier hatte ich Jasons Eltern kennengelernt, und hier hatte sogar unser erstes Date stattgefunden. Wir hatten unsere Jahrestage hier verbracht, und zu besonderen Anlässen hatte Jase mir immer einen Drink spendiert.
Tja, anscheinend war sein heutiges Anliegen so besonders für ihn gewesen, dass er mir meinen liebsten Drink spendieren musste.
Bitterkeit stieg in mir auf. Erica war meine Freundin. Sie war in meiner Lerngruppe, und ich hatte sie zu Beginn des Semesters meinen Freundinnen vorgestellt, sie in unsere Gruppe integriert und sie zu den Mädelsabenden eingeladen. Sie wusste alles über Jase und mich. Jeden noch so kleinen Herzschmerz hatte sie sich angehört, wie eine gute Freundin das eben tat, und hatte mir immer wieder den Rücken gestärkt.
Ihr Verrat grub sich so fest in meine Brust, bis ich das Gefühl hatte, nicht mehr atmen zu können.
Ich stolperte vor die Tür, als der Sicherheitsmann mich losließ, und drehte mich zu ihm um. Ich musste ein bezauberndes Bild abgeben. Fleckige Wangen, glasige Augen und zitternde Hände.
»Tut mir leid«, sagte ich kleinlaut.
Er schwieg und verschränkte bloß die Arme vor der Brust. Ich entdeckte ein Geschirrtuch, das in seine Hosentasche gesteckt war.
Das wurde ja immer besser. Er war kein Sicherheitsmann. Er war der Barkeeper, und wenn ich es richtig verstanden hatte, war dieser auch der Besitzer des Black Birch.
Ich stöhnte auf und rieb mir mit den Händen über das Gesicht. Ich wusste, was auf mich zukam, doch ich musste es von ihm hören. »Habe ich Hausverbot?«
Der Mistkerl lachte tatsächlich auf. »Und wie Sie Hausverbot haben. Schönen Abend noch, Miss.«
»Aber ich –«
Er zog die Tür hinter sich zu und ließ mich verstummen.
Bewegungsunfähig stand ich da. Die Geräusche aus dem Black Birch drangen nur noch gedämpft zu mir durch, irgendwo in der Nähe hupte ein Auto, und das leise Rauschen eines Flugzeuges vibrierte weit über mir in der Nacht.
Einatmen.
Ausatmen.
Einatmen.
Du schaffst das.
Ich konnte nicht glauben, dass das gerade wirklich alles passierte. Das war ein böser Traum, weiter nichts. Zwischen Jason und mir lief es doch gut. Das musste ein böser Traum sein. Ich konnte Menschen einschätzen, dafür hatte ich schon immer ein Gespür gehabt. Ich kannte meinen Freund. Wir hatten einfach so gut zusammengepasst. Er, der begabte Quarterback, und ich … seine nicht zu nerdige und nicht zu tussihafte Freundin. Wir hatten vielleicht öfter gestritten, aber gepasst hatte es trotzdem immer.
Nun, ganz offensichtlich war das nicht die Wahrheit. Ich war eine Idiotin. Und ich hatte mir eine verdammte Lüge vorleben lassen.
Mein Magen krampfte sich zusammen. Seit letztem Sommer, hatte Jason gesagt. Er und Erica trafen sich schon seit letztem Sommer. Jetzt war es Anfang September, das war ein ganzes verdammtes Jahr. Die Hälfte unserer Beziehung. Wie konnten er und Erica mir das antun? Wie konnten sie so falsch, so widerlich sein?
Ich raufte mir die Haare und lief ziellos die Straße hinunter. Meinen Mantel hatte ich in der Garderobe hängen lassen, aber das war mir egal. Ich traute mich nicht, wieder hineinzugehen und ihn zu holen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit zog ich mein Handy aus der Hosentasche und öffnete den Gruppenchat mit meinen Freundinnen. Heiße Wut packte mich.
Drei Sekunden nachdem ich Erica Odell aus der Chatgruppe geworfen hatte, wurde ich auch schon angerufen.
Es war Summer.
»Hey«, sagte ich müde.
»Was ist los, El? Wieso hast du Erica rausgeschmissen?«
Meine Zunge wollte sich weigern, die Worte zu formen. »Erica und Jason schlafen seit letztem Sommer miteinander. Er hat mich gerade abserviert, und ich habe ab jetzt Hausverbot im Black Birch.«
Summer schwieg. Vermutlich überlegte meine beste Freundin gerade, ob ich mir einen schlechten Scherz mit ihr erlaubte.
Ich dachte bereits, sie hätte aufgelegt, als sie plötzlich in den Hörer kreischte und mir fast das Telefon aus der Hand fiel.
»Ist das dein Ernst? Dieses verlogene Miststück! Ella, es tut mir so leid. Das hast du nicht verdient. Die beiden werden in der Hölle schmoren!«
»Ist schon okay, Summer. Ich –«
»Hast du den Verstand verloren? Nichts ist okay!«
Sie hatte recht. Nichts war verdammt noch mal okay.
»Weißt du was, El? Ich werde jetzt Ericas Mutter anrufen und auspacken. Ich erzähle ihr alles, auch die Sache mit dem Koks auf der Verbindungsparty letzten Monat.«
Ich öffnete den Mund und schloss ihn kurz darauf wieder. Ehrlich gesagt war es mir nur recht.
»Karma, Baby«, knurrte Summer. »Sie werden bekommen, was sie verdienen!«
»Danke«, murmelte ich.
»Wo bist du jetzt?«
Ich sah mich um. Die Straßen waren leer und wurden nur vom orangenen Licht der Laternen beleuchtet. »Keine Ahnung, ich bin nach dem peinlichen Rausschmiss einfach losgelaufen. Ich besorg mir gleich irgendwo ein Taxi.«
»Soll ich dich holen kommen? Ich will nicht, dass du nachts allein durch die Straßen läufst. Vor allem nicht in deinem Zustand.«
»Nein, ich glaube, ich muss jetzt allein sein. Kannst du Savannah Bescheid sagen? Ich habe keine Lust, das alles noch mal zu erzählen.«
Summer atmete hörbar aus. »Klar, wie du willst. Aber ruf mich sofort an, wenn du kein Taxi findest, verstanden?«
»Klar. Hab dich lieb«, sagte ich und legte auf. Meine Finger kribbelten. Ich hatte das Bedürfnis, mein Handy, so fest ich nur konnte, auf den Boden zu pfeffern. Am liebsten hätte ich einfach alles zerschmettert, inklusive mich selbst. Ich war so wütend, dass ich befürchtete, in Flammen aufzugehen.
Erst als ich erstickt nach Luft schnappte, bemerkte ich, dass ich weinte. Es waren tiefe, heftige Schluchzer, und sie schüttelten mich.
Unbeirrt lief ich weiter. Ich wischte mir im Sekundentakt die bitteren Tränen von den Wangen und schlang die Arme um meinen Oberkörper. Der kühle Spätsommerwind drang durch meinen dünnen Pullover und ließ eine Gänsehaut auf meinen Armen zurück.
Als ich eine nach Rauch stinkende Bar passierte, hörte ich die kleine Glocke ihrer Tür läuten. Lachende Stimmen durchschnitten die Stille der Straßen. Ich lief schneller in der Hoffnung, sie durch pure Willenskraft verstummen lassen zu können. Gott, ich hasste Spaß. Und Menschen und Gelächter und alle Typen dieser Welt. Mit dem heutigen Tag schwor ich offiziell der Liebe ab. Vielleicht hatte Summer mit ihrem zynischen Gejammer recht; diese verlogenen, selbstgefälligen, rückgratlosen –
»Hey, Süße!«, rief jemand hinter mir, gefolgt von Gelächter.
Ich ballte die Hände zu Fäusten und beschleunigte schluchzend meine Schritte.
»Nicht so schnell!«
»Du hast einen ziemlich heißen Hintern!«
Ich blieb stehen und wirbelte wutentbrannt herum. »Halt den Mund!«
Es waren drei Kerle. Ich erkannte keinen von ihnen wieder, worüber ich insgeheim froh war. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass mich jemand so sah, den ich kannte.
Einer von ihnen vergrub die Hände in den Hosentaschen und schlenderte dümmlich grinsend auf mich zu. Mein ganzer Körper bebte. Na schön – sollte er versuchen, mich anzufassen, würde ich ihm definitiv zwischen die Beine boxen.
»Du siehst traurig aus«, sagte er und blieb vor mir stehen. Er stank nach Alkohol und Rauch und hatte ein Ziegenbärtchen.
Erst würde ich ihn schlagen, dann würde ich ihm sagen, dass er hässlich war.
Wow, ich war echt in Kampflaune. Ella 1.0 war wohl heute Nacht gestorben, da ihr das Herz aus der Brust gerissen worden war, und Ella 2.0 war eine Schlägerbraut und fies.
»Soll ich dich aufheitern?«, fragte er und grinste breiter.
»Ich passe. Du stinkst und bist nicht mein Typ.« Ich funkelte ihn an. »Und wenn du mir noch näher kommst, wirst du dir wünschen, es nie getan zu haben.«
Seine Freunde brachen erneut in Gelächter aus und warfen die Köpfe zurück.
Ziegenbärtchens Grinsen wurde breiter. Seine geröteten Augen wanderten nach unten und verharrten auf meinen Brüsten. »Ich wünsche mir vor allem, das Gesicht in denen zu vergraben.«
Intuitiv verschränkte ich die Arme vor meiner Brust und wich zurück. Trotz meiner Wut konnte ich spüren, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich sollte weglaufen. Sofort. Ein ungutes Gefühl beschlich mich, doch etwas sagte mir, dass es bereits zu spät war, um still und heimlich das Weite zu suchen.
Mir wurde kalt.
»Mann, belästige die Kleine nicht so«, mischte sich einer von Ziegenbärtchens Freunden ein. Er und der andere traten ebenfalls näher. Sie trugen aufgeknöpfte Polohemden und hatten zu viel Gel in den Haaren. Einer von ihnen taumelte stark. »Sieh mal, sie zittert. Nimm sie in den Arm, Connor, und sag ihr, dass es dir leidtut, was meinst du?«
Das Blut in meinen Adern gefror, und der Atem blieb mir im Hals stecken. Ich war wie betäubt. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg.
Ich konnte mich jedoch nicht bewegen.
»Kommt noch einen Schritt näher, und ich tue euch weh«, warnte ich mit dünner Stimme. Mein ganzer Körper war zum Zerreißen angespannt. Ich war bereit, mich zu verteidigen. Zumindest würde ich, sollte einer von ihnen eine plötzliche Bewegung machen, schreien und hoffen, jemand würde mich hören. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte Summer zum Selbstverteidigungskurs im Frühjahr begleitet. Ich war ein Paradebeispiel für unüberlegte Dämlichkeit. Drei betrunkene Kerle hatten mich in die Enge getrieben. Oh Gott. Nicht gegen einen von ihnen hätte ich auch nur eine Chance gehabt.
Eine Hand legte sich auf meine Schulter, und ich schrie aus vollem Hals.
»Scheiße, die Kleine ist verrückt!«
Einer von ihnen legte mir einen Arm um die Hüfte. Er oder ein anderer lachte, und ich stieß mit dem Rücken so fest gegen die Hauswand hinter mir, dass mir die Luft aus der Lunge gepresst wurde. Unfähig, an etwas anderes zu denken, als mich von diesen Händen zu befreien, schlug ich panisch um mich. Nein. Das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren! Das Blut rauschte in meinen Ohren wie ein Wasserfall, und das Herz galoppierte durch meine Brust, als wäre es wild geworden und wolle ausbrechen. Der Gestank von Rauch und Alkohol und Schweiß umgab mich, und das Lachen der Kerle sowie ihre Worte vermischten sich zu einem undefinierten Brei.
Plötzlich wurden die Hände von mir weggerissen.
Ich keuchte und plumpste wie ein Sack Kartoffeln zu Boden. Jemand zerrte die Kerle fort von mir, alle drei.
»Verschwindet«, sagte eine tiefe Stimme, die zu keinem der Typen gehörte.
Mit aufgerissenen Augen beobachtete ich, wie ein großer, breitschultriger Mann sich vor den Betrunkenen aufbaute.
»Verpiss dich!«, knurrte Ziegenbärtchen angriffslustig und machte taumelnd einen Schritt auf ihn zu. Im Schein der Laterne wirkte sein Gesicht rot und glänzte schwitzig. »Das hier geht dich nichts an! Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß.«
»Tut so, als wärt ihr nie hier gewesen, und ich folge euch nicht«, drohte der Unbekannte. Seine Jeansjacke war dreckig, und eine löchrige Kapuze war ihm tief ins Gesicht gezogen. Meine Augen huschten hin und her. Was genau ging hier gerade vor sich?
»Komm schon, Connor«, raunte einer der Hemdträger und hielt seinen Freund zurück. »Du weißt, was dein alter Herr tut, wenn du dich wieder in eine Schlägerei verwickeln lässt.«
»Wir gehen doch jetzt nicht einfach!« Ziegenbärtchen musterte den vermummten Typen, als würde er einen wie ihn zum Frühstück verspeisen – obwohl der Mann doppelt so breit war wie er selbst. Dann spuckte er vor ihn auf den Boden. »Erst recht nicht, wenn so was wie das da aus der Gosse gekrochen kommt und glaubt, uns den Spaß verderben zu können.«
Den Spaß verderben.
Stöhnend lehnte ich den Kopf gegen die Wand und grub die Finger in meine Knie. Mir wurde noch schlechter, als mir bereits war. Wieso hatte ich mich nicht von Summer abholen lassen? Wo war mein gesunder Menschenverstand, wenn ich ihn brauchte? Und wieso zum Teufel geschahen so viele furchtbare Dinge innerhalb eines einzigen Abends?
Die Stimme meines Retters klang mit einem Mal gefährlich. »Hör auf deinen Freund. Verschwindet, bevor es euch noch leidtut.«
»I-ich rufe die Polizei«, meldete ich mich zu Wort. »Mein Abend ist schon beschissen genug.«
»Tu nicht so, als hättest du nicht von uns angesprochen werden wollen, Schlampe«, knurrte Ziegenbärtchen und funkelte mich wütend an.
Im nächsten Moment hatte sich der Vermummte vor ihm aufgebaut. Er sagte etwas, was ich nicht hören konnte. Doch die Augen der Jungs richteten sich auf mich, die Polohemdträger wichen zurück. Sie zerrten Ziegenbärtchen gewaltsam mit sich und warfen uns letzte vernichtende Blicke zu, ehe sie sich umdrehten und die Straße hinunter flüchteten.
Ich stieß hart den Atem aus, als mich eine Mischung aus Adrenalin und Erleichterung so sehr überschwemmte, dass mir schwindelig wurde. Meine Hände waren kalt und gleichzeitig schwitzig. Vielleicht hatte ich ja irgendeinen Gott verärgert, der es sich nun zur Aufgabe machte, mein Leben zu zerrupfen.
Als mich jemand an der Schulter berührte, schrie ich erschrocken auf.
»Es ist okay, sie sind weg«, sagte mein Retter beschwichtigend und bot mir eine Hand an.
Mein Mund war trocken. Von den betrunkenen Mistkerlen war nichts mehr zu sehen. Wir waren allein.
Zögernd ergriff ich seine Hand und ließ mir auf die Beine helfen. Sobald ich stand, wich er so schnell vor mir zurück, als hätte er sich verbrannt.
Wir starrten uns an. Im Licht der Laternen sah ich endlich sein Gesicht – mehr oder weniger. Die Kapuze hüllte seine Augen noch immer in Schatten, und er hatte einen dunklen, dichten Vollbart. Mehr konnte ich nicht sehen.
»Willst du dir kein Taxi rufen?«, fragte er leise, als ich nichts anderes tat, außer dazustehen und ihn anzustarren.
»D-doch«, sagte ich kleinlaut und senkte den Blick.
Mit heißen Wangen holte ich mein Telefon hervor und wählte den Taxidienst. Bevor ich die Nummer anrief, blickte ich noch einmal auf. Er beobachtete mich.
»Danke«, murmelte ich.
»Ist schon okay«, erwiderte er wie aus der Pistole geschossen.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich meine das ernst. Danke. Ich fühl mich wie der größte Vollidiot. Keine Ahnung, wieso ich mich mit denen angelegt habe.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich dich unglaublich naiv oder mutig finden soll.« Er bemerkte wohl, wie ich die Augenbrauen zusammenzog, denn er fügte hinzu: »Vielleicht ist es ein bisschen von beidem.«
Ich rief das Taxiunternehmen an und bestellte mir einen Wagen, indem ich, ein wenig umständlich, über Google Maps meinen Standort bestimmte. Währenddessen klebten meine Augen auf dem Asphalt, und ich spielte nervös mit meinen Haaren herum. Ich fröstelte, sowohl äußerlich wie auch innerlich. Vielleicht sollte ich auswandern. Zumindest ein anderer Bundesstaat würde es schon tun. Hauptsache, weit weg von dem, was hier gerade passiert war – und von Jason und Erica. Konnte ich mir sicher sein, nicht im falschen Film zu stecken? Jase hatte mich wirklich und wahrhaftig nach zwei Jahren Beziehung abserviert. Und das hier …
Als Schritte erklangen, blickte ich auf. Mein Retter hatte sich umgedreht – und ging. Gleichzeitig kam ein Taxi um die Ecke gebogen, das ganz offensichtlich meins sein musste.
»Hey!«, rief ich ihm hinterher. Er blieb nicht stehen.
»Wo gehst du hin?«
»Gern geschehen«, sagte er bloß und machte sich nicht einmal die Mühe, sich zu mir umzudrehen.
Er verschwand einfach hinter der nächsten Ecke.
Kapitel 2
Ich rückte in der Warteschlange auf. Das Café war voller Menschen, die mindestens so müde aussahen, wie ich mich fühlte.
Mein erster Kurs begann erst in einer halben Stunde. Ich musste zugeben, ich war an die andere Seite von Fletcher gefahren, nur um Kaffee zu holen, damit mich niemand dabei erwischen konnte, wie ich mich versteckte.
War das erbärmlich? Oh ja, mit großer Sicherheit.
Ob mir das egal war?
Definitiv.
Ich hatte mich das komplette Wochenende in meiner Wohnung verschanzt, ausschließlich Pizza vom Lieferservice gegessen und wie ein Baby geheult. Meine Freundinnen Summer und Savannah hatten vorbeikommen wollen, doch ich hatte mit Ausreden um mich geworfen und das Handy ausgeschaltet. Ich hatte allein sein müssen, um meine Wunden zu lecken und zu trauern. Ich hatte immer gedacht, dass ich nicht in der Lage wäre, inbrünstig zu hassen. Ella Johns, 21 Jahre alt, der sarkastische Sonnenschein von nebenan. Doch die beiden hatten mir das Gegenteil bewiesen. Ich konnte sehr wohl hassen, und zwar so sehr, dass mir schwindelig wurde. Und das war ja nicht mal alles. Wenn es mir nicht gut ging, schlief ich normalerweise die meiste Zeit, doch diesmal konnte ich es nicht, weil ich immer wieder daran denken musste, was in dieser Straße passiert war, nachdem ich aus dem Black Birch geworfen wurde. Das alles war mir einfach zu viel. Wenn ein gebrochenes Herz wenigstens den Vorteil gehabt hätte, den Heißhunger abzustellen, dann hätte ich mich mit den Worten »Wer schön sein will, muss leiden« retten können. Doch nicht einmal das war der Fall.
Jason war so kalt gewesen. Er hatte nicht einmal mit der Wimper gezuckt, als er mir im Restaurant alles gestanden hatte. Wenn man es überhaupt so nennen konnte. Er hatte den Eindruck gemacht, als hatte er es schnell hinter sich bringen wollen, wie eine lästige Aufgabe, die ihm übertragen worden war. »Ich hätte dich schon vor Monaten abservieren sollen.« Ich konnte nicht fassen, dass mein Jason so was zu mir sagte. Ich war seine Ella. Und wie sollte ich es meiner Mutter beibringen? Nach dem Tod meines Dads war Jase für mich und meine Familie da gewesen.
Ein Knoten bildete sich in meinem Hals. Die Art von Knoten, der ich schon seit langer Zeit verboten hatte, aufzutauchen.
Ich dachte an meinen Dad.
Nicht nur an dieses Wort: Dad. Ich dachte an sein Gesicht, die Grübchen, die er mir vererbt hatte, und die vielen Lachfalten um seine warmen Augen herum. Das dunkelblonde Haar und an seinen Geruch. Ich dachte an sein furchtbares Lieblingspolohemd mit dem orangefarbenen Kragen und sein lautes Lachen, wenn er einen absolut nicht komischen Witz gerissen hatte, was Mum immer dazu gebracht hatte, die Augen zu verdrehen und gequält zu grinsen.
Wenn mein Vater bloß hier gewesen wäre … Ich wollte meinen Kopf an seine Schulter lehnen, jetzt mehr denn je. Ich wollte, dass er mir zur Aufmunterung seine berühmte heiße Schokolade machte, die jeden noch so dunklen Tag aufhellen konnte. Mit Marshmallows, Schlagsahne, Streuseln und extra viel Schokolade. Ich wollte mit ihm und Mum am Coldwater River spazieren gehen und über das Leben philosophieren. Und am liebsten wollte ich von ihm in den Arm genommen werden. So fest, dass mich nichts und niemand mehr zerbrechen konnte.
Ich zwang mich, nicht daran zu denken, wie ausgemergelt er ausgesehen hatte, besonders während seiner letzten Monate im Krankenhaus. Wenn ich mich an ihn erinnerte, wollte ich ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn kannte. Voller Tatendrang und Lebensfreude und mit einem fröhlichen Funkeln in den warmen Augen.
Doch er war nicht mehr da. Es gab nur noch Mum, Tante Kat und mich. Wir waren es ihm schuldig, dass wir weiterlebten, auch wenn er es nicht tat, und dass wir versuchten, glücklich zu werden. Anders hätte er es nicht gewollt. Das sagte meine Mutter zumindest immer wieder, und ich wusste, dass es stimmte.
Ich atmete tief durch. Meine Augen brannten, was mich mit aller Kraft blinzeln ließ. Hör auf damit. Nicht daran denken. Nicht davon runterziehen lassen. Das ist Regel Nummer 1. Erst wieder auf dem Friedhof, nur dort, nirgendwo anders.
Und jetzt stand ich also hier, als Dritte in der leidigen Schlange des Coffeeshops, mit violetten Schatten unter den Augen, und blinzelte angestrengt, um nicht schon wieder in Tränen auszubrechen. Von denen hatte ich in den letzten Tagen genug gehabt. Wenn Dad mich so sehen könnte, wäre er bestimmt enttäuscht. Ich konnte nicht zulassen, dass dieser letzte Freitagabend von nun an bestimmte, wer und wie ich war. Dazu durfte ich es nicht kommen lassen. Das musste ich um jeden Preis im Keim ersticken.
Als ich endlich an der Reihe war, bestellte ich fünf glasierte Donuts, zwei Croissants und zwei Bagel, ein Stück Red-Velvet-Kuchen, dann noch einen Chai Latte und eine Flasche grünen Smoothie – Letzteres, um mir einzureden, dass meine Ernährung noch nicht vollkommen verdorben war.
»Die Lerngruppe wird sich über das Frühstück freuen«, log ich und lächelte schwach, als der Barista mit hochgezogenen Augenbrauen zusah, wie ich die volle Papiertüte und die Getränke entgegennahm. Ich flüchtete, bevor ich noch im Erdboden versinken konnte.
Gerade als ich alles in meinem kleinen Auto vor dem Café verstaut hatte, blickte ich auf und … sah ihn.
Meine Hände hörten auf, herumzukramen. Ungläubig starrte ich auf die andere Straßenseite.
War das überhaupt möglich?
Er ließ sich gerade auf eine Sitzbank fallen und lehnte das Gesicht der frühen Morgensonne entgegen.
Er war es, da war ich mir sicher, und das, obwohl ich ihn Freitagnacht kaum hatte erkennen können. Doch diesmal sah ich ein Gesicht.
Ein Gesicht, das vollkommen lädiert war.
»Oh mein Gott«, flüsterte ich. Hastig krabbelte ich aus dem Auto, blickte die Straße auf und ab und rannte auf die andere Seite. Er hatte mich noch nicht bemerkt.
Erst als ich mit flachem Atem vor ihm stand, regte er sich. Das Herz rutschte mir in die Hose, und ich hielt die Luft an. Irgendwie hatte ich ihn weniger … einnehmend in Erinnerung gehabt. Doch seine Schultern waren breit und seine Arme muskulös, was mich augenblicklich einschüchterte. Das wellige braune Haar reichte ihm bis unter das Kinn, und der Bart, welcher dunkler war als seine Haare, war voll und ein wenig verwildert.
Leicht neigte er den Kopf zur Seite und sah mich an. Seine Augen waren von einem strahlenden Hellgrau und schienen mich zu durchbohren. Außerdem war eines leicht zugeschwollen, und seine rechte Wange war dick und aufgeplatzt. Die Wunde war nicht frisch, das Blut war trocken. Doch er sah furchtbar aus. Er sah gefährlich aus. Und vermutlich war es das Beste, wenn ich einfach ging und mich nicht umdrehte.
»Hi«, sagte ich, unfähig, den Blick von ihm zu lösen.
Er blinzelte mich an, was beinahe ungläubig wirkte. »Da bist du ja.«
»D-da bist du ja?«, wiederholte ich.
»Man sieht sich immer zwei Mal im Leben. Damit hätte sich das erledigt.« Er schloss die Augen und lehnte das Gesicht wieder gen Himmel, womit für ihn offenbar das Gespräch beendet war.
»Oh«, murmelte ich. Vermutlich hatte er recht. Es war nichts weiter als Zufall, dass wir uns hier begegneten. Unbeholfen stand ich neben der Bank und biss mir auf die Lippe. Seine geschlossenen Augen erlaubten es mir, ihn genauer anzusehen. Seine Jeansjacke war schmutzig und löchrig, ebenso seine schwarze Jeans. Getrocknetes Blut klebte in seinem Bart. Er sah wirklich aus, als könnte er eine lange, heiße Dusche gebrauchen. Aber auch ohne den Schmutz und das Blut war seine Haut nicht blass. Eher so, als würde er viel Zeit draußen verbringen. Ich fragte mich, wie sein Gesicht aussehen würde, hätte er nicht diesen Vollbart gehabt – und wenn die eine Hälfte seines Gesichts nicht so geschwollen gewesen wäre.
Mir wurde plötzlich kalt, als mich eine Erkenntnis überkam.
»Du bist ja immer noch hier«, sagte er mit seiner tiefen, rauen Stimme, ohne seine Haltung zu verändern.
»Waren die das?«, platzte es aus mir heraus. Ich ballte die Hände zu Fäusten. »Die Kerle von Freitagabend? Haben sie dir das angetan?«
Jetzt öffnete er doch die Augen und sah mich mit finster zusammengezogenen Brauen an, was grimmiger nicht hätte aussehen können. »Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen, Kleine. Belassen wir es dabei, dass du sicher nach Hause gekommen bist.«
»Hast du schon gefrühstückt?«
Das schien ihn kalt zu erwischen. Er wirkte perplex. »Was?«
»Du weißt schon – Kaffee, Tee, Sandwiches oder Müsli oder Porridge.«
Er setzte sich aufrechter hin und musterte mich nun um einiges aufmerksamer.
»Magst du Bagel?«, fragte ich hastig, bevor er Nein sagen konnte. »Ich habe auch Donuts, wenn dir so was lieber ist. Lass mich dich einladen.« Ich biss mir wieder auf die Lippe. »Bitte«, fügte ich hinzu. Das war immerhin das Mindeste, was ich tun konnte. Himmel, wäre ich nicht gewesen, wäre er nicht zusammengeschlagen worden. Es war meine Schuld! Weil ich zu verletzt und zu stolz gewesen war, um mich von Summer abholen zu lassen. Ein Frühstück war vielleicht nicht alles, aber ein Anfang.
Er seufzte schwer und fuhr sich durch das zerzauste Haar.
»Du musst doch bestimmt ans College. Hast du keine Kurse?«
»Ich gehe nicht hin.« Beschämt bemerkte ich, wie trotzig ich klang.
Mein Herz vollführte einen Sprung, als die Bedeutung meiner Kurzschlussreaktion zu mir durchdrang. Oh Gott. Ich hatte noch nie einen Kurs geschwänzt. Andererseits war ich Ella 2.0. Wer wusste schon, was alles in mir schlummerte?
Mein Retter wirkte nicht überzeugt, doch ich schob das Kinn nach vorne und verschränkte die Arme. Mit dieser Haltung hatte ich in meiner Kindheit bereits meine Eltern herausgefordert – auch wenn in meinem Fall herausfordern bedeutete, dass ich um mehr Taschengeld, Briefpapier oder Actionfiguren gebettelt hatte. Vielleicht hätte ich rebellischer sein sollen, so wie Summer.
»Du wirst mich nicht in Ruhe lassen, bis ich Ja sage, oder?«, brummte er.
Ich lächelte ihn an. »Vermutlich nicht.«
»Na schön.«
Erstaunt beobachtete ich, wie er aufstand und seinen Nacken dehnte. Er musterte mich eindringlich und vergrub die Hände in den Jackentaschen. Irgendetwas an seinem Blick drang bis unter meine Haut und wollte mich dazu bringen, woanders hinzusehen.
»Du willst frühstücken gehen?«, fragte er. »Dann gehen wir frühstücken.«
Ein triumphierendes Grinsen stahl sich auf meine Lippen.
»Ich heiße übrigens Ella«, sagte ich und streckte meine Hand aus.
»Ella«, wiederholte er leise. Er ergriff meine Hand und drückte sie sanft. »Ich bin Ches.«
»Cool. Ist das ein Spitzname? Steht Ches für Chester?«
Er verzog keine Miene, nickte aber. »Ja. Genau.«
Ich räusperte mich und schüttelte seine Hand, was sich jedoch irgendwie fehl am Platz anfühlte. Seine Berührung machte mich nervös.
Ernsthaft, Ella?
Hastig wich ich zurück und drehte mich zur Straße um. Als sie frei wurde, eilte ich auf die andere Seite. Großartig. Jetzt machte mich schon der Händedruck eines Fremden nervös. Vielleicht war mein Körper ja kaputtgegangen. Der Herzensbruch konnte andere wichtige Organe zerschmettert haben und den Teil in mir, der für das Zuordnen von Reaktionen verantwortlich war. Was kam wohl als Nächstes? Ein Orgasmus, sobald ich einen Schmetterling fliegen sah?
»Wo gehen wir hin?«, fragte Ches hinter mir.
»Zu mir«, sagte ich, ohne nachzudenken. Dann erstarrte ich erschrocken und blickte über die Schulter. »I-ich meine, wir können auch im Auto essen. Das Café ist bloß voll, und –«
»Gehen wir hin, wo immer du willst«, unterbrach er mich.
Ich drehte mich zu ihm um und lächelte vorsichtig. Vermutlich hielt er mich für eine Irre. Was zum Teufel stimmte nicht mit mir?
Wir erreichten mein Auto, und ich fischte den Schlüssel aus meiner Jeanstasche.
»Du kannst die Tüte auf die Rückbank legen«, sagte ich, ehe ich mich auf die Fahrerseite fallen ließ und die Tür zuzog. Einen Moment später tat Ches es mir nach und stellte wortlos den Pappbecherhalter mit den Getränken auf seine Knie. Erst als er mit mir in meinem Auto saß, fiel mir auf, wie klein es wirklich war. Zumindest im Vergleich zu ihm. Er war nicht nur verblüffend breit, sondern auch groß.
Was tust du hier, Ella Johns?
Ich startete den Motor und fädelte mich in den Verkehr ein. Fieberhaft überlegte ich, was ich sagen konnte, während sich die Stille zwischen uns ausbreitete. Es war ein Fehler, dass ich ihn zum Essen eingeladen hatte. Er wirkte nicht so, als säße er gerne hier, und meine Mutter würde mir jetzt wohl sagen, dass es vor allem ein Fehler war, ihn verdammt noch mal zu mir nach Hause eingeladen zu haben.
Ich räusperte mich. »Also, Ches«, sagte ich langsam. »Gehst du auch aufs College?«
Er schnaubte leise, woraufhin ich ihm einen flüchtigen Blick zuwarf. Mit finsterer Miene starrte er aus dem Fenster. »Sehe ich so aus, als würde ich aufs College gehen?«
Meine Wangen wurden heiß. Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte. Jetzt konnte man mir zumindest nicht mehr vorwerfen, ich hätte nicht versucht, ein Gespräch anzufangen.
»Tut mir leid«, murmelte Ches nach einem Moment. »Nein. Ich gehe nicht aufs College.«
Ein überraschtes Lächeln machte sich auf meinen Lippen breit. Schon besser. »Und was machst du dann?«
»Hör mal, wir müssen das nicht tun. Du schuldest mir nichts.«
»Ich lade dich doch nur zum Essen ein.«
»Nein, du versuchst wiedergutzumachen, dass ich dir Freitagabend geholfen habe. Fakt ist aber, dass jeder vernünftige Mensch an meiner Stelle so gehandelt hätte. Das wäre so was wie unterlassene Hilfeleistung gewesen, hätte ich nicht eingegriffen.«
Ich murmelte etwas und blieb an einer roten Ampel stehen.
Ches lachte auf, was mich zusammenzucken ließ. »Hast du mich gerade Arschloch genannt?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Machst du immer so ein Drama, wenn dich jemand zum Essen einlädt?«
Er schien kurz darüber nachzudenken. »Nein, mache ich nicht. Liegt vermutlich daran, dass mich nie jemand zum Essen einlädt.«
»Tja«, sagte ich und konzentrierte mich wieder auf die Straße. »Jetzt schon.«
Fletcher war zwar kein weißer Fleck auf der Landkarte, jedoch auch keine gigantische Metropole. Es war groß genug, um als Stadt zu gelten, gleichzeitig aber auch so klein, dass man den Überblick behielt.
Bereits ein paar Minuten später bog ich in meine Straße ab und parkte den Wagen neben dem Haus. Ches trug Tüte und Getränke und folgte mir zur Tür.
Das Haus, in dem sich meine Wohnung befand, war nichts Besonderes. Es lag zwar nicht in Uninähe, dafür aber in einer ruhigen Gegend von Fletcher. Die Fassaden der Nachbarhäuser bestanden wie bei meinem aus roten Ziegelsteinen, was mich vor zwei Jahren, als ich eingezogen war, so sehr verwirrt hatte, dass ich mich mehr als einmal in der Tür geirrt hatte. Niemals hätte ich die Wohnung ergattern können, hätte meine Tante Kat nicht ihre Kontakte spielen lassen. Meine Tante kannte jeden in der Stadt und schien jederzeit und immerzu über alles Bescheid zu wissen. Manchmal konnte das wirklich gruselig sein.
»Die Eingangstür ist kaputt«, erklärte ich, als ich sie aufdrückte, ohne meinen Schlüssel zu benutzen. »Der Hausmeister wollte sich schon vor Wochen darum kümmern, aber er schiebt es dauernd vor sich her. Außerdem ist meine Klingel kaputt, deswegen rufen mich meine Freunde meistens an, bevor sie kommen, oder sie klopfen einfach.«
Ich hatte keine Ahnung, wieso ich plötzlich so plapperte. Vermutlich gab es kaum etwas, was Ches weniger interessierte, als die Defekte in meinem Wohnkomplex.
Als wir die Treppenstufen im Haus hinaufgingen, wurde ich zunehmend nervöser. Nüchtern betrachtet war ich ein Idiot. Ich lud einen Fremden, der noch dazu nicht ungefährlich aussah, zu mir nach Hause ein. Andererseits hatte er mir geholfen und es war meine Schuld, dass er zusammengeschlagen worden war. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass eine Grußkarte mit den Worten »Danke noch mal, und sorry für die blauen Flecken!« besser angekommen wäre.
Ich steckte den Schlüssel ins Schloss meiner Wohnungstür und trat ein.
Ches hatte recht. Ich tat das hier nur, um meine Schuld zu begleichen. Es hätte wohl vollkommen gelangt, ihn ins Café einzuladen oder im Auto die Donuts zu essen.
Das erkannte ich, als ich über die Schulter blickte und ihn ein wenig unsicher im Türrahmen stehen sah.
»Äh, komm doch rein.«
Ches schien einen ganzen Moment lang zu überlegen, ehe er offenbar einen Entschluss fasste und zögernd eintrat.
Meine Wohnung war klein. Der Flur war eng, und ich hatte bloß zwei winzige Wohnräume. Ein Wohnzimmer mit Küchenzeile, in welches ich ein Sofa und einen Esstisch gequetscht hatte, und mein Schlafzimmer. Das Badezimmer war ebenfalls äußerst überschaubar, und die Waschmaschine stand im Flur. Das war kein Scherz. Es war, als hätte sie tief im Inneren gehofft, ein Sideboard zu werden, doch ihr Schöpfer hatte ihr eine andere Funktion zugeteilt. Ich gab ihr nun lediglich die Möglichkeit, ihr Selbst auszuleben. Und ich musste irgendwie mit den ziemlich mies gelegten Leitungen zurechtkommen, das war aber nur zweitrangig.
»Du kannst die Sachen auf den Esstisch stellen«, sagte ich überflüssigerweise. Es war der einzig freie Platz. Auf der Arbeitsfläche meiner kleinen Küche standen noch immer ein Putzeimer und etliche schmutzige Lappen – ich war am Wochenende so wütend gewesen, dass ich die ganze Wohnung geschrubbt hatte.
»Was möchtest du trinken?«, wollte ich wissen und bedeutete Ches, sich an den Tisch zu setzen. Überall an den Wänden hingen Bilder von mir und meinem Dad, meiner Mum, Tante Kat und meinen Freunden – mit Ausnahme der neuerdings leeren Rahmen, von denen es mehr gab, als ich gehofft hatte. Außerdem stand neben der Küchenzeile ein Regal voller Bücher, welche ich mit Lichterketten umwickelt und mit kleinen Topfpflanzen und Kakteen dekoriert hatte. Mein bester Freund Mitchell sagte immer, ich wäre das wandelnde Pinterest-Klischee einer Literaturstudentin. Er hatte mich sogar ausgelacht, als ich mir ein Küchenbrett aus Marmor gekauft hatte, und mich für verrückt erklärt.
»Hast du Kaffee?«, erkundigte sich Ches und ließ sich auf einen Stuhl nieder.
Mit einem Satz war ich an meiner Küchenanrichte und riss eine der Schranktüren auf. »Klar, ich mach die Kaffeemaschine an.«
Während ich herumwerkelte, überlegte ich fieberhaft, was ich als Nächstes sagen konnte. Ich wollte Ches nach den Blessuren in seinem Gesicht fragen, doch ich traute mich nicht. Außerdem wollte ich wissen, wieso er diesen griesgrämigen Gesichtsausdruck draufhatte.
Eines Tages würde meine Neugierde mich noch so richtig ins Schlamassel befördern.
»Ella«, erklang es leise hinter mir.
Ich erstarrte. Dann drehte ich mich um und begegnete stahlgrauen Augen. Er hatte die Unterarme auf den Knien abgestützt und musterte mich durch lange Wimpern hindurch.
Wie in Zeitlupe klemmte ich mir eine Strähne hinter das Ohr. »Was ist?«, fragte ich.
Er deutete mit dem Kinn neben mich. Seine Augen verloren an Düsterkeit und wurden von Belustigung erhellt. »Der Stecker ist nicht drin. Ich fürchte, wir werden hier noch sehr lange sitzen, wenn wir darauf warten, bis der Kaffee fertig ist.«
Ich wirbelte zur Maschine herum. Verdammt, er hatte recht. Ich musste den Stecker wohl beim Putzen rausgezogen haben.
Die nächsten fünf Minuten, bis der Kaffee fertig war, waren die reinste Qual. Ich konnte seine Augen im Nacken spüren und widerstand dem Drang, mich erneut zu ihm umzudrehen.
Als die letzten Tropfen in die Tasse fielen, feuchtete ich ein sauberes Küchentuch mit warmem Wasser an und reichte ihm den fertigen Kaffee.
Ches gab einen seltsamen Laut von sich. »Ernsthaft? Eine Einhorntasse?«
»Ich gebe nicht jedem meine Lieblingstasse«, erwiderte ich und verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. Nur dann, wenn die anderen schmutzig sind – aber das musste er ja nicht wissen.
Es kostete mich Mühe, nicht zu grinsen, als ich ihn da so sitzen sah. Ich hätte es nicht schlechter treffen können als mit dieser bauchigen Tasse. Das Horn war von einem strahlenden Gold und glitzerte, und die Tasse hatte ein süßes Gesicht mit großen niedlichen Augen.
»Brauchst du Zucker und Milch?«, fragte ich und biss mir auf die Lippe, um nicht zu lachen.
Er schüttelte bloß den Kopf und trank einen Schluck. Währenddessen setzte ich mich und schob meinen Stuhl vor seinen, bis unsere Knie sich berührten.
Seine Hand verharrte, und er musterte mich mit verengten Augen. »Was genau machst du da?«
»Dir klebt getrocknetes Blut im Gesicht«, erklärte ich schüchtern und hielt den feuchten Lappen hoch.
»Oh«, sagte er leise und stellte die funkelnde Tasse ab. Einer seiner Mundwinkel hob sich zu der Andeutung eines Lächelns. »Ich muss ganz schön furchterregend aussehen, was?«
Ich erwiderte das Fast-Lächeln mit einem richtigen. »Ein wenig. Darf ich?« Er ist groß genug, um sich selbst den Schmutz aus dem Gesicht zu wischen, Johns. Mach dich nicht lächerlich – lächerlicher als ohnehin schon.
Doch Ches schloss den Mund und nickte knapp. Ein Okay. Er würde mir erlauben, ihm das Blut aus dem Gesicht zu wischen, und das, obwohl wir einander fremd waren.
Zaghaft streckte ich den Arm aus und tupfte seine Wange ab. Sofort zuckte er zusammen, was mich vor Schreck ebenfalls zusammenzucken ließ. »Scheiße, tut mir leid! Ich wollte dir nicht wehtun.«
»Schon in Ordnung. Ich halte mehr aus als dich.« Er zwinkerte mir zu. Die Geste hätte bei jedem anderen seltsam gewirkt, doch irgendwie fand ich es … nett.
Ich arbeitete so vorsichtig, wie ich nur konnte. Ches zuckte nicht noch einmal zusammen, doch ich sah, dass er die Zähne zusammenbiss. Die Schwellungen zu berühren musste höllisch wehtun. Ich an seiner Stelle hätte vermutlich geheult und gejammert.
»Das meiste bekomme ich nicht ab«, ergab ich mich und lehnte mich zurück. Nicht, dass ich das Blut nicht hätte runterbekommen können. Es lag aber ein Unterschied darin, ob man ein lädiertes Gesicht abtupfte oder darüber schrubbte wie über hartnäckige Flecken in einem Kochtopf.
»Willst du duschen?«, fragte ich, was mich vermutlich genauso überraschte wie auch Ches. »Wenn d-du möchtest, kann ich auch deine Sachen mitwaschen. Die sehen aus, als hättest du die Nacht auf der Straße verbracht.«
Für einen Moment trat ein seltsamer Ausdruck in sein Gesicht, den ich jedoch nicht deuten konnte, und er verspannte sich sichtlich. Im nächsten Moment war der Ausdruck jedoch fort, und er wandte den Blick ab. »Ich dachte, du wolltest mich zum Essen einladen und nicht zum Duschen.«
Hitze kroch meinen Hals hinauf. »Na ja, ich dachte nur gerade, vielleicht würdest du das wollen. Mir geht es nach einer heißen Dusche immer besser.«
Prüfend wanderte sein Blick über mich, so als würde er mich studieren. Ich fühlte mich mit einem Mal nackt, und das, obwohl ich ein weißes T-Shirt und Bluejeans trug. Ich räusperte mich und fuhr mir durch die Haare.
Die Anspannung in Ches’ breiten Schultern wollte einfach nicht verschwinden, doch ich konnte sehen, dass er über meine Worte nachdachte.
Als er schließlich aufstand und seine schmutzige Jacke auszog, strahlte ich ihn an.
Schnaubend schüttelte er den Kopf – und es kam dem Lachen aus dem Auto sehr nahe. »Du bist verdammt seltsam, Kleine. Aber ich nehme das Angebot an.«
Triumphierend strahlte ich ihn an und sprang auf. »Ich hole dir Handtücher!«
Kapitel 3
Ich tigerte durch die Küche. Im Sekundentakt blickte ich zur verschlossenen Badezimmertür, durch die der gedämpfte Klang von rauschendem Wasser drang.
Er stand unter meiner Dusche.
Ein fremder Kerl war hier in meiner Wohnung und stand unter meiner Dusche, und ich hatte erst heute seinen Namen erfahren.
Stöhnend rieb ich mir mit den Händen über das Gesicht und ließ mich auf einen Küchenstuhl fallen. Ganz offensichtlich war ich wirklich zu einem neuen Menschen mutiert. Das hier sah mir gar nicht ähnlich. Vielleicht sollte ich irgendwem davon erzählen. Es wäre vielleicht sogar das Beste, wenn ich die Polizei einschaltete, damit sie die Typen von Freitagabend finden konnten. Wer weiß, vielleicht wollte Ches ja Anzeige gegen sie erstatten.
Die Erinnerung an die Kerle sorgte dafür, dass sich mein Magen zusammenzog. Ich wollte sie nicht damit davonkommen lassen, was sie ihm angetan hatten – und mir vielleicht angetan hätten, wenn Ches nicht …
Nein. Nein, nein, nein.
Das Duschwasser hinter der Badezimmertür wurde abgestellt, was mich aus meinen Gedanken riss.
»Ella?«, erklang eine noch immer ungewohnt tiefe Stimme durch die Tür.
Hastig trat ich vor das Badezimmer. »Ja?«, erwiderte ich durch das Holz hindurch.
Es blieb einen Moment lang still. Dann hörte sich Ches’ Stimme an, als würde er genau vor der Tür stehen.
»Wo ist meine Hose?«
Ich blinzelte. »Was?«
»Meine Hose. Sie liegt nicht mehr auf dem Regal neben der Tür.«
Ich spürte, wie mir heiß wurde. Natürlich lag sie nicht mehr dort. Nachdem Ches das Angebot mit der Dusche angenommen hatte, war ich in meinem übereifrigen Helferdrang davon ausgegangen, dass das auch für das Angebot mit der Waschmaschine galt. Also hatte ich, als er unter die Dusche getreten war, die Tür einen Spaltbreit geöffnet, blind den Arm hineingestreckt und seine Sachen genommen.
Er hätte doch protestiert, wenn er das nicht gewollt hätte, oder? Aber so gesehen … hatte er meinen diebischen Arm durch das Duschwasser hindurch vielleicht einfach nicht bemerkt.
Mein Kopf zuckte zur Seite, ich warf einen Blick über die Schulter auf die Waschmaschine und dann wieder auf die Tür. Ich hatte den Schnellwaschgang genommen, aber selbst der würde noch ewig dauern.
»Oh verdammt«, flüsterte ich, während mein Herz sich dazu entschloss, einfach stehen zu bleiben. Panisch blickte ich mich um. »Ich glaube, ich habe sie in die Waschmaschine gesteckt.«
Er schwieg. »Und was soll ich jetzt anziehen?«
»I-ich bin sofort wieder da!« Ich rannte in mein Schlafzimmer und riss die Schubladen meiner Kommode auf, wühlte mich durch T-Shirts und Wäsche, die ich erst am Vortag zusammengelegt hatte. Ches hatte keine Kleidung. Natürlich. Großartig, wer würde so ein Detail übersehen? Ich natürlich. Ches konnte von Glück reden, dass ich prinzipiell nur in übergroßen Shirts schlief.
Eilig zog ich ein großes, zerknittertes T-Shirt aus der letzten Schublade, rappelte mich auf und eilte zurück in den Flur.
»Ich habe ein T-Shirt für dich gefunden!«, sagte ich atemlos zur geschlossenen Tür.
Hinter ihr blieb es still, ehe nach einem Moment ein Räuspern erklang. »Und eine Hose?«
Mein Blick wanderte wieder zur Waschmaschine. Träge drehte sich die Kleidung darin durch die Trommel und saugte sich mit Seifenlauge voll. Du bist das jämmerlichste Sideboard, das ich je gesehen habe!
Ich strich mir die Haare hinter die Ohren und wollte etwas sagen, doch kein Wort löste sich von meinen Lippen.
Zu meinem Entsetzen sah ich, wie sich die Türklinke senkte. Ich wich erschrocken zurück und stieß mit dem Rücken gegen die Wand. Ches zog die Tür auf – mit nichts am Leib bis auf zahlreiche Wassertropfen und einem Handtuch um seine Hüften. Seine Haare waren nass und nach hinten gekämmt, und sein Gesicht wirkte sauber und frisch. Herausfordernd sah er mich an. Mein Blick blieb verräterisch lange auf dem sonnengeküssten Oberkörper hängen, der nur aus Muskeln zu bestehen schien. Wirklich sehr schönen Muskeln. Verboten attraktiv und sehnig, wie man sie sonst an echten Menschen nie sah. Mein hastiger Blick entdeckte jedoch auch unzählige blaue Flecken und silbrige Narben, überall auf seiner Haut. Besonders auf Rippenhöhe. Irgendwo in meinem Hinterkopf läuteten Alarmglocken. Ich wollte wissen, woher all die Verletzungen stammten. Ich wollte ihn fragen, doch ich traute mich nicht. Außerdem befand ich mich gerade mitten in einer Reizüberflutung und war nicht in der Lage, eine halbwegs geistreiche Frage zu stellen.
Ein glitzerndes Rinnsal lief zielsicher von seinem Bauchnabel auf den Saum des Handtuches zu und …
Du fängst jeden Moment an zu sabbern. Reiß dich zusammen!
Mit brennenden Wangen richtete ich den Blick auf den Boden und hielt ihm das T-Shirt hin. Beschämt stellte ich fest, dass ich ihn weitaus länger als einen flüchtigen Augenblick angestarrt hatte. Gegafft war wohl der passendere Ausdruck. Sein bloßer Anblick sorgte bereits dafür, dass mir das Herz wie wild gegen die Brust klopfte. Er war mit Abstand der attraktivste Kerl, dem ich je begegnet war. Und das, obwohl Ches gar nicht mein Typ war. Bärte waren überhaupt nicht mein Ding, lange Haare erst recht nicht. Doch irgendetwas hatte er an sich, was mich dazu brachte, ihn anstarren zu wollen.
Ches nahm mir das Shirt mit einem trockenen Schnauben aus der Hand. »Vielleicht hätte ich auf meine Eltern hören und nicht mit einer Fremden nach Hause gehen sollen. Jetzt hat es mich schon meine Hose gekostet.«
Ha, er hatte einen Witz gerissen! Ich war so fertig mit den Nerven, dass ich kurz davor war, in hysterisches Lachen auszubrechen.
»Es tut mir so leid!« Ich flüchtete in die Küche. »Ich, äh, kann die Nachbarn nach einer Hose für dich fragen.«
Ches folgte mir. »Mach dich nicht lächerlich, Ella. Wer fragt denn seine Nachbarn nach einer Hose?«
»Wenn du mir deine Größe verrätst, fahre ich schnell in die Mall und hole dir eine.«
Er hob eine Augenbraue und schien sich das Lächeln zu verkneifen. »Ernsthaft? In die Mall?«
»Hast du eine bessere Idee?« Gab es auch etwas, worin ich gut war? Nicht einmal hilfsbereit konnte ich sein!
Er zuckte mit den Schultern, offenbar ganz die Ruhe in Person. »Ich weiß nicht, was du heute vorhast, aber ich kann warten.« Seine hellgrauen Augen verloren ein wenig an Härte und bekamen einen sanfteren Ausdruck. Er schien bemerkt zu haben, wie unfassbar peinlich mir die ganze Situation war.
Als ich mich setzte und endlich den Mut aufbrachte, seinen Blick zu erwidern, sah ich, dass er tatsächlich lächelte. Er machte sich zwar über mich lustig, aber dafür war es ein schönes Lächeln, das bis zu seinen Augen reichte und diese in kleine Lachfalten hüllte.
Seltsamerweise beruhigte es mich. Es war, als würde mich sein Blick erden.
»Ich habe heute noch nichts vor«, erwiderte ich schließlich. »Wir könnten ja erst mal frühstücken, oder?«, fragte ich, während ich fasziniert beobachtete, wie er sich das T-Shirt über den Kopf zog und sich setzte. Mein Mund wurde trocken, und meine Augen weiteten sich.
Grundgütiger.
»Wieso nicht«, erwiderte Ches und griff nach seiner Einhorntasse. »Ich bin am Verhungern. Und du?«
Ein Kichern entschlüpfte mir, und ich schlug mir hastig eine Hand vor den Mund.
Misstrauisch verengte er die Augen, doch sein Vollbart zuckte verdächtig, so als würde ein Lächeln seine Lippen umspielen. »Was ist?«
Ich stand auf, um die Kaffeemaschine wieder einzuschalten.
»Ach, gar nichts«, log ich und verkniff mir ein Grinsen.
Auf dem T-Shirt, das überall bis kurz vor dem Zerreißen gespannt war, stand in großen schwarzen Lettern SHERLOCK IS MY BOYFRIEND. Zeitgleich hielt er die glitzernde Tasse in der Hand und zog einen glasierten Donut aus der Tüte auf dem Tisch.
Dafür werde ich höchstwahrscheinlich in der Hölle landen. So muss sich Frankensteins Erfinder gefühlt haben – ich habe ein Monster erschaffen.
Ches blickte an sich herunter. Unbeeindruckt zuckte er mit den Schultern. »Hm. Sherlock. Schon mal gehört.«
Unglaube erfüllte mich. »Ernsthaft? Du kennst Sherlock nicht? Das ist die beste Serie der Welt, wie kannst du sie nicht kennen?«
»Ich kenne Sherlock«, erwiderte er und biss in den Donut. »Hab es nur nicht gelesen.«
»Und die Serie?«, hakte ich nach. Ich machte ihm frischen Kaffee und setzte mich, ehe ich meinen mittlerweile kalten Chai Latte und den grünen Smoothie vor mir platzierte. Langsam ließ die Anspannung in mir nach. Auch wenn mir noch immer bewusst war, dass Ches nichts trug, bis auf ein Handtuch und mein Sherlock-Shirt.
»Ich gucke kein Fernsehen«, erwiderte er ungerührt und führte das strahlende Einhorn an seine Lippen.
Ich nahm einen großen Bissen von einem Bagel. »Was machst du dann? Irgendwelche Hobbys? Was ist dein Job?«
Er zuckte mit den Schultern. »Was studierst du?«
Ich hob die Augenbrauen. Er hatte meine Frage einfach ignoriert.
»Literatur«, antwortete ich langsam.
»Und gefällt es dir?«
Diesmal war ich es, die mit den Schultern zuckte. »Ja. Was machst du, wenn du nicht studierst?«
»Dies und das. Kommst du aus Fletcher, oder bist du zugezogen?«
Ich seufzte frustriert, was er mit unschuldig hochgezogenen Brauen quittierte. »Ich meine es ernst. Erzähl mir von dir, Ella Johns.«
Meine Augen wurden groß. »Woher kennst du meinen Nachnamen?«
»Er steht auf dem Schild neben deiner Haustür.« Belustigung blitzte wieder in seinen Augen auf.
»Oh«, murmelte ich und biss von meinem Bagel ab. Jeder Bissen war mechanisch, und das Essen fühlte sich trocken im Mund an. Ich wusste nicht, wieso ich von mir erzählte, wo er mir mehr als offensichtlich zu verstehen gegeben hatte, dass er nichts Persönliches über sich preisgeben würde. »Ich komme von hier«, sagte ich. »Meine Mutter und meine Tante leben auch hier. Und du?«
Er zuckte wieder mit den Schultern, was mich beinahe verrückt machte. »Was hörst du für Musik?«
»Weißt du was?«, fuhr ich ihn an. »Du könntest meine Fragen zur Abwechslung auch beantworten, anstatt sie einfach zu ignorieren!«
Er klopfte sich die Hände über der Tüte ab und brummte unzufrieden. »Na schön. Ich jobbe bei einem Freund in einer Autowerkstatt, habe keinen Collegeabschluss, komme von der Ostküste, habe nichts für Popmusik übrig und rede nicht gerne über mich. Sonst noch was?«
Trotzig verschränkte ich die Arme vor der Brust. »Wie alt bist du?«
Er lehnte sich zurück und verschränkte ebenfalls die Arme vor der Brust.
Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf. Oh Gott, wenn das T-Shirt reißen sollte – was definitiv jeden Moment passieren konnte –, würde ich keinen anständigen Satz mehr hervorbringen können. Sehnen traten auf seinen Unterarmen hervor. Seine Hände waren groß und wirkten rau, und doch wusste ich, dass sich sein Händedruck sanft angefühlt hatte. Sauber und mit den zurückgekämmten nassen Haaren wirkte Ches wie ein anderer Mensch. Himmel noch mal, er war wirklich … heiß.
Ich wandte mich etwas energischer dem Essen zu. Ich war nicht nur unhöflich und wenig hilfsbereit, jetzt gaffte ich ihn auch noch an. Schon wieder.
»Sechsundzwanzig.«
Irritiert blickte ich auf. »Was?«
»Du hast eben gefragt, wie alt ich bin. Ich bin sechsundzwanzig Jahre alt.«
Okay, Ella. Konzentrier dich endlich und sei nett. Ich nahm meinen Chai Latte und trank einen Schluck. »Schön.«
Stille breitete sich zwischen uns aus.
Nach einer Weile und einem Bagel später sagte ich: »Ich, äh, bin einundzwanzig«, was die Stille, die daraufhin wieder folgte, unfassbar peinlich machte.
Wir aßen schweigend weiter. Ich hielt den Kopf gesenkt, doch ich konnte spüren, wie Ches mich beobachtete. Du Idiotin. Hättest du doch einfach deine Klappe gehalten.
Die stetig zunehmende Anspannung in der Luft brachte mich noch um.
Ich konnte einfach nicht widerstehen – ich hob den Kopf und sah ihn an.
Wortlos teilten sich seine Lippen, und er ließ seine Hände auf den Tisch sinken. Er hatte mich beobachtet. Er erwiderte meinen Blick einfach nur und rührte sich nicht. Mit jeder verstreichenden Sekunde wurde mir heißer. Träge glitten seine hellgrauen Augen über mich, aufmerksam, studierten mein Gesicht und meinen Körper. Es war wie ein Bann, und alles in mir kam zum Stillstand. Ich blickte wie gebannt in seine Augen und hatte mit einem Mal das Gefühl, nicht mehr atmen zu können.
Mein Herzschlag wummerte ungewöhnlich laut in meinen Ohren, und mein Hals wurde trocken.
Plötzlich trommelte es wild gegen die Wohnungstür, was mich erschrocken aufspringen ließ und mir einen Schrei entlockte. Der seltsame, intensive Augenblick war vorüber, platzte wie eine Seifenblase, was die reale Welt mit einem Schlag zurückbrachte. Ches zuckte ebenfalls zusammen und blickte alarmiert zur Wohnungstür.
»Ella!«, drang eine helle Stimme durch die Tür hindurch, und es hämmerte wieder. »Ich weiß, dass du zu Hause bist, dein Auto steht unten! Lass mich rein!«
Ich schnappte nach Luft. Nein, nein, nein. Der Zeitpunkt war mehr als bloß schlecht.
Natürlich hatte ich die Stimme meiner besten Freundin auf Anhieb erkannt. Summer war hier.
»Wer ist das?« Ches setzte sich aufrecht hin, seine Arme spannten sich an und …
Der Wahnsinn. Seine Arme spannten sich an.
Ich schüttelte die unangebrachten Gedanken von mir und eilte zur Wohnungstür. »Äh, nur eine Freundin.«
Bevor Summer wieder klopfen konnte, öffnete ich die Tür einen Spaltbreit.
Sie versuchte, die Tür aufzudrücken. Ich hielt dagegen.
»Hi. Ich fühl mich nicht so gut«, log ich mehr als lahm und hoffte inständig, dass meine Wangen nicht so rot waren, wie es mich die Hitze auf ihnen vermuten ließ. Probeweise hustete ich ein wenig, doch vermutlich ließ mich das vollends auffliegen.
»Ernsthaft, El?« Sie kräuselte die tiefrot geschminkten Lippen und hob eine Augenbraue. Summer Andrews war mit 1,85 m das größte Mädchen, das ich kannte. Sie hatte ewig lange goldene Haare und trug nie etwas anderes als Röcke und Kleider, um – nach ihren Worten – ihren breiten Hintern und das Hüftgold zu kaschieren, auch wenn weder das eine noch das andere vorhanden war.
»Ich bin total krank«, flunkerte ich weiter. »Ich komme heute nicht zu den Vorlesungen.«
»Ja, ja, so weit war ich auch schon«, erwiderte sie, hielt ihre Handtasche hoch und grinste verschlagen. »Deswegen habe ich auch zwei Flaschen Wein mitgebracht. Wir sollten außerdem eine Voodoopuppe basteln und überall Nadeln reinstecken. Im Internet finden wir bestimmt eine Anleitung. Hast du zufällig Nadeln oder Zahnstocher da? Im Notfall könnten wir auch Ohrringe benutzen.«
Ich war mir nicht sicher, ob ich mich nicht verhört hatte. »Hast du mal auf die Uhr geschaut? Um diese Uhrzeit trinkt man nicht!«
Sie verdrehte die Augen. »Irgendwo auf der Welt aber bestimmt schon. Ich dachte, wir machen heute einfach gemeinsam blau und lästern über Quarterback Satan und seinen kleinen Antichristen, bis uns die Ohren bluten.«
Angespannt hielt ich die Tür weiterhin zu, als Summer wieder versuchte, einzutreten. »I-ich denke, das ist keine gute Idee. Vielleicht ein andermal. Wir könnten uns heute Abend bei dir treffen, was meinst du?« Hoffnungsvoll lächelte ich sie an.
»Was zum Teufel ist los, El?«, fragte meine Freundin verärgert und drückte wieder gegen die Tür. »Wieso willst du mich nicht reinlassen? Ist irgendwas los?« Sie schnappte plötzlich nach Luft, und ihre blauen Augen weiteten sich. Dann funkelte sie mich vorwurfsvoll an. »Oh mein Gott. Jason ist hier, nicht wahr? Du hast ihn, nach allem, was war, wieder ankriechen lassen? Jason!«, brüllte sie und drückte diesmal mit der Schulter gegen die Tür, sodass der Spalt noch ein weiteres Stück größer wurde. Sie versuchte, an mir vorbeizusehen, und bekam fleckige Wangen. »Du verdammtes Schwein! Mach gefälligst, dass du da rauskommst, du verlogenes, stinkendes –«
»Summer, sei leise, Jase ist nicht hier!«, zischte ich, doch es war zu spät. Mit einem Ruck stolperte ich zurück, und Summer brauste wutentbrannt in meine Wohnung. »Du kleiner Mistkerl, wenn ich noch einmal sehe, wie du Ella auch nur …«
Sie verstummte schlagartig, als sie Ches erblickte. Wie angewurzelt blieb sie stehen.
Atemlos trat ich an ihr vorbei, doch ich konnte nichts mehr tun. Ihre aufgerissenen Augen waren auf Ches gerichtet, und ihr Mund formte ein verblüfftes Oh.
Ja. Oh.
»Morgen«, brummte Ches und trank ungerührt von seinem Kaffee.
Summer neigte den Kopf in meine Richtung und blinzelte mich mehrmals an. Dann blickte sie wieder zu Ches. Das Ganze wiederholte sich ein paar Mal, während meine Knie sich in Pudding verwandelten.
»Ella, das ist nicht Jason.« Sie starrte die Einhorntasse an, dann das zum Zerreißen gespannte Sherlock-Shirt und schließlich das Handtuch, welches er anstelle einer Hose trug. Sie registrierte definitiv auch die nassen Haare.
Ich wusste nicht, ob ich einen Vorwurf oder Ungläubigkeit aus ihrer Miene herauslesen konnte. Mir jedenfalls krachte das Herz in die Hose, und ich öffnete den Mund, ohne zu wissen, was ich sagen wollte. Sprachlos. Ja, das war das richtige Wort.
Summer fasste sich schneller als ich. Sie wandte sich Ches zu, dem sie eine Sekunde später ihre Hand entgegenstreckte und auf ihn zutrat. »Hi, ich bin Summer, Ellas beste Freundin. Und wer bist du, wenn ich fragen darf?«
Ich atmete tief durch, um mich vor dem zu wappnen, was mich gleich erwarten würde. Summer war noch nie auf den Mund gefallen gewesen, und ich kannte keinen Menschen, den man mit ihr vergleichen konnte. Selbst in der Middleschool, als wir uns kennengelernt hatten, war das so gewesen.
Genau das war es, was mir nun Angst machte.
Vollkommen ungerührt ergriff Ches Summers Hand. Seine Miene war unlesbar, und er schenkte ihr nicht mehr als ein höfliches Nicken. »Ches.«
»Hm, Ches«, wiederholte sie interessiert und setzte sich an den kleinen Esstisch. Sie nahm sich ungefragt einen Donut und lächelte erst Ches und dann mich an. »Klingt irgendwie exotisch. Und wo ist deine Hose?«
»Gott, steh mir bei«, flüsterte ich und setzte mich dazu.
Ich bewunderte Ches dafür, wie gelassen er Summers unverblümte Art hinnahm. Doch nicht einmal er konnte verhindern, dass seine Mundwinkel sich hoben. »Ella hat meine Sachen in die Waschmaschine gesteckt. Jetzt müssen wir warten, bis sie gewaschen und getrocknet sind.«
»Du solltest in die Vorlesung gehen, Summer«, sagte ich und setzte mich auf den dritten und damit letzten Stuhl am Tisch.
»Mhm, gleich«, winkte sie ab, ohne mich anzusehen. »Und du und Ella kennt euch schon lange, Ches? Oder war das bloß etwas Einmaliges?«
»Summer, hör auf!« Ich verbarg das Gesicht in den Händen.
Doch Ches machte sich nicht die Mühe, sie aufzuklären, sondern spielte einfach mit. »Klar. Es war etwas Einmaliges. Wir sind quitt, und sobald meine Sachen gewaschen sind, trennen sich Ellas und meine Wege wieder.«
Ich sah Ches durch meine Finger hindurch an und bemerkte, dass seine Augen auf mir ruhten. Er wirkte nachdenklich.
Außerdem fiel mir noch etwas auf: Zu meiner eigenen Überraschung kränkten mich seine Worte.