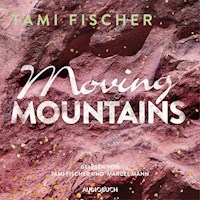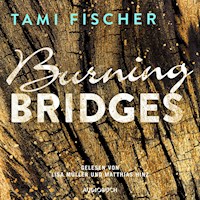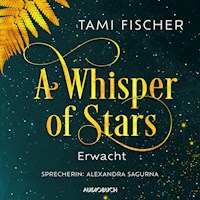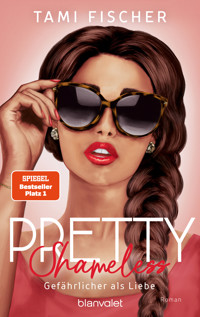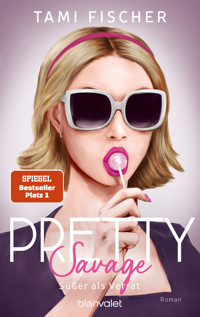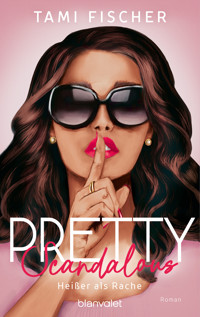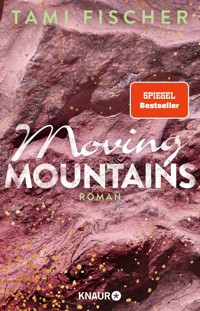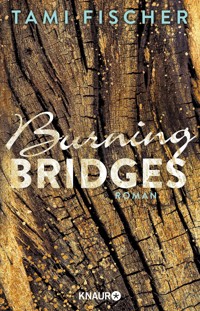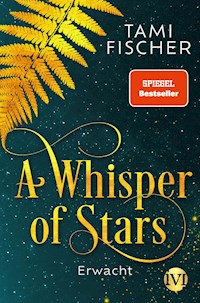
17,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Liv wünscht sich nichts sehnlicher, als ihrem Leben auf Hawaiki zu entfliehen. Weder sie noch ihre beiden besten Freunde glauben noch an die Legenden über mythische Götter und Ahnengeister, die man sich an den rauen schwarzen Küsten seit Anbeginn erzählt. Doch als am Tag des Sternenfestes nicht nur ein Fremder auf der Insel auftaucht, sondern plötzlich uralte Kräfte zum Leben erwachen, beginnt für Liv und ihre Freunde ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine Reise ins Ungewisse, ohne Zurück. Ein erbarmungsloser Jäger. Und eine gefährliche Liebe, die Livs Herz höher schlagen lässt als je zuvor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lesen was ich will!
www.lesen-was-ich-will.de
© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
PART I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Unbekannt
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Unbekannt
14. Kapitel
PART II
15. Kapitel
16. Kapitel
Unbekannt
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Jamie
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
PART III
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Epilog
Glossar
Danksagung
Disclaimer
Für Mona.
Dieses Universum ist für dich.
Mit all seinen Sternen.
Und mit all seiner Liebe.
Seit Anbeginn.
Danke für alles.
Prolog
Lautes Rauschen und ein beißender Geruch holten mich aus der Besinnungslosigkeit. Augenblicklich war ich erfüllt von so unsäglichen Schmerzen, dass mir ein Stöhnen entfuhr.
Die Erinnerungen kehrten mit einem Schlag zurück. Panisch blickte ich mich um, überall war flackerndes Feuer.
Feuer!
»Finn«, flüsterte ich und brach in keuchenden Husten aus. Meine Augen tränten so sehr, dass ich kaum sehen konnte. Alles war voller Qualm, die Luft glühend heiß. Flammen züngelten zwischen Kartons und Müllsäcken und ragten wie eine Mauer empor.
Ich versuchte aufzustehen, jedoch ohne Erfolg. Irritiert fasste ich mir an den dröhnenden Hinterkopf und sah anschließend scharlachrotes Blut an meinen schmutzigen Fingerspitzen glänzen.
Das war nicht alles. Ein reißender Schmerz in meiner rechten Schulter ließ eine Übelkeit in mir aufsteigen, die mir den Magen verknotete und meinen Mund mit Speichel füllte.
Finn. Ich musste Finn finden. Meine Umgebung war ein Durcheinander, eine Welt aus Müll und Flammen.
Ich kämpfte mich auf die Beine, kniff meine tränenden Augen immer wieder zusammen und rief nach meinem besten Freund. Doch der Rauch löste bloß den furchtbaren Husten aus. Röchelnd stieg ich über einen qualmenden Karton. Dann sah ich durch den schwarzen Rauch einen bewegungslosen Körper am Boden.
Alles in mir zog sich panisch zusammen. Nein!
Ich schluchzte auf und musste erneut gegen einen Hustenanfall kämpfen. Das Brennen in meinen Augen war so stark, dass ich fast nichts sehen konnte, doch das war in diesem Moment egal.
»Finn!«, schrie ich über das Tosen des Feuers hinweg und ließ mich neben ihm auf die Knie fallen. »Finn, wach auf!« Ich rüttelte an seiner Schulter, gab ihm sogar eine Ohrfeige. Doch es half nichts, er regte sich nicht. Ich sah Blut an seiner Schläfe und entdeckte einen Fleck auf dem verkohlten, löchrigen Shirt, der im Schein der Flammen glänzte.
Nein. Nein. Nein!
Keuchend rüttelte ich meinen besten Freund, der sich einfach nicht bewegen wollte. Ich spürte, wie ich mit jeder weiteren Sekunde schwächer wurde.
Nicht die Fassung verlieren. Du darfst nicht in Panik ausbrechen. Wie bei Whakahara. Du wirst Finn hier rausbekommen.
Schön, meine innere Stimme war nicht ganz so hilfreich wie erhofft – immerhin war es keine Frage der Motivation, wenn es um Leben und Tod ging. Ich musste Finn und mich von hier wegschaffen, sonst würden wir bei lebendigem Leibe verbrennen.
Fiebrig blickte ich mich um, suchte nach einem Ausweg. Mit meiner verletzten Schulter konnte ich unmöglich jemanden tragen, schon gar nicht Finn.
Mit letzter Kraft packte ich ihn an den Armen und zerrte seinen reglosen Körper fort von den Flammen, fort von der Hitze. Meine Atemwege brannten und meine Augen tränten, und all das Blut …
Sein Blut.
Nicht Finn, nicht Finn, nicht Finn. Die Worte liefen in Endlosschleife durch meinen Kopf, wurden immer lauter und schriller und ließen mich aufschluchzen. Bitte, bitte sei nicht tot.
Die Welt schwankte gefährlich wie ein Boot in einem Sturm auf dem offenen Meer. Mein Körper wollte aufgeben. Aber das konnte ich nicht zulassen, noch nicht.
»Komm schon!«, rief ich mit erstickter Stimme.
Wir hatten keine Wahl. Wir mussten durch das Feuer.
Trotz des lauten Rauschens in meinen Ohren vernahm ich ein dumpfes Stöhnen. Ich senkte den Blick und …
Ein erleichterter Schrei entfuhr mir.
»Finn! Na los, steh auf. Wir müssen hier weg!«
Das Weiß in seinen Augen war leuchtend rot, was mir eine Heidenangst einjagte, doch er war bei Bewusstsein und das war alles, was in diesem Moment zählte.
Finn begann ebenfalls zu husten, als er sich hochkämpfte. Ich stützte ihn, doch als seine Hand nasse, verbrannte Haut an meinem Rücken berührte, stöhnte ich vor Schmerz und fiel auf die Knie. Die Welt schwankte und weiße Punkte tanzten am Rande meines Blickfeldes.
»Olivia«, sagte Finn und sah mich voller Entsetzen an. »Dein Rücken, dein Arm …«
»Mir geht es gut.« Ich kämpfte mich hoch, hielt mich an ihm fest. Die Flammen hatten uns fast erreicht und ihr goldenes Licht tanzte auf Finns schmutzig glänzendem Gesicht.
»Wir müssen durch die Flammenwand«, stieß ich hervor.
Seine Augen weiteten sich. »Aber dann verbrennen wir bei lebendigem Leib.«
»Das werden wir ohnehin, wenn wir einfach hierbleiben!«
»Gib mir einen Moment, dann denke ich mir etwas aus.«
»Finn, wir haben keine Zeit, uns Pläne auszudenken!« Ich ergriff seine Hand, ignorierte dabei die Schmerzen in meiner Schulter. Meine Lunge brannte wie nie zuvor. »Auf drei, okay?«
Der Blick seiner dunklen, blutroten Augen war gequält. »Verdammt, Olivia! Na gut. Auf drei.«
Keuchend richtete ich den Blick auf das Feuer. Es war, als könnte ich bereits spüren, wie mir die Hitze die Haare und das Gesicht versengte, ehe alles andere folgen würde.
»Okay. Eins … zwei … drei!«
Wir rannten los.
Das Feuer wird uns verschlingen. Das wird unser Ende sein.
Die Hitze traf uns schlagartig, der Schmerz wurde unerträglich, so beißend, dass wir …
Als hätte jemand einen Schalter umgelegt, war das Feuer mit einem Mal fort, mitsamt des Lichts und der Hitze und der Glut.
Einfach so.
Kälte und Dunkelheit brachen über uns herein, wir stolperten über den verkohlten Müll und landeten mit einem harten, unsanften Schlag auf dem Boden.
Der Aufprall beförderte jegliche Luft aus meiner Lunge und in meiner verletzten Schulter erklang ein hässliches Knacken. Ich krümmte mich zusammen, stieß einen erstickten Laut aus, der nach ein paar Herzschlägen zu einem kraftlosen Wimmern verkümmerte.
Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Du bist am Leben.
Du lebst.
Ich richtete meine Augen gen Himmel. Die Sterne schienen am Firmament zu tanzen, obwohl ich wusste, dass das nicht sein konnte.
Schritte erklangen in der Nacht. Über mir erschien eine Gestalt.
Als ich sie wiedererkannte, gefror mein Blut zu Eis. Mein Herz krampfte sich zusammen und ein Schluchzen entfuhr mir. »Nein«, flüsterte ich tonlos.
Die Gestalt beugte sich zu mir herunter, während mein Bewusstsein mir immer weiter entglitt. Bei den Sternen. Er würde uns töten. Er war gekommen, um es zu Ende zu bringen.
Seine Stimme war das Letzte, das ich wahrnahm, bevor die Dunkelheit mich in ihre Tiefen riss.
»Das war nur der Anfang.«
PART I
1. Kapitel
Sonnenlicht glitzerte auf dem Wasser und blendete mich. Es funkelte wie Kristalle in den azurblauen Wellen, die sich rollend brachen und in hohen, kraftvollen Gischtwolken an der schwarzen Steinküste zerbarsten.
Mit zügigen Bewegungen ließ ich meine Arme durch das Wasser gleiten und beförderte mich und mein Surfboard weiter raus aufs Meer, in Richtung der Monsterwellen, die vom stürmischen Wind gigantisch geworden waren. Die Mittagssonne brannte auf meinem Kopf und meinem Rücken, doch es tat gut. Das tat es immer. Meine Finger waren bereits schrumpelig, das Band meines schwarzen Bikinioberteils scheuerte im Nacken und die Muskeln in meinen Armen schmerzten vor vertrauter Erschöpfung. Nicht mehr lange, und ich würde das Wasser verlassen müssen. Allein die Vorstellung stimmte mich traurig.
Vor mir baute sich eine Welle auf, funkelnd und voll unbändiger Kraft. Ich schnappte nach Luft, drückte mich und mein Board im letzten Augenblick unter Wasser und tauchte unter dem Wellenkamm hindurch. Für ein paar Sekunden umgab mich Stille. Blaue Unschärfe. Das Salzwasser kühlte mich ab und Luftblasen kitzelten mein Gesicht.
Dann war es vorbei und ich tauchte wieder auf.
Der nächsten Welle unterwarf ich mich nicht. Ich war weit genug draußen, um sie zu zähmen, bevor sie sich aufbauen konnte. Als ich spürte, wie sich der Ozean unter mir zu einem Berg erhob, paddelte ich bäuchlings auf meinem Surfboard los, so schnell ich konnte. Das Board und ich stiegen höher und höher, bis mein Herz raste und Adrenalin durch meine Adern jagte. Dann ging es steil abwärts. Ich kämpfte mich auf meinem Board mit dem Wasser hoch. Ein Jubelschrei entfuhr mir, als ich den Wellenkamm entlangraste. Ich balancierte, wurde schneller und ließ meine Hand in die majestätische Wasserwand gleiten, als sie einen Tunnel um mich bildete, der durch das Sonnenlicht leuchtete. Es war wie ein Rausch, gefährlich, wunderschön und unbeschreiblich zugleich. Ich wusste, ich sollte den Ritt beenden, es nicht hinauszögern. Ich durfte auf keinen Fall die Kontrolle verlieren. Ich sollte auf mein Bauchgefühl hören und den Ritt beenden, bevor es zu spät war und ich …
»Verdammt!«, keuchte ich, einen Wimpernschlag, bevor die Welt um mich herum plötzlich nur noch aus erbarmungsloser Kraft, Wasser und Druck bestand. Die rohe Gewalt des Ozeans wirbelte mich Dutzende Male umher, drückte mich in dessen eiskalte Tiefen und sorgte dafür, dass die Sicherheitsleine, die mich mit dem Surfboard verband, tief in meinen Knöchel schnitt. Ich schluckte Wasser, meine Lunge brannte und ich wollte schon nach Luft schnappen, als ich mich in letzter Sekunde ermahnte, es nicht zu tun. Ruhe bewahren. Gleich ist es vorbei. Konzentrier dich und überwinde die Angst. Du bist stärker als die Panik. Du schaffst das.
Alles war wild und unbändig, ich konnte nicht sagen, wo oben und unten war.
Dann beruhigte sich die Welt um mich herum wieder ein wenig. Ich öffnete die Augen. Das Umherwirbeln war vorbei und ich schwebte schwerelos in eisiger Stille. Ich sah das gebrochene Licht durch das unendlich weite Wasser tanzen, sah, wie es unter mir verschluckt wurde. Die Spitzen ewig langen Seegrases schienen sich aus den Tiefen nach mir zu strecken, als wollten sie mich in eine andere Welt ziehen.
Als ich kurz darauf wieder nach oben trieb und durch die Wasseroberfläche stieß, schnappte ich gierig nach Luft.
Es war ein Kampf, den gewaltigen Wellen zu entkommen. Immer wieder versuchten sie, mich zu erschlagen und unter Wasser zu drücken, doch irgendwie schaffte ich es zurück an die Inselküste, ohne zu ertrinken – auch wenn ich heute wirklich viel Wasser geschluckt hatte. Okay, vielleicht hatte ich es zu weit getrieben. Mal wieder. Der Wellengang war erbarmungslos und furchteinflößend gewesen. Die Farbe des Sonnenaufgangs und die Form der Wolken am Himmel hatten angekündigt, was heute auf Surfer und Seefahrer zukommen würde. Deshalb war ich auch die Einzige im Wasser.
Zitternd hievte ich mein Surfboard an den schwarzen Steinstrand und ließ mich atemlos auf den sandlosen, tiefschwarzen Steinboden fallen. Erst jetzt spürte ich, wie sehr mir der Wellenritt zugesetzt hatte. Alles tat weh. Dafür war ich aber vollkommen von Adrenalin und Glück erfüllt, sodass sich ein Lächeln auf meinem Gesicht breitmachte.
Ich befand mich an einem kleinen Strandabschnitt von Hawaiki, der sich durch schwarze Felsen und dickes Gestrüpp vom Rest der Küste abgrenzte. Hier kam ich am liebsten her, nicht nur, weil die Wellen an diesem Teil der Insel gewaltig werden konnten. Hier hatte ich meine Ruhe. Hier konnte ich allein sein – besonders, wenn es verboten war, ins Wasser zu gehen.
Eine Gischtwolke stob vor mir in den blauen Himmel empor und versorgte mich mit kühlem Sprühregen, während die heiße Sonne und der Wind vom offenen Meer versuchten, mich zu trocknen.
Schwer atmend setzte ich mich auf und löste den Knoten in der Leine, die meinen Knöchel mit dem Surfboard verband. Als ich sah, wie blutig der Schnitt war, entfuhr mir ein leiser Fluch. Das Salzwasser brannte darin wie Feuer. Noch eine Narbe. Willkommen bei den vielen, vielen anderen.
Sei es drum, ich würde nie schöne Knöchel haben, dafür waren sie schon zu stark gezeichnet – es war ein Wunder, dass ich mir bei einem Wellenritt noch nie einen Fuß abgerissen hatte, so tief wie einige Einschnitte schon gewesen waren. Vielleicht hatte meine leise Stimme der Vernunft recht gehabt und ich hätte heute nicht herkommen dürfen. Aber Whakahara war zu verlockend – die großen, unbezwingbaren Wellen, die nicht dafür gemacht waren, um durch ihre Kämme zu streifen, sondern um Ehrfurcht zu lernen und sich bewusst zu werden, wie mächtig der Geist des Ozeans war. Wir mussten ihn ehren, um in Einklang mit ihm leben zu können. Whakahara war ein Schauspiel und kein Gegner, das wusste ich, und doch reizten mich die Monsterwellen immer wieder. Besonders heute.
Seit Tagen fühlte ich mich unruhig und aufgekratzt. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, konnte nicht stillhalten und bekam ohne Grund Herzrasen, immer wieder. Deshalb brauchte ich etwas, das mich von dieser Ruhelosigkeit ablenkte und mir half, sie zu unterdrücken.
Selbst wenn ich einen Preis wie den heutigen zahlen musste.
Ich holte ein Handtuch aus meinem alten Rucksack, der weiter hinten am sandlosen Steinstrand lag, trocknete mich ab und zog mir anschließend ein altes grünes Leinenkleid über den nassen Bikini.
»Olivia!«
Ich fuhr zusammen und blickte alarmiert auf. Das dichte Gestrüpp aus Palmen und Farnblättern, welches den schwarzen Strand umgab, raschelte, ehe eine vertraute, hellhaarige Gestalt erschien.
Bei dem Anblick meines besten Freundes atmete ich erleichtert auf. Für einen Moment hatte ich schon befürchtet, dass es Männer meines Vaters waren, die öfters nach mir sahen – natürlich nur zu meiner eigenen Sicherheit und ganz sicher nicht, um mir nachzuspionieren.
»Was machst du hier, Finn? Ich dachte, Toka hätte dich den ganzen Tag am Hafen eingespannt!«, rief ich, stopfte das feuchte, löchrige Handtuch in meinen Rucksack und schulterte ihn, ehe ich das Surfboard auf meinen Kopf hob und Finn entgegenlief.
»Ach, weißt du, ich war nicht wirklich zu etwas zu gebrauchen«, erwiderte er ausweichend.
Als er zu humpeln begann, zog ich die Stirn in Falten. Daher wehte also der Wind; er hatte sich schon wieder verletzt.
»Was ist passiert?«, fragte ich besorgt, als wir voreinander standen, und musterte ihn von oben bis unten. Finn trug lange Jeans und ein blaues T-Shirt, das bereits ziemlich von Motten zerfressen war. Genau wie ich gehörte er zu einer der vier Ältestenfamilien. Seine Haut war jedoch ungewöhnlich hell und er hatte auf Armen und Brust Dutzende dunkle Pigmentflecken, die auf den ersten Blick aussahen wie eine Bemalung. Seine hellen Haare sorgten dafür, dass er noch mehr herausstach, fast als hätten die Sterne und Götter ihn verflucht. Nicht, dass ich daran glaubte, aber es gab genug Menschen auf Hawaiki, die es taten – genauer gesagt alle bis auf Finn und mich.
Mein Blick blieb an seinem linken Bein hängen. »Du humpelst.«
»Du auch«, erwiderte er wie aus der Pistole geschossen.
Ich stieß ein Schnauben aus. »Raus mit der Sprache, was hast du diesmal angestellt?«
Zögerlich nestelte er an einem losen Faden seiner Jeans herum. »Erzähle ich dir später. Wenn dein Vater übrigens erfährt, dass du wieder während Whakahara im Wasser warst, wird er dein Surfboard vermutlich endgültig in Stücke hacken.«
Eine starke Windböe peitschte mir ein getrocknetes Palmblatt in die Kniekehlen, was mir einen gequälten Laut entlockte. »Er wird es schon nicht erfahren, dafür sorge ich. Woher wusstest du überhaupt, wo ich bin?«
»Wo hättest du sonst sein sollen?« Ein Grinsen erschien auf Finns Gesicht, das seine dunklen Augen klein werden ließ. Er nahm mir das Surfbrett ab und bedeutete mir, ihm zu folgen. »Und jetzt komm mit. Ich habe etwas für dich.«
Wir stiegen durch die verwucherten Büsche und traten auf die schmale Straße. Sie bestand aus demselben tiefschwarzen Gestein wie der Rest der Insel. Hier war das Gestein jedoch weniger kantig und spitz als an den Stränden, vermutlich dank der Kutschen und wenigen Autos auf Hawaiki. Für meine nackten Füße jedenfalls war es eine Wohltat.
Finn schlug nicht den Weg zum Hafen ein, sondern humpelte geradewegs in die entgegengesetzte Richtung.
»Wo gehen wir hin?«, fragte ich verwundert.
»Lass dich überraschen.«
»Willst du zu den Klippen?«
»Liv, du solltest dich wirklich in Geduld üben.« Er warf mir einen missbilligenden Blick zu, doch ich sah das schelmische Funkeln in seinen Augen.
»Das sagst ausgerechnet du«, brummte ich. Neugierig, wie ich war, hasste ich es, wenn Finn sich so geheimniskrämerisch gab. Nichtsdestotrotz stellte ich keine weiteren Fragen.
Gemeinsam humpelten wir weiter, stiegen eine steile Anhöhe im Gestrüpp auf der anderen Straßenseite hinauf und zogen uns an dicken, knorrigen Wurzeln hoch. Die gesamte Küste besaß unzählige Hügel und steile Anhöhen, nur die Strände und der Hafen waren einigermaßen flach. In Richtung des Leuchtturmes wurde es sogar bergig und das Innere des dichten, heiligen Waldes schien in weißen Wolkenschlieren zu verschwinden. Hawaiki war keine große Insel – soweit man das von unserem Standpunkt aus sagen konnte. Wir besiedelten nur einen kleinen Abschnitt der Insel, welchen man bereits in zwei Stunden gänzlich durchqueren konnte. Der Rest der Insel war bedeckt vom heiligen Wald und dieser wurde nicht betreten. Unzählige Legenden beschrieben Hawaikis Entstehung und wie einst Sterne vom Himmel in den Ozean gefallen waren, bis eine Insel aus dem Wasser emporgestiegen war, schwärzer als die dunkelste Nacht. Nana hatte meiner kleinen Schwester Jasmine und mir die Geschichten so oft erzählt, dass wir sie mittlerweile auswendig kannten – wie jeder auf der Insel.
»Au!«, zischte ich, als sich ein Dorn in meine Handfläche bohrte, kaum dass ich mich an einem Ast die Böschung hochziehen wollte. Dann erreichten Finn und ich endlich die Anhöhe. Wir befanden uns unmittelbar am Rand des heiligen Waldes.
Ich starrte auf das zugewachsene Buschwerk. Die majestätischen, riesigen Farnpalme und grünen Laubbäume mit den dicken, moosbewachsenen Stämmen. Der zwitschernde, melodische Singsang eines Vogels schallte durch die alten, hohen Bäume und wurde auf der nächstgelegenen Palme von einem anderen Vogel erwidert.
Der Wald war das größte Heiligtum unseres Volkes. Niemand wagte es, einen einzigen Baum zu fällen, geschweige denn den Wald zu betreten. Es war mehr als ein einfaches Verbot, mehr als ein Gesetz. Es war der Respekt vor unserem Glauben, Respekt vor den Ahnen, den Sternen und allem, was unserem Volk heilig war.
Ich konnte meinen Blick nicht vom Waldrand lösen. Irgendwas war anders als sonst, das war es schon seit Tagen; seitdem ich so schlecht schlief und ruhelos war. Und doch hatte mich noch nie eine solche Gänsehaut überkommen wie in diesem Moment. Ich spürte, wie sich mir beim Anblick des heiligen Waldes jedes meiner Nackenhaare aufstellte.
Ich schüttelte mich und riss den Blick vom heiligen Wald los. »Na schön. Was genau wolltest du mir zeigen?«
»Schließ die Augen, es ist eine Überraschung«, sagte Finn und grinste breit.
Halbherzig rang ich mir ein Lächeln ab und kam seiner Bitte nach. Ich war nicht sicher, woher meine Nervosität stammte. Ich war kein abergläubischer Mensch, genauso wenig wie Finn – vermutlich waren wir die Einzigen auf Hawaiki –, doch heute … es fühlte sich nicht richtig an, hier zu sein. »Wehe, du legst mir wieder eine tote Schlange auf die Hand. Dann schubse ich dich die Klippen an der Geisterbucht hinunter«, warnte ich.
Erneut lachte Finn und ich hörte, wie er sich von mir entfernte. Mein Herzschlag beschleunigte sich und mir war unwohl. Nur zu gerne hätte ich gewusst, wieso.
Es raschelte unmittelbar vor mir und Finn ächzte.
»Du kannst die Augen wieder aufmachen.«
Sofort riss ich sie auf und hielt gleich darauf die Luft an. Auf seinen Armen trug Finn eine beachtliche Holztruhe. Sie wirkte alt und abgenutzt und die Eisenbeschläge waren verrostet.
Ich sah meinen besten Freund mit großen Augen an. »Deshalb humpelst du also. Bei den Sternen, du warst wieder in der Geisterbucht!«
Am westlichen Küstenende, nicht weit von hier, gab es eine Bucht, die von sehr steilen, tiefschwarzen Klippen umgeben war. Eigentlich hieß sie Bucht der Seelen, doch die meisten Leute nannten sie wegen all der Geschichten über die verlassenen Schiffe Geisterbucht. Es verging kein Tag, an dem kein neues Wrack in ihr zu finden war. Mal waren es majestätische, große Holzschiffe mit weißen Segeln, mal in die Jahre gekommene, lange Frachter voller Container, Kreuzfahrtschiffe oder Jachten in den verschiedensten Größen. Auch wenn Finn und ich schon lange entschieden hatten, dass wir unseren alten Legenden keinen Glauben mehr schenkten, war dieser Ort etwas, das keiner Frage des Glaubens bedurfte. Er war der Beweis für die heiligen Kräfte Hawaikis, denn egal wie groß ein Wrack war, sie blieben nie länger als einen Tag zwischen den schwarzen Felsen. Jeden Morgen befand sich in der Bucht ein neues passagierloses Schiff.
Finns Wangen färbten sich rot und er stellte die alt aussehende Truhe mit einem verlegenen Räuspern ab.
»Ich war nur ganz kurz in der Bucht«, gestand er. »Bis gestern Nacht war dort dieses gigantische Kreuzfahrtschiff, du hättest es geliebt, Liv! Und der Zugang war so nah am Ufer, da konnte ich einfach nicht …«
Ich holte aus und schlug ihm gegen die Schulter.
»Au! Hey, was soll das?«
»Verdammt, Finnley, wenn dich einer der Springer gesehen hätte, hätten sie ein für alle Mal ihre Drohungen wahr gemacht und dich ausgepeitscht!«
»Ich weiß«, brummte er und rieb sich mit einer Hand über den Nacken. »Na schön, vielleicht war es ein klitzekleines bisschen waghalsig. Ich bin beim Klettern abgerutscht und hab mir dabei das Knie verdreht. Aber ansonsten geht es mir gut und niemand hat mich gesehen, ich schwör’s. Vor Sonnenaufgang sind sich die Springer doch sowieso zu fein, die Geisterbucht zu betreten. Außerdem haben die meisten zu viel Schiss, ohne ein ganzes Team runterzugehen. Niemand hätte mich bemerkt.«
Springer nannten wir die Männer, die die verlassenen Schiffswracks erkundeten und räumten. Die Bucht war das Herz Hawaikis, da sie uns mit allen wichtigen Dingen versorgte: Kleidung, Lebensmittel, Baumaterialien wie Holz, Segeltücher und Schiffsbauteile – und am wichtigsten: Diesel. Das brauchten wir für unsere Autos und die Stromgeneratoren.
Ich rieb mir mit beiden Händen über das Gesicht und seufzte schwer. »Wenn sie dich außerdem noch mal an den Klippen erwischen, lassen sie dich niemals Springer werden.«
»Ich weiß doch«, murmelte Finn erneut und wich meinem Blick aus. »Aber ich kann nicht anders. Diese Idioten holen immer die gleichen Dinge von den Wracks, obwohl so viele Schätze auf uns warten. Wir können doch nicht einfach tatenlos dabei zusehen, wie sie tagtäglich so viele Chancen verstreichen lassen.«
»Finnley, wenn du es dir mit dem Chief verscherzt, wird man dich für immer am Hafen arbeiten lassen!« Ich sah ihn eindringlich an. »Tangaroa und die anderen werden dafür sorgen, dass du nie wieder auch nur in die Nähe der Bucht kommst, verstehst du? Das ist mein Ernst, Finn. Versprich mir, dass du nicht mehr in die Bucht gehst. Irgendwann machen sie dich sonst zum Krüppel und brechen dir die Beine!«
Mein Herz wurde bei der Vorstellung schwer und meine Kehle eng. Finn und vor allem ich hatten schon als Kinder beschlossen, dass wir eines Tages Springer werden wollten – Springer werden mussten. Hawaiki bot keinen anderen Platz, an den wir hingehörten. Wir waren ein wenig zu waghalsig, zu neugierig und besaßen zu viel Energie. Wo, wenn nicht in der Geisterbucht, sollten wir damit etwas anfangen? Ein Springer zu sein bedeutete außerdem, ein Held zu sein. Diese Männer waren furchtlose Abenteurer. Sie riskierten nicht nur täglich ihr Leben, sie waren auch mutig genug, sich verlorenen Seelen zu stellen oder verflucht zu werden, indem sie diesen heiligen Ort betraten. Jeden Tag bei Sonnenaufgang begannen sie damit, die Wracks zu erkunden und alles mitzunehmen, was man entweder auf der Insel gebrauchen konnte oder was sich vielleicht auf dem Schwarzmarkt des Festlandes verkaufen ließ, zu dem sie alle paar Wochen fuhren – nach Los Angeles. Ein Ort, der so sagenumwoben und bunt klang, als stamme auch er aus Legenden. Würden Finn und ich Springer werden, wären wir ganz sicher keine Außenseiter mehr. Besonders Finn nicht, der mit seinen dunklen Pigmentflecken und den hellen Haaren schon bei seiner Geburt zum Außenseiterdegradiert worden war.
Finn stieß mit der Spitze seines schmutzigen Schnürschuhs gegen die Truhe. »Irgendwie kommen wir schon hier weg. Ob mit oder ohne sie.«
»Es ist der einzige Weg«, erwiderte ich blitzschnell und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wir müssen uns beweisen und danach wird alles leichter, du wirst schon sehen. Nur noch ein paar Monate, dann ist unsere Zeit in der Lernstätte vorbei und wir können den Springern zeigen, was wir können.«
Ungläubig blinzelte mich mein bester Freund an. »Bei den Sternen, Liv, das glaubst du doch wohl selber nicht. Sie werden uns niemals bei sich aufnehmen.«
Ich zuckte mit den Schultern, was sich kindisch und trotzig anfühlte. »Versprich mir einfach, dass du das nie wieder machst. Geh nie wieder in die Bucht, verstanden?«
Er kniete sich vor die Truhe und hantierte am rostigen Verschluss herum. »Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde mein Bestes tun, um mich zurückzuhalten.«
»Mehr als das bekomme ich wohl nicht, was?«
Er lächelte schief. »Ganz genau.« Mit einem Knarzen öffnete Finn die Truhe, und obwohl ich den Inhalt nicht sah, stieg mir ein modriger Geruch in die Nase, als hätte das Ding eine lange Zeit an einem feuchten Ort verbracht.
Ich platzte fast vor Neugierde, wagte jedoch nicht, es Finn merken zu lassen. Immerhin wollte ich ihn keinesfalls darin bestärken, wieder in die Bucht hinabzusteigen. Doch die Wracks waren meine große Schwäche, unsere große Schwäche. Ich war fasziniert von ihnen und liebte diesen geheimnisvollen Zauber, der sie umgab.
Er warf mir einen flüchtigen Blick zu. »Ich habe alles eingesteckt, was es vermutlich nicht auf den Hafenmarkt geschafft hätte. Du weißt ja, wie die Springer sind. Das, was diese aufgeblasenen Säcke uninteressant finden, lassen sie einfach auf den Schiffen zurück. Deshalb freue ich mich, dir voller Stolz diese Schätze zu überreichen!« Er warf mir ein breites Grinsen zu und hob einen Stapel Bücher aus der Truhe.
Ich schrie auf. Dann entfuhr mir ein ungläubiges Lachen und ich fasste mir an die Brust. »Bei den Sternen, das … das sind Bücher.« Erst auf den zweiten Blick sah ich, dass auch eine Zeitschrift darunter war, deren Seiten von der Feuchtigkeit wellig und steif geworden waren.
Heiße Tränen schossen mir plötzlich in die Augen und ich rang nach Atem. Begierig und gerührt nahm ich Finn den Stapel ab und inspizierte ihn. »Himmel, das sind vier Stück!« Ich blinzelte angestrengt und versuchte, mich zu zügeln.
»Das ist noch nicht alles«, erwiderte er, ehe er wieder in die Truhe griff und mir einen Rucksack reichte. Er war schwarz und unauffällig.
Absolut perfekt. Keine sichtbaren Löcher, keine Riemen, die wortwörtlich nur noch am seidenen Faden hingen, so wie der meine, der vermutlich nur noch durch irgendeine höhere Kraft auf meinem Rücken gehalten wurde, denn anders konnte ich mir nicht erklären, wie er das Gewicht meiner Sachen aushalten konnte.
Ich konnte nicht anders und sprang meinem besten Freund stürmisch in die Arme. »Danke, Finn. Das ist das Schönste, das jemals jemand für mich getan hat.«
Er erwiderte die Umarmung und strich mir sachte über den Rücken. »Ich tue, was ich kann.«
Wir lösten uns voneinander und ich strahlte ihn so breit an, dass meine Wangen schmerzten. »Das bedeutet aber nicht, dass du wieder in die Bucht gehen solltest.«
»Natürlich nicht«, erwiderte er spöttisch.
»Finn, das ist mein Ernst.«
»Meiner auch.« Er machte ein unschuldiges Gesicht, was mich die Augen verdrehen ließ.
»Wenn du mir Bücher mitgebracht hast, muss für Hana etwas ganz Besonderes dabei sein, oder?«
Diesmal wurden nicht nur Finns Wangen rot, sondern sein ganzes Gesicht. Er griff in seine Hosentasche und fischte eine Kette heraus. Sie war silberfarben und hatte einen kleinen Anhänger in Form eines Herzens.
Ein verlegener Ausdruck machte sich auf seinem Gesicht breit. »Ich habe sie in einer Kajüte gefunden und musste sofort an Hana denken.«
»Sie wird sich unheimlich darüber freuen«, sagte ich, während ich gedankenverloren und glückselig über den Stoff des Rucksackes strich. Ein Windstoß ließ die Seiten der Zeitschrift rascheln, was meine Aufmerksamkeit auf sie lenkte. Offenbar ging es darin um Häuser – zumindest sahen die Gebäude darauf so aus. Die Fenster waren seltsam. Es waren keine Bullaugen aus Schiffen, wie all unsere Fenster. Sie waren groß und eckig, was mich faszinierte. Es würde meine erste Zeitschrift dieser Art sein und ich konnte es kaum erwarten, sie durchzublättern und mehr vom Rest der Welt in mich aufzusaugen. Alle anderen meiner Zeitschriften handelten von Menschen in seltsamen Kleidern, schönen Frauen mit blasser Haut und geschminkten Gesichtern, oder von Liebespaaren, die sich nicht treu bleiben konnten, und Rezepten zum Abnehmen mit Zutaten, die es auf Hawaiki nicht gab.
Meine neuen Bücher waren in einem besseren Zustand als die Zeitschrift. Eines war ein durch die Sonne vergilbtes Wörterbuch, das die englische Sprache ins Französische übersetzte. Es wäre dann wohl mein viertes Englisch-Französisch-Wörterbuch, aber ich beschwerte mich nicht und schätzte sie alle. Die anderen schienen Romane zu sein und waren ausnahmsweise nicht auf Spanisch oder Russisch. Ich würde sie lesen können. Ha! Sogar Kriminalromane! Das waren meine Liebsten. So wie ich Finn kannte, würde er die Truhe behalten. Sie passte in sein kleines, feines Reich, das er in seinem Schlafzimmer erbaut hatte. Er war dafür bekannt, die kuriosesten Gegenstände auf dem Markt zu kaufen, die in den Geisterschiffen gefunden wurden.
Ich verstaute die Beute in meinem neuen, makellosen Rucksack und bedankte mich erneut. Noch immer fühlten sich meine Knie weich an und meine Brust eng. Seit ich denken konnte, waren Finn und ich von Büchern besessen. Das war einer der Gründe, weshalb viele auf der Insel uns als sonderbar empfanden. Niemand interessierte sich für sie. Niemand interessierte sich für irgendetwas, das sich außerhalb von Hawaiki abspielte, und ich konnte mir nicht erklären, warum. War es so seltsam, dass Finn und ich uns nach Geschichten und Abenteuern sehnten? Oder waren alle anderen sonderbar, da sie es nicht taten? Alles auf Hawaiki drehte sich stets nur um die Insel: Um Legenden, Geschichten unserer Ahnen, die Sterne und wie sie unser Leben bereicherten, das Fischen und die Familie, alte Traditionen und die Geisterbucht. Wie war es möglich, dass fast fünftausend Menschen hier lebten und scheinbar kein anderer sich für die Bücher interessierte, die in den Geisterschiffen gefunden wurden? Niemand kam auf die Idee, sie zu sammeln und zu hüten. Die meisten nutzten sie sogar, um ihre Feuer zu schüren oder um neue Papierbögen zu gewinnen, auf denen die Frauen ihre Familiengeschichten niederschrieben.
»Du hörst mir gar nicht mehr zu, oder?«
»Was?« Hastig blickte ich auf.
Finn seufzte, schloss die Truhe und stand auf. »Eigentlich bin ich selbst daran schuld, wenn ich dir Bücher in die Hand drücke und glaube, du könntest mich noch hören.«
»Tut mir leid«, sagte ich, als Finn die schwere Truhe erneut auf die Arme nahm. Ich schulterte den Rucksack und schnappte mir mein Surfboard, ehe wir über einen weniger steilen Pfad Richtung Straße gingen. Mich beschlich der Verdacht, dass Finns Humpeln schlimmer wurde, doch offenbar gab er sich Mühe, es sich nicht anmerken zu lassen. Verbissen wie eh und je.
»Also, willst du Hana die Kette auf dem Sternenfest geben?«, fragte ich neugierig.
Er lächelte. »Ganz genau. Und dann bitte ich sie, ihren Eltern von mir zu erzählen.«
Ich runzelte die Stirn. »Denkst du, das ist eine gute Idee?« Hana und Finn waren schon seit einem Jahr ein Paar. Sie hielten ihre Beziehung jedoch vor ihren Eltern geheim, aus Furcht, Hana könnte verstoßen werden, weil sie sich mit einem Kaurehe eingelassen hatte.Dieses Wort unserer alten, heiligen Sprache bedeutete Monster, doch zugleich bedeutete es so viel mehr als das. Kaurehe war eine so tiefe Beleidigung, dass Männer deshalb schon um Leben und Tod gekämpft und sich Familien verfeindet hatten. Wenn man, wie Finn und ich, zu den Ältestenfamilien gehörte, war unser störrisches Verhalten, wie das Surfen während Whakahara oder das Herumlungern am heiligen Wald, ja noch verkraftbar. Zumindest zwang der Respekt vor unseren Familien die Leute dazu, die Verhaltensauffälligkeiten hinzunehmen. Aber besaß man dann auch noch helles Haar, so wie Finn … Es gab auf der ganzen Insel vielleicht vier oder fünf Menschen mit goldenen Haaren und sie alle wurden gemieden, weil man sagte, dass sie Pech brächten. Finn war zudem der Einzige mit diesen Flecken auf dem Körper. In den Augen vieler ein waschechter Kaurehe, eine Missgeburt. Es war wohl nichts weiter als eine Sache von Glück gewesen, dass sie ihn als Säugling nicht im Meer ertränkt hatten, um ein solch böses Omen, ein missgestaltetes Kind, verschwinden zu lassen. Manche schworen sogar, dass es nach seiner Geburt zwei Monate lang Tag und Nacht in Strömen geregnet haben soll, so als hätten selbst die Sterne und Götter gewollt, dass das Wasser ihn ertränkte.
»Es ist die einzig richtige Entscheidung«, sagte Finn nach einem kurzen Moment. »Ich möchte nicht länger ein Geheimnis sein. Eines Tages möchte ich mit Hana eine Familie gründen und das geht nicht, wenn sie ihren Eltern nicht von uns erzählt. Wir sind keine Kinder mehr, sondern siebzehn. Allmählich fängt der Ernst des Lebens an.«
»Manchmal glaube ich, dass du der furchtloseste Mensch bist, der je gelebt hat«, murmelte ich.
Er schnaubte leise. »Ich bin überhaupt nicht furchtlos.«
»Du bist in die Geisterbucht geklettert und hast dich auf ein Wrack geschlichen, obwohl du jederzeit hättest erwischt werden können. Du ziehst nie den Kopf ein, wenn Idioten wie Tangaroa oder Eduardo dich piesacken, sondern bietest ihnen immer die Stirn.« Ich blickte zu ihm auf. »Und du hast mich immer beschützt, egal vor was oder wem. Das ist ziemlich mutig, Finn.«
Es dauerte einen kurzen Moment, bis er wieder sprach. »Wie auch immer. Nicht der Rede wert.« Anschließend wurde es zwischen uns wieder still, während wir humpelnd und voller Kuriositäten über die Insel liefen, sonderbar wie eh und je.
Finn begleitete mich nach Hause. Die Sonne war gerade dabei unterzugehen, färbte die Wolken orange und tränkte den Himmel in purpurfarbenes Licht. Das kleine, schiefe Haus, in dem mein Vater, meine Schwester und ich lebten, lag am Ende einer schmalen Straße, umgeben von vielen anderen seiner Art. Die Palmen hingen nicht tief am Boden wie am Strand, sondern ragten majestätisch schlank in den Himmel, spendeten Schatten und rauschten im Wind. Unser Haus war alt, mit undichtem Dach und knarrender Eingangstür, doch es war solide und aus Stein, hatte sogar ein Obergeschoss, was nur wenige Häuser auf Hawaiki besaßen.
»Sehen wir uns morgen früh an den Klippen über der Bucht?«, fragte ich, während ich die Haustür aufschloss. Wenn wir Glück hatten, würden wir eines Tages endlich mitansehen, wie die Wracks verschwanden und von neuen ersetzt wurden. Das war fast täglich unser Plan. Irgendwann musste der Wechsel stattfinden und Finn und ich hatten uns vorgenommen, dieses Geheimnis zu lüften. Das war immerhin nicht verboten. Wir brachen keine Regeln, wenn wir uns nur an der Bucht und nicht in der Bucht befanden.
»Sonnenaufgang«, sagte Finn nickend und mit leuchtenden Augen. »Der übliche Treffpunkt.«
»Dann bis morgen. Und danke noch mal für die Bücher. Und den Rucksack.« Ein Lächeln machte sich auf meinen Lippen breit, ehe wir uns verabschiedeten.
Im Haus erwartete mich kalte, trockene Luft. Es war keine Spur von meiner Schwester Jasmine oder meinem Vater und seinem Springertrupp zu sehen, weshalb ich erschöpft und zufrieden ins Wohnzimmer schlurfte und das Surfboard an die Wand hinter der Tür lehnte. Mittlerweile pulsierte mein Knöchel heiß.
Ich humpelte in die Küche, schnappte mir den rostigen, verbeulten Erste-Hilfe-Koffer und nahm Salbe und einen Verband heraus. Nachdem ich mich verarztet hatte, schulterte ich erneut meine beiden Rucksäcke und stieg die steile, schmale Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich eines der neuen Bücher anzufangen.
Ich verschloss die Tür, um nicht erwischt zu werden, bevor ich mich auf die dünne, harte Matratze meines Bettes pflanzte. Mit den neuen Büchern wuchs meine Sammlung auf dreißig Stück. Und alle Bücher, die in Stapeln unter meinem Bett standen, waren vergilbt und zerlesen.
Geschichten waren meine einzige Chance zu entfliehen. Bücher erlaubten es mir, an die unterschiedlichsten Orte zu reisen; Paris, London, Los Angeles, New York, Kopenhagen oder Stockholm. Besonders New York und Skandinavien hatten mein Herz erobert. Nicht, dass ich die Wahl gehabt hätte, doch von meinen nun dreißig Büchern waren zwanzig blutige Kriminalromane. Die meisten waren sehr brutal, dafür aber spannend. Und obwohl ich den Ausgang aller Geschichten kannte, las ich sie immer wieder. Ganz besonders faszinierte es mich, dadurch den Rest der Welt kennenzulernen. Auf Hawaiki gab es kein fließendes Wasser in den Häusern. Wir besaßen auch kaum Strom. Wasser gewannen wir durch einen Fluss, der dem Heiligen Land entsprang, und Strom erhielten wir durch sehr laute, stinkende Generatoren.
Der einzige Grund, weshalb ich von einem Leben wie in den Büchern träumte, war, weil ich davon wusste. Ich wusste, dass es dort draußen eine Welt gab mit Häusern voller Strom und Wasser und kalten Kästen, in denen Lebensmittel frisch gehalten wurden. Kühlschränke. Ich wusste, dass es große Wälder gab mit fremden Pflanzen und Strände, die voll weißem Sand waren. Auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, wie das aussehen sollte. Sand an einem Strand. Keine schwarze, steinige Küste. Es gab Länder, die so kalt waren, dass der Regen fror und in weißen Flocken vom Himmel fiel. Es gab Internet, Telefone und Filme. Fernseher. Und vielleicht war all dieses Wissen ein Fluch, denn ich sehnte mich so sehr danach, diese Orte und Dinge mit eigenen Augen zu sehen, dass es mir das Herz zerriss. Manchmal schmerzte mich das Fernweh so stark, dass mir die Tränen kamen.
Deshalb musste ich Springerin werden. Eines Tages. So wie mein Vater. Los Angeles wäre nur der erste Halt. Ich würde nicht zurückkehren. Denn danach wäre der Rest der Welt dran.
2. Kapitel
»Verdammt«, zischte ich, als Finn zu mir an den Rand der Klippe gerobbt kam. »Wir sind schon wieder zu spät dran!«
»Pscht!«, machte er und warf mir durch das Farngestrüpp einen warnenden Blick zu. »Wenn dich ein Springer hört, war’s das für uns.«
»Ist doch egal«, flüsterte ich und kroch näher an den Klippenrand. Der Gesteinsboden war scharfkantig und grub sich in meine Handballen, was mich wieder fluchen ließ – diesmal leiser. Die Luft war kühl und die rote Morgensonne erklomm gemächlich den Horizont. Eine salzige Brise wehte über Hawaikis Küste und rauschte in den Farnpalmen.
Tief unter uns in der Geisterbucht hing ein gigantisches hölzernes Schiff zwischen zwei Felsen, die aus dem leuchtend blauen Wasser ragten. Das Schiff hatte große, weiße Segel und wirkte einsatzbereit. Kein Wasser auf Deck zu sehen und die Fässer, die gerade nach und nach von Springern weggeschafft wurden, standen gerade und ordentlich an Bord. Das Schiff sah nicht so aus, als wäre es durch einen Sturm gefahren oder als gehörte es hierher, genau wie die anderen drei in der Bucht. Sie alle wirkten fehl am Platz.
Egal wie viel Mühe Finn und ich uns gaben, egal wie lange wir die Geisterbucht beobachteten, es waren stets neue Schiffe dort unten, wann immer wir zurückkehrten. Nie sahen wir den Wechsel.
Finn brummte leise. »So egal kann es dir gar nicht sein. Du bist es doch, die unbedingt zu denen da unten gehören will.«
»Tu nicht so, als würdest du das nicht auch wollen«, flüsterte ich und warf Finn einen finsteren Blick zu. Die Springer waren eng mit unserem Glauben verbunden, traditions- und pflichtbewusst, was ihnen jede Menge Ansehen einbrachte. Aber überwiegend waren es fanatische, hochmütige, arrogante Mistkerle, die zu viel Rum tranken und glaubten, ihnen gehörte die Insel. Besonders die jüngeren Springer waren Idioten. Es war schwer, etwas zu lieben und regelrecht davon besessen zu sein, wenn jeder ein großkotziger Arsch war, der offiziell damit in Berührung kommen durfte. Bis auf meinen Vater verachteten wir sie so ziemlich alle, denn nur die Springer nahmen es sich heraus, Kinder der Ältestenfamilien zu schikanieren. Alle anderen ersparten, vor allem Finn, die körperlichen Qualen. Ich war nur eine Frau, deshalb schlugen sie mich nicht. Vermutlich bekam Finn deshalb oftmals so viel ab – weil er zwei Portionen Schläge einstecken musste. Es waren die Springer, die Finn verprügelten, uns in den Nacken spuckten oder uns öffentlich verspotteten. Ein Teil von ihnen zu werden, würde uns zwar endlich Freiheit schenken, etwas, was wir ansonsten nie erhalten würden, jedoch bedeutete es auch, dass wir vermutlich ein Leben lang mit ihrer Quälerei auskommen mussten.
Mein Wunsch zu entfliehen war größer. Ich sehnte mich so sehr nach all dieser Selbstbestimmung und Macht, dass es mir jede Qual wert wäre. Es gab nichts, wovon ich mehr träumte, als Hawaiki endlich verlassen zu können, um den Rest der Welt zu entdecken. Bis auf Finn gab es niemanden, der diesen Traum teilte. Die Aussicht, ein Teammitglied meines Vaters zu werden, der einen Springertrupp leitete, sah ohnehin nicht rosig aus. Springerinnen gab es zudem nicht. Das hatte man mir schon mehr als einmal deutlich zu verstehen gegeben. Und dennoch wollte ich diesen Traum nicht aufgeben.
»Mit einer Sache hast du recht«, murmelte Finn. »Ich kann nicht fassen, dass wir wieder den richtigen Moment verpasst haben, den Wechsel der Wracks mitzuerleben. Wie kann das sein?«
»Vielleicht sollten wir ein für alle Mal aufgeben. Du weißt doch, was Nana und Toka immer sagen: Die Sterne und die Geister unserer Ahnen …«
»… gaben uns ein Wunder«, beendete Finn den Satz mit einem ironischen Lächeln. »Und Wunder hinterfragt man nicht. Man soll dankbar für sie sein und Demut zeigen.«
»Öffne dein Herz und deine Seele für die Mächte, die unser Land gesegnet haben!«, ahmte ich Nanas Stimme leise nach, ehe wir lachten.
Ein herzhaftes Gähnen entwich mir. »Jede Wette, dass die Trottel da unten wieder die besten Dinge übersehen. Was, wenn wieder Dutzende Karten und Bücher an Bord sind?«
»Liv, du weißt, dass wir daran nichts –«
»Aber es ist unfair!«, zischte ich aufgebracht. »Wenn ich eine von ihnen wäre, würde ich alle Bücher einsammeln und eine Bilothek anlegen.«
»Bibliothek«, korrigierte mich Finn. »Ich glaube, man nennt es Bibliothek. Und was willst du dann machen? Niemand außer uns wird die Bücher lesen.«
»Wir werden es schon schaffen, andere zu überzeugen.«
Er hob eine Augenbraue. »Wir konnten nicht einmal deine Schwester überreden. Sie glaubt, wir sind verflucht.«
Ein Lachen entfuhr mir und ich verdrehte die Augen. »Du kennst sie doch. Jasmine ist zu fromm. Wir könnten Hana überreden.«
»Hana ist noch viel demütiger als Jasmine.«
»Aber Hana liebt dich und würde dir zuliebe sogar zuhören.«
Er legte die Stirn in Falten. »Es ist schwer genug, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Wenn sie herausfindet, dass ich nicht an die alten Überlieferungen glaube, Bücher lese – und überhaupt lesen und schreiben kann, so wie eine Frau – und auch noch Springer werden möchte, wird sie nie wieder ein Wort mit mir reden. Das wäre zu viel, selbst für sie.«
»Das glaubst du?«, fragte ich und runzelte die Stirn. Eigentlich mochte ich Hana. Jeder mochte Hana. Sie war freundlich, hatte ein großes Herz und sah ganz nebenbei auch noch fabelhaft aus. Vermutlich gab es niemanden, der sie nicht mochte. Sie und Finn waren schon immer das perfekte Paar gewesen. Ein wenig langweilig, aber perfekt.
»Nein, Liv, das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich kenne Hana. Ich weiß, wie sie denkt und wovon sie überzeugt ist.«
Ich stieß ein frustriertes Stöhnen aus und begann, rückwärts zu krabbeln. »Irgendwann wirst du ihr die Wahrheit sagen müssen, Finn. Und wenn sie dich wirklich liebt, wird sie es verstehen.«
Wir befreiten uns aus dem Gestrüpp und klopften den Dreck von unseren Händen und Knien. Mein Knöchel pulsierte noch immer, aber der Schmerz war erträglicher geworden.
Finn grinste mich schief an. »Lass mich raten, du hast schon wieder eine von diesen seltsamen Liebesgeschichten gelesen.«
Ich spürte, wie sich Hitze auf meinen Wangen ausbreitete. »Also in erster Linie ging es in dem Buch um einen Mordfall. Die Liebesgeschichte war nebensächlich. Was tut das zur Sache?«
»Was du da liest, hat nichts mit Liebe zu tun, Olivia. Liebe hat mit Verantwortung und Rücksicht zu tun. Und es liegt in meiner Verantwortung, Hana zu beschützen. Deshalb werde ich ihr niemals etwas von unseren Hirngespinsten verraten.«
Ich zuckte zurück, als hätte er mir einen Schlag verpasst. »Hirngespinste?«, wiederholte ich leise. »Jetzt nennst du das auch schon so?«
Finn zuckte mit den Schultern und wich meinem Blick aus. »Wenn wir wirklich Springer werden wollen, dürfen wir nicht mehr über die Stränge schlagen.«
Ungläubig starrte ich meinen besten Freund an, dann verpasste ich ihm auch schon einen Klaps gegen den Arm. »Bei den Sternen, Finnley, du bist so ein Idiot! Gestern erst warst du in der Bucht und hast dort Dinge gestohlen – ich glaube dir kein verfluchtes Wort!«
Murrend fuhr er sich durch die hellblonden Haare. »Na schön, ja, das stimmt. Regeln befolgen liegt nicht in meiner Natur. Aber gute Absichten haben ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder?«
Ich schnaubte leise. »Du solltest vielleicht dagegen ankämpfen, wenn wir wenigstens die Chance bekommen wollen, Springer zu werden.«
Plötzlich erklang schallendes Gelächter – doch es stammte weder von Finn noch von mir.
Wir fuhren vor Schreck zusammen und wirbelten herum. In den Büschen knackte es und mehrere Gestalten traten hervor.
»Oh nein«, murmelte ich und stöhnte auf. Der heutige Morgen wurde ja immer besser.
Drei Männer traten aus dem Dickicht, durch das es in Richtung Straße ging, und es waren Männer, auf die ich gerade getrost verzichten konnte: Nikau, José und Tangaroa.
Wie die meisten Springer trugen sie Kleidung, die sie vor den scharfkantigen Klippen schützte und dennoch beweglich hielt – auch wenn ich es ihnen nicht abkaufte. Sie wollten nur die Hafenarbeiter auf dem Schwarzmarkt in Los Angeles imitieren, zumindest hatte mir das mein Vater verraten – und er war schon öfter in Los Angeles gewesen.
Die drei Springer waren große, bärenhafte junge Männer. Ihre dunklen, gelockten Mähnen waren zu Haarknoten gebunden oder unter Strickmützen gesteckt. Sie trugen blaue Jeanshosen, ganz ohne Löcher, Nikau ein schwarzes Gewand aus Wolle – einen Pullover –, das sogar seinen Hals umschloss, und José und Tangaroa trugen karierte, dunkle Hemden, die an der Brust zugeknöpft waren. Ihre Gesichter waren von Dutzenden Taotus geschmückt: schwarze Linien und Muster, die in narbigen Erhebungen von Herkunft, Status und Familienrang erzählten. Die traditionellen Verzierungen begannen am rechten Ohr, verliefen über das Kinn und verschwanden unter ihrer Kleidung, wo sie ihre linke Schulter und den gesamten linken Arm umschlossen, wie es seit Anbeginn bei den Springern gehandhabt wurde.
Besonders Nikau war von den Linien bedeckt. Er war nicht nur Springer, sondern auch der Sohn unseres Chiefs und würde vermutlich bald seine eigene Springertruppe leiten, obwohl er gerade erst zwanzig Jahre alt war. Er war ziemlich hohl in der Birne, aber im Grunde harmlos. Sein gesamter Körper war übersät von den heiligen Zeichen, und er war mindestens ebenso arrogant wie gut aussehend. Nikau gehörte zu den Springern, die Finn und mich nie verletzt hatten, zumindest nicht körperlich. Zwar war er ein einfältiger Trottel, aber als Sohn des Chiefs so pflichtbewusst und traditionell, dass er wenigstens das besser wusste.
Ich spannte mich an und schob die Schultern nach hinten, während Finn und ich zusahen, wie sie sich langsam von ihrem Gelächter einkriegten.
»Bitte!«, rief Nikau grinsend, als er, José und Tangaroa näher kamen. »Redet weiter, wir wollten euch nicht dabei unterbrechen, wie ihr davon träumt, Springer zu werden.« Er schob die Ärmel seines dunklen Pullovers hoch und entblößte dabei noch mehr beeindruckende Taotus; auf seinen Fingern, den Handrücken und den sehnigen Unterarmen.
Ich funkelte Nikau und die anderen beiden wütend an. »Es gehört sich nicht, andere zu belauschen!«
Tangaroa schnaubte verächtlich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Es gehört sich aber auch nicht, an einem heiligen Ort herumzulungern. Ihr habt keinen Anstand!« Er spuckte uns vor die Füße.
Ich hob eine Augenbraue. »Wäre dir dieser Ort so heilig, würdest du nicht herumspucken.«
»Nicht«, sagte Nikau streng und hielt seinen Freund zurück, als dieser einen Schritt auf mich zu machen wollte.
Nikau hob den Blick und sah Finn und mich mit einem überheblichen Ausdruck auf dem breiten Gesicht an, was mich dazu brachte, die Augen zu verdrehen. Es war immer dasselbe mit seinem autoritären Machtgehabe.
»Ihr zwei habt hier nichts zu suchen und das ist nicht das erste Mal, dass wir euch darauf hinweisen müssen«, sagte er und straffte die Schultern. »Wenn dein Vater davon erfährt, wird er alles andere als erfreut sein, Ōriwia.«
»Ich heiße nicht Ōriwia!«, fauchte ich. »Egal wie oft du mich so nennst!«
Nikau seufzte. »Nicht das schon wieder. Komm schon, ein so hässlicher, bedeutungsloser Name wie Olivia ist kein guter Name für eine Frau wie dich. Der Chief hat dir diesen neuen gegeben und du solltest nicht so stur sein und eine solche Ehre endlich annehmen.«
Der Chief. Wer nannte seinen eigenen Vater den Chief? Am liebsten hätte ich aufgelacht.
Tangaroa – auch das war ein Name, den der Chief vergeben hatte – fletschte die Zähne. Seine Mutter hatte ihn eigentlich Charles genannt und er hatte seinen Namen, ohne mit der Wimper zu zucken, abgelegt, als er vor zwei Jahren Springer geworden war. »Wir haben dir schon oft geraten, dass du dich vom Kaurehe fernhalten sollst. Diese Missgeburt verdirbt dich und deinen Kopf, Ōriwia«, sagte er mit einem fiesen Lächeln auf den Lippen.
Diesmal musste Finn mich zurückhalten, als ich Tangaroa am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre. Dieses widerliche Ekel!
Ich wandte mich an Nikau. »Es ist mir egal, welchen Namen dein Vater mir zugeteilt hat. Meine Mutter hat mir meinen Namen gegeben und ich trage ihn mit Stolz. Und Finn wird niemals solch ein Monster sein wie ihr.«
»Ōriwia!«, sagte Nikau streng.Er baute sich vor mir auf, was wohl einschüchternd wirken sollte – bei mir funktionierte seine Taktik jedoch nicht. Dafür nahmen weder Finn noch ich ihn ernst genug. Treudoofes Schoßhündchen traf es wohl am besten.
Nikau verengte die Augen zu Schlitzen. »Hüte gefälligst deine Zunge. Du weißt doch, mit wem du gerade sprichst, oder etwa nicht?«
Hinter ihm lachte José leise. Sein neuer Name lautete eigentlich Tiaki, doch er war erst seit wenigen Monaten Springer und ich hatte mich noch nicht daran gewöhnt. »Sie ist eine Frau, Nikau. Erwarte nicht zu viel von ihr.«
Ich stieß ein Knurren aus und wollte auf diesen widerlichen, hochnäsigen Mistkerl losgehen, als es erneut im dichten Gestrüpp raschelte. Wir alle drehten uns gleichzeitig um.
Ich schrie überrascht auf. Dann stieß ich Nikau grob zur Seite, rannte los und sprang meinem Vater in die Arme. »Papa! Du bist wieder da! Seit wann? Ich dachte, du bist noch in Los Angeles!« Meine eben noch brennende Wut auf die Sprüche der Jungs war wie weggeblasen, als mein Vater seine bärenhaften Arme um mich schlang, bis meine Füße den Boden nicht mehr berührten und ich durch die Luft gewirbelt wurde. Er lachte und ich vergrub mein Gesicht in dem weichen Stoff seiner dunklen Weste.
»Ich wollte dich und deine Schwester überraschen.« Mit einem warmen Lächeln stellte er mich auf dem Boden ab und zerzauste mir die Haare, als sei ich noch immer ein kleines Mädchen.
Ich lächelte zurück. »Die Überraschung ist gelungen.«
Mein Vater, Ihaia Crate, war ein großer Mann mit kräftigen Muskeln und stolzen Taotus. Im Gegensatz zu Nikau waren sein Gesicht und der breite, kahle Kopf sowie sein gesamter Oberkörper von den heiligen Verzierungen bedeckt. Er war nicht nur Leiter eines Springertrupps, er hatte mit meiner Mutter auch eine Frau geheiratet, die zu einer Ältestenfamilie gehört hatte. Außerdem war er ein wahrer Held, half jedem, wann immer er gebraucht wurde, und fand für jedes Problem eine Lösung. Jeder wusste, dass mein Vater es am meisten verdient hätte, Chief zu sein, doch er hatte seine Chance verpasst. Nach dem Tod meiner Mutter hatte er sich für lange Zeit zurückgezogen. Zu lange.
Auch mein Vater trug robuste Kleidung: Ein weiches Hemd, das ein ähnliches Muster hatte wie die von Tangaroa und José, eine schwarze Weste, eine Jeans und festes Schuhwerk.
Er drückte mir einen Kuss auf den Scheitel. Dann tat er etwas, das mich mit Stolz und Genugtuung gegenüber den Springern erfüllte: Er schloss auch Finn in eine Umarmung. »Es ist schön, dich zu sehen, mein Sohn.«
Ich sah, wie Finn sich entspannte und stolz zu strahlen begann.
»Ihaia!«, sagte Tangaroa eindringlich, als Papa Finn auf die Schulter klopfte und einen Schritt zurücktrat. Ich musste mir auf die Lippe beißen, um das schadenfrohe Grinsen zu unterdrücken, als ich die finsteren Mienen der jungen Männer betrachtete.
»Die zwei haben hier nichts zu suchen! Die Klippen sind nicht gemacht für Leute wie sie und –«
Tangaroa verstummte, als mein Vater sich bedrohlich vor ihm aufbaute. So arrogant der Springer auch war – er blickte mit eingezogenem Kopf und großen Augen auf.
»Was meinst du mit Leute wie sie?«, fragte Papa herausfordernd. »Finn ist Tokas Enkel und seine Familie ist sehr wohlhabend und von höherem Rang als deine. Es ist richtig, dass sie hier nichts zu suchen haben, aber bei den Sternen, Tangaroa, sprich in meiner Gegenwart nie wieder so von meiner Tochter und Finnley.«
Ich sah, wie Tangaroa schluckte, sich hastig räusperte und den Blick senkte.
Bevor meine Schadenfreude allzu große Ausmaße annahm, richtete Papa seinen Blick auf mich und nun war ich es, die den Kopf einzog.
»Jetzt zu euch beiden. Ich möchte nicht erst alt und gebrechlich werden, bis meine Tochter Respekt lernt. Wie oft muss ich euch genau hier, an Ort und Stelle, zurechtweisen? Willst du, dass meine Männer auch vor mir den Respekt verlieren und auf keines meiner Worte hören, so wie du? Möchtest du, dass unsere gesamte Familie an Ansehen verliert? Wieso bereitest du mir ständig Ärger, Olivia?«
Meine Kinnlade klappte herunter und mein Hals wurde trocken. Ich fühlte mich plötzlich wie ein dummes, kleines Kind. »I-Ich … es tut mir …«
»Nikau, bringt Olivia und Finn in die Lernstätte«, fiel mein Vater mir ins Wort und drehte sich zu den Klippen um. Die Sonne war nun gänzlich über den Horizont gestiegen und hüllte das weite, tiefblaue Meer und die schwarze, Insel in weiches, warmes Morgenlicht.
Ich war drauf und dran, die Augen zu verdrehen, aber verkniff es mir. Als mein Blick jedoch Finns begegnete, sah ich, wie einer seiner Mundwinkel zuckte, als wüsste er, was mir durch den Kopf ging.
»Natürlich, Ihaia«, sagte Nikau und nickte meinem Vater ergeben zu. »Wir sorgen dafür, dass sie ihre Lektion wirklich lernen.«
Ah, da war es wieder. Mein Bedürfnis, diesem Schwachkopf irgendetwas ins Gesicht zu pfeffern.
»Danke, Nikau«, sagte Papa und wandte sich ein letztes Mal mit strenger Miene an mich. »Ich will euch hier nie wieder sehen, Olivia. Das nächste Mal werdet ihr öffentlich am Hafenbecken bestraft.«
Ich zuckte zurück und schnappte nach Luft. Ich hatte mich doch wohl verhört …?! »E-Eine öffentliche Bestrafung?« Finn und ich tauschten einen beunruhigten Blick und ich spürte, wie sich mein Magen verknotete. Mir wurde sogar richtig heiß.
Mein Vater strich sanft über mein Haar, als wollte er seiner Drohung die Schärfe nehmen, auch wenn wir beide wussten, dass er das nicht tat. Dann wandte er sich ab und kletterte durch die Böschung von der Anhöhe der Klippen. »Denk an meine Worte, Ōriwia.«
Diesmal erstarrte ich zu Eis. »Was?«, wisperte ich beinahe lautlos.
Finn keuchte neben mir. »Hat er dich gerade wirklich …?«
Mir wurde heiß. Ja, das hatte er. Mein Vater hatte mich Ōriwia genannt. Bei allen heiligen Sternengöttern. Er hatte mich nie zuvor so genannt! Das war das allererste Mal und … Himmel, ich konnte nicht fassen, was für einen Stich es mir versetzte. Es fühlte sich nicht bloß falsch an, weil es nicht mein Name war, sondern wie Hochverrat. Selbst wenn meine Mutter lange nicht mehr unter uns weilte, wusste jeder, wie sehr mein Vater sie geliebt hatte. Es war eine so große, innige Liebe gewesen, dass er sich nach ihrem Tod nie mit einer anderen Frau vermählt hatte.
»Wie kann er es wagen?«, stieß ich hervor. Noch immer blickte ich auf das tiefgrüne Dickicht aus Farn, durch das er verschwunden war. »Wie kann er es wagen, mich so zu nennen?«, flüsterte ich beinahe lautlos und ballte die Hände zu Fäusten.
»Ōriwia, Kaurehe«, sagte José und ließ damit Finn und mich aufblicken. »Ihr habt Ihaia Crate gehört, wir sollen euch zur Lernstätte bringen.«
Ich drückte meine Fingernägel in die Handinnenflächen, bis sich ein spitzer Schmerz auf ihnen ausbreitete. Plötzlich war ich von heißer, scharfer Wut erfüllt, die dafür sorgte, dass mein ganzer Körper unter dem löchrigen T-Shirt und den zerfledderten Jeansshorts zu kribbeln begann. Am liebsten wäre ich ihnen allen an die Kehle gesprungen! Ich konnte mir selbst nicht erklären, woher ich die Kraft nahm, es nicht zu tun.
Ich spürte, wie Finn die Hand auf meinen Rücken legte und meine Wut dadurch etwas dämpfte. Wir kannten uns mittlerweile so in- und auswendig, dass ich die Worte fast hören konnte, die er mit Sicherheit an mich gerichtet hätte, wären die drei Springer nicht in Hörweite gewesen. Lass gut sein, Liv. Das ist den Streit nicht wert. Wir würden es nur schlimmer machen, wenn wir uns von ihnen provozieren ließen. Du kennst die Trottel. Wir stehen da drüber.
Auch wenn es bloß meine eigenen Gedanken waren, fühlten sie sich an wie seine Worte und beruhigten mich.
Wir folgten Nikau, José und Tangaroa zurück zur Straße. Finn humpelte noch immer, doch ich hatte den Verdacht, dass er versuchte, es sich vor den Jungs nicht anmerken zu lassen. Ein laut brummender Truck schoss an uns vorbei, der eine beißende schwarze Auspuffwolke hinter sich herzog. Dann war die Straße wieder leer. Es war ein kleiner Trost, dass Tangaroa, dieser mutige, fähige und überaus gewiefte Springer, auf dem Moos am schrägen Abhang abrutschte und sich an einer Wurzel die Hand aufschnitt – nicht einmal am rauen, schwarzen Gestein, sondern an einer einfachen Wurzel.
Die Lernstätte lag in der Nähe des Hafens. Sie war anders als die Schulen, die in meinen Büchern geschildert wurden, ähnelte ihnen jedoch. Dort lernten wir alles über die alte Zeit, die Tiere und Pflanzen von Hawaiki, die Seefahrt und den Fischfang. Außerdem erlernten alle Frauen Fähigkeiten, die wir beherrschen mussten – das Flechten von Körben, das Knüpfen von Netzen und das Lesen und Schreiben, um die Familiengeschichte aufzuschreiben, die anschließend in den Archiven des Leuchtturmes aufbewahrt werden würde, wie alle Familientagebücher.
Es war alles andere als überraschend, dass es Dinge gab, die die Frauen im Unterricht nicht lernten. Wie beispielsweise das Jagen von Albatrossen, Taukopas und kleinen Nagetieren, die im Unterholz lebten. Niemand auf Hawaiki erwartete von einer Frau, dass sie in der Lage war zu jagen. Es hatte auch niemand Interesse daran, nicht einmal die Frauen selbst. Wieder einmal tanzte ich aus der Reihe, denn ich wollte mich sehr wohl in der Jagd beweisen. Je öfter man mir sagte, dass ich etwas nicht konnte, zu zart für dies und jenes war, desto mehr fühlte ich mich herausgefordert, exakt das zu tun.
Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, während Nikau, Tangaroa und José ins Schwafeln über ihre lange Seereise nach Los Angeles gerieten. Sie erzählten, wie viel sie auf dem Schwarzmarkt verkauft hatten und was Papas Truppe im Gegenzug hatte kaufen können: neue Taschenlampen für das Springerteam. Licht, das ganz ohne Feuer oder dieselbetriebene Stromgeneratoren funktionierte, lediglich mit zwei kleinen Stäben – Batterien –, die in kleine Geräte eingelegt wurden. Man brauchte nur einen Schalter hin und her zu bewegen und schon hatte man Licht, das angeblich so hell war, dass José beim Hineinsehen geglaubt hatte, es hätte ihm die Augäpfel verbrannt. Ein Teil von mir wünschte ihm dieses grausame Schicksal. Und ich fühlte mich deshalb nicht einmal schlecht.