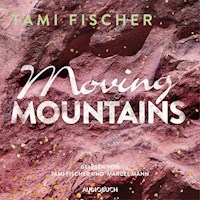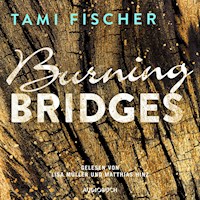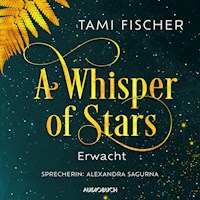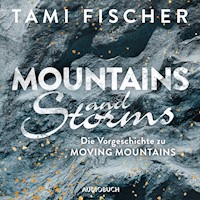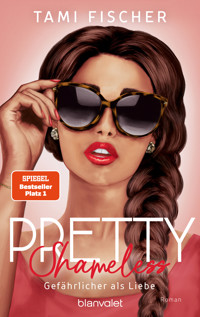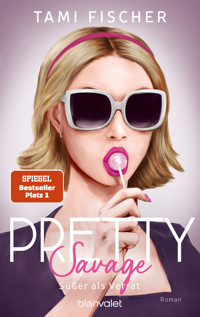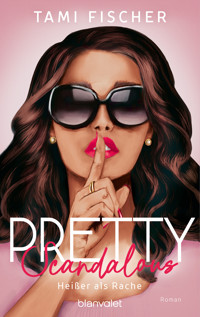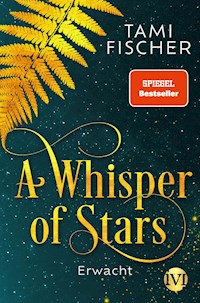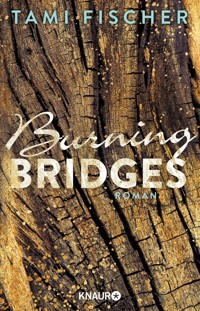9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fletcher University
- Sprache: Deutsch
Ihre Liebe könnte Berge versetzen. Doch finden sie den Mut dazu? In »Moving Mountains«, dem 4. New-Adult-Roman der »Fletcher University«-Reihe von Bestseller-Autorin Tami Fischer, trifft die schüchterne Buchliebhaberin Savannah auf den undurchsichtigen und attraktiven Maxx. Sie will endlich selbstbewusster sein, er seine Vergangenheit ein für alle Mal hinter sich lassen … Savannah Moore ist es leid, Angst zu haben: Angst vor der Welt, dem Glücklichsein und vor der Liebe. Sie träumt davon, stark, unabhängig und frei zu sein. Um ihre Schüchternheit zu überwinden, nimmt sich die Studentin kurzerhand vor, einen One-Night-Stand zu haben. Über eine Dating-App lernt sie den charmanten »MadDog« kennen, der ihr gehörig unter die Haut geht. Was sie nicht ahnt: »MadDog«, alias Maxx, hat in seinem Leben schon so einige Fehler begangen, die ihm nicht zuletzt vier Jahre Gefängnis eingebracht haben. Maxx Williams will sich mithilfe seines Bruders Ches in Fletcher ein neues, ehrliches Leben aufbauen. Das ist jedoch alles andere als leicht, da ihn seine inneren Dämonen und Schuldgefühle fest im Griff haben. Dann ist da auch noch Savannah, die Maxx einfach nicht mehr aus dem Kopf geht – und die ausgerechnet zur Clique seines Bruders gehört! Trotz aller guten Vorsätze droht seine Vergangenheit ihn einzuholen, weshalb Maxx schweren Herzens beschließt, sich von Savannah fernzuhalten. Das ist bei dem gewaltigen Knistern zwischen ihnen jedoch leichter gesagt als getan … Im Liebesroman »Moving Mountains« erzählt Bestseller-Autorin Tami Fischer von Savannahs und Maxx' Weg zu einem neuen, selbstbestimmten Leben – und von der Kraft der Liebe, die dir helfen kann, Berge zu versetzen. Die Liebesromane der romantischen New-Adult-Reihe »Fletcher University« sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Burning Bridges (Ella & Ches) - Sinking Ships (Carla & Mitchell) - Hiding Hurricanes (Lenny & Creed) - Moving Mountains (Savannah & Maxx), mit Kurzgeschichte »Mountains and Storms« - Crushing Colors (Summer & Brigham)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tami Fischer
Moving Mountains
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Savannah ist es leid, Angst zu haben: Angst vor der Welt, vor möglichen Risiken und vor der Liebe. Sie träumt davon, mutig, unabhängig und frei zu sein. Um ihre Schüchternheit zu überwinden, nimmt sie sich kurzerhand einen One-Night-Stand vor und lernt über eine Dating-App den charmanten »MadDog« kennen. Dieser geht ihr gehörig unter die Haut, doch was sie nicht ahnt: »MadDog«, alias Maxx, hat in seinem Leben schon so einige Fehler begangen, die ihm nicht zuletzt vier Jahre Gefängnis eingebracht haben.
Maxx möchte sich in Fletcher ein neues Leben aufbauen, doch seine Vergangenheit droht ihn einzuholen. Eine Vergangenheit, vor welcher er Savannah beschützen will. Aber wie kann er sein Herz davon überzeugen, sich von ihr fernzuhalten?
Inhaltsübersicht
Hinweis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Epilog
Danksagung
Playlist
Triggerwarnung
Quellennachweis
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit Moving Mountains.
Tami & der Knaur Verlag
Für Michelle und Halil.
Ihr werdet für immer geliebt
und niemals vergessen.
Versprochen.
Kapitel 1
Ich bekam keine Luft. Mein Herzschlag dröhnte mir in den Ohren und sorgte dafür, dass meine Haut sich immer enger zusammenzog. Ich schluchzte ein letztes Mal und versuchte, es mit einem Husten zu kaschieren. Doch es änderte nichts. Ich hatte das Gefühl zu ersticken. Komm schon, atme tief durch. Du schaffst das. Eine Panikattacke ist das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst.
Ich wagte es nicht, aufzublicken und meine Eltern anzusehen. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte ja nicht einmal das Omelett auf meinem Frühstücksteller anrühren.
Ihre Worte echoten erbarmungslos durch meinen Kopf, und ihr Verrat saß so tief, dass mir schlecht war.
Scheidung.
Hausverkauf.
Das Ende meiner Therapie. Meine Therapie! Keine Sitzungen mehr mit Dr. Dreyer, kein Abschied, kein Abschlussgespräch. Einfach … nichts. Und das nach all den Jahren, in denen Dr. Dreyer so wichtig und so essenziell für mich geworden war.
Die Morgen, an denen ich unbekümmert mit meinen Eltern auf ihrer Terrasse frühstücken konnte, waren damit wohl ein für alle Mal dahin. Sie hatten mir einfach einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben genommen. Und sie hatten mir so lange etwas vorgemacht, nur um mich jetzt mit allem auf einmal zu erschlagen und mich der Sintflut zu überlassen.
Mein Dad seufzte schwer und stellte in aller Seelenruhe das Glas mit dem frisch gepressten Orangensaft ab. Er schlug einen versöhnlichen Tonfall an. »Savy, Liebling. Es hört sich übler an, als es ist. Deine Mutter und ich haben diese Entscheidung doch nur hinausgezögert, weil es das Beste für dich war. Wir wollen dich nicht verletzen, und wir denken, jetzt, wo es dir besser geht, ist der ideale Zeitpunkt gekommen.«
Im Augenwinkel konnte ich sehen, wie meine Mom heftig nickte. »Dein Vater hat recht. Wir können außerdem nicht für immer Rücksicht auf dich nehmen und unsere eigenen Leben hintanstellen. Vor allem wo du jetzt mit einundzwanzig offiziell erwachsen bist.«
Ich konnte nichts dagegen tun, dass mir erneut ein Schluchzen entfuhr und meine Augen hinter den Gläsern meiner Brille zu brennen begannen. Wütende Hilflosigkeit in ihrer reinsten Form. Aber ich wollte nicht, dass sie es sahen, sonst würden sie mich gar nicht mehr ernst nehmen. Irgendwie musste ich mich zusammenreißen.
Mit all meiner Kraft zwang ich mich, meinen Eltern in die Augen zu sehen. In meinem Kopf hatte ich mir all die richtigen Worte schon längst zurechtgelegt, wie zum Beispiel: Wie könnt ihr mir das nur antun? Habt ihr euren Verstand verloren? Ihr seid schon so lange kein Paar mehr und haltet das vor mir geheim, während die ganze Welt Bescheid wusste? Ihr verkauft einfach unser Haus, in dem Mitch und ich aufgewachsen sind? Und wie könnt ihr es wagen, mir einfach Dr. Dreyer wegzunehmen? Ich brauche sie! Das habt ihr nicht zu entscheiden!
»Es tut mir leid«, wisperte ich statt all der Worte, die ich so viel lieber in die Welt hinausgeschrien hätte. Doch es brauchte nur einen Blick in ihre erwartungsvollen Augen, die ja nur das Beste für mich wollten …
Ich konnte es einfach nicht. Wie immer.
Das klaffende Loch in meiner Brust verschluckte die Wut einfach, obwohl sie so heiß, so brennend und wild und unbezwingbar war. Doch plötzlich war sie einfach fort, und mit ihr all meine Kraft. Zurück blieb nur ein Gefühl von Leere.
Ich zwang meinen Mund dazu, Worte zu formen, auch wenn mein Hals noch immer wie zugeschnürt war. »Ich kann noch nicht darüber reden. I-ich brauche Zeit. Es … tut mir leid.«
Meine Mutter stieß hart den Atem aus, was beinahe genervt klang, doch sie nickte. Dad wirkte ein wenig hoffnungsvoller. Er lächelte mich sogar an. »Natürlich, Liebling. Nimm dir alle Zeit der Welt, okay? Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, ruf mich einfach an.«
In Gedanken hatte ich erneut eine patzige Antwort parat. Was du für mich tun kannst? Gib mir verdammt noch mal Dr. Dreyer zurück!
Am liebsten hätte ich den Gedanken ausgesprochen. Aber ich war schließlich ich. Und wie jeder wusste, war Mut nicht gerade mein Ding. Verbitterung darüber, nicht mutig zu sein? Damit konnte ich wiederum dienen.
Das Gefühl der Taubheit in mir wurde stärker und meine Hände zunehmend kälter und klammer. Ich musste hier weg. Die Panikattacke hatte bereits begonnen, und ich konnte nicht zulassen, dass ich hier und jetzt zusammenbrach. Ich musste so schnell wie möglich allein sein. Deshalb nickte ich bloß, legte mir meine Umhängetasche um und verließ mit mechanischen Schritten die Terrasse meiner Eltern. Ich verabschiedete mich nicht einmal, genauso wenig wie sie.
Wie ferngesteuert lief ich zu meinem Auto und setzte mich hinein.
Mein Puls wurde immer schneller und meine Kehle immer trockener. Es war so warm hier drin, dabei war es gerade mal zehn Uhr morgens. Himmel noch mal, wie konnte es bereits jetzt so heiß sein? Egal. Es war mir so was von egal. Nichts spielte mehr eine Rolle. Und gegen die Panikattacke konnte ich nichts mehr tun. Die Welt wurde träge und zäh, wie in Zeitlupe, während ich selbst, mein Herz, mein Blut und meine Gedanken zu rasen schienen.
Ohne wirklich darüber nachzudenken, brachte ich meine Hände dazu, den Motor zu starten. Rückwärtsgang. In diesem Zustand würde ich mich nicht in den regen Verkehr von Fletcher einfädeln, aber Abstand zu dieser Straße musste ich allemal gewinnen. Ich rollte vom Grundstück meiner Eltern. Zu Hause. Das Haus, in dem mein Bruder Mitchell und ich aufgewachsen und in dem wir unsere gesamte Kindheit verbracht hatten. Das Haus, welches unsere Eltern nun verkaufen würden. Weil sie sich scheiden ließen. Weil sie kein Paar mehr waren, was jeder wusste außer mir, weil niemand mir zugetraut hatte, mit dieser Neuigkeit umzugehen.
Ich entfernte mich davon.
Alles schien vor meinen Augen zu zerbrechen.
Und nun fiel ich. Nein, ich fuhr. Eine Querstraße weiter, mehr brachte ich nicht zustande. Ich parkte einfach nur am Straßenrand.
Ich ließ den Motor ersterben, zog die Handbremse an und löste mich anschließend in Tränen auf. Wie Zuckerwatte in einer Pfütze. Tränen, die nichts und niemand aufhalten konnte.
Nicht dass das etwas Neues für mich gewesen wäre. Ich war schließlich Savannah Moore.
Und Schmerz war mein treuster Begleiter.
Kapitel 2
Ein ohrenbetäubender Signalton drang durch den Trakt. Wie jeden Morgen machte er mich augenblicklich hellwach und ließ mich aufrecht im Stockbett sitzen. Und wie auch an jedem anderen Morgen der letzten tausendeinhundertzweiundneunzig Tage ertönte anschließend das Klicken der elektrischen Verriegelung unserer Gittertür. Carmichael, einer der Wärter, lehnte sich in unsere Zelle. »Raus aus den Federn, Zuckerpuppen! Das Frühstück macht sich nicht von selbst.«
Stöhnend rieb ich mir den Schlaf aus den Augen. Von all den Wärtern musste es natürlich ausgerechnet ein Arschloch wie Carmichael sein, der uns an diesem Morgen weckte. Sein lahmer Spruch war der gleiche wie immer, genauso wie die Alkoholfahne, die ich selbst von meiner harten Matratze aus riechen konnte.
Carmichael richtete den Gürtel unter seinem Bauch, räusperte sich, was ziemlich unappetitlich klang, und hob den Blick – geradewegs zu mir. »Du kommst mit mir, Williams«, knurrte er. »Du darfst heute …«
»Ich werde endlich entlassen«, fiel ich ihm ins Wort und grinste breit. »Geht es jetzt schon los? Ich dachte, ich könnte vielleicht noch …«
Er machte einen Satz auf das Stockbett von Rae Joe und mir zu. »Du kleiner Bastard, ich glaube nicht, dass ich dir erlaubt habe, dein Maul aufzumachen, und schon gar nicht, mich zu unterbrechen.«
Gerade so konnte ich mich davon abhalten, die Augen zu verdrehen. Glaubte er wirklich, dass ich mich an meinem allerletzten Morgen dermaßen unterordnen würde? Das konnte er vergessen. Heute war der Tag, den ich mir seit fast einem Jahr im Kalender markierte: der Tag meiner Entlassung.
Heute würde ich endlich wieder frei sein. Ich sein, Maxx Williams, ein ganz normaler, zweiundzwanzigjähriger, voll integrierter US-Bürger. Dort draußen. Nicht länger hinter diesen hohen Mauern aus Beton und dem vielen Stacheldraht. Deshalb war es mir herzlich egal, wie ich mit Carmichael sprach. Er konnte mir schließlich nichts mehr anhaben.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung«, sagte ich in einem Ton, der nur so vor Sarkasmus triefte. »Unter gar keinen Umständen werde ich Sie jemals wieder unterbrechen, Sir.«
Carmichael wirkte sichtlich verblüfft – immerhin war ich als der Musterknabe bekannt – oder unter den anderen Häftlingen als kleiner Schleimscheißer, der sich immer korrekt verhielt und deshalb auch so eine niedrige Sicherheitseinstufung und kleine Privilegien genoss.
Carmichael verengte die Augen zu Schlitzen, und sein schmal getrimmter Oberlippenbart zitterte, als er den Mund kräuselte. »Komm mir ja nicht blöd, Williams. Noch bist du hier nicht draußen, also pass auf, wie du mit mir sprichst, hast du das verstanden?«
Ich setzte mich aufrechter hin, sofern das zwischen der niedrigen Zellendecke und meiner oberen Etage des Stockbetts möglich war. »Verstanden, Sir. Kommt nicht wieder vor, Mr. Carmichael, Sir.«
Offenbar schien Carmichael zu überlegen, ob er mir eine letzte Lektion erteilen sollte. Da ließ Rae Joe unter mir auf seinem Bett gehörig einen fahren.
Ich verzog das Gesicht. »Scheiße, RJ, nicht schon um diese Uhrzeit.«
Selbst Sally und Trez aus der Zelle nebenan begannen damit, Rae Joe zu verfluchen, der jedoch bloß dreckig lachte.
Carmichael trat angewidert zurück. »Na los, Bewegung, sonst hole ich Verstärkung, ihr miesen kleinen … Großer verfluchter Gott, Browning! Scheiße, das riecht nach zehn toten Ratten!«
Diesmal konnte ich nicht anders und lachte mit den anderen Insassen in den Zellen neben uns los, auch wenn mir von RJs Stinkbombe verdammt schlecht wurde. Bevor Carmichael noch handgreiflich wurde, kamen wir seinem Befehl nach und kletterten aus unseren schmalen Betten.
Die Jungs von nebenan und RJ machten sich, im Gegensatz zu mir, auf den Weg zur Küche. Mehr als ein hartes Schulterklopfen von Sally und ein paar »Alles Gute«-Sprüche von Trez und Rae Joe waren nicht drin. Verabschiedet hatten wir uns bereits gestern, und auch wenn niemand Alkohol hatte auftreiben können, hatte Nigel uns ganze zwei Schachteln Zigaretten besorgt. Und das war es dann gewesen.
Wir verließen den Zellenblock, und Carmichael übergab mich an einen der älteren Wärter, der mich zu meinem Sozialarbeiter bringen sollte. Nach und nach passierten wir die grünen Hochsicherheitstüren, die sich eine nach der anderen öffneten, während sich die nächste hinter uns schloss. Es fühlte sich komisch an, kein Gespräch zu führen, auch wenn ich mich nie gerne mit den Wärtern unterhielt. Ob er erwartete, dass ich mich verabschiedete? Was sagten andere Häftlinge, die entlassen wurden?
Endlich erreichten wir einen Bereich des Gefängnisses, den ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen hatte: den Ausgang.
Ich wurde zunehmend aufgeregter. Gott, es passierte wirklich. Nach all der Zeit geschah es endlich, das hier war kein Traum!
Auch wenn die Türen und Fenster aus Milchglas bestanden, hatte sich der Vorgeschmack auf Freiheit nie süßer angefühlt. Ich hatte mir den ersten Moment draußen in den letzten vier Jahren schon Dutzende Male ausgemalt. Ich konnte es kaum erwarten, mein Gesicht der Sonne zuzuwenden, die Augen zu schließen und tief durchzuatmen. Im besten Fall nicht nur die trockene Sommerluft, sondern auch den Rauch einer Zigarette. Glücklicherweise hatte ich das nahezu leere Päckchen unter meiner Kleidung versteckt, mit einem Stück Stoff an mein Bein gebunden. Aber diesen Augenblick des Glücks musste ich mir vermutlich aufheben, bis ich vom Gefängnisgelände runter war. Man konnte schließlich nie vorsichtig genug sein, selbst wenn ich gleich offiziell ein freier Mann war.
Als es endlich so weit war und mir mein Sozialarbeiter Mr. Vargas eine Papiertüte mit der Kleidung reichte, mit welcher ich vor fast vier Jahren hier angekommen war, raste mein Puls, und ich konnte das Grinsen nicht unterdrücken. Ich würde das Drecksloch namens Maine State Prison endlich verlassen!
»Hier bitte, Maxx.« Mr. Vargas lächelte freundlich und drückte mir eine weitere Tüte in die Hand. Diese war aus grauem Plastik und überraschend schwer. Offenbar konnte er mir die Frage vom Gesicht ablesen. »Das ist von Ihrer Familie. Ihr Bruder hat die Kleidung gebracht. Wenn Sie möchten, können Sie sich gleich hier umziehen.« Er deutete auf eine graue Tür.
Ich nickte bloß und trat in den kleinen Raum, um mich umzuziehen.
Es waren keine besonders auffälligen Sachen in der Tüte. Bloß Jeans, die ein wenig zu kurz waren, ein schwarzes Shirt mit V-Ausschnitt und silbergraue Sportschuhe von New Balance.
Ein seltsames Flattern fuhr durch meine Brust. Ich erinnerte mich an dieses Paar. Das waren meine Schuhe. Ich hatte sie gekauft, kurz bevor ich … kurz bevor das hier passiert war. Verflucht, sie sahen immer noch so aus wie neu. Das Shirt und die Jeans gehörten mir nicht, aber um sie war ich mindestens genauso froh. Für die meisten wäre all das vermutlich nichts Besonderes gewesen. Für mich jedoch waren diese Sachen so unbeschreiblich kostbar, dass sich mein Hals zuschnürte. Es war lange her, dass mich etwas so emotional gemacht hatte. Zuletzt war es das Gerichtsurteil gewesen, das meinen Weg zur Freiheit geebnet hatte.
Nachdem ich mich umgezogen und das Päckchen Zigaretten in der hinteren Tasche meiner Jeans verstaut hatte, verließ ich den kleinen Raum wieder. Ich legte meine Gefängniskleidung, bestehend aus grüner Hose, grünem Shirt und weißem Longsleeve, auf dem Tisch neben Mr. Vargas ab. Der alte Kerl klopfte mir auf die Schulter. »Denken Sie dran, Maxx. Sie können mich jederzeit anrufen. Meine Visitenkarte ist in der Papiertüte, aber für den Fall der Fälle habe ich Ihnen noch einmal ein Schreiben an die Adresse Ihrer Eltern geschickt. Dort finden Sie meine Mailadresse und meine Nummer, mobil und im Büro. Ich weiß, Sie möchten meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen, aber wenn ich doch etwas für Sie tun kann, bin ich jederzeit erreichbar. Melden Sie sich einfach.«
»Klar, danke«, sagte ich, schnappte mir die Papiertüte und nickte Mr. Vargas zu. Wir wussten beide, dass wir uns von diesem Tag an nie wieder hören oder sehen würden, aber auch das war mir mehr als recht. Ich wollte ganz von vorne anfangen, ein neues Kapitel starten. Nein. Verdammt, ich wollte ein gänzlich neues Buch, da die Blätter meines alten total vergilbt waren, von zu viel Nikotin, falschen Entscheidungen und Partys. Wellig und rissig und abgenutzt, weil man sie nicht gut behandelt hatte. Selbst wenn ich ein neues Kapitel darin anfangen sollte, würde jedes neue Blatt bis zur letzten Seite nach Scheiße riechen, weil das ganze Ding in Dreck gebadet hatte, und das jahrelang. Deshalb musste ich raus aus Maine. Deshalb und wegen all der Dinge, die ich mit diesem verfluchten Bundesstaat verband.
Ich drehte mich zu Fleming um, dem Wärter, der mich hergebracht hatte, und versuchte es mit einem Grinsen. »Auf Nimmerwiedersehen.«
Der alte Mann schnaubte, auch wenn ich nicht sagen konnte, ob es verächtlicher oder belustigter Natur war.
Dann war es so weit. Ich lief zum Ausgang, öffnete die Milchglastür, atmete tief durch und …
War frei. Ich war frei.
Meine Füße bewegten sich wie ferngesteuert. Die warme, frische Luft des Sommermorgens wehte mir entgegen, und das gleißende Sonnenlicht blendete mich. Es war still. Friedlich, sofern das der Parkplatz eines Gefängnisses sein konnte.
»Maxx!«
Bei dem Klang der vertrauten Stimme rutschte mir das Herz in die Hose, und ich wirbelte herum. Erleichterung erfüllte mich, als ich meinen großen Bruder auf dem Parkplatz erblickte. Doch nicht nur er stand dort, neben diesem silbernen unscheinbaren Auto, sondern auch mein ältester und engster Freund Creed.
Ich joggte los und spürte, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete. Es war wie ein Rausch, als ich von Creeds harter Umarmung in Empfang genommen wurde und er auflachte. Er sah noch genauso aus wie bei seinem letzten Besuch: kurz rasierte dunkle Haare, eckiges Kinn, aufrechte Statur und Augen voller Wärme und Schalk.
Als Nächstes war mein Bruder dran. Wir umarmten uns ebenfalls fest, und er klopfte mir mit einem erleichterten Lachen auf den Rücken. Ich konnte regelrecht spüren, wie sich dabei seine Schultern entspannten.
»Schön, dich zu sehen, Knirps. Es ist endlich vorbei.« Er löste sich von mir. Chesters Lächeln war breit und echt, wodurch seine grauen Augen klein wurden. Er war ziemlich gebräunt vom Sommer, und seine braunen welligen Haare berührten mittlerweile sogar schon seine Schultern.
Ungläubig und ergriffen lachte ich ebenfalls. »Fuck, ich hab’s wirklich geschafft.«
Creed drückte meinem Bruder die Autoschlüssel in die Hand. »Vergeuden wir keine Zeit. Lasst uns endlich von hier verschwinden und nie wieder zurückkommen.«
»Nichts lieber als das.« Mir wurde leichter ums Herz. Am liebsten hätte ich eine geraucht und wie ursprünglich geplant mein Gesicht in die heiße Sommersonne gehalten, aber dafür hatte ich später noch Zeit. Und wenn nichts mehr schiefging, sogar noch den Rest meines Lebens.
Ich kletterte nicht auf die Rückbank, sondern geradewegs auf den Beifahrersitz im erwärmten Wageninneren.
Nervös rieb ich mit den Händen über meine Beine, über den rauen Stoff einer Jeans, die mir nicht gehörte. Oder ab jetzt gehörte. Gierig wie nie zuvor sog ich den leicht staubigen Ledergeruch des Autos ein und lehnte mich zurück, während mein Bruder den Motor anspringen ließ und vom Parkplatz des Maine State Prison fuhr.
Creed legte mir von hinten eine Hand auf die Schulter und drückte sie. »Ab jetzt wird alles anders, Maxx. Du wirst sehen. Von jetzt an geht es nur noch bergauf.«
»Das hast du mir in den letzten Monaten bei jedem einzelnen Besuch gesagt«, erwiderte ich spöttisch.
Wir fuhren durch die offene Schranke, am Wachhäuschen vorbei. Wir ließen die hohen Mauern ein für alle Mal hinter uns.
Mein Bruder warf mir ein Lächeln zu. »Weil es stimmt. Willkommen in der Freiheit, Maxx.«
Kapitel 3
Ich zupfte gedankenverloren an meiner gepunkteten Bikinihose und sank tiefer in die Poolliege. Hastig blätterte ich um. Meine Augen huschten unruhig von Zeile zu Zeile, immer schneller und immer verzweifelter. Nein, nein, nein! Es ist Heiligabend! Tut mir das jetzt bitte nicht an!
Einerseits wollte ich, dass dieses blöde Buch endlich endete, andererseits liebte ich es auch und wollte überhaupt nicht, dass es jemals endete. Es war der zweite Band einer weihnachtlich-romantischen Serie, und die Protagonistin Kate versuchte gerade, durch einen Schneesturm zu rennen, um ihre große Liebe Sam daran zu hindern, eine andere zu heiraten. Bei so wenigen verbleibenden Seiten konnte das doch nur in einer Tragödie enden!
Hinter meiner riesigen gelben Sonnenbrille kämpfte ich angestrengt mit den Tränen, während aus den Boxen ein ruhiger elektronischer Remix lief. Vor mir, im Pool des Verbindungshauses, war das halbe Schwimmteam der Fletcher University und lauter Mädchen, denen ich hier schon öfter begegnet war, wann immer Austin eine Party schmiss. Es wurde gelacht, mit einem aufblasbaren Ball gespielt und auf Luftmatratzen gedöst – immerhin herrschten um die vierzig Grad. Die flimmernde Luft war erfüllt vom Geruch nach Chlor, Sonnencreme, verbrannter Holzkohle und Steaks. Ich jedoch war dermaßen in die Geschichte versunken, dass es mir vorkam, als würde es nach eisigem Schnee, Zimt und Kaminfeuer riechen. Meine feuchten Augen zuckten weiter, von Wort zu Wort. Mir stockte der Atem. Wenn Sam Trina und nicht Kate heiratet, breche ich die Reihe ab!
Ich fröstelte, obwohl die Sommerhitze auf meiner sommersprossigen Haut brannte. Mitchell, Summer und Ella hatten mehrfach versucht, mich länger als zehn Minuten in den Pool zu locken, aber ich wollte nicht feiern. Ich wollte einfach nur lesen, das Wetter genießen und mich ab und an abkühlen. Partys waren sowieso nicht mein Ding. Es war nicht so, dass ich sie nicht leiden konnte, doch manchmal laugten sie mich aus. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, hatte ich heute nicht unter Menschen gehen wollen. Das wollte ich schon seit dem Gespräch mit meinen Eltern vor ein paar Tagen nicht mehr. Ich hatte mich zwingen müssen, herzukommen, weil ich wusste, dass die Alternative es nur schlimmer gemacht hätte: im Bett liegen und so lange schlafen, bis sich das Gewicht auf meiner Brust von selbst auflöste. Nicht dass es wirklich half, doch zu schlafen bedeutete auch, nicht fühlen zu müssen. Eine Flucht vor mir selbst und meinen Gedanken. Das war auch der Grund, aus dem ich nicht gerade selten Feiern oder Spieleabende mit meinen Freunden abgesagt hatte. Doch ich wollte nicht länger vor mir selbst fliehen. Es war die Angst vor der Angst, die mir schon so viele Möglichkeiten genommen hatte, und je besser es mir ging, desto größer wurde meine Furcht davor, dass sich das wieder änderte. Aber damit war Schluss. Ich war es leid, mich zu verkriechen und so viel Leben zu verpassen. Deswegen war ich stolz auf mich, dass ich trotz meines heutigen Gemütszustandes hier war. Auf der Poolparty von meinem Kindheitsfreund Austin, bewaffnet mit einem Buch und einer so großen Sonnenbrille, dass ich vermutlich aussah wie eine Fruchtfliege. Auch wenn ich nicht feierte wie die anderen – es war ein erster richtiger Schritt, überhaupt hier zu sein.
Ich blätterte um. Irgendwo im Hintergrund nahm ich die Stimme meines Bruders Mitchell wahr, der seinem Mitbewohner Todrick etwas zurief. Ich hätte ja aufgeblickt, um zu sehen, was sie taten, aber Kate brach gerade im Schnee zusammen und wollte aufgeben. O nein, bitte steh wieder auf, Kate! Ein Schluchzen entfuhr mir. Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Nicht nach allem, was ich die letzten vierhundert Seiten mit ihr und Sam durchgemacht hatte!
Eine Hand berührte meinen Arm. »Savy?«
Mit einem Schrei setzte ich mich auf und klappte das Buch zu. »Was?! Was ist?«
Grinsend und pitschnass stellte sich Ella in ihrem blauen Bikini vor mich und blockierte die Sonne. »Du würdest nicht mal mitbekommen, wenn eine Bombe hochgeht, oder?«
Ich räusperte mich, damit sie nicht merkte, dass ich noch immer drauf und dran war, in Tränen auszubrechen. Widerwillig legte ich ein Lesezeichen in mein Buch und verstaute es in meinem Minnie-Rucksack neben der Poolliege. »Das, äh, macht doch ein gutes Buch aus. Außerdem ist es grade echt spannend.«
Ella war eine meiner besten Freundinnen. Wir kannten uns schon, seit ich denken konnte, und hatten seither alles miteinander geteilt und erlebt. Sie studierte Literatur und ging ebenfalls auf die Fletcher University.
Sie wrang sich die schulterlangen dunkelblonden Haare aus, was Wassertropfen auf die heißen Steinfliesen beförderte. »Was liest du da überhaupt?«
»Herzschmerz & Schneesturm. Das ist der zweite Band aus der Hot-Christmas-Pudding-Reihe.«
»Wow. Nur du kannst mitten im Hochsommer eine Weihnachtsgeschichte lesen.«
»Ich kann nichts dafür. Das Buch hat mich ausgewählt, nicht andersherum. Wenn ich eine Reihe anfange, muss ich sie außerdem an einem Stück lesen. Das ist so was wie ein Naturgesetz.«
Im Augenwinkel konnte ich sehen, wie Summer beim Wasserwrestling gerade von Austins Schultern gestoßen wurde und platschend im Wasser landete. Zwei Mädchen, die am Poolrand saßen, schrien auf, als sie dabei von oben bis unten nass gespritzt wurden.
Ella musterte mich einen Moment lang. Kurz darauf erschienen Sorgenfalten auf ihrer Stirn, die mir augenblicklich Unbehagen bereiteten.
Mein herzzerreißendes Buch war vergessen.
Sie setzte sich auf ihre Liege, rechts von mir. »Möchtest du über die Nachricht von gestern reden?«
Obwohl ich mich auf diese Frage eingestellt hatte, versteifte ich mich bei den Worten. Ich begann damit, sehr ausführlich meine sommersprossigen Arme mit Lichtschutzfaktor 50+ einzucremen.
Ich konnte diesem Gespräch noch immer aus dem Weg gehen. Es würde diesen schönen Tag bewahren und ihn nicht mit dunklen Gedanken überschatten, die ich heute so erfolgreich verdrängt hatte. Doch würde ich das tun … dann würde ich erneut davonlaufen. Dabei hatte ich mir doch versprochen, dass sich von nun an die Dinge ändern würden.
Aus diesem Grund kratzte ich auch all meinen Mut zusammen und setzte mich auf. »Na schön. Also, vor ein paar Tagen haben meine Eltern …«
»Vorsicht!«, brüllte Todrick vom Pool aus, ehe eine Sekunde später auch schon der aufgeblasene Ball Ella im Gesicht traf. Erschrocken quiekte ich auf, und Ella stieß ein Grunzen aus.
»Au, verdammt!«, rief sie und sah wütend Richtung Pool. »Was soll das denn, Todd?«
»Sorry, El! Das war keine Absicht. Ich wollte Mitchell treffen!«
»Ist klar.« Sie warf den Ball mit beiden Händen zurück in den Pool. Mitchell fing ihn in der Luft und warf Ella ein entschuldigendes Lächeln zu. »Danke, Elmo!«
Neben ihm kletterte Summer aus dem Pool, wischte sich die langen blonden Haare nach hinten und zupfte ihren knappen Bikini zurecht. Durch den weißen Stoff wirkte sie noch gebräunter, als sie diesen Sommer ohnehin schon war. Summer war über ein Meter achtzig groß, kurvig und hatte die längsten Beine, die ich je an einem lebenden Menschen gesehen hatte.
Mit einem zufriedenen Seufzen trat sie zu uns und ließ sich pitschnass auf ihre Liege neben Ella fallen. »Ich wäre diesen Sommer zwar immer noch lieber mit euch nach Cancún geflogen, aber das hier ist auch nicht zu verachten.«
Ich warf Ella einen entschuldigenden Blick zu, ehe ich mich Summer zuwandte und schwach lächelte. »Wenn du das Hotel und die Flüge bezahlst, komme ich sofort mit, versprochen.«
»Wie wäre es mit Ratenzahlung? Ein Kredit bei der Bank?«
»Man gibt kein Geld aus, das man nicht besitzt, Summer.«
Sie grinste. »Dann müssen wir uns wohl weiter mit dem Pool von Austin und den Verbindungsheinis zufriedengeben. Sav, sag mal, was hat es eigentlich mit deiner Nachricht von gestern Nacht auf sich?«
Das Herz sank mir in die Hose. Seit dem grauenhaften Gespräch mit meinen Eltern tat ich nichts anderes, als Pläne zu schmieden. Ich hatte sogar eine Liste dafür angelegt. Letzte Nacht hatte ich Ella und Summer schließlich davon erzählt. Zumindest in gewisser Weise. Dass ich »mein Leben verändern wolle« und »sofort damit starten würde, all die Pläne in die Tat umzusetzen«. Sie wussten noch immer nichts von dem Frühstück mit meinen Eltern, obwohl ich sonst immer meine Sorgen mit ihnen besprach. Doch dieses Mal war es anders. Ich wollte nicht albern klingen, weshalb ich versuchte, mir nicht einzureden, sie hätten mein Leben zerstört. Aber ein kleiner, weinender Teil meines Herzens empfand es genau so. Ich hatte Zeit für mich gebraucht. Zeit, um herauszufinden, was ich jetzt tun sollte. Ich fühlte mich nicht gerade so, als könnte ich Berge versetzen, aber ich war immerhin bereit, es zu versuchen.
Deshalb hatte ich mich auch entschieden, endlich mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen. Ich hatte ihnen diese Nachricht geschickt, und ich würde jetzt nicht kneifen.
Einen kurzen Moment überlegte ich, wie ich es am besten ausdrücken sollte. Ich konnte ja selber nicht genau in Worte fassen, wofür meine Liste diente. Mit steifen Fingern zog ich meine Sonnenbrille ab. »Ich möchte aus meiner Komfortzone raus«, versuchte ich es mit unüberhörbarer Vorsicht in der Stimme. »Ich … will Dinge tun, die nur für mich sind und die ich mich sonst noch nicht getraut hab. Ich will einfach keine Angst mehr haben. Deshalb hab ich eine To-do-Liste erstellt.« Voller Argwohn blickte ich zu Ella und Summer auf. Vermutlich fanden sie die Idee albern. Sie war albern! Und kindisch.
Ella lächelte mich jedoch an. »Das klingt doch toll. Wirklich.«
Erleichtert stieß ich den Atem aus und ließ die Schultern sinken. »Ja?«
»Natürlich!«, sagte auch Summer. Sie stand auf und zog mich auf die Füße. Das sorgte augenblicklich dafür, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste. Immerhin war ich mit meinen eins sechzig ein Winzling, vor allem neben ihr. Sie lächelte ermutigend. Auf ihrem Gesicht war nicht die Spur Belustigung zu sehen, was mir eine riesige Last von den Schultern nahm. »Es ist verdammt schwer, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Dass du das versuchst, ist toll. Das sollte gefeiert werden!«
Meine Kehle war vor Rührung wie zugeschnürt, und ich lächelte meine Freundinnen an. Es machte vielleicht nicht den Anschein einer großen Sache, aber für mich war es das. Am liebsten wäre ich ihnen augenblicklich in die Arme gesprungen.
Summer sah sich um, ehe ihr Blick auf einer Person im Pool hängen blieb. »Hey, Austin! Wo ist die Erdbeerbowle, von der du gesprochen hast?«
»Du gehst hier ein und aus, Andrews!«, rief er aus dem Wasser, ohne Anstalten zu machen, rauszukommen. »Sieh einfach in der Küche nach!«
Sie verdrehte die Augen. »Alles muss man hier selber machen. Kommt mit!« Ohne Protest ließ ich mich von meinen Freundinnen über die trockene, warme Wiese ins Haus ziehen.
»Dürfen wir Fragen stellen?«, fragte Ella, als wir barfuß und in unseren Bikinis in die Küche traten.
»Klar«, erwiderte ich sofort, ohne genau zu wissen, worauf ich mich einließ. »Cookie?«
»Aber so was von Cookie«, erwiderte Summer und holte die Schüssel mit der Bowle aus dem Kühlschrank.
Cookie war unser Safeword. Wenn wir über Themen und Dinge sprachen, die einem von uns schwerfielen, setzte Cookie den Schlussstrich. Dann wussten alle anderen, dass ein Punkt erreicht worden war, an welchem man das Thema besser fallen ließ, um niemanden zu verletzen oder zu bedrängen. Es hatte als kleiner Spaß angefangen, aber tatsächlich half es uns, noch offener miteinander zu sprechen. Dr. Dreyer war auf die Idee gekommen, als ich ihr während einer Sitzung gebeichtet hatte, wie schwer es mir bei sensiblen Themen fiel, mich anderen gegenüber zu öffnen.
Allein der Gedanke an Dr. Dreyer sorgte dafür, dass sich mein Hals zusammenzog. Nie wieder. Ich würde nie wieder auf dieser Ledercouch sitzen, ihren süßen Hund Bowie streicheln und mit ihr reden.
Summer reichte mir einen bis zum Rand gefüllten roten Becher mit Bowle, den ich vorsichtig entgegennahm. Hastig trank ich einen Schluck, um nichts zu verschütten.
Sie legte neugierig den Kopf schief, während sie eine Erdbeere aus der Schüssel fischte und sie aß. »Welche Punkte stehen auf deiner Liste? Bungee-Jumping? Paintball? Prank-Videos mit fremden Menschen? Oder mit einem Umarme-mich-Schild über den Campus laufen? Uh, hast du schon an Dates gedacht?«
Beinahe hätte ich mich verschluckt. Ich spürte genau, wie mein Gesicht ziemlich dunkelrot anlief. »Dates?«, quiekte ich, ehe ich mich hastig räusperte. »Ich meinte … Dates? Äh, nicht direkt.«
Summer ließ mich nicht aus den Augen, als sie einen weiteren randvollen Becher an Ella weiterreichte. Ein wissendes Lächeln erschien auf ihren Lippen. »Savy, gibt es vielleicht noch etwas, was du erzählen möchtest?«
Ich trank einen großen Schluck, drehte mich abrupt um und lief zurück nach draußen. »Nope. Nö. Wie kommst du darauf?«
Ella holte lachend auf, bis sie neben mir lief, und verschüttete dabei ein wenig Bowle auf der Wiese. »Ich weiß, wie du klingst, wenn du dich bei etwas ertappt fühlst.«
Ein gequälter Laut entfuhr mir, und ich sank auf meine Liege. O Gott. Wenn sie wüssten!
Komm schon, Savannah, spring über deinen Schatten. Wenn deine besten Freundinnen die Liste schon nicht sehen dürfen, wer dann?
Ich griff in meine Tasche und drückte Ella mein Handy in die Hand. Kurz und schmerzlos. »Hier. Die Liste ist in meinen Notizen.« Ich trank den gesamten Rest Bowle in einem Zug aus und legte mich wieder hin. Meine Fußzehen krümmten sich, während ich darauf wartete, was Ella und Summer zu sagen hatten. Beide beugten sich über mein Smartphone. Und wieder kam mir die Liste absolut albern vor.
Lass dir ein Tattoo stechen.
Tanze in der Öffentlichkeit.
Such dir einen Nebenjob.
Verlasse auch mal das Wohnheimzimmer.
Habe einen …
Summers Kopf zuckte nach oben. »Ein One-Night-Stand?«
»Leise!«, zischte ich und sah mich panisch um. Allem voran sah ich zu meinem Bruder im Pool. Der war jedoch gerade unter Wasser gewesen und tauchte nun wieder auf. Glück gehabt!
Mein Herz klopfte rasend schnell gegen meine Rippen, und ein unangenehmes Prickeln ließ meine Ohren glühen. »Mein Gott, Summer, das kannst du doch nicht einfach so hier herumschreien!«
Ella gab mir mein Handy zurück und strahlte mich begeistert an. »Ich liebe diese Liste. Und das sage ich nicht wegen Punkt Nummer fünf.«
»Aber apropos Punkt Nummer fünf«, wandte Summer vorsichtig ein und runzelte die Stirn. »Wie genau wird das … ablaufen? Du weißt schon, was ich meine.«
Sie musste nicht aussprechen, was sie sagen wollte. Sie hatte recht, ich wusste, was sie meinte. Habe einen One-Night-Stand. Eigentlich war dieser Punkt lächerlich. Immerhin bekam ich kaum ein richtiges Wort heraus, wenn ich mit einem Mann sprechen wollte, der auch nur halbwegs attraktiv war! Selbst bei Ches und Creed brauchte ich immer noch etwas Zeit, um aus mir herauszukommen, so wie ich es bei meinen Freundinnen oder bei Todrick und Austin konnte.
Summer betrachtete ihre Nägel und ließ ihre Stimme beiläufig klingen. Es war, als könnte sie geradewegs meine Gedanken lesen. »Wann, äh, hattest du eigentlich zuletzt Kontakt zu einem Kerl, der nicht zu unserer Truppe gehört?«
Ausweichend zuckte ich mit den Schultern. »Also … So lange ist das noch gar nicht her.«
Ella lächelte verschwörerisch. »Das wäre doch auch ein guter Punkt auf deiner Liste, bevor es zu einem Du weißt schon was kommt. Mit Männern sprechen. Du könntest die Punkte ja kombinieren.«
Empört schnappte ich nach Luft. »In meinen Vorlesungen sind auch Jungs, und mit denen rede ich andauernd! Vor ein paar Monaten zum Beispiel wollte sogar Connor, dieser Kunstgeschichtsstudent aus meinem Buchclub, mit mir ausgehen, und ich habe ihm gesagt, dass es besser wäre, wenn wir nur Freunde bleiben. Ich bin nicht zu Eis erstarrt und bin dabei auch nicht schreiend davongelaufen.«
»Aber Connor ist doch gar nicht dein Typ«, warf Ella ein. »Ich dachte, dieses Kommunikationsproblem gibt es nur mit Jungs, die du süß findest. Na ja, denk einfach mal drüber nach. Das war auch nur ein Vorschlag, letztendlich ist das ganz dir überlassen.«
»Dann … findet ihr das nicht albern?«
»Überhaupt gar nicht!«, sagte Summer mit einem begeisterten Grinsen.
Ich sah mich verstohlen um, ehe ich die Stimme senkte. Mein Gesicht glühte so sehr, dass es vermutlich leuchtend rot angelaufen war. »Okay, es ist ziemlich peinlich. Ihr wisst ja, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Das einzige Mal war … also mein erstes Mal … ihr wisst doch noch, Toby?«
O ja, dem Ausdruck auf Ellas Gesicht nach zu urteilen wusste sie auch noch genau, wer Toby war. Mein erster und einziger Freund, damals in der Middleschool.
Summer machte eine wegwerfende Handbewegung. »Vergiss dieses Arschloch. Um es noch mal auf den Punkt zu bringen, es ist nichts schlimm und erst recht nichts peinlich daran, One-Night-Stands zu haben oder sie zu wollen. Wenn du welche hast, ist das super, und wenn du keine hast, ist das genauso super. Außerdem hat die halbe Uni SuperCrush auf ihrem Handy.«
SuperCrush war eine App, die vor ein paar Jahren von IT-Studentinnen der Fletcher University erschaffen worden war. Ihr Ziel war es, eine lokale Dating-App zu schaffen, die für alle Teilnehmenden sicherer war. Man konnte sogar eine anonyme Bewertung abgeben. Nicht ob das Date gut war oder schlecht, sondern ob man sich dabei sicher gefühlt hatte und ob man gut behandelt worden war. Mittlerweile war SuperCrush so beliebt, dass es in ganz Fletcher und Umgebung Tinder und Co. abgelöst hatte.
Ertappt zog ich die Schultern hoch und den Kopf ein.
Mein Gesicht war ein offenes Buch, und Summers Luftschnappen zufolge konnte sie eins und eins ziemlich schnell zusammenzählen.
»Wirklich? Du hast dir SuperCrush heruntergeladen?«
»Summer!« Wieder blickte ich alarmiert zum Pool. »Kannst du bitte leiser sprechen?«
»Oh, oh! Darf ich mir dein Profil ansehen?«
»Vergiss es! Ich will nicht, dass du oder Ella es seht.«
»Na schön, du hast gewonnen«, brummte Summer.
Erleichtert atmete ich auf und stupste sie mit dem Fuß an. »Danke.«
Ich hatte SuperCrush erst gestern installiert. Noch immer hatte ich keinen blassen Schimmer, wie ich mein Kommunikationsproblem bei attraktiven Männern lösen sollte, aber im Internet war ich viel mutiger als in der echten Welt. Vielleicht war dieser Weg ja genau der richtige für mich. Und, wer weiß, vielleicht sogar der einzige. Es war eine Schnapsidee gewesen, nichts weiter als eine impulsive Entscheidung. Ich hatte nach der Registrierung ein Bild von mir hochgeladen und die leeren Felder ausgefüllt. Fertig. Danach hatte ich die App geschlossen und sie seither auch nicht mehr geöffnet. Ich traute mich nicht. Es war fast schon witzig. Da installierte ich mir diese Dating-Sex-App, um über meinen Schatten zu springen, und traute mich dann nicht einmal, sie auch nur zu öffnen. Vielleicht würde es ja gar nicht zu Punkt Nummer fünf meiner Liste kommen. Vielleicht würde ich SuperCrush auch einfach wieder löschen.
Nein, das wirst du nicht, nur weil du Angst vor neuen Dingen hast!
Nervös kratzte ich an einem Fleck Sonnencreme auf meinem linken Knie. »Cookie«, sagte ich entschuldigend. »Wollen wir schwimmen gehen?«
Ella lächelte und band sich die dunkelblonden Haare zusammen, die fast schon wieder trocken waren. »Klar. Ich gehe bei der Hitze total ein. Übrigens fahre ich später zu meiner Mom. Sie und Tante Kat wollen schon seit Ewigkeiten unbedingt diesen neuen Sushiladen in der Mall ausprobieren. Wieso kommt ihr nicht mit uns?«
Meine Laune hob sich sofort. »Das klingt toll! Ich habe Kat und Nancy schon lange nicht mehr gesehen.«
Summer verzog unglücklich das Gesicht. »Ausgerechnet heute Abend kann ich nicht. Ich hab meinem Dad versprochen, mit ihm und Delia zu skypen und dabei zu kochen.«
»Wenn du willst, könnten wir morgen zu dir kommen«, schlug ich vor. Ella und Summer wohnten seit dem letzten Winter im gleichen Wohnhaus, worauf ich ehrlich gesagt ein wenig neidisch war.
»Deal!«, sagte Summer sofort, und ihre Miene hellte sich wieder auf. »Wir könnten uns mit Snacks vollstopfen und uns Punkte für deine Liste überlegen, Savy.«
Begeistert nickte ich und stand auf. »Dann haben wir ein Date. Das wird toll!«
Plötzlich wurde ich von hinten gepackt, und das von jemandem, der ziemlich kalt und nass war. Ein spitzer Schrei entfuhr mir. Ich hatte kaum genug Zeit, um einen Blick nach hinten zu werfen, ehe Todrick mich auch schon über die Schulter warf und meine Sonnenbrille auf der Poolliege landete.
»Toddy! Was soll das?« Ich trommelte halbherzig auf seinen Rücken.
Er lachte verschlagen. »Ihr drei gehört ins Wasser! Es sind vierzig Grad, und du bist schon wieder trocken.«
Ich konnte gerade noch sehen, wie Summer die Augen verdrehte, uns aber folgte, ehe Todrick auch schon Anlauf nahm. Er rannte mit mir in den Pool, und ich lachte laut auf, als wir im kalten Chlorwasser landeten.
Obwohl ich mich noch am Morgen alles andere als bereit dazu gefühlt hatte, herzukommen, entpuppte sich der Tag als voller Erfolg. Vielleicht weil ich über meinen Schatten hatte springen müssen, um das hier zu erleben. Und obwohl ich dieses traurige, beklemmende Gefühl, das mir seit dem Gespräch mit meinen Eltern schwer auf die Brust drückte, noch immer spüren konnte, fühlte es sich an, als würde ich ein wenig besser Luft bekommen. Meine Liste würde wachsen. Ich würde Punkt für Punkt abhaken. Und meine Freundinnen unterstützten mich dabei und waren für mich da.
Hoffnung allein war vielleicht noch kein wirklicher Schritt. Aber es war ein Funken, der früher oder später etwas entfachen konnte.
Bald schon würde sich mein Leben von Grund auf verändern. Nicht weil ich mit einem Wunder rechnete, sondern weil ich es von jetzt an selbst in die Hand nahm.
Kapitel 4
Ches ließ den Motor verstummen. Er und Creed schnallten sich ab und stiegen aus dem Auto. Für einen Moment konnte ich nichts anderes tun, als bewegungslos auf dem Beifahrersitz zu verharren und aus dem Fenster zu blicken; auf unser Haus, das ich so viele Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte.
Die verschiedensten Gefühle durchströmten mich und verknoteten mir den Magen. Meine Kehle war so eng, dass ich kaum noch Luft bekam.
Ich bin endlich zu Hause.
Das Haus, in dem ich aufgewachsen war, an welches ich so oft gedacht hatte, während ich jahrelang schlaflos auf meinem Stockbett in der Zelle gelegen hatte – es fühlte sich überwältigend an, hier zu sein, obwohl ich mir diesen Moment so oft ausgemalt hatte. Ich konnte nicht ganz glauben, dass das hier echt war. Dass ich wirklich draußen war. Und dass mich nie wieder ein Arschloch wie Carmichael aus dem Bett schmeißen würde. Kein Wärter und keine anderen Insassen würden mich je wieder demütigen oder piesacken. Nie wieder würde ich lästige Arbeiten in der Holzwerkstatt erledigen, ein Essenstablett nach dem anderen mit ungenießbarem Fraß vollladen oder Drecksarbeiten für andere erledigen, um an die ein oder andere Zigarette zu gelangen. Das alles war von jetzt an Geschichte.
Ich blinzelte so angestrengt das verdächtige Brennen aus meinen Augen, dass mir schwindelig wurde.
»Maxx?«
Ches lugte durch die offen stehende Fahrertür in den Wagen und sah mich fragend an. »Kommst du?«
Ich rang mir ein Lächeln ab. »Klar doch.«
Ich stieg aus und umklammerte mit beiden Händen die braune Papiertüte mit meinen alten Sachen. Dann stand ich auch schon auf dem holprigen Bordstein. Wehmut erfüllte mich. Allem voran aber auch Verwunderung.
Mein Zuhause war nicht mehr das, was es früher gewesen war. Ich sog den Anblick geradezu in mich auf. Der Vorgarten war vertrocknet, die vielen Büsche und Pflanzen, die mein Vater all die Jahre sorgsam gepflegt hatte, waren fort, und an deren Stelle war nackte Erde zu sehen. Von der Deutschen Dogge, die meine Eltern sich angeschafft hatten, war glücklicherweise auch keine Spur zu sehen. Große Hunde und ich, das war keine gute Kombination, und ich war wirklich nicht scharf darauf, Mr. Rowdy kennenzulernen.
Wir liefen los. Vor den Stufen der Veranda blieb ich jedoch stehen. Sie wirkte trostlos. Kein Blumenkranz hing an der Tür, auf der Holzbank daneben lagen keine weichen Kissen. Ein Teil von mir wünschte sich, dass es nur das Haus war, welches sich so verändert hatte. Doch ich ahnte bereits, dass mich die wahre Veränderung drinnen erwartete. Dort war nämlich nicht nur mein Dad, der mich während meiner Haft regelmäßig besucht und angerufen hatte. Der für mich da gewesen war und mir versprochen hatte, das auch zu bleiben. Dort drin …
War auch meine Mom.
Meine Gefühle überwältigten mich; die Erleichterung und die schmerzlich süße Glückseligkeit darüber, endlich wieder hier zu sein, das leise Versprechen, dass alles besser werden würde. Doch meine Angst vor der Begegnung mit meinen Eltern, besonders mit meiner Mutter, drehte mir den Magen um. Sollte ich mich auf sie freuen? Erleichtert sein? Stinkwütend? Oder doch um Vergebung bettelnd auf Knien rutschen? Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung. Ich wurde von den Empfindungen verschluckt, bis mir fast die Kontrolle über mich zu entgleiten drohte.
»Bist du bereit?«, fragte Ches, betont gelassen. Ich sah ihn an. Der Ausdruck auf seinem Gesicht wirkte seltsam, und die Haltung seiner Schultern war unnatürlich steif. Mein Blick wanderte zu Creed, der ein Stück neben uns stand. Es war, als würden die beiden versuchen, ein lässiges, unbeschwertes Bild abzugeben, aber auch wenn ich die Jungs in den letzten fast vier Jahren nur ein paar Mal gesehen hatte, konnte ich genau sehen, wie angespannt sie wirklich waren. Ich kannte sie bereits mein ganzes Leben. Ich wusste, wie sie sich verhielten, wenn sie nervös waren, und mein großer Bruder und Creed strotzten nur so vor Nervosität.
Ihre Anspannung ließ meine eigene ins Unermessliche steigen. Trotz allem zwinkerte ich ihnen zu, mit einer falschen Gelassenheit, die ich mir über die letzten Jahre mühsam antrainiert hatte. »Ich bin mehr als bereit.«
Ches lief voraus und öffnete die Haustür. Meine Knie fühlten sich weich an, als ich die Stufen der Veranda erklomm, und noch weicher, als ich schließlich über die Türschwelle schritt – und überrumpelt stehen blieb.
Nach allem, was ich draußen gesehen hatte, hatte ich damit gerechnet, dass das Innere einen ähnlich trostlosen Eindruck machen würde. Stattdessen war es, als würde ich eine andere Welt betreten. Auf dem Sideboard im Hausflur brannten Kerzen. Der Dielenboden glänzte frisch gewischt, es war aufgeräumt und dekoriert. Ein Song von Johnny Cash spielte leise im Hintergrund, und das ganze Haus duftete nach etwas, was ich schon seit Jahren nicht mehr gerochen hatte: Moms berüchtigtem Schmorbraten. Mein Lieblingsessen.
Und dort, am Fuß der Treppe ins Obergeschoss, waren sie:
Mom und Dad.
Sie boten mir kaum die Gelegenheit, mich fiebrig zu fragen, was ich sagen sollte. Ich konnte nicht einmal Nervosität oder Angst darüber empfinden, ihnen in die Augen zu sehen, denn meine Mutter schluchzte bei meinem Anblick augenblicklich auf und sprang mir in die Arme. »Maxx! Gott, Maxx, du bist wieder hier. Mein Junge ist wieder hier!«
Noch immer war ich wie erstarrt. Was … zum Teufel war das denn?
Ich erwiderte ihre stürmische Umarmung ein wenig unbeholfen. All ihre Emotionen und die Tränen … waren wie ein brutaler Schlag ins Gesicht. »Hi, Mom«, stieß ich hervor.
Ihr Weinen war bitterlich, und ihr ganzer Körper schien unter den Schluchzern zu beben. Sie umfasste mein Gesicht, küsste meine Wangen und lachte immer wieder auf. Dieses Bild war so falsch, so anders als das Bild von dem einzigen kurzen Mal, als sie mich im Gefängnis besucht hatte. Damals war sie distanziert und kalt gewesen, hatte mir kaum in die Augen blicken können, ehe sie schließlich wortlos in Tränen ausgebrochen und gegangen war. Danach war sie nie wieder gekommen. Kein einziges verfluchtes Mal. Aber jetzt? Sie schien ein völlig anderer Mensch zu sein als der, der mich dieses eine Mal besucht hatte. Ihre braunen gewellten Haare waren hochgesteckt, sie trug eine Leinenbluse und eine gestärkte Stoffhose. Diese Frau hier wirkte wie meine Mom von früher. Nur wusste ich, welcher Abgrund nun zwischen jetzt und damals klaffte. Wir wussten es beide. Sie hatte mich im Stich gelassen, fallen gelassen, als ich sie mehr als je zuvor gebraucht hatte.
Ich war vollkommen vor den Kopf gestoßen.
Es verpasste mir eine ganze Ladung verwirrender Schuldgefühle, als sie mich losließ und ich deshalb Erleichterung verspürte. Zum Glück nahm mein Dad mich anschließend ebenfalls erdrückend fest in die Arme und seufzte so schwer auf, als hätte er für eine lange Zeit die Luft angehalten. »Dad«, sagte ich leise und lehnte meine Wange an seine Schulter, als wäre ich neun und nicht zweiundzwanzig, und wünschte mir für einen Moment, dass mich das bittersüße Gefühl von der Entlassung erneut durchströmte – aber das war nicht der Fall. Obwohl ich mich wirklich, wirklich freute, meinen Dad zu sehen.
»Schön, dich wieder hier zu haben, mein Junge.« Seine Stimme klang belegt, und er räusperte sich.
Ich lachte unbeholfen, als wir uns voneinander lösten.
Um dem Ganzen eins draufzusetzen, verpasste mir meine Mutter einen Schmatzer auf die Stirn und tätschelte mir den Rücken – es fühlte sich so was von falsch an. Wie konnte es sich bei ihr so falsch anfühlen und bei meinem Dad so richtig? »Willkommen zu Hause, Maxx.«
Mein Blick begegnete erst dem meiner Mom, dann blickte ich zu meinem Dad, der mich voller Liebe anstrahlte, ehe mein Blick zu meinem Bruder glitt. Die Wärme in seinen grauen Augen war ehrlich, aber da war noch immer diese Nervosität. Vielleicht ja, weil er das Verhalten unserer Mom auch irritierend fand.
Ich trat einen Schritt zurück, bis mich endlich niemand mehr berührte, und klatschte in die Hände. »Ich rieche Braten. Ist das Essen schon fertig?«
Meine Mutter lachte laut, als hätte ich einen besonders lustigen Witz gerissen. Selbst Creed rieb sich bei dem atemlosen Gelächter unruhig über den Nacken, und Ches räusperte sich verhalten. Mom ergriff meine Hand und zog mich in die große offene Wohnküche aus dunklem Holz. Wieder kicherte sie. »Der Schmorbraten ist bei Weitem nicht fertig, Liebling! Er ist für heute Abend. Zum Frühstück gibt es Pancakes mit Bacon, Ahornsirup und Baked Beans!«
Mein Lieblingsfrühstück. Ich schluckte schwer, als ich den vollgedeckten runden Esstisch sah. Heilige Scheiße. Sie hatten wirklich alle Geschütze aufgefahren, um mir das beste Willkommen zu bereiten, das ich je erlebt hatte.
»Das sieht toll aus«, sagte ich mit leiser Stimme – und ich meinte es auch so.
»Na dann, nichts wie ran an den Speck!«, sagte Mom überschwänglich und drückte mich auf einen Stuhl. Sie strahlte mich an und begann damit, meinen Teller vollzuladen. »Lass es dir schmecken!«
Ches, Creed und ich blickten uns wieder an. Selbst mein Dad wirkte ein wenig besorgt. Diesmal fiel es mir deutlich schwerer, meine Fassungslosigkeit zu verbergen. Andererseits brach es mir das Herz, zu sehen, wie überdreht meine Mom war. Sie versuchte, das Beste aus dem hier zu machen, und das war ihre Art und Weise, damit umzugehen. Und vermutlich war sie mindestens so verunsichert wie ich.
Endlich setzten sich die anderen ebenfalls. Ich wusste nicht, ob ich es aus Pflichtgefühl tat oder weil ich einfach ziemlichen Hunger hatte. Aber einen Moment später lächelte ich meine Mutter an und goss mir ein Glas Orangensaft ein.
Es war, als würden wir ein Stück spielen. Und dieses Stück nannte sich »Heile Welt«. Wir waren eine in die Jahre gekommene Originalbesetzung, die sich nach vielen Jahren für ein Comeback noch einmal zusammentat und verstaubte Kostüme in alten Kulissen anlegte. Den ganzen Tag dauerte dieses Spiel schon an, und hätte man uns von außen betrachtet, hätte man uns wahrscheinlich für eine Bilderbuchfamilie gehalten. Nein, hätte man uns von außen betrachtet, hätte man meinen können, dass die letzten Jahre nie stattgefunden hätten. Und das machte mich wütend. Aber auch verzweifelt, weil ich zu viel Scheiß durchgemacht hatte, nur um jetzt so zu tun, als gäbe es ihn nicht. Doch dieser Tag war nichts als ein verkrampfter Versuch, eine Reise in die Vergangenheit zu machen. Zu tun, als sei ich nie weg gewesen, und die Tatsache, dass alles im Haus so vertraut war, hätte es vielleicht auch mir einfach machen können. Aber jeder Blick in das Gesicht meiner Mutter, jedes sorgenvolle Stirnrunzeln von Dad oder Ches oder Creed oder auch nur ein einziger Blick aus dem Fenster in den verödeten Garten riefen mir wieder ins Gedächtnis, dass alles nur gefakter Mist war. Unter der scheinbar harmonischen Oberfläche verbargen sich einfach zu viele falsche Details, die die Kulisse unseres ach so perfekten Schauspiels zerstörten. Angefangen bei Mr. Rowdy hinten im Garten, der mich tatsächlich schon auf den ersten Blick nicht hatte leiden können und mich mit seinem wütenden Bellen ständig aus meinem eigenen Zuhause zu vertreiben versuchte. Die Treppe knarzte mehr als früher. Die gerahmten Bilder hingen etwas schief.
Man hatte sich große Mühe gegeben, alles für mich so herzurichten, als hätten meine selbstsüchtigen und unbedachten Entscheidungen von früher nicht ihrer aller Leben zerstört. Doch das hatten sie. Das hatte ich. Und ich spürte es mit jeder Faser meines Körpers, in jedem Zentimeter dieses Hauses. Vielleicht sogar besonders deshalb, weil meine Eltern dermaßen darum bemüht waren, es vor mir zu verstecken.
Und sosehr ich es auch hasste, es zerriss mir das Herz.
Irgendwann hatte ich genug von dem Trubel und zog mich zurück. Eine Weile hing ich einfach nur in meinem alten Zimmer herum. Ich genoss die Stille und die staubige Hitze, den vertrauten Blick vom Bett an die Zimmerdecke und den Geruch vom Weichspüler. Es war noch immer der gleiche. Diese kleine Vertrautheit sorgte dafür, dass ich mich wieder ein wenig wie ich selbst fühlte. Einfach nur Maxx.
Ich setzte mein altes Handy, das noch immer im Nachttisch gelegen hatte, auf Werkseinstellungen zurück und startete ein paar Updates, die das überholte Ding ziemlich warm werden ließen. Der Akku war vollkommen hinüber. Ich konnte es ausschließlich am Ladekabel nutzen, was nicht gerade ein Idealzustand war.
Ich streckte mich ausgiebig, döste noch eine Weile, um die lang ersehnte Einsamkeit zu genießen, und verließ eine Stunde später mein Zimmer wieder. Ich trabte die Treppen nach unten, so wie ich es früher immer getan hatte, und übersprang dabei die vorletzte Stufe, weil sie auch früher schon am lautesten geknarzt hatte.
Ches saß alleine am Esstisch und sprang sofort vom Stuhl auf, als er mich sah. Das Lächeln auf seinem Gesicht wirkte ein wenig erschöpft, so als ginge auch ihm die Kraft aus, das Schauspiel aufrechtzuerhalten.
Ich schlenderte auf ihn zu. »Ich glaube, ich muss mir einen neuen Handyakku besorgen, meiner hat den Geist aufgegeben.«
Ches wirkte überrascht. »Hat Mom es dir noch nicht gegeben?«
»Was, einen Akku?«
Er schüttelte den Kopf. »Komm mit.«
Ich folgte meinem Bruder ins Wohnzimmer, wo unsere Eltern saßen und sich alte Fotoalben ansahen. Gerade so konnte ich mein Stöhnen unterdrücken. Oh, bitte. Muss das gleich heute auch noch sein?
Ich schaffte es jedoch nicht, nur Wut zu empfinden, auch wenn diese wesentlich einfacher war als Schuld. Ich sah mit eigenen Augen, wie hart das heute für sie war. Meinetwegen waren ihre Söhne, alle beide, vor vier Jahren einfach spurlos verschwunden. Ohne auch nur ein Wort des Abschieds. Ich ins Gefängnis und Ches nach Fletcher. Mom und Dad hatten mit einem Schlag ihre Kinder verloren. Ich konnte mir nicht ansatzweise ausmalen, was ich ihnen damit angetan hatte.
Mit einem Mal wurde mir kotzübel. Ich hatte kein Recht, wütend zu sein. Oder genervt und frustriert. Ich trug die Schuld, und sie versuchten nur, endlich wieder so was wie Normalität zurückzuerlangen, nachdem ich unsere Familie zerstört hatte.
Ich.
Wie auch den ganzen Tag schon strahlten die beiden mich an, als sie mich sahen, so als hätten sie es sich in kürzester Zeit antrainiert. Ich bemühte mich, es zu erwidern, so herzlich ich konnte. Wenn es den beiden half, mit der Situation umzugehen, waren ein Lächeln und falsche Leichtigkeit das Mindeste, was ich beisteuern konnte.
»Hey, Mom, kannst du Maxx das Telefon geben?«, fragte Ches.
Sie sprang auf, als wäre sie von einer Tarantel gestochen worden. »Aber sicher! Einen Moment, ich habe es gleich hier …« Sie trat an eine der schweren Holzkommoden, auf denen jede Menge eingerahmte Bilder von uns standen sowie Kerzen und ein Strauß frischer Blumen. Sie holte ein ziemlich großes Smartphone aus einer Schublade und drückte es mir in die Hand. »Ich habe mir vor ein paar Monaten ein neues gekauft, weil mir das hier zu groß war. Eigentlich wollte ich es verkaufen, aber dein Vater meinte, dass ich es für dich aufbewahren könnte.«
Verblüfft blickte ich zu Chester, ehe mein Blick wieder zurück zu meiner Mutter kehrte. »Ich … Danke?«
Ich betrachtete das große Smartphone in meiner Hand. Es besaß nicht einmal einen Homebutton und schien nur aus kratzerfreiem schwarzem Touchscreen zu bestehen.
Überwältigt schüttelte ich den Kopf. »Fuck, das muss doch Hunderte von Dollar gekostet haben!«
»Maxx«, warnte Dad leise, als Mom bei dem Fluch kaum merklich zusammenfuhr.
»Sorry«, sagte ich und kniff die Lippen zusammen. Scham brannte mir im Nacken. »Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«
Ihre Augen leuchteten auf. Und – wieder umarmte sie mich. Diesmal erwiderte ich es fest. Denn ich hatte es nicht verdient, mich verraten zu fühlen. Vielleicht hatte ich es sogar verdient, dass sie mich hatte hängen lassen.
»Oh, Liebling. Das ist doch selbstverständlich.« Sie streichelte mir über den Kopf und seufzte schwer. Ich hielt mein verkrampftes Lächeln wacker aufrecht, als ich mich von ihr löste. »Ich, äh, werde gleich mal meine SIM-Karte einlegen und so. Danke noch mal.«
»Lust auf ein Bier?«, fragte Ches und lief zurück in Richtung Küche.
Und wie ein Hund, der ein Leckerli angeboten bekommt, war ich sofort Feuer und Flamme und folgte ihm. Vielleicht auch weil es die perfekte Ausrede war, um meiner Mom und dem Knoten in meiner Brust halbwegs zu entkommen. Gott, und wie ich Lust auf ein Bier hatte. Ich konnte sogar mehr als das gebrauchen. Eine Zigarette und eine ganze Flasche Whiskey, oder Tequila.
Ich folgte meinem Bruder, das große Handy noch immer in der Hand und noch immer von Unglaube erfüllt.
Die Dose, die er mir aus dem Kühlschrank reichte, war eiskalt, und es brauchte nur wenige Augenblicke, bis sich Kondenswasser auf ihrer grünen Oberfläche sammelte.
Erneut sahen Mom und Dad von den Fotoalben auf, als wir zur Verandatür liefen, aber diesmal kam ich mit einem schwachen Lächeln davon.
Ches und ich traten nach draußen. Nicht mehr im Blickfeld meiner Eltern zu sein war dermaßen erleichternd, dass mich selbst das mit Schuldgefühlen erfüllte. Verflucht noch mal.
Creed saß auf der Hollywoodschaukel. Er zog ein finsteres Gesicht, und irgendwie erleichterte es mich, zu sehen, dass er eine ganz normale menschliche Emotion zeigte und mir keinen Scheiß weismachen wollte. Auch wenn mir die tiefe Furche zwischen seinen Augenbrauen nicht gefiel.
»Hey, Mann, was ist los?«, fragte ich und ließ mich neben ihn auf die Schaukel fallen.
Hastig steckte er sein Handy ein und rieb sich mit einer Hand über die kurz rasierten Haare.
»Nichts, es ist alles gut. Ich hab nur … eine Sache.«
»Eine Sache?«, wiederholte ich und trank einen Schluck Bier und …
Fuck. War das gut. Ich seufzte auf und trank gleich noch einen Schluck.
Creed zuckte mit den Schultern und blickte in unseren Garten, wo Mr. Rowdy im Schatten der Laube saß und hechelte. Dabei bellte er mich nicht einmal an. Das war doch mal ein Fortschritt.
»Eine kleine Meinungsverschiedenheit«, sagte Creed schließlich.
Irgendwas an seinem Unterton sagte mir, dass es ziemlich an ihm nagte. Ich fragte mich, was wohl alles vorgefallen war.
So viel Leben.
Sie hatten so viel gelebt. Während ich klumpiges, geschmackloses Essen für neunhundert Inhaftierte zusammengekleistert, in der Bibliothek ausgeholfen oder irgendwelche Handwerksarbeiten erledigt hatte, hatten sie ein Leben in Freiheit gelebt.
Bitterkeit erfüllte mich. Sie war auch noch da, als ich versuchte, sie mit dem nächsten Schluck Bier hinunterzuspülen. Ich durfte es ihnen nicht zum Vorwurf machen. Ches hätte nicht im Käfig landen dürfen. Für jegliche Konsequenzen hatte ich doch schon ausgesorgt. Ich war für sie alle ins Maine State Prison gegangen, damit sie kein Schaden traf. Doch sie hatten sehr wohl Schaden abbekommen und die letzten vier Jahre ebenfalls die Hölle durchgemacht, wenn auch eine andere. Ebenfalls aus der Motivation heraus, mich und unsere Eltern zu schützen, und nicht wissend, dass wir uns zeitgleich füreinander aufgeopfert hatten.
Ich schüttelte meine düsteren Gedanken ab und trank mein Bier aus. Danach stieß ich auf, was Creed lachen ließ. »Hey, hat Ches dir eigentlich schon erzählt, dass in Fletcher eine Überraschung auf dich wartet?«
»Ach ja? Was für eine?«
»O bitte, man fragt nicht nach dem Inhalt von Überraschungen. Das macht die Sache an sich doch total sinnlos.«
»Wir sollten es ihm vielleicht trotzdem sagen, immerhin wird es eine Woche lang gehen«, überlegte Ches laut und grinste.
Ich setzte mich aufrechter hin und sah erst zu Creed, dann zu meinem Bruder. Sie kannten mich leider viel zu gut. Ich war neugieriger als ein Kind am Weihnachtsmorgen, und ich liebte Überraschungen. »Was ist es?«, fragte ich nachdrücklich.
»Wir dachten, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir campen gehen. Das hast du doch früher so gerne mit Dad und mir gemacht – oder du hast hier im Garten gezeltet. Du könntest dabei unsere Freunde kennenlernen, baden gehen und die Natur genießen. Na ja, ich dachte, nach der langen Zeit eingesperrt … Dass es dir gefallen könnte. Und vielleicht erleichtert es dir den Anschluss, wenn du dich gut mit unseren Freunden verstehen solltest.«
Aufregung kribbelte durch meine Adern. Mit großen Augen starrte ich Chester an, und langsam formte sich mein Mund zu einem Lächeln. »Camping? Machst du Witze? Das ist die beste Idee überhaupt!«