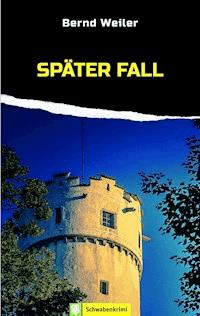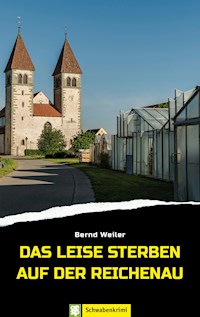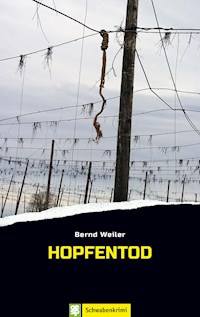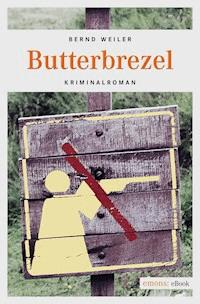
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach haarsträubenden Aufregungen verläuft das Leben in Pfenningen am Fuße der schwäbischen Alb wieder in beschaulichen Bahnen. Bis ein Bankraub und eine Reihe von Todesfällen die Kommissare Thomas Knöpfle und Willi Schirmer aufschrecken. Hat erneut der ominöse Schriftsteller seine Finger im Spiel? Und muss am Ende Gott wieder Ordnung ins schwäbische Chaos bringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Weiler wurde 1959 in Eislingen/Fils am Albtrauf geboren und studierte Germanistik und Anglistik, um dann als freier Redakteur und Autor im Bereich Reise und Natur zu arbeiten. Derzeit ist er als Hausmann, freier Lektor und Autor tätig. Er hat mehrere Regiokrimis veröffentlicht, den Vorgängerband »Leberkäsweckle« und eine Bodensee-Krimireihe mit der Kommissarin Kim Lorenz. Er lebt mit seiner fünfköpfigen Familie in Pfullingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/pfosti Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Gestaltung Innenteil: César Satz & Grafik GmbH, Köln Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-636-2 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Elisabeth
Es ist nicht die Zeit, die Menschen macht,
es sind die Menschen, die ihre Zeit machen.
Bernd Weiler
Vorwort des Autors
Liebe Leser, als ich das Manuskript zu diesem Buch verfasste, war die Geschichte der FDP noch nicht so weit geschrieben, wie sie es heute ist. Als Autor habe ich gewisse Entwicklungen beobachtet und spekuliert, wohin der Weg der FDP wohl gehen würde. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, mag Zufall oder Unausweichlichkeit sein. Ich sah keinen Grund, meinen Text jetzt, mehr als zwei Jahre nach seinem Entstehen, in dieser Hinsicht zu korrigieren. Natürlich wünschen Frieder Kötzle und ich der FDP gute Besserung.
Prolog
Drei Tote in Pfenningen!
Gestern erreichte den Beutlinger Generalanzeiger ein Bericht seines Pfenninger Korrespondenten Ignaz Würer über die Geschehnisse der letzten Tage im Nachbarort Pfenningen. Würer sprach auch mit der örtlichen Kriminalpolizei.
Drei tote Menschen gibt es in unserer Nachbarstadt Pfenningen zu beklagen. Kommissar Knöpfle vom Pfenninger Revier erklärte gegenüber dem Beutlinger Generalanzeiger, dass es eine Reihe von unglücklichen Todesfällen in Pfenningen gegeben habe. Begonnen habe das Ganze mit dem Tod von Elfriede Schuckerle, die von der Ehefrau des Pfenninger Bürgermeisters, Luise Bremer, versehentlich beim Waffenreinigen erschossen wurde. »Des war a Ofall«, meldete sich dazu der bekannte Kommissar Schirmer zu Wort. Ein weiterer Toter war am selben Tag an einer Kreuzung der Hauptstraße ganz in der Nähe der Christuskirche zu beklagen. Franz Werth hatte beim Überqueren der Straße den Bürgerbus übersehen und wurde bei der Kollision tödlich verletzt. Mehr als verletzt wurde tags darauf die Sekretärin des Bürgermeisters an den Rathaustreppen. Wie bekannt wurde, hatte Hans Bremer einen Auftragskiller gedungen, seine Frau aus der Welt zu schaffen, der dann versehentlich die Sekretärin erschoss. Laut Kommissar Knöpfle werde hier noch ermittelt, die Hintergründe seien noch nicht klar. Wie zu hören war, ging diese Aktion wohl vom Pfenninger »Atlas-Grill« aus. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht.
Ein vermeintlich vierter Toter entpuppte sich als Kunstprojekt einer Klasse am hiesigen Goethe-Gymnasium. Die Jugendlichen hatten eine männliche Figur im Kühlraum der Mensa einfrieren wollen. Als dies einer der Kochenden bemerkte, verständigte er umgehend die Polizei. Beutlinger Beamte ermittelten vor Ort, was vorgefallen war. Sie stellten fest, dass es sich lediglich um eine Pappmaschee-Figur handelte. Die Pfenninger Kriminalbeamten erlebten diesen falschen Todesfall nur von Weitem, denn sie waren, wie auch übrigens die Beutlinger Kriminalpolizei, mit anderen Fällen beschäftigt. Wie aus gut unterrichteten Kreisen bekannt wurde, verschwand unter sehr seltsamen Umständen ein Polizeifahrzeug. Wie unsere Zeitung berichtete, gab es am vergangenen Freitagabend einen Facebook-Aufruf zu einer Fete am Georgenberg. Die Jugendlichen strömten auch aus Beutlingen an die Berghänge. Wie es zu dem kam, was dann folgte, kann sich Dr. Sommerwagen von der Beutlinger Kreisklinik nur dadurch erklären, dass jemand die Getränke der Jugendlichen mit etwas versetzt hatte. Inzwischen hat sich eine Gruppe »Rache für den Georgenberg« gegründet, die nach dem Schuldigen für diese Sauerei sucht. Wie Herr Dr. Sommerwagen berichtet, waren die Stationen des Beutlinger Kreiskrankenhauses mit den unzähligen Neuaufnahmen völlig überfordert. Erst jetzt, nach Tagen, könne man wieder einigermaßen mit offener Nase durchs Haus gehen. Allerdings, so Dr. Sommerwagen, sei es interessant, dass gerade lange Liegefälle und auch Frischoperierte eine teilweise unglaubliche Genesung erfahren hätten. Offensichtlich, so der Mediziner, habe sie der Gestank aus ihren Betten getrieben. Dr. Sommerwagen plant in diesem Zusammenhang eine Veröffentlichung im Medical Journal.
Im Gespräch teilte der Doktor unserer Zeitung weitere Pfenninger Fälle mit. Die Frau des Bürgermeisters, Luise Bremer, Opfer eines Hausbrandes, war leider ihren Verletzungen erlegen. Die Anlieferung ihres eigenen Grabsteines hatte sie so aus der Fassung gebracht, dass sie sich mit ein paar Gläsern Cognac beruhigen musste. Mit etwa zwei Promille im Blut habe sie auf dem Stuhl das Gleichgewicht verloren, sei am Herd angeschlagen und bewusstlos zu Boden gegangen. Dabei hatte sie wohl die Herdschalter gestreift und so den Brand in Gang gesetzt.
Außerdem, so Dr. Sommerwagen, sei ein Pfenninger Geistlicher mehrmals mit verschiedenen Verletzungen bei ihm auf Station gewesen. Dem Patienten gehe es inzwischen besser, er sei entlassen worden. Des Weiteren seien auch ein Angestellter der Stadtverwaltung, ein Pfenninger Einzelhändler und ein Polizeiassistent bei ihm eingeliefert worden. Nachforschungen unserer Zeitung ergaben, dass es sich bei dem Einzelhändler um Hans M. handelt. Wie Augenzeugen berichten, sei dieser von der Sekretärin des Bürgermeisters attackiert worden, als diese wegen der Verletzung des Stadtverwaltungsbeamten einen Notruf absetzen wollte.
Es mag für den Leser verwirrend sein, was ich aus Pfenningen zu berichten habe. Ein Gespräch mit dem Gütlesbesitzer Frieder K., auf dessen Wiese das Pfenninger Besäufnis stattfand, war wenig ergiebig. Herr K., einmal Ressortleiter Politik unserer Zeitung, konnte zusammen mit Alfred R. am Samstagmorgen lediglich die Verunreinigung der Wiese feststellen. »A Mordssauerei«, so der Rentner Alfred R. Wie es zu dem Facebook-Aufruf gekommen war, konnte sich Frieder K. nicht erklären. Auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Polizeifahrzeugs, das zwei Tage später weiß angestrichen und mit einem Strohhut über dem Blaulicht plötzlich wieder hinter der Wache stand, wollte der Pensionär keine Angaben machen.
Nun wäre dies eine zwar schwierige, aber doch machbare Berichterstattung. Es kommt aber hinzu, dass all diese Vorfälle in der örtlichen Zeitung, dem »Pfenninger Blatt«, in literarischer Form beschrieben wurden. Die Redaktion des »Pfenninger« wollte zu diesen Veröffentlichungen keine Informationen geben. Allerdings konnte Kommissar Knöpfle unserer Zeitung gegenüber nicht verhehlen, dass ein hiesiger Schriftsteller verhaftet worden sei. Nachforschungen ergaben aber, dass es sich wohl um zwei verhaftete Schriftsteller handelt. Der eine, Zyrill von Ebhausen, wird sich in einigen Wochen wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu verantworten haben, der andere, Bernd Weiler, scheint derjenige gewesen zu sein, der diese Zeitungsartikel geschrieben hat. Die Kommissare machten den Eindruck, als ob ihnen meine Recherchen in dieser Angelegenheit nicht gerade recht wären. Offensichtlich hatte dieser Schriftsteller einen deutlichen Wissensvorsprung gegenüber der örtlichen Kriminalpolizei. Wie zu hören war, ermittelten die Kommissare eher ihren eigentlichen Fällen hinterher.
Wie uns Kommissar Knöpfle auf weiteres Nachfragen erklärte, sei dieser Bernd Weiler aus der Untersuchungshaft im Trübinger Gefängnis auf mysteriöse Weise geflohen. Zu allem Überfluss, so Knöpfle, habe er auch noch den Hans Bremer »mitgehen lassen«, wenn man ihm diese Formulierung erlaube. Wo sich die beiden Flüchtigen im Augenblick aufhielten, das entziehe sich seiner Kenntnis, so Kommissar Knöpfle. »Weg send se halt«, so Kommissar Schirmer aus dem Nebenzimmer. Die beiden Beamten machten nicht gerade den Eindruck, die Situation in irgendeiner Weise im Griff zu haben.
Die Artikelserie im »Pfenninger Blatt« war mit »Stille Tage am Albtrauf« überschrieben gewesen. Stille Tage waren das in keinem Fall. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Polizei über die Vorkommnisse in Pfenningen einen umfassenden Bericht liefern könne, so Kommissar Knöpfle. Der Beutlinger Generalanzeiger wird seine werte Leserschaft über weitere Entwicklungen in Pfenningen auf dem Laufenden halten.
Weitere stille Tage am Albtrauf
So ging das doch nicht mit dem Schreiben, dachte der Schriftsteller. Hier in diesem Verlies konnte er kaum richtig Luft holen. Frei war er, gut, das schon, aber in diesem Keller konnte doch keiner ein paar vernünftige Worte aneinanderreihen. Er brauchte die Freiheit, den Wind, die Berge und auch mal ein kühles Bier.
Fast wünschte er, er hätte damals die Versorgung von Hans Bremer, als der hier einsaß, ein wenig mehr kritisiert und verbessert. Davon könnte er heute profitieren. So blieb die Versorgung hier eine einzige Zumutung. Dabei war doch alles so gut gelaufen. Der Litauer hatte dafür gesorgt, dass er wieder aus dem Gefängnis kam. Das war so was gewesen. Er hatte natürlich gleich an Literatur gedacht, »Der Graf von Monte Christo« etwa, »Papillon« oder die »Flucht aus Alcatraz«. Von wegen. Er wusste bis heute nicht, woher sein Zellenkollege, genannt die Glatze, all die vielen Schlüssel hatte und warum da überhaupt kein Wärter zu sehen gewesen war. Das war anscheinend ein sehr personalarmes Gefängnis dort in Trübingen, dachte er.
Jedenfalls waren sie, das konnte er so schreiben, einfach hinausgegangen. Gut, der Bremer war mal eben noch so mit rausgewitscht, aber sonst lief alles einwandfrei und zu seiner Zufriedenheit. Bis dahin. Eben bis dahin. Denn als sich Bremer dann davongeschlichen hatte, ging es für den Schriftsteller darum, einen Ort zum Schreiben zu finden. Denn in sein Haus am Pfenninger Ortsrand konnte er natürlich nicht zurück. Er brauchte seine Ruhe, wollte weiterschreiben, dieses Pfenninger Spiel weitertreiben. Er brauchte nichts Besonderes, war in dieser Hinsicht nicht anspruchsvoll. Gut, der Blick von seinem Balkon auf den Albtrauf war schon was Schönes gewesen. Es hatte funktioniert dort. Ihm hatte sein Büro genügt, aber bitte, wenn es um Höheres gehen sollte, dann vielleicht auch was Passenderes, um zu schreiben.
Er war locker, er schrieb so vor sich hin. Das merkte er, das sah er in seinen Sätzen. Das machte man nicht mal eben so, eine Stadt so hinschreiben, dass sie so lebte. Die Figuren agieren lassen, dann auch noch Gott mit reinschreiben, so was machte man eigentlich nicht. Man schrieb doch, um gelesen zu werden, oder man war so bekannt, dass man schreiben musste, egal was. Hauptsache, schwarz auf weiß. Aber wie sollte er anfangen? Hatte er nicht schon das meiste von Pfenningen erzählt? Sollte er die Komödie denn wirklich noch weitertreiben?
Diese Frage stellte sich auch Gott droben im Himmel. Er wollte nicht unbedingt einen zweiten Band. Ihm hätte ja der erste genügt. Der Himmel mochte keine Wiederholungen. Einlieferungen hatte er nun wirklich genug gehabt in der letzten Zeit, und schließlich war er ganz zufrieden mit der Geschichte gewesen. Das mit der Befreiung aus dem Gefängnis stand allerdings nicht auf seinem Zettel, das musste ihm irgendwie rausgegangen sein. Die Gerda und der Franz, die übrigens hier oben gute Freunde geworden waren, erinnerten sich aber noch gut.
Da hatte er sich so zwei eingefangen. Die turtelten hier oben rum, als ob sie im siebten Himmel wären. Dabei gab es doch nur den einen. Aber mit denen kam er zurecht. Da machte ihm die Luise schon eher Sorgen, denn deren besseres Teil trieb sich ja noch dort unten rum. Die schaute und schaute, und sie las vor allem mit Entsetzen die Untertitel und zeterte rum. Und das konnte er nun gar nicht brauchen.
Da unten durften und konnten sie von ihm aus laut sein, diese seine Menschen, aber hier oben im Himmel galten dann endlich mal seine Gesetze, hier hatte er das Sagen, und das hieß: Stille. Das klappte mit den meisten auch ganz hervorragend. Da saßen Weltpolitiker in netter Runde und redeten über ihre Zeit da unten. Da wurden Gedanken ausgetauscht, womöglich Fehler zugegeben. Gut, da wurde dann auch mal einer laut, weil er feststellte, da unten gar nicht der gewesen zu sein, der er hatte sein wollen. Da wurde auch mal einem der Kopf zurechtgerückt, von wegen, wer warst du denn wirklich. Das war halt Himmel. Das Ende eben oder auch ein neuer Anfang.
Petrus beklagte sich immer, wie viel Mühe er hatte, dass die Hartz-IV-Empfänger bestimmten Herren nicht an die Gurgel gingen. Auch das war Himmel, schon so, wie es seine Jungs da unten seit Jahrhunderten proklamierten, man traf sich halt wieder, ein zweites Mal. Gericht? Nicht seine Sache, das machten die Menschen schon mit sich selbst aus. Mal so, mal so. Und auf das Jüngste Gericht konnte auch er noch ganz gut eine Weile warten. Er wollte sich die Chose noch ein paar Jahrtausende anschauen und ein wenig mitspielen, dann würde er sehen. Schließlich war er Gott, und Zeit war ein Begriff, der ihm gehörte.
Das hätte Pfarrer Leonhard auch gern so gesehen. Aber die Zeit, die lief ihm ja eher immer davon. Wie jetzt etwa. Er hätte sich gern mal in Ruhe auf seine Bank hinter dem Pfarrhaus gesetzt und ein Zigarillo geraucht. Aber er musste immer weiter. Das hatte ihm irgendwie auch keiner gesagt, als er damals anfing, dass da auch junge Menschen, sozusagen Kinder, sein würden, die er dann zu unterrichten hätte.
Der Religionsunterricht war ihm ein Gräuel. Eigentlich waren es nicht so sehr die Kinder, diese Last hatten die rechtschaffenen Lehrer auch, nein, es war der Verlust an Glauben, der Achtung vor Gott und dem Ganzen, was ihn umtrieb und unsicher machte. Er konnte sich doch keines Momentes bewusst und sicher sein. Kaum hatte er eine Linie gefunden, war mittendrin, da fiepte entweder ein Handy mit einer SMS, oder einer dieser Schüler hatte eine Anwandlung.
Wie letzte Woche diese Sophie. Steht mitten im Unterricht auf und behauptet, eine Erscheinung zu haben. Liebe Sophie, hatte er ohne Körperkontakt, denn man musste ja vorsichtig sein, gesagt, das wollen wir doch mal nicht so ernst nehmen. Von wegen. Die hatten das doch abgemacht, das war doch gegen ihn und die Kirche! Wie eingeübt knieten sich die anderen Schüler vor diese Sophie hin und beteten für ihre Erscheinung. Oh große Sophie und so. Er war Pfarrer, aber er war kein Depp.
Mit dieser Einstellung ging er immer in die Schule und bis dahin hatte das genügt. Aber diesmal waren Reserven gefordert. Eigentlich hätte er sich so viel Phantasie gar nicht zugetraut, aber wenn es dann über einen kam, war es auch schön. Er hatte geistesgegenwärtig das Waschbecken gesehen und flugs die Gemeinde mal deutlich kalt getauft. Und wie bei sonstigen gesellschaftlichen Entgleisungen war der allgemeinen Euphorie eine schnelle Ernüchterung gefolgt. Er war mit Achtung aus der Sache rausgekommen, was ihm nicht unbedingt immer gelang. Gut, er musste anschließend zum Schulleiter, weil sich die Eltern beschwert hatten, dass ihre Kinder nass aus dem Unterricht nach Hause gekommen waren. Immerhin, da hatten sie mal was mitgenommen, dachte Pfarrer Leonhard.
So hätte das Kommissar Willi Schirmer nicht gesehen. Er war auch nass, hatte aber nichts mitgenommen. Er hatte doch gleich gewusst, dass dieser Schreiberling weitermachen würde. Das war doch klar gewesen. Da gab es doch Wege, aus dem Gefängnis heraus zu schreiben. Heutzutage mit diesen Mails eh.
Ihn hatte der erste Band eingeholt. In seinem innersten Innern hatte er schon so etwas erwartet gehabt. »Die Rache des Georgenbergs« könnte man das nennen, dachte er hinterher.
Natürlich war mit den Artikeln in der Zeitung seine Aktion am Georgenberg bekannt geworden. Manche der Jugendlichen hatten zum ersten Mal wieder eine Zeitung in der Hand gehabt und bewusst gelesen. Und wie die gelesen hatten. Alles, das Trinkgelage, sein Einschleichen und schließlich auch alles darüber, warum es ihnen allen hinterher so schlecht gegangen war. Kein Wunder, dass sie einen Hass auf ihn schoben. Aber sie waren ja noch Kinder, hatte Schirmer gedacht und die Sache feste verdrängt.
Bis gestern Abend. Die hatten ihn also ausspioniert. Ihn und seinen Abendspaziergang, den er ziemlich regelmäßig machte. Er ging nicht mit dem Hund, denn er hatte keinen, nein, er ging einfach so noch eine Runde am Waldrand unterhalb des Monikabergs. Immer denselben Weg. Er hatte diese Blechbadewanne schon mal gesehen, hatte er noch gedacht, als er wieder aufwachte. Er war vermutlich schon Hunderte Male daran vorbeispaziert. Er erinnerte sich noch an ein Mal, da hatte er sich gefragt, was diese Blechbadewanne in diesem Gütle wohl zu suchen hatte oder was man damit machte. Jetzt wusste er es.
Er musste zugeben, die Rache war etwa so ausgefallen, niveaumäßig, wie auch seine Aktion am Georgenberg gewesen war. Sie hatten ihn abgepasst, ihm einen Sack über den Kopf gestülpt und mit so einem Spray kampfunfähig gemacht. Er hätte nicht gedacht, dass das ging, durch den Sack hindurch. Ganz schön gewitzt, die Jungs, war ihm noch durch den Kopf gegangen, bevor ihm die Sinne schwanden.
Als er aufwachte, lag er in der Scheiße, aber so richtig. Wo sie diese Menge an Exkrementen herhatten, war ihm schleierhaft. Aber stinken tat das zum Gotterbarmen. Er wuchtete sich aus der Wanne, sah an sich hinunter und dachte an Vollreinigung und die Möglichkeit, diese Freizeitjacke und seine Lieblingswanderhose jemals wieder benutzen zu können.
Sein Heimweg war quatschend verlaufen. Die Scheiße war ihm in die Schuhe gelaufen und von dort bei jedem Schritt, den er machte, auf den Weg gespritzt. Es hatte in der DDR mal einen tollen Film mit Manfred Krug gegeben: »Spur der Steine«. Er hingegen spielte hier gerade eher in einem Streifen mit, der hieß: »Spur der Scheiße«. Hoffentlich würde ihn niemand sehen, und hoffentlich würde ihm niemand begegnen. Das wäre fatal gewesen. Aber so, in diesem Zustand, konnte er nicht im Wohngebiet einlaufen. Das hätte ja nach Entdeckung und Bloßstellung geradezu geschrien. Als einziger Ausweg war nur der Bach geblieben, den er immer am Ende seines Spaziergangs überquerte. Er wusste, wenn er einigermaßen sauber und vor allem geruchsmäßig neutral das Wohngebiet betreten wollte, dann musste er rein in den Bach. Der war allerdings wirklich nur ein kleiner Bach, kaum dreißig Zentimeter tief. Also hatte sich der Kommissar hin und her gewälzt. Das Wasser war kalt, sehr kalt.
Als er bibbernd nach Hause kam und durchs Treppenhaus in den ersten Stock hinaufging, sah er es gleich: »Georgenberg-Revenge«, hatten sie ihm kunstvoll auf die Wohnungstür gesprüht. Verdammte Jungs, von wegen Kinder. Aber solange niemand wusste, wie diese Georgenberg-Revenge ausgefallen war, konnte er damit leben. Er schlich sich in seine Wohnung, zog die versauten Klamotten aus, duschte und zog sich an. Dann machte er sich daran, das Treppenhaus zu wischen. Schließlich setzte er sich todmüde auf sein Sofa und machte sich eine Flasche Bier auf. Es hatte ihm gereicht.
Aber nun war ein neuer Morgen. Es muffelte zwar noch ein wenig um ihn rum, aber er hatte mit viel Rasierwasser dafür gesorgt, dass ein strenger männlicher Duft den üblen Geruch überlagerte. Das würde an diesem Morgen seine kleinere Sorge sein. Aber das wusste Willi Schirmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was sich da mit einem Klingeln an der Tür ankündigte, würde sein Leben auf den Kopf stellen. Aber lassen wir ihn ruhig mal zur Tür gehen, sich so seine Gedanken machen, wer denn wohl zu einer so frühen Stunde bei ihm klingelte. Mal sehen, wie weit es dann mit der Schirmer’schen Ruhe her sein würde. Womöglich würde das Öffnen der Tür ihm einen ganz neuen Blick auf die Welt und sein eigenes Leben geben, womöglich.
Eine solche Veränderung hätte Genoveva Christlein an diesem Morgen nicht gebraucht. Veränderung, das war etwas Neues, und sie war fest im Glauben. Das hieß für sie Bleiben im Seienden. So hatte es Herr Bleibtreu gesagt, und sie hatte ihm das gleich geglaubt. Vorsichtshalber hatte sie mal den Schirm mitgenommen. Ihr wöchentlicher Einkauf auf dem Markt stand an. Viel brauchte sie ja nicht. Der Garten hinter ihrem Haus brachte eine kleine Ernte an Gemüsen, die sie über das Sommerhalbjahr genießen konnte. Sie kellerte Karotten und Steckrüben in Sand ein, so wie sie es früher auf dem elterlichen Bauernhof in Ochsenwang am Albrand getan hatten. Dazu kamen zwei, drei Zentner Kartoffeln, die sie auf ihrem kleinen »Stückle« anbaute. Damit kam sie gut über den Winter. Denn der Herrgott sorgte schon für die, die an ihn glaubten, sagte sie dann immer zu sich und legte vertrauensvoll ihre rechte Hand auf die Bibel. Sie war eine Frau der Kirche, eine Tochter Jesu, das wollte sie sein.
Ihr Weg führte durch die geschäftigen Straßen Pfenningens, vorbei auch am Busbahnhof, wo diese Kinder saßen, rauchten, laut Musik hörten und sich Eis in die Rachen schleckten. Es ekelte sie vor diesem Genuss, diesem Genießen, diesem gottlosen Vorsichhinleben. Was sollte aus diesen Kindern denn einmal werden? Würden sie je einen Weg zum Herrgott finden? Sie musste sich beruhigen und an Gutes denken, an den heiligen Sebastian zum Beispiel, der so viel Gutes getan hatte, oder an den heiligen Emil, von dem niemand so recht wusste, warum er eigentlich heiliggesprochen worden war. Sie kannte sich richtig gut aus mit den Heiligen. Schon als Kind in Korntal hatte sie die Bildchen vom Pfarrer gesammelt und konnte heute mit Fug und Recht behaupten, eine der größten Sammlungen an Heiligenbildchen in ganz Süddeutschland zu besitzen. Hugo hatte das nie besonders wichtig gefunden. Obwohl er doch ein so gläubiger Mann gewesen war. Hugo, ihr Mann, der so früh gegangen war. Sie hatten sich gefunden, Kinder gezeugt, großgezogen im Glauben, dann ging er. An einem Himmelfahrtstag nahm ihn der Herrgott hinauf in seinen Himmel. Warum, das hatte sie nicht gefragt. Sie hatte getrauert um diesen gläubigen Mann, der sich sogar bei der Zeugung der Kinder die Augen verbunden hatte. Er hatte sie nie erkannt, im biblischen Sinne. Er wollte einen Schritt weitergehen, noch biblischer, noch gläubiger sein. Auch er war aus Korntal gebürtig. Der Herrgott hatte ihn sicherlich gut aufgenommen. Die Guten nahm er gut auf, das glaubte sie fest. Die, die Gutes auch getan hatten, die nahm er noch besser auf. Dann würde es Hugo jetzt gut haben, wahrscheinlich, so dachte sie.
Sie schaute auf diese Kinder und dachte an ihre, die sie schon so lang nicht mehr gesehen hatte. Die Dorothea war nach Amerika ausgewandert, der Hans in den Norden, und die kleine Amalie trieb sich irgendwo im Bayerischen herum. Sie waren alle gegangen, geflüchtet, vor Hugo, diesem guten Mann. Er hatte sie doch erziehen wollen im Geiste seines Herrgotts, hatte ihnen die Bibel so lang über ihre Kinderschädel geschlagen, damit der Geist des Herrgotts in sie einkehren sollte. Sie hatten ihm das übel genommen. Sie hatte noch gedacht, vielleicht geht das so nicht.
Das hatte der liebe Gott damals auch gedacht. So ging das ja wohl aber überhaupt nicht. Er kannte diesen Herrgott nicht, den dieser Hugo da für sein Tun bemühte, aber das konnte er so nicht zulassen. Also hatte er ihn Himmelfahrt oder nicht Himmelfahrt kurzerhand von Petrus holen lassen. Dieser Hugo schmorte jetzt auf der Lernwolke vor sich hin und musste sich die ganze Glaubenskiste von ein paar Atheisten erklären lassen. So ging das, dachte Gott, du denkst, du hast einen Glauben, und dann stimmte das alles gar nicht.
Er wusste um die Schicksale der Kinder dieses Hugo. Der Dorothea ging es gut in Amerika, sie konnte sich frei machen von all dem Scheiß, den ihr ihr Vater hatte eintrichtern wollen. Der Hans, der war nicht mehr im Norden, den hatte es nach Südafrika verschlagen, damals. Der war nicht mehr rausgekommen aus dem väterlichen Denkhüttchen. Arbeitete lange in der Entwicklungsarbeit für die Kirche. Mit den Negern, wie er damals meinte. Dann wurden diese Neger befreit, und seine Einrichtungen musste er für ein Entgelt übergeben. An die Neger. Das hatte er nicht verkraftet. Ging in den Keller und schoss sich ein Loch in den Kopf. Armer Mensch, dachte Gott, aber die Wege des Herrn, also seine, waren eben so.
Er hatte den Fall auch mit Gerda und Franz besprochen. Die waren ganz erstaunt, dass es so etwas heutzutage noch gab. »Und was wurde aus der jüngsten Tochter?«, hatte Gerda neugierig gefragt.
»Die kleine Amalie ist heute eine der kommenden Kandidatinnen der Grünen in Bayern«, sagte Gott mit ein wenig Stolz in der Stimme, »mal sehen, wann wir die dann drankommen lassen!« Gerda und Franz hatten gelacht, und auch Luise, die auf einen Sprung vorbeigeschaut hatte, amüsierte sich. Die Grünen in Bayern! Aber, siehe Baden-Württemberg. Es ging die Zeit, sie ging voran. »Das bin ich«, sagte Gott stolz. Die anderen nickten.
Das tat auch Kommissar Knöpfle an diesem Morgen, als Schirmer mal wieder kein Licht wollte. Natürlich, kein Licht. Bitte schön. Die alte Prozedur. Er wollte keine schlechte Stimmung heute Morgen. Er wusste noch nicht, wie er es machen sollte. Er musste sich was einfallen lassen. Wie sollte er das dem Kollegen Schirmer beibringen? Er konnte es selbst ja noch nicht glauben. Für Höheres empfohlen. Er war sich keiner Schuld bewusst. Aber das Schreiben lag schon ein paar Tage auf seinem Schreibtisch. Nur seiner Frau Britta hatte er davon erzählt. Ihr Jubel war da, aber hielt sich auch in Grenzen, denn immerhin bedeutete das Schreiben, dass er von Pfenningen wegmusste. Und damit auch weg von der Familie sein würde. Aber reizen würde ihn das schon. Britta hatte ihm dann doch zugeredet. Er sollte doch, das wäre doch und so. Da hatte irgendjemand seine Leistung in den letzten Monaten beobachtet und wohl gemeint, wer ein solches Chaos meisterte, der war doch zu mehr in der Lage, den konnte man doch brauchen. Er sollte ein Hauptkommissar in einer Ermittlungsgruppe werden. Hauptkommissar, das kam jetzt ziemlich schnell. Oder auch nicht, wie immer man zählte. Schirmer würde kein Hauptkommissar, da konnte man noch so lang zählen. Aber das alles war noch eine Weile hin. Deshalb zögerte er noch, dem Willi Bescheid zu geben. Das hatte doch noch Zeit. Er wollte ihm das schonend beibringen. Es würde sich schon noch eine Gelegenheit ergeben. Wenn keine Not ist, dann mach keine Not, das sagte sein Vater immer.
Mit solchen Lebensweisheiten konnte Hans Bremer in seiner Situation wenig anfangen. Er war zwar zusammen mit dem Schriftsteller aus dem Untersuchungsgefängnis geflohen, hatte sich dann aber recht schnell vom Acker gemacht. Denn er wollte mit dem Litauer nichts mehr zu tun haben. Der war schließlich verantwortlich für die schlimmste Zeit in seinem Leben. Statt, wie bestellt, seine Frau ins Jenseits zu befördern, hatte der Handlanger des Litauers seine Sekretärin auf der Rathaustreppe erschossen. Die gute Frau Schickle, seine rechte Hand, war nun nicht mehr. Er schaute gen Himmel und spürte einen inneren Drang, an ein Leben nach dem Tode und einen Gott im Himmel zu glauben. Der Schickle würde er das wünschen, den andern dort droben eher weniger, denn die Schickle würde denen dann mal beibringen, was Organisation bedeutete.
Aber, riss er sich aus seinen Gedanken, er musste jetzt an sich denken. Was blieb ihm von seinem Leben, das wollte er jetzt wissen. Er hatte Fehler gemacht, das wusste er, aber es musste doch auch für ihn weitergehen. Die Sache mit Luise war gegessen, das war nicht seine Schuld gewesen. Die Gerda, nun, das war er, aber doch eher indirekt. Aber, was war Schuld in diesen Zeiten, da regierten Politiker rum wie die Wahnsinnigen, da schlugen Jugendliche Menschen zusammen, nur so, da starb ein junger, hoffnungsvoller Eisbär, Schuld? Was war seine Schuld dagegen! Er reimte sich das so zusammen. Er musste sich das so zusammenreimen. Er wollte weiter, wieder raus, Sonne sehen. Aber wie, ohne Heim und Geld? Heim? Auf keinen Fall wieder zum Litauer in den Keller, das bestimmt nicht. Im Ort war es schwierig, weil ihn halt fast jeder kannte. Es müsste was draußen sein, draußen, aber doch nicht so ganz. Vielleicht ein wenig ins Grüne, dachte der Hans. Den Frieder Kötzle, den kannte er doch ganz gut, der hatte doch so ein Gütle am Georgenberg. Das wäre doch vielleicht was. Und der Frieder, der würde dichthalten, als Kegelbruder und Journalist, der hin und wieder Genaueres von ihm erfahren hatte. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die sich überprüfen ließe.
Nach Möglichkeiten suchte auch Friedhelm Mirner. Freilich, es war Weltspartag, aber mussten denn immer alle kleinen Sparer gleichzeitig kommen? Sie taten ihr Bestes, mit den zwei Zählmaschinen, die ihnen zur Verfügung standen, die ankommenden Sparbüchsen zu entleeren und zu zählen. Aber dann passte hier mal ein Schlüssel nicht, da klemmte was, oder nach dem Durchzählen fehlte das Sparbuch. Sie hatten regen Zulauf, denn sie waren die Leutebank in Pfenningen und hatten einen großen Anteil am Bankgeschäft dieser Stadt. Aber mit einem solchen Andrang war einfach nicht zu rechnen gewesen. Friedhelm holte aus der Verwaltung noch ein paar Lehrlinge dazu, dann lief die Sache einigermaßen. Er war schon eine ganze Zeit, wenn er richtig überlegte, seit fast zehn Jahren bei dieser Bank. Es war nicht mehr so wie früher. Viel angespannter und hektischer. Und wage nur ja nicht, zu sagen, du arbeitest bei einer Bank. Das kam heute nicht mehr so gut. Er wusste nicht, was die da oben machten, aber irgendwie machten die das nicht so gut. Was sollten sie hier unten an den Schaltern denn tun? Sie waren diejenigen, die auf die Fragen dann antworten mussten. Aber dann antworte mal, wenn die Kunden dir die Verfehlungen der Geschäftsleitung ins Gesicht bliesen. Sie standen ganz schön bescheuert da.
Es ging. »Bescheuert« hätte Hans Bremer dazu jetzt nicht gesagt. Er hatte eine Lösung für sein Behausungsproblem gefunden. Er kannte das Gelände, den Georgenberg und das Gütle, und er wusste auch, wo der Schlüssel lag. Vielleicht war Frieder um diese Jahreszeit noch nicht dort zugange. Der Mai hatte begonnen, es würde warm genug sein. Wenn er sich einigermaßen bedeckt hielt, dann konnte er hier zumindest ein paar Wochen verbringen. Versorgungsmäßig musste er sich durch die Vorstadt stehlen und dann, wenn er Glück hatte, unerkannt in den großen Supermärkten seine Einkäufe erledigen. Das Risiko war ihm klar, das war er inzwischen gewohnt. Nachdem er sich in der Hütte ein wenig eingerichtet hatte, machte er sich eine Flasche Bier auf. Tja, der Frieder, der hatte gern ein wenig auf Vorrat. Außer Bier und Wein hatte er auch noch ein paar Dosen mit Suppen und Ravioli gefunden. Also fehlte es ihm erst einmal nur an frischen Sachen. Vielleicht könnte er da unten bei der Gärtnerei Ludwig heute Nacht was organisieren. Er musste nur auf den Hund aufpassen. Der kannte ihn zwar und war tagsüber harmlos, aber wie der sich nachts verhielt, das war eben nicht sicher. Das würde er heute Abend angehen.
Der Abend war für Kommissar Knöpfle noch weit. Er war noch nicht richtig weiter. Ein Versuch nach Schirmers Leberkäs-Runde, inzwischen ja eigentlich eine Butterbrezel-Runde, war kläglich gescheitert, Irgendwie war der Willi nicht mehr der Alte. Das konnte doch wohl nicht daran liegen, dass ihm sein Arzt nun endgültig die Leberkäswecken verboten hatte, dachte Kommissar Knöpfle. Es könnte aber auch an dem seltsamen Geruch liegen, den der Willi heute Morgen ins Büro hereingebracht hatte.
Knöpfle hatte eine Weile überlegen müssen, dann war er draufgekommen, es roch bei ihnen hier drin ein wenig nach Stall. Aber was sollte er sich weiter Gedanken machen, der Willi war schon wieder weg, weil er unbedingt noch etwas Persönliches zu erledigen hatte. Was, das wollte der Willi ihm nicht sagen, und das war dann so gar nicht Willi.
Ansonsten war der Tag ruhig verlaufen. Sie hatten noch mit den Nachwehen dieser Pfenningen-Geschichte zu kämpfen. Alle Betroffenen waren inzwischen aus dem Krankenhaus zurück. Einige Fragen blieben allerdings noch zu bearbeiten. Da war Alfred Rottwald, der zwar ein Polizeiauto gestohlen hatte, dessen Golf allerdings von den Kollegen beschädigt und dann von der Feuerwehr vollends Richtung Schrottplatz geschickt worden war. Die Versicherungen stritten sich noch, wer denn nun welchen Schaden abzudecken hatte. Derweilen machte ihnen Alfred die Hölle heiß, weil seine Klara nicht mehr laufen oder Fahrrad fahren wollte. Er selbst, der Alfred, konnte sich mit einer Gehhilfe schon wieder ganz gut bewegen. Man sah ihn hin und wieder über den Marktplatz schleichen. Unglaublich, dachte der Kommissar, wie man mit dem Fahrrad so unglücklich stürzen konnte, dass kaum ein Knochen im Körper des Rentners ganz geblieben war.
Thomas Knöpfle sah aus dem Fenster und dachte an Erscheinungen. Da kam er, der Alfred. Keine Gehhilfe mehr, nur noch eine Krücke, und er ging oder schleppte sich in Richtung Polizeirevier. Schirmer saß inzwischen wieder hinten in seinem Büro. Es war an der Zeit, eine Dienstfahrt anzusetzen, beschloss Kommissar Knöpfle. Er griff sich den Autoschlüssel, rief ein kurzes »Bin weg« nach hinten und war, bevor Schirmer reagieren konnte, auf dem Weg zum Hinterausgang. Der sollte sich jetzt mal selbst mit diesen Problemen beschäftigen, dachte Knöpfle. Schließlich würde er ja sowieso nicht mehr lang da sein.
Ein Gedanke, der auch Genoveva Christlein umtrieb. Sie würde zum Herrgott gehen. Nicht demnächst, aber in nicht zu ferner Zukunft. Sie ging auch auf die achtzig zu und fühlte ihr Leben gelebt. Sie freute sich darauf, die Himmelspforte zu sehen, Petrus kennenzulernen und dann, das Größte, den lieben Herrgott zu sehen. Dazu musste sie aber ihre weltlichen Dinge abschließen. Das hatten sie erst am letzten Dienstag in der Bibelstunde besprochen. Der richtige, der gute Weg zu Gott, war das Motto gewesen. Herr Bleibtreu hatte wieder mit eindrücklichen Worten gesprochen. Zuerst ein Lied, dann die Andacht und dann das Thema. Herr Bleibtreu hatte ihr klargemacht, wie einfach ihr Weg zum Herrgott sein würde. Sie musste so langsam abschließen mit dem Leben. Ein Ende finden. Das fiel ihr nicht schwer. Die Vergangenheit war vorbei. Da war ein Grab, und da waren Kinder, von denen sie nicht wusste, wo auf dieser Welt sie sich herumtrieben. Man solle sich frei machen, hatte Herr Bleibtreu gesagt. Weltliche Dinge zurücklassen, sich versorgen für das Jenseits, für den Schritt zum Herrgott. Und was gab es da für einen besseren Weg, als die weltlichen Dinge zu Geld zu machen und dem Herrn zu geben. Das wollte Genoveva tun. Allzu viel hatte sie nicht, aber immerhin ihr Häuschen. Das wollte sie demnächst mit dem netten Herrn von der Leutebank in Pfenningen besprechen. Der Herrgott würde sich freuen.
Vielleicht, hätte Pfarrer Leonhard dazu höchstens gesagt. Für ihn ging es gerade um anderes. Es stand sein nächster Kontakt mit diesen kleinen Menschen an. Der Konfirmationsunterricht. Hier wurde es für ihn noch ein bisschen schwieriger, denn er hatte die Instanz Schule nicht hinter sich, war sozusagen nun selbst der Chef. Aber davon wollten diese Jugendlichen nichts wissen.
Er hatte beim ersten Treffen einen Fragebogen ausgeteilt und war sichtlich überrascht von den Ergebnissen gewesen. Immerhin hatten doch einige Interesse an dieser Sache mit Gott angekreuzt. Freilich waren ein paar dabei, die bei »Warum besuche ich den Konfirmandenunterricht?« frei von der Leber weg hingeschrieben hatten: »Wegen der Geschenke.« Er fand das eigentlich gut. Warum sich was vormachen. Da war ihm doch Ehrlichkeit lieber als irgendwelche Heucheleien. Aber nun kannte er seine Kandidaten, die wahrscheinlich nur die Unterrichtsstunden absitzen, ihre Kirchenbesuche absolvieren würden und insgesamt sich den Tag herbeiwünschten, dass endlich diese Konfirmation über die Bühne gehen würde. Ebendiese Kandidaten würden heute Mittag zum zweiten Konfirmandenunterricht antreten. Das wollte vorbereitet sein.
Er war noch nicht der Alte, das bemerkte er immer wieder. Die Konstruktion geisterte noch in seinem Kopf herum. Er sah Menschen und schaute ihnen auf ihr Mittelteil und war froh, wenn keine Konstruktion zu sehen war. Wer hätte gedacht, dachte der Pfarrer, dass dieses Aufeinandertreffen mit dem Einzelhändler Millreiner im Beutlinger Krankenhaus solche Nachwirkungen haben würde. Vielleicht, wenn er die Vorgeschichte gekannt hätte und nicht selbst ans Bett gefesselt gewesen wäre, dann hätte er eventuell verstanden, warum die diesem Einzelhändler diese Verbandskonstruktion über seine Weichteile gebaut hatten. Aber so war es ein Schock gewesen. Das hatte ausgesehen, als ob sie über seinem besten Stück ein Zelt errichtet hätten. An die anschließenden Geschehnisse mochte er sich lieber nicht mehr erinnern.
Millreiner hatte er seitdem gemieden. Der war wohl aus der Reha zurück, wie er gehört hatte. Es ging ihm wohl sehr ordentlich. Er wusste nicht so richtig, wie er die Sache angehen sollte. In seinem Innern spürte er den Drang, sich zu konfrontieren, diesem Millreiner entgegenzutreten und ihn endlich ohne Konstruktion zu sehen. Das würde ihm helfen. Aber er hatte Angst. Wenn dieser Millreiner dann doch noch eine Konstruktion da unten hatte, dann war womöglich alles wieder da. Dann lag er wieder im Krankenhaus in Beutlingen in dem Zimmer und erlebte alles noch einmal. Und das durfte nicht passieren.
Genau, hätte Willi Schirmer dazu gesagt. Eigentlich durfte so etwas überhaupt gar nicht passieren. Er hatte sein Leben geordnet, ihm Bahnen gegeben und Sicherheit. Er war Beamter, hatte seine Wohnung abgezahlt und fuhr, nun gut, einen alten R4. Er war zufrieden. Die Ziele waren verfehlt, und er wusste, viel weiter würde er sowieso nicht kommen. Seit Jahren hatte er Spaß an seinem Hobby, er sammelte alles rund ums Spätzlemachen. Seien es die klassischen Pressen, die Hobel, was auch immer.
Allen Geräten, die mit der Herstellung der schwäbischen Leib- und Magenspeise zu tun hatten, war er auf der Spur und reihte sie in seine Sammlung ein. Oft war er am Wochenende unterwegs und stöberte auf Flohmärkten nach alten Maschinen. Inzwischen hatte er einen ganzen Keller voll. Er hatte sich ein paar Vitrinen gebaut, und dort lagen die Utensilien nun alle. Die Geschichte des Spätzlemachens, chronologisch aufgereiht, teilweise mit alten Anleitungen, präsentiert von Willi Schirmer. Sein ältestes Exemplar stammte aus dem frühen 19. Jahrhundert. Aber auch die neuen Entwicklungen hatte er alle eingekauft.
Jedes Wochenende war die Überlegung: Was machst du heute? Dann ging er in seinen Keller hinunter und holte sich die passende Maschine. Interessant auch die Teigvarianten, flüssiger fürs Schaben, aber fester für die Pressen, mal ein Schuss Öl, dann wieder ein Stück Butter oder aber auch ein Spritzer Sprudel. Er experimentierte und hatte so langsam, aber sicher seine eigene Spätzle-Philosophie entwickelt. Das war sein Leben. Der Dienst im Revier, seine tägliche Butterbrezel und seine Spätzlemaschinen. Damit war er ausgefüllt. Dazu hin und wieder am Abend einen dieser Regiokrimis, um zu lesen, wie sein Job wirklich sein sollte. Das war es dann aber auch.
Dann kam sie. Stand an diesem Morgen vor der Tür und behauptete, seine Tochter zu sein. Eine junge Frau, hübsch, das musste er zugeben, vielleicht Anfang zwanzig. Und jetzt?, hatte er sich gefragt. Hurra, oder was?
»I ben dei Tochter, die Elke«, hatte sie gesagt.
Mit Lebenserfahrung im Hintergrund kam man auch über solche Situationen hinweg, dachte der Kommissar bei sich. Aber er spürte eine gewisse innere Unruhe in sich aufkommen.
»No kommsch rei«, sagte er und war sich dabei wenig bewusst, was er da eigentlich sagte und tat. Er musste zum Dienst, die tägliche Butterbrezel in der Bäckerei gleich neben dem Großmetzger wartete nicht. Elke setzte sich, er schenkte ihr einen Kaffee ein und rief im Büro an. Eine Stunde später würde es wohl werden. Sie erzählte von ihrer Mutter, deren letzten Tagen und wie sie endlich den Namen ihres Vaters von ihr erfahren hatte. Dann war sie losgezogen. Weit war es ja nicht, und nachdem die Mutter am vergangenen Abend gestorben war, hatte sie sich heute auf den Weg zu ihrem Vater gemacht. »Stichwort Bodensee«, hatte die Mutter ihr noch zugeflüstert. Der Bodensee, verdammt, hatte Willi Schirmer gedacht. Nur so ein kleiner Ausflug, und heute stand eine Tochter vor ihm.
»Des war am Bodensee, domols, gell, Vatter?«, fragte seine Tochter, als ob sie seine Gedanken lesen könnte.
»Genau, am Bodensee muss des gwesa sei, des isch jetzt aber scho lang her«, antwortete Schirmer.
»Fascht vierundzwanzig Jahre«, sagte die junge Frau.
Willi Schirmer nickte. Beinahe ein Vierteljahrhundert hatte es gedauert, bis er erfuhr, dass er eine Tochter hatte. Er zeigte ihr seine Wohnung und auch das Gästezimmer. Er gab ihr Geld zum Einkaufen und verabschiedete sich bis zum Abend. Als er die Treppe hinunterging, dachte er daran, was nun wohl alles passieren und was sich verändern würde. Alles vorbei, dachte er dann, alle Planung dahin, keine ruhige Rente, keine Spätzlemaschinen. Obwohl, seinen Keller würde er sich nicht nehmen lassen. Aber vielleicht war bald die Ruhe dahin. Mit so einer jungen Frau in der Wohnung ging wahrscheinlich so manches nicht mehr so wie vorher.
Was nicht mehr ging, das versuchte Britta Knöpfle ihren Kundinnen und Kunden zu erklären. Der erste Band von »Stille Tage am Albtrauf« war immer noch ein Bestseller und ging weg wie warme Wecken. Aber die meisten der Kunden wollten wissen, wann denn der zweite Band erscheinen werde, man sei ja schon so gespannt. Was sollte sie sagen? Sicher, der Autor hatte Ende des ersten Bandes angedeutet, dass es vielleicht weitergehen werde. Aber wie das gehen sollte, das war ihr auch nicht klar. Soweit sie wusste, saß der ja noch ein. Womöglich konnte der aus dem Gefängnis heraus am nächsten Band arbeiten. Was wusste sie denn? Schlimm genug, dass sie in ihrer Beziehung einiges hatten ausdiskutieren müssen. Sie begriff das bis heute nicht. Da schrieb einer ein paar Artikel in der Zeitung, daraus wurde ein Buch, und halb Pfenningen machte da einfach so mit. Ihr Thomas allen voran in der Hauptrolle. Und die fanden das alles ganz toll, so mitspielen und so und drin sein im Buch. Das war für die aber mal wirklich so richtiggehend Literatur direkt. Am liebsten hätten die noch mit dem Autor telefoniert, um ihm die neuesten Geschichten brühwarm zu erzählen. Wie das mit Thomas weiterging, das wollten sie in den nächsten Tagen genau besprechen. Sie fand es gut und freute sich, dass er aus diesem Pfenningen mal rauskam, aber er musste das für sich wissen. Mit ein wenig Abwesenheit konnte sie leben, lebte sie schon, und wenn es für ihn eine Chance und auch interessant war, warum nicht.
Warum nicht auch mal anders. Das sagte sich Frieder Kötzle. Mit seiner Barbara hatte er sich wieder ganz gut zusammengelebt. Sie hatte ihm die Sache mit dem Automower und dem Beet verziehen, und er hatte kein Wort mehr darüber verloren, dass sie so Hals über Kopf zur Klara gerannt war. Oft war Schweigen auch ganz gut, dachte er so bei sich. Immerhin hatte ihn die Wiederherstellung des Blumen- und Gemüsebeets seiner Frau eine Stange Geld und einen Haufen Arbeit gekostet. Nun gut, er war der Schuldige gewesen, der den kleinen Moritz, seinen Enkel, mit dem Gerät allein gelassen hatte. Dass der findige Knabe an diesem Ding herumprogrammieren würde, damit konnte man ja nun wirklich nicht rechnen. Aber das war nun Schnee von gestern. Er hatte sich zur Belebung der Beziehung eine schöne Reise herausgesucht und wollte damit seine Barbara überraschen.
Schon als Kind hatten ihn Schiffe fasziniert, und es war immer so ein kleiner Traum von ihm gewesen, mal auf so einem richtig großen Schiff zu fahren. Keine kleine Fähre nach Elba oder Sardinien, sondern was Großes, eine Kreuzfahrt in der Karibik. Er hatte sich kundig gemacht, so teuer war das gar nicht, wenn man keine allzu großen Ansprüche stellte. Schnell entschlossen hatte er gebucht, und nun stand der Moment der Bekanntgabe dieser Überraschung an. Er hatte schon einen Prosecco kalt gestellt und sich dem Anlass entsprechend in die bessere Schale geworfen. Die Barbara würde demnächst heimkommen. Dann ging es los.
Los ging auch Hans Bremer. Diese Dunkelheit musste genügen, dachte er. Wenn es stockdunkel sein würde, fände er womöglich den Weg auf den Georgenberg, zurück ins Gütle, nicht mehr wieder. Dann würde er dumm dastehen. Also schnappte er sich den Rucksack von Frieder und machte sich auf den Weg. Die Feldwege den Georgenberg hinunter waren kein Problem, etwas schwieriger wurde es, als er die beleuchteten Straßen erreichte. Hier hielt er sich möglichst an den Hauswänden und versuchte, eventuellen Passanten frühzeitig auszuweichen.
Nach einer guten halben Stunde war er dort, wo er damals vor den Polizisten geflüchtet war: am Parkplatz des Großmetzgers. Es war alles ruhig, die Gegend wenig beleuchtet. Nur vorn am großen Supermarkt war noch was los. Aber das kam ihm grade recht. Er hatte ein wenig befürchtet, dass vielleicht zu wenige Leute jetzt noch einkauften. Daher reihte er sich recht beschwingt in die Wagenschieber ein und lud sich die notwendigen Dinge in seinen Wagen. Immerhin musste er bedenken, dass er das alles mit seinem Rucksack auf den Georgenberg tragen musste.
Er hatte sich gerade zwei Flaschen trockenen italienischen Weines in den Wagen gelegt, da sah er ein Gesicht. Er kannte das Gesicht, und das Gesicht kannte ihn. Es war der Litauer zusammen mit seinem Bodyguard, der Glatze. Sein Gehilfe durfte ihm den Wagen schieben, und der Litauer spazierte durch die Regale und lud ein. Verdammte Scheiße, dachte Hans Bremer, ehemals Bürgermeister von Pfenningen, das ist der Litauer. Und der Litauer dachte, das ist doch der Bremer Hans, den kennst du doch. Bremer beschleunigte seinen Schritt und versuchte, dem Litauer irgendwie noch zu entwischen. Aber, keine Chance, kaum hatte er zwischen sich und den Litauer ein wenig Abstand gebracht, schoss von rechts die Glatze mit einem voll bepackten Wagen genau in den seinen rein. Prost Mahlzeit, dachte Bremer. »Dich kenn ich«, sagte die Glatze. Von hinten kam der Litauer sehr locker und lässig auf Bremer zu. Und jetzt?, dachte Bremer. Was kam jetzt?