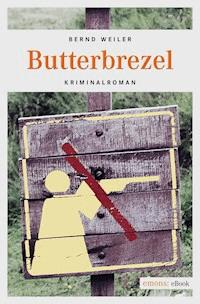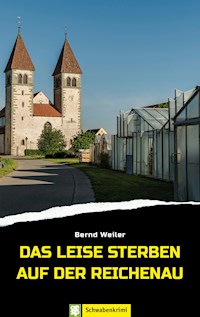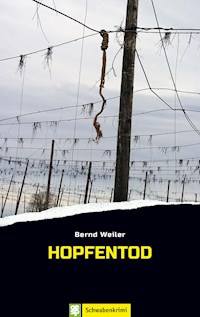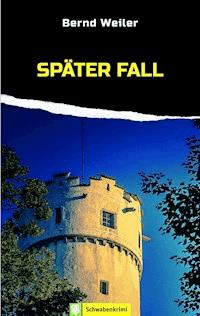
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel u. Spörer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was heißt schon schwanger, denkt sich Hauptkommissarin Kim Lorenz in Horn am Bodensee. Ihr Chef hat sie deswegen in den Innendienst versetzt. Im Archiv stößt sie auf einen rätselhaften Mordfall: Ein Anwalt wurde vor fünf Jahren in seinem Ravensburger Büro erstochen aufgefunden. Keine Zeugen, keine Beweise, nichts. In den Akten findet sie einen weiteren unaufgeklärten Mord, in Weingarten an einem alten Mann, nur wenige Monate nach dem Tod des Architekten. Sollten diese beiden Fälle miteinander zu tun haben? Kim Lorenz beschließt, zusammen mit ihrer Kollegin Christina Hahn in Ravensburg und Weingarten zu ermitteln. Die Ehefrau des toten Anwalts scheint die einzige Verdächtige zu sein. Aber die liegt dann eines Tages tot am Mehlsack, dem Wahrzeichen Ravensburg.s
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Weiler
in Eislingen/Fils geboren, studierte Anglistik und Germanistik in Tübingen und Leeds. Als Freier Redakteur und Autor arbeitete er bei zahlreichen Reise- und Naturführern mit. Mehrere seiner Mundarthörspiele wurden vom SWR produziert. Seit einigen Jahren schreibt er auch Krimis. Er lebt und arbeitet in Pfullingen.
Bernd Weiler
Später Fall
Schwabenkrimi
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen.Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel+Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2017Postfach 16 42 · 72706 ReutlingenAlle Rechte vorbehalten.Titelbild: Marco Mehl, RavensburgGestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, ReutlingenLektorat: Sabine TochtermannSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-88627-594-6
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren
Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:
www.oertel-spoerer.de
Für Miriam
Jetzt musste sie bald um die Ecke. Dann, am Marienplatz, war es mit dem Versteckspiel vorbei. In ihr kam ein erstes Gefühl von Verunsicherung auf. Bisher war sie im Schatten der alten Häuser durch die Gassen geschlichen. Die Dämmerung mit ihrem spärlichen Licht machte sie für die wenigen Passanten kaum erkennbar, kaum wiedererkennbar. Aber wenn schon, sie sollten sich an die ganz in Rot gekleidete blonde Frau auf ihren hochhackigen Schuhen ruhig erinnern. Sollten sie es ruhig später der Polizei zu Protokoll geben. Damit rechneten sie ja. Die Suche nach dieser Frau würde einige Tage dauern. Tage, die sie brauchten, um hinter sich aufzuräumen und alles klar für die Reise zu machen. So dachte sich das zumindest Mark, gutgläubig wie er war. Sie war sich noch nicht sicher, wann sie sich seiner entledigen würde. Vielleicht ein Badeunfall, vielleicht auch eine Klippe, oder er verschwand ganz einfach. Das kam vor, oft. Sie musste lächeln, verbot sich diesen Gesichtsausdruck aber jetzt hier auf dem noch sehr belebten Platz. Eigentlich handelte es sich eher um eine sehr breite Straße, die zwischen zwei Häuserreihen mit prächtigen alten Patrizierhäusern mitten durch die Stadt führte. Eine Stadt, die seine Stadt war. Vielleicht der Kern ihres Problems. Seine Familie war ein Teil der Ravensburger Gesellschaft. Über die Generationen hinweg hatten sich zu den Rechtsanwälten die Immobilienmakler und schließlich auch die Architekten gesellt. Er war einer aus dieser neuen Generation, die, aufbauend auf Reichtum und Verbindungen, hier in Ravensburg so manchen schönen Auftrag an Land gezogen hatte.
Das war alles genau überlegt. Jeder ihrer Schritte war geplant bis ins letzte Detail. Tagelang hatten sie Punkt für Punkt noch einmal durchgesprochen, die Unsicherheiten abgewogen und mögliche Probleme durchdiskutiert. Mark war es irgendwann zu viel geworden. Aber sie musste für sich sicher sein. Dazu überprüfte sie alle Punkte, die eine Möglichkeit boten, entdeckt zu werden. Einige Situationen bargen ein Risiko, das war nicht zu vermeiden. Immerhin musste sie jetzt, am Nachmittag über den Marienplatz gehen. Denn sie sollte ja gesehen werden. Im Kopf hatte sie sich das ausgemalt, durchgespielt, wie sie in ihrem knallroten Kostüm über den Platz gehen würde. Aber nun, jetzt, in der Situation, fühlte sich das ganz anders an, irgendwie gefährlicher. Denn jetzt gab es kein Zurück mehr. Nun war sie den ersten Schritt gegangen und musste den zweiten folgen lassen. Sie konnte jetzt nicht mehr umdrehen. Ihr Weg war nun klar gezeichnet, vorbei am alten Rathaus, dem Blaserturm, einem der vielen Türme dieser Stadt, die sich ihre Sicherheit in vergangener Zeit wirklich einiges hatte kosten lassen. Reich war diese Stadt schon lange, dachte Lydia, als sie am prächtigen Backsteinbau vorbei ging. Reich geworden und schließlich auch bis heute reich geblieben. Hier waren einige Vorteile zusammengekommen. Grundlage waren wohl die geschäftigen Ravensburger früherer Generationen, die aus einem kleinen Ort eine bedeutende Handelsstadt gemacht hatten. Auch sie hatte eigentlich von diesem Reichtum profitiert. Auch sie hatte es genossen, Geld zu haben. Aber eben nicht ihr eigenes Geld. Sein Geld, das Geld seiner Familie. Und dann dieser Dünkel, obwohl sie mit ihren Immobiliengeschäften in manchen Jahren mehr Profit eingefahren hatte als er. Sie hatte ein paar Jahre zugesehen. Zu viele Jahre, wenn sie heute zurückblickte. Warum war sie so blöd gewesen, diesen Ehevertrag zu unterschreiben, das fragte sie sich später immer wieder. Einen Vertrag, der sie zu seiner und der Familie Angestellten machte. Sie war als Ehefrau und Gesellschafterin in diesem seltsamen geschäftlichen Konglomerat von Anfang an eine bessere Hilfskraft gewesen. So sah sie das wenigstens heute. Jede Loslösung aus diesem Netz hätte sie mittellos zurückgelassen. Am Anfang war ihr klar, dass dies ihr Weg aus der Situation nicht sein konnte. Sie wollte ihre eigene Frau sein, Geld haben und damit etwas Vernünftiges machen. Aber sie wollte eben auch das Leben führen, das sie sich für sich vorstellte. Nicht hier in Ravensburg, draußen in der Welt, London, New York, Paris, das waren ihre Ziele. Wie viele Nächte hatte sie neben ihm gelegen und daran gedacht, was sie alles machen könnte, wenn sie frei wäre. Dort drüben im Gasthof Engel hatten sie früher oft gesessen, vor allem im Sommer. Hubert liebte gutes Essen, vor allem die einheimische Küche. An wie vielen Sonntagen waren sie mittags ins Land hinaus gefahren, um in irgendeinem Landgasthof zu Mittag zu essen, weil Hubert einen Tipp erhalten hatte. Und immer mit einem Teil der großen Familie, anschließend natürlich dann der Kaffee zu Hause mit Kuchen aus der einen guten Konditorei, in der man seit Generationen den Kuchen holte. Was waren das für Sonntage gewesen! Allein deswegen hätte sie ihn manchmal umbringen können. Wie er dann, ganz der erfolgreiche Sohn, an der Stirnseite im Lokal Platz nahm, natürlich als Erster die Karte bekam, und zu kommentieren begann. Obwohl er selbst kaum einen Kochlöffel von einem Schneebesen unterscheiden konnte, ließ er sich dann aus über die oberschwäbische Küche und ihre Leckereien. Irgendwann hatte sie begonnen, immer nur Schnitzel mit Pommes und Salat zu bestellen. Das war ihm saumäßig auf den Wecker gegangen, ja, richtig aufgeregt hatte es ihn manches Mal. Auch hier im Engel, an dem sie gerade vorbeiging, hatte sie so manches Schniposa bestellt. Obwohl Hubert natürlich über die oberschwäbischen Knöpfle, Krautwickel und grünen Spatzen philosophierte. Einmal, sie erinnerte sich jetzt, es war an einem der äußeren Tische der Terrasse gewesen, hatte sich Hubert richtiggehend in Rage geredet, weil sie wieder mal ihr Schniposa bestellt hatte. Er war ziemlich laut geworden. Daraufhin war am Nachbartisch ein großer Mann aufgestanden und zu ihrem Tisch rübergekommen.
»Would you please calm down a bit«, hatte er auf Englisch zu Hubert gesagt, »it’s just a simple Snitzel!«
Der ganze Tisch war baff gewesen. Hubert bekam den Mund vor Staunen nicht zu. Der Engländer ging zurück zu seinem Tisch und setzte sich.
»Genau so führen die sich in der EU auf. Immer vorlaut, immer England vor!«, redete sich Hubert in Rage. Er versuchte, die Situation zu überspielen.
»Was ist die EU?«, fragte die kleine Tochter von Huberts Schwester.
»Die Europäische Gemeinschaft«, sagte Hubert.
»So wie Jungschar?«
»So ähnlich, bloß sind das Länder, die zusammen was machen«, griff Oberlehrer Richard, Huberts einige Jahre jüngerer Bruder, ein, der immer so gern erklärte.
»Zum Wohl«, rief Onkel Franz und hob sein Glas.
Damit war die Sache damals beendet. Aber genau so ging das. Nur wegen ihres Schnitzels konnte der so eine Szene hinlegen. Als ob es eine Rolle spielte, was sie aß. Vielleicht war das der Punkt gewesen, könnte sein. Es war ihr noch ein Gedanke im Kopf, dass sie sich hinterher gefragt hatte, warum sie sich so aufregte, innerlich natürlich, denn nach außen war sie die kleine Ehefrau, die eben blödsinnigerweise immer Schnitzel aß. Sie hatte sich aufgeregt, weil es niemand begriff in der erlesenen Runde. Auch Huberts Eltern waren damals dabei gewesen. Die hatten nur mit den Köpfen gewackelt, so, wie sie es immer taten, wenn Hubert mal wieder was sagte. Sie konnte nicht mehr nur mit dem Kopf wackeln. Da wackelte in Richtung Hubert deutlich nichts mehr. Vielleicht war ihr genau an diesem Abend klar geworden, dass das so nicht weitergehen konnte. Vielleicht.
Sie schaute hinauf zum Turm des Frauentors. Wie viele Frauen hatten in den letzten Jahrhunderten wohl da hinaufgeschaut und sich Besseres gewünscht. Sie hatte auf dem Heimweg damals auch hinaufgeschaut. Hinaus, durch ein Tor, in ein anderes Leben. Was für ein Leben, das war ihr damals noch nicht klar gewesen. Anders sollte es halt sein, freier und, ohne Hubert. Diesen Weg war sie gegangen. Wenn sie jetzt vor dem Frauentor links abbog, dann war es nicht mehr weit zu Huberts Büro. Ein herrschaftliches Haus in der Rosenstraße, früher Wohnhaus, heute Bürogebäude, wie so manches in der Ravensburger Innenstadt. Die Mieten wurden zu hoch und die Versuchung, mehr aus seiner Immobilie herauszuholen, war für viele zu groß. Sie hatte davon profitiert, Geschäfte gemacht, Geld verdient. Aber es war immer ein Beigeschmack geblieben. Für Hubert war das nie ein Problem gewesen. Die einen so, die andern so, meinte er. Damit war das Thema für ihn vom Tisch. Es ging darum, Geld zu machen, reich zu werden und dann reich zu sein. Sicherlich, auch sie wollte Geld verdienen, aber nicht unbedingt so. Sie hatte andere Pläne, wollte endlich finden, wonach sie suchte: sich. Aber das natürlich in einem Rahmen, der ihr auch Möglichkeiten bot, ein gutes Leben ermöglichte.
Sie musste an dieser Ecke aufpassen. Ihre Gedanken flogen und lenkten sie ab. Es war unglaublich, was einem alles in ein paar Momenten durch den Kopf gehen konnte. Vielleicht war das die Anspannung, das Adrenalin, das ihren Körper und damit auch ihren Geist so anregte und in Hochspannung versetzte. Die Ecke. Dort waren einige Menschen, die sie kannten. Wenn die vor ihren Läden standen, dann war Vorsicht geboten. Sie durfte die Menschen nicht zu nahe kommen lassen. Wenn sie an dieser Stelle jemand genauer anschaute und vielleicht hinterher auf die Idee kam, dass sie das gewesen war, diese rote Frau, dann hatte sie ein Problem. Sie beschleunigte ihre Schritte. Aber nicht zu schnell, nur nicht auffallen, keine Bewegungen, die hinterher vielleicht erinnert werden konnten. Sie musste ganz normal, wie uninteressiert, an den Läden und Häusern vorbeigehen. Den Blick nach vorne, um zu vermeiden, auf einen anderen Blick zu treffen. Wenn jemand genau hinsah, dann könnte ein Wiedererkennen möglich sein. Aus dem Augenwinkel erkannte sie Frau Zehetmayer, die, schwatzhaft wie sie war, wie immer vor ihrem kleinen Bioladen stand. Auch sie kaufte dort manchmal ein. Man sollte da schon hin und wieder einkaufen, meinte ihr Mann, denn die Familie Zehetmayer war schließlich mit der ihren befreundet. Man sah sich in der Kirche und bei verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen. So war das. Man gehörte dazu. Das hieß eben auch, dass man bei der Frau Zehetmayer einkaufte. Auch wenn der Bioladen der ansonsten gescheiterten höheren Tochter im Grunde genommen eine Apotheke war, preismäßig. Sie kaufte nicht unbedingt billig ein, das natürlich nicht, denn im Aldi oder Lidl konnte sie sich natürlich nicht sehen lassen, vielmehr durfte sie dort auch nicht gesehen werden. So wie jetzt, dachte sie, eigentlich genau so wie jetzt auch. Aber sie konnte es kaum ertragen, in diesem Bioladen für ein paar Kleinigkeiten eine gehörige Summe Geld zu lassen. Nur, damit der Laden auch lief, auf dass die höhere Tochter, Klara hieß sie wohl, ihr Auskommen oder ihre Berechtigung hatte. Das war das Spiel in dieser Stadt. Ein Spiel, dem sie heute entkommen wollte, endgültig. Sie ging weiter, mit stetem Schritt, kein Blick nach links, kein Blick nach rechts. Ein wenig schnaufte sie durch, dass die entscheidenden Stellen passiert waren. Nur noch wenige Häuser, dann würde sie die Treppen in den ersten Stock hinaufgehen. Sie würde die Türe öffnen in der Gewissheit, dass Mark seinen Job gemacht hatte. Einen Moment musste sie unten noch warten, bis die Sekretärin herunterkam. Sie hoffte, dass bei Mark alles klappte. Eigentlich konnte nichts schiefgehen. Lange hatten sie überlegt, wie sie es schaffen konnte, die Sekretärin, Fräulein Roswitha, aus dem Büro zu locken. Aber sie wussten um deren Gewohnheiten. Jeden Nachmittag, so gegen vier Uhr, holte sie zuverlässig etwas zum Kaffee. Meistens rief Fräulein Roswitha in der Bäckerei am Ende der Straße vorher an und ließ sich das Gewünschte einpacken. Um sicherzugehen, hatte Mark kurz vor vier im Büro angerufen und sich als Bäckerei Kunzelt gemeldet. Falls sie noch Nussschnecken wollten, die sie öfters orderten, dann würde er ihnen zwei zurücklegen. Die Verwirrung hinterher war dann nicht mehr ihr Problem. Mark hatte ein Prepaidhandy, das nicht nachzuverfolgen war. Aber mit dieser Aktion wollten sie sichergehen, dass für sie der Weg frei war. Also ging sie langsamer, schaute nicht auf die Uhr. Sie wartete einfach auf Fräulein Roswitha, die jeden Moment aus der Haustür kommen musste. Wenn nicht, dann nicht. Dann war der Plan gescheitert, bevor er noch recht begonnen hatte. Sie ging noch etwas langsamer. Aber auch jetzt durfte sie nicht auffallen. Wie langsam ging ein Mensch normalerweise, wenn er langsam gehen wollte. Wie langsam konnte sie gehen, ohne aufzufallen. Sie schaute kurz nach rechts auf die Haustür. Genau in diesem Moment kam Fräulein Roswitha heraus. Sie hatte es anscheinend nicht eilig. Fünf Minuten hatten sie kalkuliert. Sie würde nur vier Minuten brauchen. Es gab ein wenig Spielraum. Sie hofften auch darauf, dass die Bestellung ein wenig Gesprächsstoff liefern würde und damit auch mehr Zeit, zur Sicherheit. Für einen Moment hielt sie noch inne. Die folgenden vier Minuten liefen wie in einem Film vor ihrem inneren Auge ab. Sie würde mit ihrem Schlüssel ins Büro gelangen, dann durch das Vorzimmer in Huberts Büro hineingehen. Er wäre am Telefon, denn wenn Fräulein Roswitha nicht da war, stellte die Anlage direkt zu ihm durch. Mark würde ihn am Telefon beschäftigen. Hubert saß, so hatte es ihm die Innenarchitektin empfohlen, auf einer Diagonale mitten im Raum mit dem Gesicht zum Fenster. Er würde sie nicht bemerken.
Fünf Jahre später
Hatte sie sich das genau überlegt? War da ein Gedanke gewesen, sich so zu entscheiden? Kim Lorenz saß auf der Terrasse ihrer Wohnung in Gaienhofen und schaute mit kritischem Blick auf den unruhigen Bodensee hinaus. Genau so ging es ihr auch gerade. Unruhig war sie, ziemlich unruhig. Das kam immer wieder, ein leichtes Kribbeln im Bauch, dann in den Beinen und schließlich diese Gedanken. Aber was sollte sie auch anderes denken. Die Situation war nun mal da und sie hatte den Salat, wie man so sagte. Peter war drüben in der Schule und schlug sich mit seinen pubertierenden Zöglingen herum. Der hatte auch sein Päckchen zu tragen, das wusste sie wohl. Allerdings schleppte er nicht einen Bauch in der Größe eines Fußballs vor sich her.
Sie hatten sich dazu entschlossen, sie hatten sich ein Kind gewünscht. Die langen Abende mit den Gesprächen. Eine Zeit, eine schöne Zeit. Die Zeit der Vorfreude, der Erwartung. Sie hatte sich immer so viele Gedanken gemacht. Peter war da ganz anders. Für ihn war das ein weiterer Schritt ins Leben. Kind eben und fertig. Sie sah das nicht unbedingt so. Immerhin ging man doch den Schritt zur nächsten Generation. Das, was da dann kommen würde, wäre die Zukunft, irgendwie. So ging das doch weiter. So war Leben, eben. Sie musste lächeln. Vielleicht ein kleiner Espresso, das könnte nicht schaden. Ihre Ärztin hatte ihr das ausdrücklich hin und wieder erlaubt. Anscheinend war der Gehalt an Koffein längst nicht so hoch wie bei einer Tasse Kaffee. Sie wusste zwar wirklich nicht, warum, aber wenn es die Ärztin schon sagte, warum dann nicht. Immerhin hatte es ihr die letzten Monate nichts gemacht, und es tat ihr einfach gut, das war das Wichtigste.
Nun war sie im sechsten Monat. Ihr Chef wusste zwar von ihrer Schwangerschaft und war auch über den entsprechenden Fortschritt im Bilde, aber sie hatte inzwischen nichts mehr von ihm gehört. Hatte weitergemacht mit ihrer Arbeit, als ob nichts Neues passiert wäre. Aber innen drin, dort, im Bauchgefühl, spürte sie ganz genau, dass bald etwas passieren würde. Die würden sie doch als Kommissarin nicht einfach so weitermachen lassen. Die doch nicht. Das war doch der Staat, da gab es Verordnungen, Regeln, zur Not auch noch Gesetze. Die würden es schon schaffen, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Und dann? Hier, zu Hause, sitzen und auf das Kind warten, Weihnachten spielen, bis es einem zum Hals herauskam? Keinesfalls. Das hatte sie auch Peter schon gesagt. Das Telefon klingelte.
»Lorenz.«
»Michelmeier, Stuttgart. Sie wissen?«
»Ah, Herr Michelmeier, grüße Sie.«
»Tja, Frau Lorenz, ebenfalls, ebenfalls.«
»Sie wünschen, wir spielen!«
»Wie?«
»Ihr Anliegen?«
»Ach so, genau, richtig. Ich wollte mit Ihnen einen Termin vereinbaren. Wegen Ihrer Schwangerschaft, wissen Sie.«
»Warum?«
»Wie, warum?«
»Einfach warum. Was ist mit meiner Schwangerschaft?«
»Sie sind Kriminalhauptkommissarin, nicht wahr?«
»Stimmt.«
»Da ist es angebracht, zu einem entsprechenden Zeitpunkt darüber nachzudenken, was Sie noch machen können und was nicht, oder?«
»Sehe ich nicht so, aber bitte. Weiter.«
»Ich habe mir überlegt, Sie könnten doch in den nächsten Tagen in den Innendienst sozusagen übergehen und sich dort nützlich machen. Was meinen Sie?«
»Warum?«
»Frau Lorenz, ich bitte Sie! Ich brauche Ihnen wohl nicht zu erklären, dass meine bisherige Zurückhaltung lediglich ein Entgegenkommen meinerseits war. Es ist eigentlich nicht üblich, weibliche Mitarbeiter so lange im aktiven Dienst zu belassen. Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das nicht mehr vertreten kann. Also.«
»Wie, also?«
»Frau Lorenz. Sie wissen schon, dass dies nicht der übliche Weg ist, den die Dinge gehen. Ich habe Ihren Chef, Kriminalrat Mühleisen, angewiesen, Sie entsprechend einzusetzen. Wir haben hier ein Auge auf Sie, ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist. Ich habe einen sehr guten Eindruck von Ihrer Arbeit und habe mich deshalb an diesem Punkt eingemischt. Gut, es fiel dem Kollegen Mühleisen nicht leicht, Ihnen das schonend beizubringen, deshalb mach ich es. Sie werden sich also am kommenden Montag in Konstanz auf dem Präsidium einfinden und sich zum Innendienst melden. Dort wird sie Hauptmeister Brüderle entsprechend einweisen, damit Sie wissen, was zu tun ist. Haben wir uns verstanden?«
»Haben wir.«
»Also gut. Dann danke ich für Ihre Gesprächsbereitschaft und erwarte entsprechend Meldung am Montag, acht Uhr dreißig, Konstanz.«
»Verstanden. Auf Wiederhören.«
Sie setzte das Telefon auf die Station. So ging das also. Hatte sie das überrascht? Eigentlich nicht. Sie hatte schon mit Kolleginnen gesprochen, denen es auch so gegangen war. Auch in Filmen hatte sie schon gesehen, wie so was ablaufen konnte. Aber jetzt ging es ihr so. Jetzt ging es um ihr Leben und auch um ihre Arbeit, ihre Karriere. Ach was, Karriere. Das war ihr nun wirklich nicht das Wichtigste. Aber die Arbeit, draußen, die Wege, die Menschen, der kleine Kitzel, etwas herauszufinden, eine Spur zu verfolgen. Das war doch das, was für sie die Polizeiarbeit ausmachte. Deswegen war sie doch bei der Truppe.
Die Tür ging. Manchmal hatte das Leben sein eigenes Drehbuch, dachte sie. Kaum hatte der Kriminaldirektor aufgelegt, stand der eigene Mann in der Tür. Sie freute sich zwar, dass er heute schon ein wenig früher von der Schule nach Hause kam, aber für den Moment hätte sie sich noch ein bisschen Ruhe für sich selbst gewünscht.
»Hallo du. Und, telefoniert?«
»Hallo. Ja.«
»Soll ich wieder gehen?«
»Nein, bleib ruhig. Ich wollte eigentlich nur ein wenig nachdenken.«
»Ohne mich?«
»Vielleicht.«
»Verstehe. Wer hat angerufen?«
»Stuttgart.«
»Stuttgart?«
»Ja, echt.«
»Immerhin.«
»Stimmt.«
»Und dann also Stuttgart. Und, was meint Stuttgart?«
»Dass ich am Montagmorgen in Konstanz mit dem Innendienst anfange.«
»Sinnvoll, oder?«
»Sinnvoll vielleicht schon, aber ich, keine Lust!«
»Du weißt aber schon. Die Situation und so. Die können das doch nicht anders machen. Da gibt es Regelungen.«
Kim Lorenz setzte sich in ihren Sessel. Peter stellte sich hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern. Das war oft so, wenn sie wichtige Gespräche zu führen hatten. Sie hatten festgestellt, dass sie sich nicht unbedingt in die Augen sehen mussten und sie so am besten miteinander in Gesprächen klarkamen.
»Das weiß ich, natürlich gibt es das. Im Grunde genommen verstehe ich das auch. Nur nicht für mich. Da kann ich das nicht akzeptieren. Stell dir das doch mal vor. Ich in einem kleinen Büro über die Ohren mit Akten überhäuft. Dieser Staub dann auch noch, und …«
»Jetzt mach mal halblang. Zum einen geht es um ein paar Wochen, die du nun halt im Innendienst verbringen musst. Zum andern geht es darum, dass du mit unserem Kind im Bauch einfach keine Verbrecher jagen kannst und darfst. Verstehst du das?«
»Schon, irgendwie. Aber dann gleich Innendienst!«
»Was sollen sie denn sonst mit dir anfangen? Frag dich das mal. Willst du als Schülerlotse in deinem Zustand am Zebrastreifen stehen?«
Kim musste lachen. Auch Peter stimmte mit ein. Immerhin konnten sie über ihre Situation mit ein wenig Humor reden. Das tat schon mal gut. Kim stand auf, legte den Arm um Peters Hals und schaute ihm tief in die Augen.
»Aber du hast mich lieb, gell. Trotz meines Zustands?«
Er drückte sie ganz fest an sich und spürte das neue Leben, das sich vehement gegen seinen Bauch presste. Fast meinte er, Bewegungen des kleinen neuen Ichs zu spüren. Aber das bildete er sich wahrscheinlich ein, dachte er.
»Und wie ich dich lieb hab. Wie am ersten Tag, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch mehr, wer weiß.«
Kim schmunzelte. Es war gut, eine solche Schulter immer in der Nähe zu haben. Es klingelte an der Tür. Beide drehten ihre Köpfe dem Eingang zu.
»Das kann nur Max sein, kannst wetten!«, rief Peter.
»Stimmt. Aber vielleicht ist Julia auch dabei.
Peter ging zur Wohnungstür und riss sie mit Schwung auf. Max und Julia, die draußen auf der Treppe standen, schauten etwas überrascht.
»Na«, sagte Max, »fehlt es euch an Gesellschaft, oder was?«
Julia lachte laut los.
»Die junge Familie freut sich über Besuch, das lasse ich mir doch mal gefallen.«
»Schön, dass ihr vorbeischaut«, sagte Kim.
»Jetzt aber herein«, lud Peter die beiden Besucher ins Wohnzimmer.
Alle vier setzten sich auf Sofa und Sessel.
»Na, wie geht’s?«, fragte Julia in Kims Richtung.
»Nach mir fragt mal wieder niemand«, schmollte Peter.
»Es gibt Momente, mein Freund, da sind wir mehr als abgemeldet in dieser Angelegenheit. Wir spenden unseren Samen …«
»Unter Schmerzen«, führte Peter fort.
»… na ja. Du vielleicht, als ich …«
»Es reicht, die Herren!«, unterbrach Julia.
»Genau«, stimmte Kim zu, »nicht schon wieder die leidige Rolle des Mannes in dieser sogenannten Angelegenheit. Ich kann es wirklich nicht mehr hören!«
»Vielleicht ein Weizenbier?«, fragte Peter.
»Danke, ein Tee tut es auch«, antwortete Julia ungefragt.
»Wäre schön«, meldete sich nun Max.
Peter ging in die Küche zum Kühlschrank. Mit seinem zweiten Handgriff füllte er die Wasserkanne und suchte nach den Teebeuteln.
»Wie wäre es mit einem schönen Wohlfühl-Tee?«, rief er ins Wohnzimmer.
»Sehr gut, der Mann«, bestätigte Julia. Auch Kim nickte.
»Die werdende Mutter ist auch einverstanden«, rief Julia Peter in der Küche zu.
»Mein Tee darf ruhig ein bisschen Schaum haben«, bemerkte Max lapidar.
Peter kam aus der Küche zurück und stellte zwei gut gefüllte Weizenbiergläser auf den Couchtisch.
»Tee dauert noch einen Moment«, meinte er.
Julia und Max saßen auf dem Sofa. Max legte Julia seinen Arm um die Schulter. Die haben das alles hinter sich, dachte Peter, ihre Kinder waren schon groß, aus dem Haus, überall im Land und auf der Welt verstreut. Wie wird das einmal sein. Wenn Kim und er in einer Wohnung oder einem Haus sitzen werden und die Kinder gegangen waren.
»Wie geht es euch denn?«, fragte er, durchaus mit seinen eigenen Hintergedanken.
Max schaute auf, auch Julia wendete ihren Blick Peter zu.
»Gut«, sagte Max.
»Ganz gut«, meinte Julia mit leiser Stimme.
»Julia vermisst halt die Kinder«, erklärte Max.
»Es ist nicht mehr viel los bei uns«, sagte sie.
»Klar, das war abzusehen. Dann sagt man immer: Das wird einmal eine ruhige Zeit, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind. Von wegen. Ruhig schon. Aber es braucht schon einiges, sich daran wieder zu gewöhnen. Plötzlich ist es so ruhig. Keine nörgelnden Kinder, keine Jugendlichen, die an dir ihre Launen auslassen und dann doch zum Sport gefahren werden wollen. Das alles fehlt einem dann.«
»Aber sie kommen euch doch besuchen«, meinte Kim.
»Schon. Das ist auch immer toll. Aber du merkst plötzlich, dass da Leben weitergehen. Und du selbst bist nur noch ein kleiner Teil dieser Leben. Die suchen sich, orientieren sich, finden ihren Platz im Leben.«
»Stimmt schon«, sagte Max, »es ist ein wenig Neid dabei, glaube ich. Manchmal denkt man einfach über sein eigenes Leben nach. Welche Möglichkeiten man hatte, vielleicht gehabt hätte. Welche Wege man hätte gehen können, und so weiter. Das ist nicht leicht. Es ist wie ein Licht, das sich auf die eigene Vergangenheit wirft. Ein Licht, das nachdenklich macht.«
Peter schaute die beiden an, wie sie da einträchtig auf dem Sofa saßen. Ein vertrauter Anblick. Ein Anblick, der es ihm warm ums Herz werden ließ. Wie lange kannte er die beiden schon? Gefühlt ein halbes Leben. Schließlich hatten Max und er sich schon im Studium kennengelernt. Dort hatte Max auch Julia getroffen und sich in sie verliebt. Wie lange sie wohl schon zusammen waren, fragte er sich. Immerhin war ihre älteste Tochter schon zwei- oder dreiundzwanzig.
Kim kuschelte sich in ihren Sessel und zog soweit sie konnte die Beine hoch. Über ihre Knie hinweg schaute sie Max und Julia an. Irgendwie war es seltsam, nun ein Kind zu erwarten, wenn bei den beiden das Thema Kind fast erledigt war. Schade eigentlich, dachte sie. Wie gerne hätte sie mit Julia hinter dem Kinderwagen ihre Runden gedreht. Aber vielleicht würde sich das auch so ergeben.
»Und, wie geht es bei dir weiter, Kim?«, fragte Max.
»Genau. Du kannst doch mit diesem Bäuchlein nun wahrlich keine Verbrecher jagen, oder?«, setzte Julia hinzu.
Peter stellte sich hinter die beiden und legte ihnen seine Hände auf die Schultern.
»Die Frau Hauptkommissarin soll sich in den Innendienst zurückziehen. Das schmeckt ihr gar nicht!«, meinte Peter lächelnd.
»Na und«, kam es von Julia mit einem leichten kritischen Unterton, »verstehst du das etwa nicht?«
Verunsichert zog Peter seine Hände zurück.
»Echt?«, fragte Max.
Kim schmunzelte innerlich. Endlich, endlich. Menschen, die sie verstanden, die wussten, was das für sie bedeutete.
»Schon«, sagte Peter leise.
»Also, wie geht es dir dabei?«
Max wollte nun endlich Klarheit. Er liebte lange Redereien, aber an manchen Punkten wollte er wissen, was nun Sache war.
»Sagen wir mal so«, setzte Kim an, »es ist halt nicht einfach. Ich war die letzten Jahre immer dort draußen, mal mehr, mal weniger. Mich jetzt in ein Büro zu setzen und Akten zu wälzen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, echt nicht!«
»Verstehe ich voll«, meinte Julia.
»Klar«, kam es von Max.
»Schon«, sagte Peter.
»Aber ich weiß auch, dass ich ein neues Leben in mir trage und damit eine gute Portion Verantwortung. Das heißt auch, dass ich zu Vielem bereit bin. Aber ich kann es mir überhaupt noch nicht vorstellen.«
»Seh es doch mal so«, versuchte sich nun Julia, »vielleicht hast du dadurch ein wenig mehr Zeit für anderes. Für dich, für das Kind oder vielleicht die Flüchtlingsarbeit. Wir machen das nun schon eine ganze Zeit, und ich muss wirklich sagen, es hilft über Kinder, die nicht mehr da sind, oder die noch nicht geboren sind, wie soll ich sagen, hinweg.«
Sie sah Kim mit einem schmunzelnden Lächeln an.
»Flüchtlingsarbeit?«
»Warum denn nicht«, sagte Max, »wenn du wieder mehr hier bist, dann kannst du uns da wirklich helfen. Du kennst dich doch aus mit den Institutionen, Ämtergängen, Personaldokumenten und so weiter. Das ist doch …«
»Papierkram!«
»Stimmt, aber sinnvoll. Du hilfst Menschen.«
»Da hat Max vollkommen recht. Warum solltest du deine Fähigkeiten nicht auch bei uns einbringen«, wandte Julia ein.
Kim schaute sich um. Eine Welt wurde kleiner. Ihre Welt. Anscheinend hatten die Menschen, auf die sie gehofft hatte, keine Ahnung von ihrer Freiheit, ihrer Luft, die sie zum Atmen brauchte. Sie konnte kein Büro in Konstanz für ein Büro in Gaienhofen eintauschen. Was Julia und Max da machten, in der Flüchtlingsarbeit, war aller Ehren wert. Sie fand das toll und war stolz darauf, solche Menschen zu Freunden zu haben. Aber als Ersatz für ihre Arbeit dort draußen war das einfach zu wenig.
»Wird interessant, wie es weitergeht. Jetzt, nach dieser Wahl«, sagte Peter.
»Es ist links nichts mehr los. Diese Zeiten sind vorbei«, meinte Max.
»Das von dir, dem Altlinken, fast Achtundsechziger?«, fragte Kim.
»Vielleicht ein wenig provokant. Aber ich sehe schon die Änderung. Wir haben es ihnen zu leicht gemacht. Alles purzelte über uns herein. Versteht mich richtig, über die anderen auch. Aber wir mussten nach vorwärts, wir wollten vorne sein. Aber wir haben uns nur inhaltlich ausgehöhlt, sind leer geworden. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn man ein solches Ergebnis bekommt.«
Max hatte fast feuchte Augen. Peter bedauerte es beinahe, dieses Thema angesprochen zu haben. Aber es musste sein, dachte er.
»Die alte Tante SPD. Nun hat sie abgewirtschaftet. Vorbei, der sozialdemokratische Traum.«
Julia sagte es leise. Sie wusste um Max’ Empfindlichkeit. Sie hatte ihm aber auch immer wieder gesagt, so ginge es nicht. Und er. Hatte gehofft. Und Gerechtigkeit und wir und Schulz. Und jetzt?
»Wo seid ihr?«, fragte Peter.
»Gute Frage«, antwortete Max, »ich weiß es nicht. Ist ein Sozialismus in einer humanen Form möglich? Muss, soll ich mir darüber Gedanken machen? Sind wir nur noch postengeile Figuren? Sind sie das? Soll das alles sein, was bleiben könnte? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir sagen. Ich hatte Hoffnung im Frühjahr mit: Gerechtigkeit! Aber wenn dann nichts mehr kommt, dann ist es eben aus. Dann kann ich nur einen Titel einer Linken zitieren: Wohin denn wir.«
Komisch, dachte Kim. Max war sonst keiner, der so schnell die Flinte ins Korn warf. Aber jetzt, auf einmal. Wie erklärte sich das, fragte sie sich. War es eine zu lange Zeit in der Großen Koalition gewesen oder hatte Max an eine Sache geglaubt, die schon längst nicht mehr seine war?
»War die richtige Entscheidung von Schulz, in die Opposition zu gehen, oder?«
»Ich sehe die Opposition nicht als Allheilmittel. Es war klar, dass eine weitere Große Koalition uns schließlich den Rest kosten würde. Aber inwieweit sich diese Partei in der Opposition erneuern kann, das wage ich denn doch zu bezweifeln.«
»Ich glaube, Max hat da recht«, meinte Julia, »dieser Partei fehlen die richtigen Köpfe, die Denkerinnen und Denker!«
»Stimmt schon«, bestätigte Kim.
»Und, was macht dein Krimi?«, fragte Julia in Richtung Peter.
»Ach, mein Krimi. Tja. Immerhin habe ich schon einen guten Titel gefunden, denke ich: Hopfentod. Was denkt ihr?«
Max nickte nur mit dem Kopf. Julia strahlte über das ganze Gesicht.
»Toll!«, sagte sie, »richtig gut. Tettnang, Hopfen, Hopfentod. Das passt doch prima!«
»Finde ich auch«, meinte Kim, »allerdings ist mir die Geschichte ein wenig zu nahe an der Wirklichkeit.«
»Wie, zu nahe?«, fragte Max.
»Sie meint, es sei zu nahe an ihrem eigentlichen Fall dran. Ich hab natürlich die Fakten so genommen, wie sie waren …«
»Und eigentlich hast du dir wenig dazu einfallen lassen«, bemerkte Kim schnodderig.
»Bloß weil der Fall doch so gut war«, verteidigte sich Peter.
Max stand auf, ging zu Kim hinüber und legte ihr den Arm um die Schulter.
»Vielleicht war das halt so ein Fall, wo man überhaupt nichts dazuspinnen muss? Kann das sein?«
»Vielleicht schon«, gab Kim zu, »es war wenig klar und die verschiedenen Täter haben sich mehr oder weniger selbst gerichtet. Das stimmt schon. Aber trotzdem, es gefällt mir nicht, nun in einem Krimi die Hauptrolle zu spielen!«
»Da sind wir dann an des Pudels Kern«, setzte Max nach, »das ist ein anderes Thema. Verstehe ich, verstehe ich gut. Da sollte der Krimischreiber vielleicht ein wenig weg von der Wirklichkeit gehen. Oder?«
Max schaute Peter an. Peter sah ein wenig betroffen zu Boden.
»Vielleicht«, sagte er.
»Na, das wird doch nicht so schwer sein«, meinte Julia.
»Ich möchte das aber!«, sagte Kim entrüstet, »ich brauche keinen Watson, der meine Fälle aufschreibt.«
Max lachte. Das Thema amüsierte ihn. Im Grunde genommen gefiel es Kim schon, dass sich Peter für ihre Arbeit und eben nun für ihren ersten großen Fall interessierte. Sie war sich wohl nur nicht so recht ihrer Rolle als Hauptkommissarin dabei bewusst. Schließlich war dieser Fall in etwa ausgegangen wie das Hornberger Schießen.
»Fühlt sich die Frau Hauptkommissarin ein wenig auf den nicht vorhandenen Schlips getreten, oder was?«
Kim schaute den Freund erstaunt an. Irgendwie schaffte es dieser Max immer wieder, ihre eigentlichen Gedanken zu erraten. Denn es war tatsächlich so. Dieser Fall war nun wirklich kein Ruhmesblatt für eine junge Hauptkommissarin. Drei mögliche Täter, einer hängt sich auf, der zweite kommt bei der Flucht ums Leben, und nur die dritte Täterin überlebt. Kim dachte an die Frau des Hopfenbauern, die bei dessen Tod auch irgendwie beteiligt gewesen war. Sie hatte es nie genau herausgefunden, welchen Anteil die Ehefrau an der Tat gehabt hatte und konnte sie deshalb auch nicht verhaften und anklagen. Es stimmte schon, in diesem Sinne war ihr nicht ganz wohl bei dem Gedanken, gerade diesen Fall in einem Buch ihres Freundes und dem Vater ihres Kindes zu lesen. Aber sie musste zugeben, Hopfentod, das war tatsächlich ein sehr brauchbarer Titel für diesen Fall. Irgendwann würde sie vielleicht wieder nach Tettnang kommen und sich nach der Frau erkundigen. Irgendwann, wenn sie mal wieder unterwegs sein durfte, dem Verbrechen auf der Spur. Kim lachte nun auch.
»Touché, Max, du hast mal wieder meine Gedanken erraten. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber vielleicht bist du an der Schule in Gaienhofen nicht unbedingt am richtigen Platz. Du solltest auf die Bühne, Gedanken lesen. Wäre doch eine Idee!«