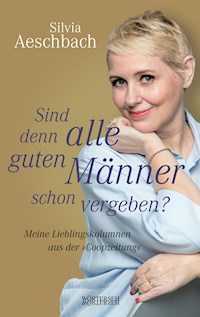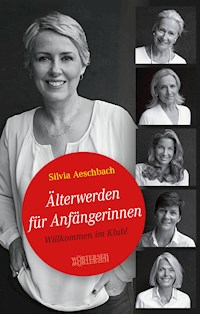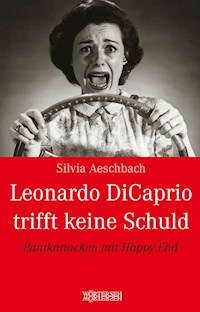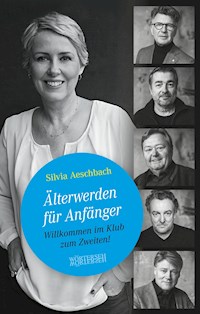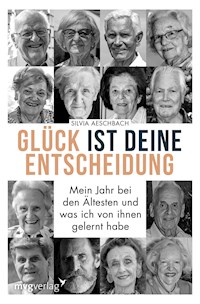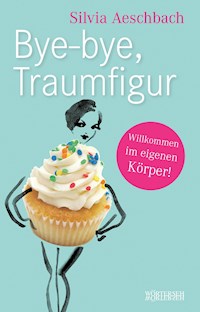
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin und Bestsellerautorin Silvia Aeschbach war schon als Teenager überzeugt, dass ihre Rundungen ein Irrtum der Natur seien. Und dass sie diese mit allen möglichen und unmöglichen Maßnahmen korrigieren, um nicht zu sagen, bekämpfen müsse. Doch die Ergebnisse ihres Strebens nach der "idealen" Figur zeigten sich nie so, wie sie sich das gewünscht hatte. Heute – mit über fünfzig – sagt sie: "Meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist, fällt mir noch immer nicht ganz leicht, aber ich habe einen Waffenstillstand mit mir vereinbart: Keine Diäten mehr, keine Workouts mehr, bei denen ich meine Grenzen überschreite, keine Selbstgeißelungen!" In ihrem Buch schaut sie zurück auf dreißig Jahre Kurvenkrieg, beleuchtet die Frage, ob Frauen heute, auch was ihren Körper betrifft, selbstbewusster geworden sind, und kommt zur Erkenntnis, dass nach wie vor viel zu viel kritisiert, korrigiert und optimiert wird. Dagegen – und davon ist sie überzeugt – gibt es ein einfaches Rezept: einen Gang runterschalten, den Wunsch nach einer androgynen Modelfigur in den Himmel schießen und sich mit dem, was ist, aussöhnen. Ihren beschwerlichen, abenteuerlichen und mitunter auch skurrilen Weg zu mehr Selbstakzeptanz, vor allem aber zu mehr Gelassenheit beschreibt sie offen, unterhaltsam und köstlich selbstironisch. Und sie meint: "Ich hoffe, dass sich viele Frauen in meinen Geschichten wiedererkennen können. Denn egal, ob kurvig, rund, füllig oder dünn: Zu meckern gibts ja immer was."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 bis 2020 unterstützt und dankt herzlich dafür.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2018 Wörterseh, Gockhausen
Lektorat: Lydia Zeller, ZürichKorrektorat: Brigitte Matern, KonstanzProjektleitung: Andrea Leuthold, ZürichIllustrationen Umschlag und Cupcakes im Buch: Claudia Klein, München, www.claudiaklein.netUmschlaggestaltung: Thomas Jarzina, HolzkirchenLayout und Satz: Beate Simson, Pfaffenhofen a. d. RothDruck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Print ISBN 978-3-03763-098-3E-Book ISBN 978-3-03763-749-4
www.woerterseh.ch
»Wo immer du hingehst, ich bin bei dir.«
»Wir sollten einfach alle etwas liebevoller mit uns umgehen.«
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Mein Ideal bin ich
Mägerlimuck
Die verhasste Miederhose
Einsteigen zur Fahrt auf der Achterbahn, bitte!
Der Weg zur Hölle ist mit Diäten gepflastert
Die Top 7 meiner Diäten
»Segelohren« vs. »Traumbusen«
So ein Quark!
Noch mehr Quark
»Zu jung«, »zu alt«, »zu dick«: Frauen sind immer etwas »zu« …
Zu peinlich: Madonna
Zu dick: Rihanna
Zu normal: Adele
Erfinde dich neu!
Bauch voll, Herz leer
Daves Liste
Und erstens kommt es anders …
Abschied von der Traumfigur
Sara Barcos, interviewt von Silvia Aeschbach»Wir haben es verlernt, auf unsere körperlichen Bedürfnisse zu hören«
Silvia Aeschbach, geb. 1960, ist Journalistin. Sie arbeitete bei einem Lokalradio, beim Schweizer Fernsehen und bei verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen. Sie war in leitenden Positionen beim Nachrichtenmagazin »Facts«, beim Frauenmagazin »Meyer’s«, beim »Blick« und für die deutschsprachige Ausgabe des Lifestyle-Magazins »Encore!« der »Sonntags-Zeitung« tätig. Heute schreibt sie unter anderem für das Onlineportal des »Tages-Anzeigers« den erfolgreichen Blog »Von Kopf bis Fuss« sowie Kolumnen für die »Coopzeitung«. Bei Wörterseh erschienen von ihr nach ihrem Buch »Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld«, in dem sie ihren Umgang mit Panikattacken beschreibt, die zwei weiteren Bestseller »Älterwerden für Anfängerinnen« und »Älterwerden für Anfänger«. Silvia Aeschbach ist verheiratet und lebt in Zürich.
Die Journalistin und Bestsellerautorin Silvia Aeschbach war schon als Teenager überzeugt, dass ihre Rundungen ein Irrtum der Natur seien. Und dass sie diese mit allen möglichen und unmöglichen Maßnahmen korrigieren, um nicht zu sagen, bekämpfen müsse. Doch die Ergebnisse ihres Strebens nach der »idealen« Figur zeigten sich nie so, wie sie sich das gewünscht hatte. Heute – mit über fünfzig – sagt sie: »Meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist, fällt mir noch immer nicht ganz leicht, aber ich habe einen Waffenstillstand mit mir vereinbart: Keine Diäten mehr, keine Workouts mehr, bei denen ich meine Grenzen überschreite, keine Selbstgeißelungen!« In ihrem Buch schaut sie zurück auf dreißig Jahre Kurvenkrieg, beleuchtet die Frage, ob Frauen heute, auch was ihren Körper betrifft, selbstbewusster geworden sind, und kommt zur Erkenntnis, dass nach wie vor viel zu viel kritisiert, korrigiert und optimiert wird. Dagegen – und davon ist sie überzeugt – gibt es ein einfaches Rezept: einen Gang runterschalten, den Wunsch nach einer androgynen Modelfigur in den Himmel schießen und sich mit dem, was ist, aussöhnen. Ihren beschwerlichen, abenteuerlichen und mitunter auch skurrilen Weg zu mehr Selbstakzeptanz, vor allem aber zu mehr Gelassenheit beschreibt sie offen, unterhaltsam und köstlich selbstironisch. Und sie meint: »Ich hoffe, dass sich viele Frauen in meinen Geschichten wiedererkennen können. Denn egal, ob kurvig, rund, füllig oder dünn: Zu meckern gibts ja immer was.«
Obwohl heute allgemein bekannt ist, dass die scheinbar so attraktiven Stars und Models in den Magazinen oder auf Instagram und Co. mithilfe von Photoshop geschönt sind, streben viele Frauen – und zwar längst nicht nur junge – dieses völlig unrealistische Körperbild an. Um es zu erreichen, ist ihnen fast jedes Mittel recht, seien es ungesunde Diäten, Fastenkuren oder Schönheitsoperationen. Das ist doch Wahnsinn!
Sara Barcos, Ernährungspsychologische Beraterin, im Interview mit Silvia Aeschbach
Ein paar Dellen im Oberschenkel sind plötzlich wichtiger als ein abgeschlossenes Studium. Der vermeintlich zu kleine Busen ist schuld daran, dass der Freund abgehauen ist. Und was zählt der Erfolg im Job, wenn die Kollegin in ihren Jeans einfach hundertmal besser aussieht? Wir alle – oder mindestens fast alle – kennen das: Ein Blick in den Spiegel genügt, um einem das ganze Selbstbewusstsein zu rauben.
Das Rezept dagegen ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich. Doch es ist unglaublich schwierig, es umzusetzen. Das Rezept heißt Selbstakzeptanz. Das Ziel ist, Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Was einfach klingen mag, ist für die meisten Frauen ein Weg, der mit Schmerzen und Verletzungen verbunden ist. Warum das so ist, wollte ich mithilfe meiner eigenen Geschichte herausfinden, die stellvertretend für viele andere steht. Ich führte Gespräche mit Mädchen und Frauen, in deren Verlauf es durchaus einiges zu lachen gab, aber auch Tränen flossen. Ich interviewte verschiedene Expertinnen und Experten, recherchierte viel und studierte gesellschaftliche Entwicklungen und Trends.
Dabei bin ich immer wieder auf einen eklatanten Widerspruch gestoßen. Einerseits leisten Frauen viel in Beziehungen, in der Familie und im Beruf, sind erfolgreich, beweisen Stärke und nehmen Herausforderungen an. Aber all dieses Selbstbewusstsein verpufft, wenn sie in den Spiegel schauen.
Traurig, aber wahr: Noch nie zuvor waren Frauen so unzufrieden mit ihrem Körper wie heute. Das ist das Ergebnis einer Studie der US-Zeitschrift »Glamour«, bei der tausend Frauen zum Verhältnis zu ihrem Körper befragt wurden. 80 Prozent gaben an, dass sie sich nach dem Blick in den Spiegel schlecht fühlten, 54 Prozent sagten, dass sie unglücklich über ihren Körper seien. Eine besorgniserregende Entwicklung. Bei einer identischen Umfrage vor dreißig Jahren hatten »nur« 43 Prozent der Befragten angegeben, sich mit ihrem Körper nicht wohlzufühlen.
Wenn es also um Selbstliebe oder Selbstakzeptanz geht, werden aus intelligenten und selbstbewussten Mädchen und Frauen Opfer. Opfer, die an den eigenen überzogenen Vorstellungen und Idealen verzweifeln, wie sie uns heute auf allen Kanälen eingeimpft werden. Und die sich mit Selbstvorwürfen oder gar Selbsthass quälen und immer häufiger Essstörungen entwickeln. Oft passiert dies im Geheimen, und selbst die Familie oder die Freunde wissen nichts von diesen dunklen Seiten.
Doch seit wenigen Jahren gibt es einen weltweiten Trend, der Mädchen und Frauen ermutigen will, zum eigenen Körper zu stehen, selbst wenn dieser nicht den gängigen Schönheitsnormen entspricht. Als ich im Herbst 2017 dieses Buch zu schreiben begann, war die sogenannte Body-Positivity-Bewegung auf einem Höhepunkt. Deren Botschaft lautet: Ob groß oder klein, dick oder dünn, mager oder üppig, sommersprossig oder dunkelhäutig, mit oder ohne Körperhärchen, Tattoos oder Orangenhaut – jeder Körper ist einzigartig und verdient es, geschätzt und geliebt zu werden.
Diese Kampagne zielt darauf ab, ein vielfältigeres Frauenbild zu zelebrieren als jenes, das uns von der Werbe- und Modeindustrie seit Jahrzehnten diktiert wird. Der Widerstand gegen dieses Schönheitsideal begann in den USA, wo Autorinnen und Schauspielerinnen eine klare Message verbreiteten: Schönheit ist keine Frage von Standards und Schablonen.
Vor allem im Internet formierten sich Aktivistinnen. Mode-Bloggerinnen hörten auf, ihre Bilder mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop zu schönen. Und plötzlich gab es nicht mehr nur dünne, also sogenannte Size-Zero-Influencerinnen, sondern auch üppige Plus-Size-Models galten als sexy. Die Modeindustrie reagierte prompt auf den Wunsch nach mehr Diversität und produzierte zunehmend coole Kleider auch in großen Größen. Dies allerdings nicht aus reiner Menschenliebe, sondern weil man erkannt hatte, dass hier ein lang vernachlässigter Markt brachlag.
Natürlich ist die Body-Positivity-Bewegung prinzipiell eine gute Sache, weil sie Toleranz schaffen will und dies in vielen Bereichen auch geschafft hat. Aber, und das ist die Krux, schauen wir selber in den Spiegel, dann sind es trotzdem wieder diese Idealvorstellungen, mit denen wir uns vergleichen. Und denen gegenüber wir natürlich schlecht abschneiden.
Es wäre zu einfach, ausschließlich gesellschaftliche Entwicklungen, Medien oder die Mode dafür verantwortlich zu machen, dass immer mehr Mädchen und Frauen mit sich und ihrem Äußeren unzufrieden sind und sich Essstörungen häufen. Denn die Ursachen für Unsicherheiten, Selbstzweifel und Ängste liegen viel tiefer: in der Unfähigkeit, sich selbst anzunehmen und letztlich zu lieben. Solche Prägungen zu erkennen, die oft schon in der Kindheit und Jugend entstanden sind, ist unglaublich schwierig. Und noch schwieriger ist es, sie zu verändern. Denn es fällt uns Frauen bekanntlich leichter, Selbstkritik zu üben, als uns zu loben.
Und immer wieder fallen wir in alte Muster zurück. Obwohl wir längst wissen, dass Diäten langfristig nichts bringen, kaufen wir Frauenmagazine, die solche propagieren. Obwohl wir längst wissen, dass praktisch jedes veröffentlichte Bild eines Models künstlich geschönt wurde, vergleichen wir uns mit ihnen. Und weil wir diszipliniert sind und keine Versagerinnen, quälen wir uns im Fitnessstudio und geben die Hoffnung nicht auf, im nächsten Sommer endlich die ideale Bikinifigur feiern zu können. Doch je länger wir gegen den eigenen Körper kämpfen und unerreichbaren Idealen nachjagen, desto unglücklicher und frustrierter werden wir. Wir können uns noch Hunderte Male sagen: Du bist schön, wie du bist. Ewas in uns antwortet: Was für eine Lüge! Schau dich doch an! Deine Beine sind zu dick, der Bauch zu schwabbelig, und erst der Po!
In den letzten Jahrzehnten variierte die Vorstellung, wie ein idealer Frauenkörper auszusehen hat, nur wenig. Durfte dieser in den 1950er-Jahren noch über ausladende Kurven, natürlich an den richtigen Stellen, verfügen, galt spätestens mit dem Einzug der 1960er und mit dem Auftauchen von Magermodel Twiggy die Devise: Frau kann nicht dünn genug sein.
Natürlich waren, je nach dem gängigen Modetrend, mal ein bisschen mehr Busen oder breitere Schultern gefragt, allerdings immer in Verbindung mit schmalen Hüften. Diese idealen Formen schienen der Garant für private und berufliche Erfolge zu sein. Im Gegensatz dazu wurden fülligen oder gar dicken Frauen schnell einmal Maßlosigkeit und Schlamperei nachgesagt.
Eines der Aushängeschilder von Body Positivity ist Ashley Graham, das derzeit berühmteste Plus-Size-Model. Sie zierte 2016 erstmals als kurvige Frau die Bademoden-Ausgabe des Magazins »Sports Illustrated«, ganz im Widerspruch zum Magerideal der Branche. Das US-amerikanische Model inszeniert sich medienwirksam auf allen Kanälen, steht auf den Titelseiten der wichtigsten Magazine und scheut sich auch nicht, ihre offensichtliche Cellulite zu präsentieren.
Für diese ehrliche Darstellung ihres Körpers lieben sie vor allem ihre weiblichen Fans. Endlich mal eine Frau mit ausgeprägten Rundungen, die sich selbstbewusst und erotisch inszeniert. Allerdings, und das muss auch gesagt werden: Graham ist keine durchschnittliche füllige Frau. Sie hat ein engelsgleiches Gesicht, und die ausladenden Kurven befinden sich an den »richtigen« Stellen. Und sie ist in der Fashion-Welt immer noch eine Ausnahme: Laut dem Diversity-Report des Online-Magazins »The Fashion Spot« vom Frühjahr 2017 trugen von den 2973 Models, die sich an den Fashion-Shows in New York auf dem Laufsteg präsentierten, gerade mal 16 Plus-Size-Größen. In Europa waren es noch weniger. Wer also glaubt, dass Frauen wie Ashley Graham den Catwalk revolutionieren könnten, irrt. Solange jene Designer das Sagen haben, die der Meinung sind, dass exklusive Mode an großen und dünnen Frauen einfach am besten aussieht, wird das wohl so bleiben.
Es tut vielen Frauen sicher gut, Ashley Grahams Botschaft »I love myself« zu hören, die sie fast mantrahaft wiederholt. Aber neben diesem Selbstbewusstsein – oder vielleicht besser: dieser Selbstverliebtheit – hat Graham, die sich selber als Bodyaktivistin und »beauty beyond size« bezeichnet, auch die Zeichen der Zeit erkannt: Sie betreibt ein hervorragendes Selbstmarketing. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, denn sich zu einer Marke zu machen, ist auf alle Fälle intelligenter und lukrativer, als »nur« ein erfolgreiches Model zu sein. Warum aber muss bei ihr immer wieder betont werden, dass das »Plus Size« ist? Was spricht dagegen, alle Frauen, die Kleider, Unterwäsche oder Beauty-Produkte präsentieren, einfach nur »Model« zu nennen?
Leider wird auch ein gegenteiliger Trend, nämlich jener zur Selbstoptimierung, immer stärker – welche Auswirkungen dieser auf Mädchen und junge Frauen hat, ist noch gar nicht abzusehen. Auf den sozialen Kanälen wie Instagram ist fast ausschließlich (gefilterte) Perfektion gefragt. Dort präsentieren gekonnt geschminkte, überschlanke Influencerinnen mit wallenden langen Haaren, schmalem Näschen und geschürztem Schmollmund die neusten Mode- und Beauty-Trends, und zwar bevorzugt in schöner und edler Umgebung.
Im Gegensatz zu internationalen Stars und Sternchen ist es diesen neuen Idolen wichtig, für ihre jungen Fans eine gewisse Nahbarkeit auszustrahlen und Identifikation zu ermöglichen. Ihre Botschaft: Mit überzeugendem Aussehen und Style steht dir die Welt offen! Natürlich gibt es auch in den sozialen Medien immer mehr Frauen, die sich gegen diese Darstellungen wehren und dafür auch Applaus bekommen, aber es sind und bleiben Einzelfälle.
Für mich war der Weg zur Akzeptanz meines Körpers lang, abenteuerlich, kurvenreich, mühevoll – aber auch voller überraschender Erlebnisse. Und ich musste manche meiner Überzeugungen revidieren, wie zum Beispiel die, dass Schlanksein glücklich macht. Das Gegenteil war oft der Fall – Dünnsein hängt bei mir mit Depressionen zusammen. Oder die Vorstellung, dass die meisten Männer nur sehr schlanke Frauen mögen. Oder dass ich nur schlank leistungsfähig bin. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern.
Heute bin ich weder dick noch dünn. Ich schwanke zwischen den Kleidergrößen 40 und 42 und verkörpere so eine gewisse Normalität. Doch auch wenn ich äußerlich gewissermaßen der Norm entspreche, weiß ich inzwischen: Ich bin einzigartig, weil es keine zweite solche Silvia gibt. Und je älter ich werde, umso mehr schätze ich meinen Körper mit allem, was dran ist (und das ist nicht wenig). Ich achte ihn, versuche, ihm hin und wieder Gutes zu tun. Schließlich ist er mein treuster Begleiter, vom ersten bis zum letzten Atemzug.
Weil ich mich nicht mehr konstant mit meiner Figur beschäftige, habe ich mehr Zeit dafür, einfach zu leben. Und ich weiß jetzt nicht mehr nur über den Intellekt, sondern auch mein (wohlgerundeter) Bauch sagt es mir: Ein gutes Körpergefühl kann ich nur erreichen, wenn ich mich selber mag. Dazu gehört, dass ich mich nicht dauernd mit anderen vergleiche und dass ich nicht versuche, ständig zu gefallen. Und das Wichtigste: Wenn ich an mir selber oder an meinem (zu dicken) Po zweifle und wieder in alte Verhaltensmuster falle, verurteile ich mich nicht sofort, sondern lasse auch mal Milde walten. Gemäß meiner Lieblingsweisheit von Samuel Beckett: »Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.«
In meinem Fall bedeutet das: Ich falle wenigstens weich.
Ich war ein dünnes Kind. Nicht schlank, hoch aufgeschossen oder zartgliedrig, wie man es etwas schmeichelhafter umschreiben könnte. Nein, ich war mager, mit knochigen Kniegelenken, schmalen Schultern und einem Gesicht, das nur aus Augen zu bestehen schien – ein richtiger Mägerlimuck also.
Meine Mutter musste sich oft den Vorwurf gefallen lassen, sie gebe mir wohl zu wenig zu essen, das kleinste Lüftchen könne mich ja umblasen. Aber dies stimmte natürlich nicht, im Gegenteil: Obwohl sie keine begnadete Köchin war, unternahm meine Mutter vieles, um mir das Essen schmackhafter zu machen. Mit mäßigem Erfolg. Das Einzige, was ich goutierte, waren Butter- oder Honigbrötli, Joghurt, gekochter Reis, Kartoffelstock mit »Sößeli« und Spaghetti mit Hero-Sugo. Und jeden Morgen trank ich ein großes Glas warme Milch mit Ovomaltine.
Gemüse, Früchte – mit Ausnahme von Bananen –, Käse, Fleisch oder Fisch rührte ich nicht an. Und selbst Dinge, die Kids sonst lieben, wie Pommes frites, Schnitzel, Fleischkäse, Milchreis mit Zimt oder Pudding, schmeckten mir nicht.
Als Baby hatte ich noch mit »Pfuusbagge« und Knuddelärmchen bezaubert, aber irgendwann als kleines Mädchen wurde ich zu einer »schwierigen Esserin«. Ich erinnere mich noch gut, wie ich auf dem Schoß meiner Mutter saß und sie mich mit einem Brei füttern wollte, der mir nicht schmeckte, und wie ich ihn in hohem Bogen ausspuckte. Ich erinnere mich genau an meinen Widerstand dagegen, runterschlucken zu müssen. Und auch an den Ärger meiner Mutter, als die »Pampe« auf ihrer hellblauen Bluse landete. Aber auch an die Zufriedenheit, die ich bei dieser Aktion empfunden hatte.
Wenn ich später von diesem Erlebnis erzählte, wollte mir niemand glauben, dass ich mich noch so genau daran erinnern konnte, war ich doch damals nicht viel älter als zwei. Aber ich habe die Gabe, Ereignisse bildhaft abspeichern zu können. So weiß ich zum Beispiel noch genau, wie man mir als Kleinkind einmal ein Klistier verabreichen wollte, wie ich mich wehrte und dabei vom Wickeltisch auf den Steinboden fiel. Und so habe ich auch die Bilder vor Augen, wie meine Mutter und ich vor dem großen Fenster im Kinderzimmer saßen und sie mich füttern wollte. Sie trug die Perlenkette, die ich so gern berührte, weil sie sich schön glatt und kühl anfühlte. Ich höre noch immer ihre sanfte Bitte: »Iss noch ein Löffeli. Eines für mich. Eines für Papi. Und noch eines für Jeannette« – das ist meine Schwester.
Und dann spuckte ich.
Ich blieb auch in den nächsten Jahren ein dünnes, kränkliches Kind, und nach einer misslungenen Mandeloperation wäre ich beinahe gestorben. Nach dieser Nacht, in der ich mit hohem Fieber Blut hustete, war es dann ganz vorbei mit dem Essen. Meine Mutter gab sich in der Folge noch mehr Mühe, mich mit Apfelmus, Haferbrei und cremigen Süppchen aufzupäppeln. Ein sinnloses Unterfangen, aber zum Glück gab es ja noch die geliebte Vanilleglace, die sich angenehm kühlend in meinem Rachen verteilte und mich doch noch mit ein paar Kalorien versorgte. Ich bin überzeugt, dass in dieser Zeit meine Liebe zu allem Süßen zementiert wurde.
Heute ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Vanille, egal, ob man sie riecht oder isst, ein wahrer Seelentröster ist und das körperliche Wohlbefinden stärken kann. In Vanille sind nämlich über vierzig verschiedene Aromastoffe enthalten, die direkt auf unser Gefühlszentrum wirken und so einen positiven Effekt bei Depressionen und Angsterkrankungen haben können.
Wie sehr meine damalige seelische Befindlichkeit mit meinem Essverhalten zu tun hatte, ist heute schwer zu ergründen. Tatsache ist, ich war ein überbehütetes Kind, das vor Neuem und Unbekanntem Angst hatte. Und seit ich denken kann, verfolgten mich große Verlustängste. Meine Mutter hatte vor mir mehrere Fehlgeburten. Als ich auf die Welt kam, war sie bereits 47-jährig, und mir wurde von meiner älteren, eifersüchtigen Schwester Jeannette oft gesagt, ich müsse besonders lieb sein, da sie schon bald sterben könnte, wenn ich nicht folgsam sei.
Ich habe mich oft gefragt, ob ich wegen dieser steten Ängste womöglich an einer kindlichen Depression gelitten hatte. Ich kann mich auch an ein seltsames und beängstigendes Gefühl innerer Leere erinnern und an eine Traurigkeit, die ich fühlte, wenn es dunkel wurde. Damit ich einschlafen konnte, musste immer mindestens ein Licht brennen. Die Angst vor Dunkelheit blieb auch, als ich älter wurde.
Überkamen mich die Gefühle der inneren Leere, versuchte ich jeweils, sie meinem Vater zu erklären, denn meine Mutter wollte ich natürlich nicht mit meinen Sorgen belasten. Vater hörte mir aufmerksam zu, nahm mich in den Arm und sagte: »Was du fühlst, kenne ich gut.« Und dann erzählte er mir Geschichten aus seiner Jugend als ungeliebter Bub und aus der Zeit, als er eine Lehre als Mechaniker machen musste, obwohl er studieren wollte. Seine Hände hätten jeweils so gezittert, dass ihm die Schrauben aus der Hand gefallen seien und ihn der Lehrmeister vor allen ausgelacht habe. Nur seine geliebten Mandelgipfel, die er heimlich zum Znüni und zum Zvieri aß, »der süße Trost«, wie er sie nannte, hätten ihn davor bewahrt, alles hinzuschmeißen.
Doch diese Geschichten trösteten mich nicht wirklich. Mein starker, geliebter Vater, der mir bei nächtlichen Spaziergängen die Sternenbilder erklärte und mich tröstete, wenn mich Albträume plagten, durfte nicht schwach sein. Wer sonst passte auf mich und meine »alte« Mutter auf? Mein Vater war übrigens nur ein Jahr jünger als meine Mutter, aber ich hörte nie, dass jemand sagte, er sei alt und werde bald sterben.
Schon als Kind spürte ich, dass meinen Vater nicht die gleichen Ängste wie mich plagten. Er wurde von seiner Familie und seinem Lehrmeister gedemütigt, seine Angst war durchaus verständlich und nachvollziehbar. Ich hingegen war ein behütetes und geliebtes Kind. Warum also diese Gefühle der inneren Leere und diese Angst vor dem Nichts?
Am Schluss seines Lebens, als mein gescheiter Vater, der gegen alle Widerstände doch noch studiert und es sogar zu einer Professur geschafft hatte, an Demenz erkrankt war, sagte er mir in einem lichten Moment: »Jetzt weiß ich, was du als Kind gemeint hast mit dieser inneren Leere. Es ist die Angst vor der eigenen Auflösung und dem Nicht-mehr-Sein.« Bevor er wieder ins Vergessen abglitt, verlangte er noch nach einem Vanillejoghurt, das er mit verzücktem Lächeln löffelte. In dieser Minute dachte ich: Das ist der Anfang vom Ende, aber nach dem Ende wird kein neuer Anfang kommen. Ich sollte recht behalten. Wenige Tage später starb er.
Während meiner Kindheit bestanden meine Eltern darauf, dass ich von allem, was auf den Tisch kam, wenigstens ein bisschen probierte. Bei den Mahlzeiten, die meine Mutter zubereitete, handelte es sich nicht um eine ausgefallene Küche, sondern um bodenständige Hausmannskost: Spaghetti bolognese, Zürcher Geschnetzeltes, Toast Hawaii. Das Exotischste war das sogenannte Riz Casimir mit geschnetzeltem Kalbfleisch, Currysauce aus dem Beutel, die mit Milch aufgekocht wurde, und mit halben Aprikosen aus der Dose, mit Schlagrahm garniert.
Am meisten hasste ich Bohnen und Kefen, Letztere wegen ihrer dünnen Fäden, die immer zwischen den Zähnen hängen blieben. Mit der Zeit entwickelte ich meine eigene Methode, wie ich verhindern konnte, sie runterschlucken zu müssen. Ich kaute sie in kleine Stücke und füllte dann die Backentaschen wie ein Hamster. Danach gab ich an, dringend aufs WC zu müssen, wo ich alles ausspuckte. Es brauchte Jahrzehnte und die feine Küche meines Mannes, bis ich Bohnen genießen konnte. Kefen esse ich allerdings auch heute noch nicht.