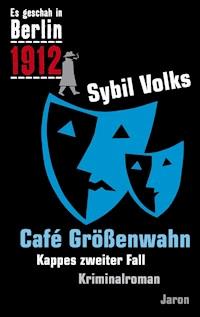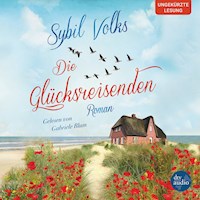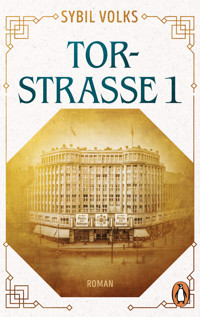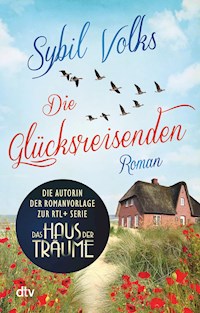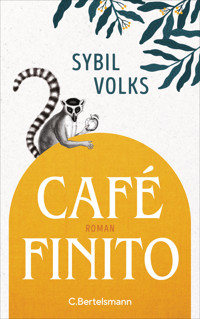
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Café Finito – wo sich Trauernde und Liebende, Tragik und Komik begegnen. Eine Hymne an die Kraft der menschlichen Gemeinschaft. Ein Roman, der das Leben feiert.
»Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, in Gesellschaft von Deutschlands talentiertesten Toten, stand das Café Finito. Hier versorgte Kristof seine Gäste mit Kaffee, Tee und Torte, und wer es wünschte, bekam eine Portion Sahne und Trost obendrauf. Kristof riss ein Blatt vom Kalender, sein Blick fiel auf das Schild an der Wand, Lost & Found. Er war gespannt auf die Menschen seiner neuen Abschiedsgruppe, die sich heute zum ersten Mal trafen – und auf ihre gemeinsame Reise durch das kommende Jahr. Es war ein Anfang für alle - nach einem Ende, das für sie alles verändert hatte.«
Kristof ist die Seele des Cafés. Seit vielen Jahren geleitet er die Abschiedsgruppen mit sanfter Autorität durch das Tal der Trauer. Nur über seine eigene weiß niemand etwas. Iris, die Schriftstellerin, hat ihre Mutter verloren, Matthias, Versicherungsmakler, seine Geliebte, Lizzie nach siebzig Jahren ihren Mann, und Mira, die junge Ärztin, trauert um ihre beste Freundin. Sie lassen sich ein auf ein Angebot, das ihnen völlig neue Perspektiven eröffnet.
Ein hinreißend erzählter, lebenskluger Roman über all das, was Menschen verbindet und das Leben einzigartig macht. Ein wenig Magie kommt ins Spiel. Und wie es sich beim Tod gehört, sitzen Tragik und Komik im selben Boot.
Für Leser:innen von Mariana Leky, Alena Schröder und Elisabeth Strout – und für all jene, die sich auf kluge Weise mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SYBIL VOLKS
CAFÉ FINITO
ROMAN
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025 C.Bertelsmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: buxdesign | Lisa Höfner unter Verwendung von Motiven von AdobeStock und Bridgeman Images
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31771-3V002
www.cbertelsmann.de
Für die Trauernden und die Liebenden
DIE MITWIRKENDEN IM KOSMOS DORO
Der Dorotheenstädtische (Doro) – auf Berlins berühmtestem Friedhof ruhen die talentiertesten Toten, die Deutschland zu bieten hat. Zumeist in Frieden.
Café Finito – hier gibt es Torten, Trost und Abschiedsgruppen für alle. Wird gebraucht, musste daher erfunden werden.
Kristof – Friedhofsverwalter, ach was, Seele des Doro und Café Finito. Geleitet die Abschiedsgruppen durch das Tal der Trauer.
Iris – nach Pflege und Tod der Mutter eine Schriftstellerin in Verpuppung
Matthias – Lebensversicherer, aus der Bahn geworfen durch den Unfalltod der Geliebten
Mira – alleinerziehende junge Ärztin, kämpft um die kranke Freundin und ihren Platz in der Welt.
Lizzie – mit fast neunzig verwitwet, hat die lebensmüde Lebenskünstlerin mit allem abgeschlossen – oder doch nicht?
Jonas – Sohn und Erbe, melancholischer DJ, Mitbewohner eines zahmen Lemuren
Leonie – verlor ihr ungeborenes Kind und in den Krisen der Zeit auch Halt und Kompass.
Dorothee & Dorothea – die Zwillingsschwestern führen gemeinsam, doch stets uneins, das Familienunternehmen »Bestattungen Frohmut«.
Immanuel, Dr. Dr. h. c. – ist mit allen berühmten Toten per Du. Bei seinen Führungen wuchern die Fabeln wie Efeu.
Der stumme Steinmetz – lebt wie Kristof auf dem Doro und teilt mit ihm ein tragisches Geheimnis.
Oblomow (besagter Lemur), Cerberus (Lizzies uralter Pudel), ein Blauer Morphofalter sowie weitere Wesen aus Flora und Fauna
LOST & FOUND
Wie jeden Morgen stand Kristof schon kurz nach dem Aufwachen mit einem Bein auf dem Friedhof. Und beim nächsten Schritt mit beiden Beinen im Leben, denn das wuchs und wucherte auf dem Totenacker. Doch um das zu erkennen, musste man wohl wie Kristof Fährer selbst dort leben.
Seit mehr als drei Jahrzehnten bewohnte er das kleine ockergelbe Haus auf dem Dorotheenstädtischen Kirchhof, den Kristof nur »der Doro« nannte. Hier, in dem Gebäude gleich neben der Kapelle, hausten traditionell die Verwalter. Früher hieß es »Totengräberhaus«, aber das hatte es nicht leichter gemacht, einen Mieter zu finden, trotz Premiumlage im Zentrum von Berlin.
Kristof hatte damit kein Problem. Der Tod war ein direkter Nachfahre des Lebens, fand er, und die Trauer ein Kind der Liebe. Auch mit dem Graben kannte Kristof sich aus. Achtzehn Monate hatte er in der DDR als Spatensoldat gedient (oder eher nicht gedient) und wurde daher als feindlich-negative Kraft für unwürdig befunden, dem Sozialistischen Staat mit einem Studium auf der Tasche zu liegen. So hatte Kristof Fährer seine Spatenkarriere folgerichtig als Totengräber fortgesetzt und sich zielstrebig zur Verwalterstelle hochgegraben.
Keine Sekunde hatte Kristof gezögert, als man ihm zum Antritt seiner Stelle anbot, in das Haus zu ziehen. Es stand bereits einige Jahre leer. Bei der Besichtigung entschuldigte man sich für morsche Fensterrahmen und abblätternden Lack, zog ihn unauffällig fort von stockfleckigen Tapeten und wischte Spinnennetze beiseite. Kristof sah die Zukunft in den Räumen.
Heute saßen im Erdgeschoss des Totengräberhauses Menschen auf rot gepolsterten Stühlen um Bistrotische beisammen. Tische, Stühle und Tresen, schönstes 50er-Jahre-Design, stammten aus dem Eiscafé Firenze; der Padrone meinte, er müsse mit der Zeit gehen. Kristof meinte das nicht. In seinem Café Finito versorgte er die Gäste mit Kaffee, Tee und Torte, und wer es wünschte, bekam eine Portion Sahne und Trost obendrauf, doch niemals ungefragt.
Nachdem Kristof Verwalter des Dorotheenstädtischen geworden war, mit all den Berühmtheiten aus Kunst, Politik und Wissenschaft, betrachtete er es als seine Aufgabe, die ihm Anvertrauten näher kennenzulernen. Er las über ihre Leben und aus ihren Werken, alles, was ihm in die Hände fiel, und irgendwann wurde Kristof klar, dass er damit nie und niemals zu einem Ende finden würde. Die Leute vom Doro waren zu ihren Lebzeiten ungeheuer produktiv gewesen.
Seit einigen Jahren betrachtete Kristof neben den Toten vor allem die Trauernden als seine Schützlinge, und er hörte all jenen beim Reden und Schweigen zu, die ins Café und in seine Gruppen kamen.
Im hinteren Teil des Cafés, wo sich die Abschiedsgruppen trafen, hing ein Schild an der Wand: Lost & Found. Es war das einzige Souvenir seiner einzigen Auslandsreise. Diese Reise ging gerade mal bis zum Flughafen Tegel. 1990, als Kristof, so lagen ihm Hinz und Kunz in den Ohren, doch endlich die Welt offenstand, als Hinz nach Mallorca und Kunz auf die Malediven flog, hatte sich Kristof für London entschieden. Warum denn gerade London? Das hatte mit John Heartfield zu tun, der dort im Exil gewesen war. Kristof hatte ihn leider erst auf dem Doro kennen- und lieben gelernt, wie so viele Menschen, mit denen Kristof sich verwandt und befreundet fühlte.
Damals also hatte er sein Herz an Helmut Herzfeld alias John Heartfield verloren, den weltberühmten Erfinder der Fotomontage, Künstler, Kommunist und Pazifist. Helmut lag hier neben seinem Bruder Wieland, dem Schriftsteller und Verleger des seinerzeit ebenfalls weltberühmten Malik-Verlags. Und immer, wenn Kristof vor ihren Gräbern stand, dachte er an die Hütte im Wald. Österreich, 1899, tiefe Nacht, eine Waldhütte, darin vier Kinder: Helmut, Hertha, Wieland, Lotte, der Älteste acht und die Jüngste ein Jahr alt. Über Nacht allein zurückgelassen von ihren Eltern, die sie nie wiedersahen. Kristof fühlte sich den Geschwistern nah wie ein Bruder. Nur dass er in dieser Geschichte Lotte wäre, das Baby.
Wegen Heartfield also sollte es London sein. Doch Kristof, der bis zu diesem Tag seine Heimat Berlin noch nie und seine Friedrichstadt nur dann verlassen hatte, wenn es sein musste, verlor im Flughafen Ticket, Mut und Motivation und fand nur das Ticket wieder. Auf dem Piktogramm am Schalter Lost & Found waren Hut, Schirm und Handschuhe abgebildet. Doch wohin wandte man sich beim Verlust von Glaube, Liebe und Hoffnung? Im selben Moment, als Kristof die Frage durch den Kopf ging, schloss die Dame den Schalter, und das Schild fiel von der Wand. Kristof steckte es ein, kehrte nach Hause zurück und legte Lost & Found in die Schublade für »eines Tages«.
Eines Tages war gekommen, als Kristof im Erdgeschoss des Totengräberhauses das Café eröffnete. CaféFinito hatte Kristof am Haus über den Türbogen gepinselt und drinnen das Schild Lost & Found an die Wand geschraubt. Alle, die sich seitdem unter diesem Zeichen am Tisch versammelten, so verschieden sie auch sein mochten, hatten einen Menschen verloren. Nichts und niemand konnte ihnen diesen Menschen ersetzen. Doch dafür waren sie nun da, dieses Café, dieser runde Tisch, diese Gruppen und dieser Kristof: dass alle, die einen Verlust erlitten hatten, hier auch etwas wiederfanden.
Heute stand Kristof kurz nach Sonnenaufgang auf der Schwelle des Hauses. Schon zu früher Stunde spürte man die Hitze des kommenden Tages. Er war froh, dass diese Nacht vorbei war. Eine Nacht mitten im August, an der man vor einundsechzig Jahren eine Stadt entzwei geteilt hatte.
Kristof band sich die aschblonden Haare zum Zopf und witterte, wie jeden Morgen, was wohl in der Luft lag, an diesem nie da gewesenen, niemals wiederkehrenden Tag. Dann trat er hinaus aus den Friedhofsmauern und warf einen Blick auf die Welt vor der Haustür. Auf Himmel und Häuser, Autos und Straßenbahnen, Menschen auf dem Weg zur Arbeit und Touristen, die nach durchfeierter Nacht in die Quartiere taumelten.
Nur zwei Jahrhunderte zuvor zogen im Morgengrauen auf diesen Straßen Heere von Arbeitern nach Feuerland, wie man die Gegend nannte, als vor dem Oranienburger Tor Gießereien und Maschinenbauanstalten Rauch und Ruß aus den riesigen Schloten spuckten, die den Himmel verdunkelten und die Luft zum Atmen nahmen. Hier ließen Fabrikanten wie Borsig und Schwartzkopff Lokomotiven bauen, Minen und Torpedos, Dynamos, Motoren und Druckerpressen. Nun ruhten die Borsigs und Schwartzkopffs, nach denen umliegende Straßen benannt waren, auf dem Dorotheenstädtischen unter steinernen Baldachinen auf dorischen Säulen. Doch von den Tausenden, die im Morgengrauen zur Arbeit nach Feuerland zogen, war keine Spur geblieben.
Kristof kehrte Feuerland von gestern und Feierland von heute den Rücken, um in sein friedliches Reich zurückzukehren. Obwohl die Mauern des Doro keineswegs in den Himmel ragten, schien es ihm, als blieben Abgas, Lärm und Hektik eine bloße Ahnung, vielleicht Mahnung jenseits der Wände, hinter denen die Stadt begann. Während diesseits, auf dem Friedhof, ein steter Hauch von Ewigkeit wehte, den Kristof erfrischend fand.
»Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute …«. Dr. Dr. h. c. Immanuels sonore Stimme erklang hinter der hohen Hecke. Im nächsten Augenblick bog der Friedhofsführer um die Ecke, dicht gefolgt von einer Schar Zuhörer. Welcher Ehren halber Herr Immanuel seine Doktortitel führte, war Kristof nicht bekannt, doch zweifellos verfügte er über ein schier unerschöpfliches Wissen. Die Einwohner des Dorotheenstädtischen, berühmte und berüchtigte – Dr. Immanuel kannte sie alle. Er war mit Hegel und Herrndorf, Schinkel und Seghers per Du, kannte die Toten, ihre Jahreszahlen und die Geschichten zwischen den Zahlen. Die ganz besonders. Bei Immanuels Führungen trieben die Reden wilde Blüten, und Fabeln wucherten wie Efeu. Die Zuhörer lauschten gebannt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so lauschen sie noch heute …
Kristof ging seines Weges. Es gab noch viel zu tun für ihn an diesem Tag, und er musste Augen und Ohren offen halten auf dem winzigen Stück Welt, für das er die Verantwortung trug. Besonders an einem brenzligen Augusttag wie diesem. Ein Spätsommertag auf der Kippe, an dem Menschen auf schiefe Bahnen gerieten. Wie die Frau, die er letzte Nacht in flagranti erwischt hatte.
Schlaflos hatte Kristof im viel zu warmen Dachgeschoss gelegen. Er lebte und schlief im Oberstübchen des Totengräberhauses. Die schrillen Rufe des Käuzchens waren in der Nacht durch das offene Fenster gedrungen. Er hatte sich die Beine vertreten wollen und war, wie andere Leute in ihrem Garten oder auf der Straße, zwischen den Gräberreihen spazieren gegangen.
Es war finster, der Himmel bewölkt. Zuerst hörte Kristof ein Scharren und Schaben und dachte, der Waschbär wäre zurück. Oder eine der halb wilden Katzen, die seit diesem Frühjahr in Scharen auf dem Doro auftauchten. Doch der nächtliche Streuner war weder Waschbär noch Katze oder Fuchs gewesen. Als Kristof sich näherte, vernahm er ein sehr menschliches Geräusch. Leises Weinen.
»Guten Abend«, sagte Kristof zu der Frau, die unter der Kastanie hockte. »Haben Sie hier etwas verloren?«
Die Frau sprang auf. »Bloß den Verstand«, murmelte sie und stellte sich vor das frisch gegrabene Loch.
Kristofs Blick fiel auf ihre erdverkrusteten Hände und Knie. Neben dem Loch, in dem man höchstens einen Tennisball hätte verbuddeln können, lag ein Bündel Stoff. Selbst im Dunkeln schienen die Blumen darauf zu leuchten. Es war ein trockener Sommer, wieder einmal, die Erde steinhart. Sogar mit einer Schaufel war das Graben schwere Arbeit.
»Ausgraben oder eingraben?«, wollte Kristof von ihr wissen. Beim Ausgraben verstand er keinen Spaß.
Mit einigem Abstand zueinander saßen Kristof und die Unbekannte auf der Bank unter dem Maulbeerbaum. Der Baum spendete im Sommer mit seinen dichten Blättern viel Schatten, und seine knorrigen Äste hingen voller dunkelroter Beeren. Kristof hatte ein paar von der Bank gewischt, bevor sie sich setzten. Die Frau war nicht mehr jung, auch noch nicht alt, hatte kluge Augen, blutige Finger und eine Fahne.
Als sie erst einmal angefangen hatte zu reden – früher oder später taten das alle auf dieser Bank –, sprudelten ihre Worte wie Quellwasser aus dem Gestein. Plötzlich verstummte sie und sah ihn vorwurfsvoll an. »Das hab ich noch niemandem erzählt!« Sie rieb sich mit den Händen durchs Gesicht. »Sie halten mich ja für verrückt.«
Jetzt war auch ihre Stirn unter dem pechschwarzen Haar mit Erde verschmiert, ein paar blutige Streifen auf den Wangen, es sah aus wie Kriegsbemalung. Stand ihr, fand Kristof.
»Warten Sie hier.« Kristof verschwand, kam kurz darauf zurück und zog etwas aus einer Tüte hervor. »Hände hoch.«
Die Frau sah auf die Plastikflasche, auf ihre blutigen Fingerkuppen, und streckte ihm die Hände entgegen. Der Mann mit dem Zopf goss lauwarmes Wasser darüber.
»Da hab ich schon ganz anderes gehört.« Kristof tupfte ihre Finger mit einem weichen Handtuch trocken. »Für ein halbes Jahr von der Bildfläche verschwinden, alle Brücken abbrechen … kommt vor. Stillhalten bitte.« Er zog ein Fläschchen aus der Tüte und sprühte etwas auf die Wunden. »Eine Wohngemeinschaft mit dem Tod als Personal Trainer. Gevatter Basta …« Kristof lachte. »Schon schräg. Aber da müssen Sie bei mir noch ’ne Schippe drauflegen.«
»Apropos Schippe«, sagte die Frau und klang plötzlich nüchtern, »können Sie mir eine ausleihen?«
Nach getaner Tat versprachen sie sich gegenseitig zu schweigen. »Das bleibt unter der Erde und unter uns«, hatte Kristof gesagt. »Aber du musst mir auch was versprechen, Iris.«
Heute Morgen ging Kristof als Erstes zur Kastanie; bei Tageslicht kam ihm die nächtliche Aktion wie ein bizarrer Traum vor. Doch da war der kleine Busch, frisch gepflanzt, ein lavendelfarbenes Corpus Delicti für ein nicht genehmigtes Begräbnis. Aber Kristof fand nun mal, dass kein Mensch illegal war. Weder auf der Erde noch darunter. O Mann, sagte sich Kristof Fährer, irgendwann kostet’s dich noch Kopf und Kragen. Und deinen Job. Das alles hier. Noch ein paar abgelaufene Gräber, die du nicht vorschriftsmäßig beseitigst, noch eine einzige aus dem Ruder gelaufene Abschiedsparty nachts auf dem Friedhof, wie es in der Akte stand … Kristof sah sich um, sah Wege und Bäume und Blumen und Steine, die Kapelle und daneben das ockerfarbene Haus, sein Zuhause. Er musste vorsichtig sein. Bei der nächsten Abschiedsgruppe durfte wirklich nichts schiefgehen.
Kristof ging zum Schuppen, holte eine Gießkanne und goss den Lavendel, damit er gut anwuchs. Die Asche würde ihn lange Zeit nähren. Er hoffte, dass der Lavendelduft Bienen und Hummeln anlockte und Iris immer etwas fand an dieser Stelle, an der es weder Stein noch Kreuz geben würde.
Beim Gießen fiel ihm das über Nacht entfallene Wort wieder ein, erblühte unter den Wassertropfen vor seinen Augen wie eine schwarze Tulpe. Kristof ließ alles stehen und liegen, ging zurück ins Haus und stieg die Treppe hinauf. Im Spitzgiebel stand sein Schreibtisch am Fenster, das zur Kapelle hinausging. Kristof notierte den neuen Wortschatz und bettete ihn in die Zigarrenkiste mit der Aufschrift Begriffsvorräte. Ob er auch ein Nachtdurchschwärmer sei, hatte Iris gefragt. Kristof musste verneinen und staunte, wie sie den Ausdruck ohne Stolpern über die alkoholschwere Zunge brachte. Andere an ihrer Stelle hätten wissen wollen, was er eigentlich nachts auf dem Friedhof zu suchen hatte und wie er dort an frische Handtücher, warmes Wasser und Desinfektionsspray kam.
Die Etage unterm Dach war Kristofs Reich. Kaum jemand hatte sie je betreten. Für ein Liebesleben, das musste er zugeben, war ein Zuhause auf dem Friedhof nicht die erste Adresse. Ob es daran lag, dass er weder die Frau noch den Mann fürs Leben gefunden hatte, kümmerte Kristof selbst weniger als andere Leute.
Und überhaupt, war so ein Friedhof, um dort zu leben, nicht ein trister, ja sterbenslangweiliger Ort? Beim ersten Mal, als ihm die Frage gestellt wurde, war Kristof ehrlich erstaunt. Seitdem hatte er unzählige Male darauf geantwortet. Klar, er konnte nicht für alle Friedhöfe sprechen, aber der Doro gehörte gewiss nicht zu den öden Orten dieser Stadt, so wie der Potsdamer Platz, wo Touristen auf Untote in Shoppingmalls trafen. Hier, auf dem Doro, waren echte Begegnungen möglich, zwischen Lebenden und Toten – die ja allesamt auch ein Leben hinter sich hatten.
Zwar war auch der Dorotheenstädtische mit seinen berühmten Bewohnern ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Doch hier suchten sie keine Schnäppchen, kein Event. Manche Besucher kamen in tiefem Schmerz, einige aus Pflichtgefühl und viele, sehr viele aus Liebe. Sie kamen aus Liebe zu Menschen, die ihnen nahestanden. Manche hatten sich sogar nahe gelegen und im Bett unter einer Decke gesteckt. Andere verpassten sich auf diesem Planeten um Jahrzehnte oder Jahrhunderte und waren doch Verwandte im Geiste. So wie die junge Frau, die vor den verwitterten Steinen mit Hegel und Fichte disputierte. Der Mann mit dem Turban, der für Brechts Nachschub an Zigarren und Stiften sorgte. Oder die alte Dame mit dem uralten Hund, die Körner ins Vogelhäuschen legte, das Johannes R. Becher sich neben sein Grab an die Wand bauen ließ. Noch nach dem Tod immer einen Vogel zu haben, das erschien auch Kristof eine verlockende Aussicht.
Nicht nur zwischen den Lebenden und Toten, auch unter den Toten auf dem Doro gab es unzählige Verbindungen. Zeichnete man sie, der Boden wäre überzogen mit einem dichten Geflecht aus verschlungenen, abgerissenen und sich kreuzenden Linien. Viele der hier zur Ruhe Gebetteten waren zu Lebzeiten miteinander bekannt, befreundet, verfeindet, hatten sich geliebt, gehasst oder beides, einander Geliebte und Ideen entwendet, sich inspiriert und gefördert, gerettet und verraten.
Allein der notorische Brecht brachte es fertig, noch über den Tod hinaus ein Ensemble um sich zu scharen, das bei nächtlicher Geisterstunde jedes Stück aufzuführen imstande wäre, Macbeth und Mutter Courage, Dreigroschenoper oder die Rocky Horror Picture Show. Da war Helene Weigel, Frau und Gefährtin, Schauspielerin und Intendantin, unbeirrbar an seiner Seite in Leben und Tod; da waren über den Doro verteilt eine Handvoll Künstlerinnen, die dem großen B. B. Liebe und Arbeit, geistige und leibliche Kinder schenkten; da waren seine Töchter Hanne und Barbara; da lag kreuz und quer ein Geschwader von Kollegen, Freunden und Feinden aus Weimarer Republik, Nazideutschland und Nachkriegsdeutschland. So viele, die wie Brecht und Weigel aus dem Exil zurückgekehrt waren aus aller Exilanten Länder und sich nach dem letzten Vorhang noch einmal versammelten, auf diesem Fleckchen Erde mitten in Berlin.
Auch heute war wieder Krieg in Europa und an vielen Orten auf dieser Erde, auch heute wieder waren die Menschen auf der Flucht. Kristof wollte nirgendwo und nie wieder Krieg. Nicht umsonst hatte er die Uniform mit dem kleinen Spaten auf den Schulterklappen getragen. Aber so sehr Kristof sich damals wie heute Frieden wünschte: Die Welt machte nicht an den Friedhofsmauern halt. Schon gar nicht an denen des Doro, der mitten in Berlin zwei Weltkriege und einen Kalten Krieg überdauert hatte. 1945 lagen, wie auch die Häuser um sie herum, die meisten Gräber in Trümmern. Noch immer sah man die Wunden der Bombensplitter an den Mauern der Gruften, und viele metallene Grabgitter, Reliefs und Figuren waren im Zweiten Weltkrieg verschrottet worden – Kreuze und Engel zu Kriegswaffen.
Auf diesem Kirchhof traf man Gott und die Welt. Selbst der Teufel lag hier begraben. Vorsichtshalber schaute Kristof regelmäßig, ob bei Dutschkes Freund alles rechtens zuging. Einmal hatte man Fritz Teufel entführt, und seine Urne tauchte westwärts bei Rudi Dutschke wieder auf, der im gutbürgerlichen Dahlem ruhte. Die Kommune 1 war Geschichte, doch für ein paar Tage und Nächte waren die Kommunarden noch einmal vereint. »Wenn’s der Wahrheitsfindung dient«, hatte Fritz Teufel den Richtern geantwortet und war widerwillig aufgestanden. Das konnte jetzt keiner mehr von ihm verlangen.
Das Haus, auf das Kristof zuging, um über eine bevorstehende Bestattung zu sprechen, lag gleich hinter dem Friedhof. Die linke Haushälfte war cremeweiß, die rechte knallorange. »Bestattungen Frohmut« prangte in großen Lettern quer über die Häuserfront, »Bestattungen« über dem linken Eingang, »Frohmut« über dem rechten. Seit ihrer Geburt vor fast fünfzig Jahren lebten Dorothea und Dorothee Frohmut hier, Bestatterinnen in vierter Generation. Sie teilten Familienbetrieb und Elternhaus und einst sogar die Eizelle. Das war’s auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Vorsichtshalber schaute Kristof noch mal in die Akte. Bloß keine Verwechslung riskieren, das hatte schon fatale Folgen gezeitigt. Denn wenn sich Dorothee und Dorothea auch äußerlich ähnelten wie ein Ei dem anderen, so waren sie doch von Kindesbeinen an in allem und jedem konträr. Einig waren sie sich in einer einzigen Sache: Beide liebten ihr Elternhaus, und keine dachte daran, auszuziehen. Nur über ihre Leiche.
Also teilten die Schwestern Haus und Bestattungsinstitut in zwei Hälften. Konzept und Kundschaft waren so strikt getrennt wie ihre Weltanschauung. Das Beispiel einer funktionierenden Zwei-Staaten-Lösung, wie Kristof ihr Modell nannte. Kristof Fährer, der wie die Frohmut-Zwillinge genügend Mumm in den Knochen hatte, um auf dem Friedhof zu leben. Allerdings nicht von Geburt an, wie Dorothea betonte. Aber dafür innerhalb der Friedhofsmauern, konterte Dorothee.
Kristof ließ Dorotheas Tor links liegen, mitsamt Riesenschnauzer und Schild: »Mein Haus! Mein Garten! Meine Familie! Hier wache ich.« In Dorothees Garten wachte niemand, Katzen dösten in der Sonne, zu fett gefüttert, um durch einbeinige Krähen und lahme Enten – Dorothees neueste Schützlinge – in Versuchung zu geraten.
Bei Dorothee war die Haustür meist nur angelehnt. Wie üblich brutzelte etwas auf dem Herd, ein Sektkorken knallte. In der Diele erschien Dorothee Frohmut mit aufgetürmtem Haar und kreisrunden Brillengläsern. »Ach, du bist es!« Sie drückte Kristof ein Glas in die Hand. »Übrigens, was sagt der Herrgott zu Es werde Licht? Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen?«
Wenn Dorothee Frohmut vom Herrgott sprach, war damit der Chef der Friedhofsverwaltung gemeint. Und der konnte Dorothees Idee, das Lichtspiel in der Kapelle für die Trauerfeier einer Sängerin auf die Musik von Das Phantom der Oper einzustimmen, so gar nichts abgewinnen. Kristofs Hinweis, dass es sich bei der Lichtinstallation ihrer Kapelle um das Werk eines weltberühmten Künstlers handelte, wurde von Dorothee als kleinkariert beiseitegeschoben. So wie nun Kristof, als er den Kopf schüttelte und sagte »vergiss es«.
Kristof zog weiter und ging die Gräberreihen ab. Alle Gräber, die vom Friedhofsgärtner versorgt wurden, sahen ordentlich aus. Bei denen, für die Angehörige selbst zuständig waren, gab es himmelweite Unterschiede. Manche zeugten von treuer Pflege, andere von überbordender Liebe, wieder andere sahen trist und vernachlässigt aus. Kristof kannte seine Pappenheimer und griff hier und da selbst zu Harke und Gießkanne oder stellte eine Kerze auf das Grab. Auch wenn er mit solchen Eingriffen vorsichtig war, hielt Kristof im August die Zeit für gekommen, den vertrockneten Weihnachtsstern zu entfernen, und legte Monika Gerster eine frisch geschnittene Rose aufs Grab. »Nimm’s nicht persönlich, Moni. Deine Lieben haben dich bestimmt nicht vergessen.« Tatsächlich hatte sich Kristof angewöhnt, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht lebten ihre Leute weit weg oder waren selbst verstorben, oder sie dachten tatsächlich an Monika, aber eben an anderen Orten. Kristof dachte hier an Monika. Eine kleine blonde Frau, immer in derselben Jeansjacke, die jeden Sonntag auf dem Fahrrad vorgefahren war und mit einem Korb mit Hacke, Schippe und Schere am Arm das Grab ihrer Eltern besucht hatte, die beide über neunzig geworden waren. Monika wurde nur zweiundsechzig.
In regelmäßigen Abständen prüfte Kristof, ob die Steine noch fest und sicher standen. Wenn nicht, klebte er einen signalroten Zettel an einen schief stehenden Marmorstein. »Vorsicht, Unfallgefahr! Grabmal nicht mehr standsicher. Bitte bei der Verwaltung vorsprechen.« Kristof seufzte. Da konnte man lange warten, von Familie Helling sprach niemand vor. Doch den Grabstein zu entfernen, kam für Kristof nicht infrage. Die noch lebenden Hellings hatten es womöglich nicht besser verdient, wohl aber die toten.
Die abgelaufenen Gräber räumen zu lassen, war für Kristof der einzige Teil seiner Arbeit, den er verabscheute. Er wollte nicht die Totenruhe stören, bloß weil keiner mehr Miete zahlte. Kristof zögerte jede Räumung hinaus, solange er konnte. Sein einziger Trost, wenn es doch einmal sein musste, war, dass es auf einem kleinen Friedhof wie dem Doro, mitten in der Stadt zwischen Straßen und Wohnhäusern, sonst schon lange keinen Platz mehr für Neuankömmlinge gegeben hätte.
Aus der hinteren Ecke des Friedhofs drang lautes Klopfen. Er war also da, dachte Kristof, bei der Arbeit. Der Schuppen machte den Eindruck, als könnte er jeden Moment in sich zusammenfallen. Das Fundament war eingesunken, die Wände schief, das Dach löchrig. Der Weg zum Steinmetz führte über geborstene Platten, zwischen denen Gras und Unkraut wuchsen. Nur die Grabsteine zu beiden Seiten sahen picobello aus. Marmor, glatt und glänzend, Findlinge aus Granit, angelandet aus der Eiszeit, heller und grauer Sandstein, auch Trauerstein genannt, aus dem, wenn er verwitterte, melancholisch die Sandpartikel rieselten. An der Werkstatt des Steinmetzes gab es weder Schild noch Klingel, die Tür klemmte. Nur ein Experte und Monopolist vor dem Herrn konnte sich so etwas leisten.
Kristof hämmerte an die Tür – lang, kurz, kurz, lang –, trat ein und räusperte sich. »Tach, Fritz. Hast du einen Moment?« Der Steinmetz blickte auf, nickte und meißelte weiter. Etwas leiser vielleicht.
»Was machen wir mit Hellings?« Kristof traf ein leerer Blick. »Dunkelgrüner Marmor, farblich passend bemoost, schief wie der Turm von Pisa.«
Der stumme Steinmetz wandte sich wieder dem Stein zu, der vor ihm lag: eine rosa Marmorstele. Er würde nicht ruhen, bis die Inschrift in Stein gemeißelt war, perfekt bis zum letzten i-Punkt. Das konnte eine Weile dauern. Sigrid Schmilinski, entzifferte Kristof, ruhe in Frieden.
Trotz der Hitze war das Fenster geschlossen wie immer. Alles im Raum war von feinstem Steinstaub überzogen, der sich in Schichten übereinanderlegte und mit der Zeit verklebte. Auch der Steinmetz wirkte wie vom Staub der Jahrzehnte bedeckt. Heute lag hellrosa Puderzucker von der rosa Stele auf seiner Jacke und dem grauen Haar wie Kirschblüten.
»Wiedersehen, Fritz.« Kristof schloss die quietschende Tür hinter sich und verließ die Werkstatt.
Ein Stück weiter, auf diesem abgelegenen Teil des Friedhofs, sah Kristof sich um, bevor er neben einer krummen Tanne in die Hocke ging. Unter der Tanne lag, verborgen unter dichtem Efeu, ein Grabstein flach auf der Erde. Die Inschrift war unter den Blättern nicht zu erkennen, doch Kristof schob vorsichtig die Hand unter die Ranken und ertastete die Buchstaben im grauen Granit. Auch die hatte Fritz eigenhändig gemeißelt. Und Kristof selbst hatte den Stein in Auftrag gegeben. Nur sie beide wussten, dass unter diesem Stein niemand lag und niemals jemand gelegen hatte.
Bevor er am Nachmittag die Tür des Café Finito öffnete, kehrte Kristof zurück ins Haus, um den Pflichtteil seines Tagewerks zu erledigen. In seinem kleinen Büro neben dem Café warteten Briefe, Anträge und Rechnungen, Aktenordner aus Pappe, Ordner und Unterordner im PC. Arbeit, die getan werden musste, um den Laden am Laufen zu halten – auch ein Friedhof war schließlich ein Unternehmen mit Finanzen und Bilanzen und Bürokratie. Aber das alles war nur Beiwerk, ein Rahmen für das Eigentliche: den Toten einen Raum für die ewige Ruhe zu geben und den Lebenden einen Raum für die Trauer. Einen Ort zu schaffen, an dem die Lebenden die Toten besuchen konnten, mit ihnen reden und schweigen, überraschend mit einem Blumenstrauß aufkreuzen, einfach kurz Hallo sagen oder bleiben, bis man hinauskomplimentiert wurde – ein Ort, von dem man nach dem Besuch auch wieder zurückkehren konnte, nach Hause, ins Leben.
Kristof riss ein Blatt vom Kalender. Nur noch wenige Wochen bis zum Beginn der neuen Abschiedsgruppe. Ob Iris ihr Versprechen halten und kommen würde? Kristof wollte es schwer hoffen, denn Iris Feder brauchte dringend andere Gesellschaft als Gevatter Basta.
IRIS – MUTTERLAND
»Sie steigen auf, die Schmetterlinge des Planeten,
wie Farbenstaub vom warmen Körper der Erde.«
Inger Christensen, Schmetterlingstal
Iris hatte ihre Rückkehr nicht angekündigt. Sie musste allein einfahren in Berlin, von West nach Ost über die Stadtbahngleise, allein durch die Straßen laufen, den Hof durchqueren, ihr Haus betreten, allein die Treppen in den fünften Stock steigen, ihre Wohnung aufschließen und nachschauen, ob dort jemand lebte. Ob die Stühle um den Tisch versammelt und noch alle Tassen im Schrank waren, die im Stich gelassenen Papiere unter Staub begraben, die blau bekritzelten Blätter verwelkt, ob die Frau im Garderobenspiegel ihr ähnlich sah.
Heute erst war es Iris gelungen, ihnen endgültig den Rücken zu kehren: der fremden Heimatstadt, der Suche nach der verlorenen Zeit, der Kindheit, ihrer Vergangenheit.
Am Abend zuvor war Iris in der leeren Wohnung ihrer Mutter umhergegangen, verfolgt vom Hall ihrer Schritte. Sie hatte innegehalten beim Aufblitzen einer Idee, in deren grellem Licht ihr ein Ausweg erschien. Ja, so konnte es gehen. Noch in derselben Nacht hatte Iris mit krimineller Energie den Plan in die Tat umgesetzt. Dabei war sie, soweit ihr bisher bekannt, weder spontan und tatkräftig noch kriminell.
Während der Zugfahrt wagte Iris es nicht, ihren Platz zu verlassen. Sie hielt die Tasche mit dem Diebesgut auf dem Schoß – ihrem Passierschein zurück in die Gegenwart.
Der Zug bremste so jäh, dass Menschen gegeneinanderstießen, Gepäck aus den Ablagen fiel. Ein Rucksack traf einen Mann im Genick, Kaffee floss über Hosenbeine, Rufen und Fluchen gingen unter im Gebrüll eines Säuglings. Iris’ Tasche, die sie kurz zuvor geöffnet hatte, machte einen Satz auf den Boden. Ein Apfel und ein geblümtes Stoffbündel fielen heraus, aus dem Bündel rollte eine Holzpuppe in den Gang.
An einer Schuhspitze kam die Matrioschka zum Halten. Die junge Frau, deren Fuß im Schuh steckte, hob sie auf und hielt die große, bunt bemalte Puppe in den Händen. Gleich würde sie die obere Hälfte von der unteren drehen, ihr Innenleben entblößen. Wo sonst als in ihrem runden Bauch lag die unwiderstehliche Magie einer Matrioschka?
Sag etwas, befahl sich Iris, steh auf, geh hin, nimm die Puppe. Wie eine Ertrinkende hob sie die Hand und hörte sich krächzen »bitte!«.
Bis zum Ende der Reise umklammerte Iris die verschlossene Tasche. Der Apfel lag wieder darin, ein wenig lädiert und schmutzig, doch das machte nichts. Es ging um die Kerne. Auch die Matrioschka war zurück an ihrem Platz. Sie hatte dichtgehalten. Keine kleinen, kleineren und ganz kleinen Matrioschkas klapperten in ihrem Bauch. Sie war viel zu schwer. Und das, obwohl sie nur die Hälfte der Asche enthielt. Die andere Hälfte lag in einer Urne auf dem Friedhof, wo sie hingehörte. In der Urnenwand des Kirchhofs der Kleinstadt am Niederrhein, wo Iris und eine Handvoll anderer Menschen Marieluise Feder, genannt Malou, an einem bitterkalten Tag im Februar bestattet hatten.
Iris war aus dem unterkühlten Untergeschoss des Hauptbahnhofs in die Hitze des Augusttages getreten, hinein in den Tumult der Passanten, Busse und Baustellen. Es schien ihr, als sei sie nicht Monate, sondern Jahre fort gewesen. Sie hatte den kürzesten Weg über den Humboldthafen genommen, im Bogen um die Charité, bis zur Rückseite des Dorotheenstädtischen Friedhofs. In der Chausseestraße war Iris vom Vorderhaus in den Hof getreten, das graubraune Haus im Hinterhof stand unverändert da, ebenso ihr Nachname auf dem Klingelschild.
Als Iris im Dachgeschoss die Wohnungstür öffnete, schlug ihr die abgestandene Luft dreier Jahreszeiten entgegen. Niemand hatte diese Räume betreten, seit Iris im Februar zu Malous Bestattung gefahren war. Für ein paar Wochen, um danach die Wohnung der Mutter auszuräumen. Ihren Briefkastenschlüssel hatte Iris Simone gegeben. Simone kannte Iris gut genug, um nicht nach dem Wohnungsschlüssel zu fragen.
Als Erstes ging Iris auf den Balkon, von dem aus man auf den Dorotheenstädtischen Friedhof blickte. Dann riss sie alle Fenster auf, inspizierte ihre zweieinhalb Zimmer und dachte, wer wird das alles ausräumen, wenn du stirbst? Zwar war ihre Wohnung schön übersichtlich – oder kahl, wie Malou bei jedem Besuch betont hatte, denn es fehlte an Krimskrams und Kissen, Deko und Bildern, kurz an Gemütlichkeit. Dennoch gab es auch hier all diese Dinge, von denen, das wusste Iris jetzt, erstaunlich viele ihre Besitzer überlebten.
Inmitten ihrer Bücher wurde Iris klar, dass sie in diesem Jahr kein einziges gelesen hatte. Kein Wunder, dass sie sich aus Einsamkeit Gevatter Tod zur Gesellschaft geladen hatte. Der Tod von Klein-Karo, wie Iris das Städtchen ihrer Herkunft nannte, trug Goldkettchen und weiße Sneakers. Auf seine Art war er sehr amüsant gewesen.
In der Schlafkammer öffnete Iris den Schrank. Hosen, Hemden und Kleider hingen aneinandergeschmiegt auf ihren Bügeln, als hätten sie ohne ihre Einwohnerin eine muntere Zeit verbracht. Wären raschelnd und knisternd durch die sturmfreie Bude getanzt und eines Abends, angeführt von der Lederjacke, durchs Treppenhaus in die Straße entschwebt, um sich in die Ballsäle und Clubs dieser Stadt zu stürzen.
Die Frau im Spiegel trug statt kurzer schwarzer Haare eine halblange Unfrisur, ein paar Silbersträhnen neu eingefädelt. Ansonsten zeigte sie dieselbe blasse Haut und die blaugrauen Augen, die schmale Nase und den breiten Mund ihrer Vorgängerin. Es kam Iris falsch vor, geradezu anmaßend, dass die Frau im Spiegel sich so wenig verändert hatte.
Iris hörte den Anrufbeantworter ab. Sie erschrak, als die Stimme ihres Lektors im Raum erklang. Es ging um die Erinnerung an den Abgabetermin ihres Romans im Mai. Er bat dringend um Rückruf.
Zum ersten Mal, beim Nachhausekommen, keine Nachricht ihrer Mutter. Früher waren Iris die Anrufe oft lästig gewesen, in denen Malou redete und redete; und wenn sie Iris doch einmal fragte, »und, wie geht’s dir?«, wusste sie darauf nichts mehr zu sagen. Malous Nummern waren alle noch eingespeichert. Festnetz, Handy, Krankenhaus, Pflegedienst. Doch abergläubische Scheu hatte Iris gehindert, eine Nachricht ihrer Mutter aufzubewahren, als könnte es die letzte sein. Nun waren alle gelöscht. Und Iris hatte Angst, solche Angst, Malous Stimme zu vergessen.
Um den Schreibtisch, der im Wohnzimmer am besten Platz stand, machte Iris erst mal einen Bogen. Nichts von dem, was hier entstand, über Tage, Monate, Jahre, existierte in Klein-Karo am Niederrhein. So war es schon immer gewesen.
Eine Staubschicht klebte auf dem Monitor, der Tastatur, dem Stapel mit ausgedruckten Anfängen. Im Stehen begann Iris zu lesen, blätterte durch die Seiten und schob den Stapel von der Tischplatte in den Papierkorb. Iris erkannte die Stimme, aber sie stimmte nicht mehr.
Koffer und Tasche waren ausgepackt. Iris drehte die Matrioschka in den Händen. Ging ins Wohnzimmer und stellte sie ins Bücherregal neben Frank McCourts Die Asche meiner Mutter. »Natürlich hatte ich eine unglückliche Kindheit«, hieß es darin, »eine glückliche Kindheit lohnt sich ja kaum.« Iris hatte keine unglückliche Kindheit. Es machte sie nur unglücklich, daran zu denken. Warum nur, warum?
Iris wanderte mit der Holzpuppe in die Küche, stellte sie aufs Fensterbrett zwischen die bis zur Unkenntlichkeit vertrockneten Kräuter (Berliner Mischung) und den Apfel aus Klein-Karo. Sie drehte die Puppe mit dem Gesicht zum Fenster, seitlicher Friedhofsblick. Vielleicht genügte zur Melancholie, was uns allen in den Knochen steckte: ein Säugling gewesen zu sein, zum Bersten erfüllt von Todesangst, weil die Mutter fort und die Welt leer ist; ein Schulkind, dessen Erdboden einbricht, weil es aufwacht und Gott tot ist; eine junge Frau, die vor Liebeskummer sterben und nichts wissen will von einer Zeit, die Wunden heilt.
Iris verfrachtete die Puppe in die Abstellkammer, schloss die Tür und lehnte sich von außen dagegen. Alle – alle außer Simone – hatten früher oder später die Geduld mit ihr verloren. Iris sagte es sich ja selbst. Jeden Tag starben Menschen an Unfällen, Hunger, Gewalt. Starben junge Menschen und Kinder. Jede Sekunde. Und sie war wegen eines Muttertods in den Brunnen gefallen? Ein Kind von vierundfünfzig Jahren.
Doch nun, mit der Abstellkammer im Rücken, dachte Iris: Vielleicht brauchen wir für den Eintritt ins Reich der Trauer nichts weiter als einen einzigen Tod. Steckte doch in jeder Trauer, wie in dieser Matrioschka, eine weitere Trauer: um die verflossenen Jahre und verstrichenen Augenblicke, um die Sommertage, die wir nicht miteinander am See lagen, Simone, und um diejenigen, an denen wir es lachend taten. So sind wir am Ende traurig um alles, was gewesen und nicht gewesen ist. Denn das eine wie das andere wird nie wieder sein.
Bossa nova schwappte aus einem Fenster, als Iris auf den Balkon in die laue Abendluft trat. Unten im Hof wurde gebechert und gelacht. In der Linde, die Iris zuletzt mit kahlen Ästen gesehen hatte, sang jetzt eine Amsel im dichten Blätterdach. Lange stand sie an der Brüstung und sah die apfelsinenrote Sonne sinken. Zuerst geht es lässig abwärts, dann schneller und am Ende eh du dich’s versiehst … Wie immer verließ Iris die Loge kurz vor dem Finale.
Gegen Mitternacht schreckte Iris aus dem Schlaf. Es war heiß und stickig, sie konnte kaum atmen. Auf der Kommode gegenüber vom Bett stand die Matrioschka und blickte sie an.
»Eine von uns beiden muss ausziehen«, sagte Iris. Mit der Holzpuppe im Arm ging sie im Nachthemd zur Wohnungstür. Dort kehrte sie um.
Die Matrioschka thronte in der Mitte des runden Küchentischs, umgeben von brennenden Teelichtern. Iris legte den schrumpeligen, doch noch immer rotwangigen Apfel dazu, den letzten seiner Art. Er stammte von Malous Dachterrasse. Fehlte bloß der Eierlikör. Iris hasste das klebrige, süße Zeug. Malou hatte es geliebt und aufgeben müssen, dann hoch die Tassen mit alkoholfreiem Sekt, bis auch das Feiern mit Freunden passé war und ein Malzbier auf der Couch mit der Tochter ein Feiertag.
»Prosit«, sagte Iris zur Matrioschka, leerte ein Glas Eierlikör aus Klein-Karo, dann noch eins und noch eins und wer weiß, vielleicht noch eins.
Malou hatte Kerzen- und Mondschein geliebt, Blumen wuchsen, wo sie ging und stand und schmückten ihr lockiges Haar, sie sang nicht melodisch, doch aus vollbusiger Brust, tanzte auf Tischen und wollte ans Meer, eine Romantikerin vor dem Herrn war Malou gewesen, doch die Herren in ihrem Leben bekamen meist bald kalte Füße. Früher oder später wurde es jedermann zu bunt. Auch ihre Tochter hielt sich lieber bedeckt, auch sie hatte abgewunken und abserviert, nun saß sie vor einem Häuflein Asche im Kerzenschein.
Kurz vor Schluss hatte Malou doch noch einmal Eierlikör gewollt, darauf käme es jetzt wohl nicht mehr an. Die Flasche war ungeöffnet geblieben. Dann eben beim nächsten Mal, hatte Malou zahnlos lachend zu Iris gesagt, die mit besorgtem Gesicht auf der Bettkante saß.
Iris stopfte sich den kleinen Apfel in den Mund, zerbiss ihn, bis ihr Schaum aus dem Mund quoll wie einem kauenden Pferd, aß ihn auf mit Kitsch und Stiel und spuckte nur die Kerne wieder aus. Sie strich der Matrioschka über das aufgemalte Kopftuch und gab ihr einen Kuss. Dann noch einen und noch einen und wer weiß, vielleicht noch einen. Sie wickelte die Puppe in das Lieblings-Shirt ihrer Mutter, mit bunten Blumen bedruckt, früher peinlich eng und am Ende viel zu weit.
Schwankend stand Iris auf und stützte sich auf die Tischkante. Der Bistrotisch begann zu kippen. Iris blies die Kerzen aus. »Wir müssen dann jetzt.«
Noch einmal dieser Gang. Und diesmal ganz allein.
In Gummischlappen und Shorts stieg Iris im Dunkeln die Treppen hinab, neunzig Stufen. Auf einer kam sie ins Stolpern, konnte sich eben noch fangen, ohne nach dem Geländer zu greifen. Mit beiden Händen hielt sie die Matrioschka an die Brust gepresst.
Erst auf der anderen Seite der Friedhofsmauer fiel Iris ein, dass sie keine Schaufel dabeihatte.
Als Iris aufwachte, war es beinahe Mittag. Sie fühlte sich leicht und klar. Mit einem Kaffee trat Iris auf den Balkon und blickte über den Friedhof, den sie öfter von hier oben betrachtet als betreten hatte: bis gestern ein kleiner Park vor der Tür, mit Bäumen, Bänken und berühmten Toten – ab heute die letzte Ruhestätte ihrer Mutter. Ob es der Weisheit letzter Schluss oder ein Kurzschluss war, sie nach dem Tod in die Nachbarschaft zu holen? Solange Malou ihr Leben lebte und sie ihre Tochter ab und an besuchen konnte in Hamburg und Amsterdam, Dublin und Berlin, war Iris nicht öfter als nötig »nach Hause« gefahren.
Einst hatte Iris nichts wie weggewollt. Da draußen gab es die große, weite Welt, Länder, Städte und Meere, Sprachen und Musik, Kunst und Revolte. In Klein-Karo gab es Baggersee und Kohlfelder, Kirmes und Schützenfest. Und immer das Gefühl: Hier kannst du nichts werden. Jahrzehnte hatte es gedauert, bis die Beklemmung nachließ, die sich einstellte, sobald von Weitem der Kirchturm in Sicht kam. Denn eine große Kirche hatte Klein-Karo, und das Land war flach und die Sprache Platt.
Iris zog Wahlheimaten und Wahlverwandtschaften vor. Das Erstaunen ihrer Wahlverwandtschaft aber, als Iris vorübergehend nach Klein-Karo zog, um die krebskranke Mutter zu pflegen, wandelte sich in Befremden, als sie nach deren Tod nicht mit wehenden Fahnen zurückkehrte. Woche um Woche ging ins Land, die Wohnung war besenrein, alles abgewickelt, was tat sie noch dort? Zeynep und Micha hatten angeboten, einen Kombi zu leihen und Iris abzuholen, das wollte was heißen.
Wenn die wüssten. Im tiefen, tiefen Tal ihres Heimatexils hatte Iris daran gedacht, für immer dort auszuharren. In der Wohnung ihrer Mutter, der Stadt ihrer Kindheit. Warum nicht, wie so viele es taten, sich stoisch einwurzeln, ausbreiten, überdauern, wohin einen der Zufall geweht hatte? An einem Ort wie tausend andere. Weder Großstadt noch Dorf, weder Berge noch Meer, weder Fisch noch Fleisch, weder heiß noch kalt.
Da war nur eine Sache, die Iris nicht auf Eis gelegt hatte während ihrer Abwesenheit. Weil es einfach außer Frage stand, sich weiter um ein winziges Wesen zu kümmern, dessen Patin sie geworden war, freiwillig und wahlverwandt. Der Blauschillernde Feuerfalter – eine der unzähligen vom Aussterben bedrohten Kreaturen – war einzigartig auf dieser Welt. Der metallisch blauviolette Glanz seiner Flügel wurde nur durch Lichtbrechung erzeugt und würde nicht verblassen – solange es Feuchtwiesen und kühle Sommer gab. Im Team Feuerfalter sorgte Iris von Berlin aus dafür, dass die Raupen in einem kleinen Gebiet nahe der Ostsee, wo die letzten Vorkommen im Tiefland existierten, genügend Schlangenknöterich, Sumpfdotterblume und Wiesenschaumkraut fanden. Auch in ihrer Zeit in Klein-Karo hatte Iris den Bestand der Falter über Webcams dokumentiert. Wer den Blauschillernden Feuerfalter zu Gesicht bekommt, hat Glück gehabt, hieß es. Iris hatte ziemlich oft Glück gehabt.
Im Bad stopfte Iris Wäsche in die Trommel, ein großer Haufen lag auf der Maschine. Ein Käfer hatte sich auf Malous Blumenshirt verirrt. Die Matrioschka war unverhüllt begraben, in den bunten Kleidern, die ihr auf den Leib gepinselt waren. Ihr runder Bauch enthielt außer der Hälfte der Asche ihrer Mutter ein wenig Mutterboden aus Klein-Karo. Iris trug den Käfer auf den Balkon und riet ihm, das Freie zu suchen.
Klein-Karo war nie eine Heimat, aber Iris kam von dort. Herkunft suchst du dir nicht aus, ebenso wenig wie Vater und Mutter. Auch Marieluise Feder hatte sich die Kleinstadt nicht ausgesucht, in der sie in den Siebzigern mit Mann und Töchterchen gelandet war, als Tagpfauenauge zwischen fleißigen Bienen, als Klatschmohnsamen im Stiefmütterchenbeet. Auch Malou hatte nicht an diesen Ort gepasst und doch Wurzeln geschlagen, ihren Frieden gemacht. So hoffte Iris jedenfalls.
Apropos Wurzeln schlagen. Iris nahm eine Plastikdose aus dem Kühlschrank und öffnete den Deckel. Fein säuberlich zwischen feuchten Lagen Küchenpapier ruhten die Apfelkerne. Nach ein paar Wochen simuliertem Winterschlaf würden sie bereit sein, an den Frühling zu glauben und anfangen zu keimen.
Mit einer Gießkanne ging Iris hinaus und durch das Friedhofstor, an der Mauer entlang, am ockergelben Haus und an der Kapelle vorbei. Sie bog am Lutherstandbild ein, ließ Thomas Brasch, Stephan Hermlin und Christa Wolf links liegen, John Heartfield, Günter Gaus und Edgar Hilsenrath rechts. Unter der Kastanie würde Malou keine ewige Ruhe haben, dafür war gesorgt. Hier gab es Blätter und Blüten, Mondschein und Kerzen. Im Frühjahr prachtvoll rosarote, entzündet vom Baum, im Winter stinknormale von der Tochter. In den Zweigen sangen Amsel, Drossel, Fink und Star. Selbst ein Kuckuck war gesichtet worden, so wie auf Malous von den Eltern geerbten Möbeln nach ihrer Scheidung. Und war nicht auch die Matrioschka ein Kuckucksei, dem Friedhof von Iris ins Nest gelegt?
Zu Nachbarn hatte Malou nun nicht mehr Frau Schulz, die Schnecken mit der Gartenschere entzweischnitt, und Herrn Roberti, der zweimal die Woche sein Auto und zu Feiertagen die Haare wusch, sondern Menschen mit Talenten und Temperamenten. Hier lag Marieluise Feder in der ersten Reihe. In den Brettern, die die Unterwelt bedeuten, deklamierten Otto Sander und Inge Keller, Hilmar Thate und Jutta Lampe in einer Inszenierung von Jürgen Gosch. Iris wusste nicht, warum es sie zu dieser Stelle unter der Kastanie gezogen hatte, doch sie war froh über ihre Wahl, als sie entdeckte, dass auch die Schauspielerin Renate Krößner in der Nähe lag. »Ich würde es gern machen«, hatte sie als Solo Sunny beim Vorsingen für die neue Band gesagt. »Ich schlafe mit jemandem, wenn es mir Spaß macht. Ich nenne einen Eckenpinkler einen Eckenpinkler. Ich bin die, die bei den Tornados rausgeflogen ist. Ich heiße Sunny.« Auch Iris’ Mutter hatte die Männer nach Gusto statt Geldbeutel ausgewählt und einen Eckenpinkler stets einen Eckenpinkler genannt. Beides nicht immer zu ihrem Vorteil. Und doch, so ließ es sich leben, vielleicht nur so. Eine Frau, an die man sich erinnert. Jeden Morgen und Abend in der blauen Stunde betrat Solo Sunny die von Kastanienkerzen erleuchtete Bühne und sang:
»Red, the sun is rising red / And all my love you’ll get / When you will come and stay / Someday.«
But nobody stayed.
Die Erde um den Lavendel glänzte feucht und dunkel. Jemand war Iris zuvorgekommen. Wer, wenn nicht der bezopfte Frühaufsteher, der Ritter vom weißen Frotteetuch. Was hatte der Mann ihre Mutter zu gießen, besaß er keine eigene?
»Aber du musst mir auch was versprechen, Iris.« Seine Stimme hatte sie noch im Ohr. War das eine freundliche Einladung oder doch eher ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Iris ging vor dem Lavendel in die Hocke. Und wie, bitte, kam er zu der Annahme, sie wäre scharf darauf, weiteren Unbekannten ihr Herz auszuschütten wie schmutzige Seelenlauge? Sie brach ein Zweiglein ab und drehte es in ihren verpflasterten Händen. Iris mochte keine Gruppen, hatte Gruppen nie gemocht und würde auch diese Gruppe nicht mögen. Deshalb würde sie ja auch gar nicht erst hingehen.
»Und um wen trauert er so abgrundtief, wenn man mal fragen darf«, murmelte Iris in den Lavendelbusch, »dass er nachts auf dem Friedhof geistert?« Auf dem Rückweg würdigte Iris die Bank unterm Maulbeerbaum keines Blickes. Schuld war einzig der verfluchte Eierlikör!
Zu Hause sog sie den Duft des Lavendels ein. Ach, Mama. Bücher hatte Malou nicht so gern gelesen, aber Reiseprospekte durchblättert. Südfrankreich war voller Eselsohren. Die Provence lag violett gewellt unter gelben Haftklebezetteln. Frühbucherrabatte winkten mit Ausrufezeichen.
Jederzeit wäre Malou mit Iris gefahren. Jederzeit.
Nebenan war die Waschmaschine im Schleudergang. Iris ging ins Bad. Bunte Blumen auf weißem Stoff klebten im Bullauge, wirbelten im Kreis. Der Boden bebte.
Plötzlich Stille. Von einer Sekunde zur anderen.
Iris sackte auf dem Wannenrand zusammen. Das Display zeigte Ende. Einfach so.
Iris trat in das letzte Zimmer am Ende des langen Gangs. Sie sah auf das einzige belegte Bett am Fenster, die alte Frau, die reglos darin lag. Eine Entschuldigung murmelnd wandte sie sich ab. Erst später konnte sich Iris erklären, wie es dazu gekommen war, dass sie ihre Mutter nicht erkannte.
In guten wie in schlechten Zeiten, auf Tischen tanzend und am Tropf der Chemo, und bis zuletzt war ihre Mutter voller Leben, selbst dann noch, als sie einen Rollator brauchte, Beinwickel und Windeln, eine sprechende Uhr und Lupen, Hilfe zum Waschen, Anziehen und Essen.
Bei der Frau am Fenster war nichts davon zu spüren.
Sie drehte nicht den Kopf, als Iris an ihr Bett trat. Ihre Hände verharrten, nebeneinander drapiert, auf der weißen Decke. Sie sprach kein Wort, als Iris sich zu ihr beugte, sie berührte: »Malou!«
Die Hände ihrer Mutter waren stets in Bewegung gewesen, beim Reden, beim Stillsitzen, sodass es nie still blieb, nicht eine Sekunde. Den Strom der Worte und Gesten zu entschlüsseln hatte Iris gefordert wie ein fremdsprachiger Film mit fremdsprachigen Untertiteln. Die Muttersprache hatte sie nie gut verstanden. Es machte sie müde und mürbe, all das Meinen, Wollen und Wünschen, das Iris nie und nimmer erfüllen konnte. Vielleicht auch gar nicht sollte. Eben das verstand sie ja nicht.
Jetzt jedoch, in dieser Stille am Ende des Gangs, hätte Iris viel gegeben für ein paar Worte: Da bist du ja! Eine herrische Geste: Wo bleibt mein Essen? Das Tablett mit Graubrot, Teewurst, Gurkensalat stand unangerührt auf dem Krankenhaus-Rolltisch.
»Hast du Durst?« Malou antwortete nicht, nickte nicht. Reglos ruhten ihre Hände auf der Decke, als hätte sie nichts mehr mit ihnen zu schaffen. Iris hielt ihr die Schnabeltasse mit Wasser an die Lippen. Sie blieben geschlossen, nichts wollend, nichts abweisend. Iris erkannte ihre Mutter nicht wieder.
Eine Frau mit Kittel und Maske kam ins Zimmer, räumte das volle Tablett auf den Wagen und schob ihn wieder hinaus. Iris stellte ein Bild auf den Rolltisch neben dem Bett. Ihre Mutter im Mittelpunkt, klein, aber noch kräftig, fröhlich lachend, eingerahmt vom breitschultrigen, lächelnden Sohn und von der schmalen, ernst blickenden Tochter. Aufgenommen im vorvorletzten Sommer auf Malous Dachterrasse.
Jetzt hielt Iris ihrer Mutter, die nur noch halb so viel wog wie die vergnügte Frau zwischen ihren üppig grünenden Pflanzen, das Foto gar nicht erst vor die Augen. Ein Bild aus einer fernen Zeit, in die Malou Feder nie zurückkehren würde. Ebenso wenig wie in ihre Wohnung und auf die unerreichbare Dachterrasse, wo im Niemandsland zwischen Rhein und Ruhr ein Apfelbäumchen und Zitronen blühten. Kennst du das Land …?
Hastig hatte Iris in Malous Wohnung eine Tasche gepackt, frische Nachthemden, Unterhosen, Waschlappen, Kukident und die Cracker, die Malou so gerne aß. Gegessen hatte. Zuletzt hatte Iris das Foto mit dem geklebten Rahmen eingesteckt. So stand nun das notdürftig geflickte Bild vergangener Tage neben der nutzlosen Brille, dem unnützen Gebiss in der von Iris in Großbuchstaben mit »ZÄHNE« beschrifteten Plastikdose, der zwecklosen Fernbedienung für den Fernseher und dem unerreichbaren Telefon. Malou aß nicht mehr, Malou sah nicht mehr, schon gar nicht in die Ferne.
Der größte Schrecken, als Iris eben ans Bett ihrer Mutter trat: die nach innen gekehrten Augen. Im letzten Jahr war sie fast blind geworden. Und dennoch hatten Malous grüne Augen geleuchtet, begehrlich, begeistert, zornig, empört, amüsiert. Jetzt nicht mehr. Stumpf, ohne Glanz, blickten sie Iris an. Durch sie hindurch.
Iris sah aus dem Fenster in die Dämmerung. Weit unten im Hof des Krankenhauses bewegten sich vermummte Menschen durch den einsetzenden Schneeregen. Dem Januarnachmittag ging unwiderruflich das Licht aus.
Zwei Tage und Nächte waren vergangen, seit sie Malou zu Hause abgeholt hatten, mit hohem Fieber, als Covid-Verdachtsfall. Zwei Tage und Nächte, in denen ihre Mutter im Isolierzimmer lag, bis sie unverdächtig war, versorgt von Menschen in Schutzanzügen.
»Mama«, sagte Iris, die ihre Mutter seit vierzig Jahren nicht mehr so nannte, »weißt du, wer hier ist?«
»Ja«, sagte ihre Mutter, »Iri!«
Iris, ein Name, der keine Abkürzung erlaubte. Ihre Mutter hatte dennoch einen Kosenamen für sie gefunden, hell und zärtlich wie der Ruf eines Vogels. Eines einst wilden und bunten, nun zerrupften, flugunfähigen Vogels.
Iri – ihre Mutter war der einzige Mensch auf der Welt, der sie so nannte. Iris wollte ihre beiden Worte in Seidenpapier wickeln und nach Hause tragen.
Eine Krankenschwester kam herein, sah nach dem Beutel mit Urin, der Infusionsflasche mit Nährlösung. Ein voller Beutel wurde durch einen leeren ersetzt, eine leere Flasche durch eine volle. Alles ging zügig und beinahe wortlos vonstatten.
Besuche im Krankenhaus waren noch immer nicht erlaubt; Iris war dankbar, dass man bei ihrer Mutter eine Ausnahme machte. Und sie wusste, was es bedeutete. Vorhin hatte sie mit dem Arzt gesprochen. Er kannte ihre Mutter von früheren Aufenthalten, das war tröstlich. Er weiß, dass sie ein Mensch ist, dachte Iris.
Der Arzt war jung und freundlich, er machte ihr keine Illusionen. Iris hatte ihm die Patientenverfügung ausgehändigt und die Vollmacht ihrer Mutter, in der ihr Bruder Florian und sie seit Jahren eingetragen waren, in der krakeligen Schrift der umerzogenen Linkshänderin. Eingeschult in einer Zeit, als alles Linke ausgemerzt wurde im Deutschen Reich.
Vielleicht war die Frage, vor der Iris nun stand, die bisher schwerste ihres Lebens. Doch auf den schwankenden Brettern dieses Augenblicks fiel ihr, die oft endlos abwog und zweifelte, die Antwort leicht. Sie müsse noch ihren Bruder fragen, sagte sie, aber von ihr aus (und dieses »von ihr aus« meinte Malou): keine künstliche Beatmung, keine Wiederbelebung im Notfall, nicht noch einmal eine Verlegung auf die Intensivstation. Der junge Arzt schien erleichtert.
Die Dämmerung war in Dunkelheit übergegangen, der Schneeregen in Schnee. Iris machte sich auf die Suche nach einem Kaffeeautomaten. Die Cafeteria war geschlossen. Im Sommer hatte sie dort täglich Eis geholt, Eis ging immer bei Malou, auch wenn ihr sonst kaum noch etwas schmeckte. Iris hatte nie Appetit im Krankenhaus.