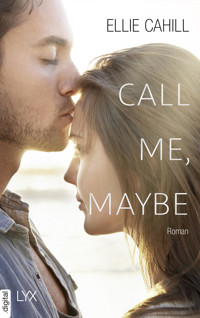
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
CALL ME, MAYBE? Den Uniabschluss frisch in der Tasche befindet sich Clementine Daly auf dem Weg nach Kalifornien, als sie am Flughafen buchstäblich in den Schoß eines Fremden stolpert. In dem darauffolgenden Durcheinander verwechselt sie sein Handy mit ihrem eigenen und steckt es ein. Als Clem den Fehler bemerkt, liegen zwischen ihr und Justin Mueller bereits Tausende von Meilen. Clem und Justin beginnen sich Nachrichten zu schreiben und lernen einander immer besser kennen. Und bald schon geht das, was zwischen ihnen passiert, weit über harmloses WhatsApp-Flirten hinaus ... Doch was passiert, wenn sie sich wieder wahrhaftig gegenüberstehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung123456789101112131415161718192021222324DanksagungenDie AutorinEllie Cahill bei LYXImpressumELLIE CAHILL
Call me, maybe
Roman
Ins Deutsche übertragen von Stephanie Pannen
Zu diesem Buch
Clementine Daly darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, seit Handyfotos von ihr in falsche Hände geraten sind und ihrer einflussreichen Unternehmerfamilie beinahe einen handfesten Skandal beschert hätten. Obwohl sie nichts lieber tun würde, als tagelang nur zu lesen und Bücher auf ihrem Blog vorzustellen, schicken ihre Großeltern sie quer durch die USA, um den Daly-Namen wieder ins rechte Licht zu rücken. Als Clem auf dem Weg nach Kalifornien am Flughafen mit einem Fremden zusammenstößt und in dem darauffolgenden Durcheinander ihr Handy mit seinem vertauscht, kommt das für sie einem Weltuntergang gleich. Denn als sie das Missgeschick bemerkt, liegen zwischen ihnen bereits Tausende von Meilen. Auch Justin Mueller, der sich mittlerweile in Chicago auf der Hochzeit seiner Schwester befindet, ist alles andere als begeistert von der Verwechslung. Doch als die beiden beginnen, sich Nachrichten zu schreiben, wird schnell klar, dass sie mehr miteinander verbindet als ein vertauschtes Handy. Die Nachrichten, die höflich und reserviert beginnen, werden lustiger, freundschaftlicher. Und bald geht das, was zwischen ihnen passiert, weit über harmloses Handy-Flirten hinaus. Doch was ist, wenn Clem und Justin sich im wahren Leben wieder gegenüberstehen?
Für die Buchbloggerinnen, die Liebesromanleserinnen und die Fangirls.
Lasst euch niemals eure Begeisterung nehmen.
1
»Aufruf an alle Passagiere für Flug 1873 nach Miami – wir beginnen jetzt mit dem Boarding …«
Unvermittelt wurde ich aus dem neunzehnten Jahrhundert gerissen. Es war mir gelungen, die ständig wiederholten Ansagen auszublenden, aber irgendjemand schnäuzte sich in meiner unmittelbaren Nähe die Nase, und das war einfach zu viel. Die Prinzen und Spione meines Liebesromans würden warten müssen. Ich schaltete meinen E-Reader aus und warf der Boarding-Mitarbeiterin einen wütenden Blick zu, auch wenn sie mindestens zehn Meter von mir entfernt war und vollkommen unbekümmert darauf reagierte.
»Ist dir schon mal aufgefallen, dass über einen Lautsprecher alle Stimmen gleich klingen?«, fragte Honor mit einem Gähnen.
Ich hörte auf, der Frau böse Blicke zuzuwerfen, und lauschte einen Moment. »Du hast recht.«
Honor sah mich übertrieben vornehm an und sprach mit einem affektiert klingenden Akzent. »Wir hätten eben doch den Privatjet nehmen sollen.«
Ich verdrehte die Augen. »Weißt du, langsam frage ich mich, ob du es nicht vielleicht doch ernst meinst, wenn du so redest.«
Er grinste. »Erste Klasse fliegen ist so gewöhnlich, meine Liebe.«
»Versuch es irgendwie durchzustehen, alter Knabe.« Ich klopfte meinem Bruder auf die Schulter und stand auf. »Ich geh noch mal schnell auf die Toilette, bevor es losgeht.«
»Dann beeile dich lieber, wenn du den ersten Cocktail vor dem Flug nicht verpassen willst.«
»Es ist sechs Uhr morgens!«
»Klingt nach der perfekten Cocktailstunde«, sagte er.
»Behalte bitte meine Sachen im Auge, ja?«
»Ich sollte mich weigern«, scherzte Honor und deutete in Richtung Lautsprecher, aus dem Hintergrundmusik und die bekannten »wichtigen Sicherheitshinweise« drangen. »Die Vorschriften, du weißt schon.«
»Was soll ich sagen?« Ich zuckte mit den Schultern. »Ich lebe einfach gern gefährlich.« Was nicht stimmte, und das wussten wir beide.
Ich drehte mich um und fiel fast über einen Koffer, den jemand direkt hinter mich gestellt hatte. Er kippte um, gegen den Laptop auf den Knien eines wartenden Passagiers. Ich wirbelte mit den Armen und kippte fast auch noch auf seinen Schoß. Nur indem ich mich auf seiner Schulter abstützte, fand ich mein Gleichgewicht wieder.
Er streckte seinen Arm aus, um den Koffer festzuhalten und seinen Laptop zu retten, bevor dieser auf den Boden stürzen konnte. »Hey!«
Ich hätte mich gleich wieder aufrichten sollen, aber als ich aufsah, ließen mich seine blauen Augen innehalten. Sie waren strahlender, als sie um diese unmenschliche Uhrzeit hätten sein dürfen, und blickten aus einem Gesicht heraus, das so umwerfend war, dass ich fast vergaß, warum ich mich überhaupt zu bewegen begonnen hatte.
»Tut mir leid«, keuchte ich und starrte weiter in seine Augen. Sie waren blau und von dunklen Wimpern eingerahmt.
»Sind Sie okay?«, fragte er.
»Ich bin … ich bin in Ordnung.« Meine Stimme klang ganz seltsam.
Er lächelte und zeigte dabei zwei Grübchen und gleichmäßig weiße Zähne. Sein Kinn sah aus wie gemeißelt, und seine volle Unterlippe ließ dieses Lächeln noch überwältigender wirken. »Bist du sicher?«
»Wir möchten nun die Passagiere der ersten Klasse an Bord begrüßen, zusammen mit unseren Platinumkartenbesitzern …« Wieder ließ mich der Lautsprecher zusammenzucken.
»Danke. Ich meine, Entschuldigung. Ich … ich bin in Ordnung. Tut mir leid«, plapperte ich vor mich hin, richtete mich auf und nahm meine Hand von seiner Schulter. Auch wenn ich mir sofort wünschte, ich hätte ihr mehr Beachtung geschenkt, solange ich ihn noch berührt hatte, denn es war eine wirklich nette Schulter.
Sein Lächeln wurde tiefer, und wieder erschienen diese Grübchen. Meine Güte, war er süß. Seine kurzen strohblonden Haare waren ein wunderbarer Kontrast zu den unglaublich blauen Augen. »Schon okay«, sagte er.
Honor pikste mir in den Rücken. »Wir müssen gleich einsteigen.«
»Stimmt.« Ich ging um den Koffer herum und marschierte Richtung Toilette. Dabei drehte ich mich nur zweimal nach dem hübschen Fremden um. Beim zweiten Mal sah er mich auch an, und wir hielten so lange Augenkontakt, dass ich fast gegen einen Mülleimer gelaufen wäre. Der Kerl sah aus wie ein Model aus einem dieser Liebesromane, und zwar nicht wie die alten. Sondern wie die, die wie die tatsächlichen Charaktere in den Büchern aussahen. Mjam.
Normalerweise stand ich gar nicht so auf den typisch amerikanischen Sunnyboy: blonde Haare, blaue Augen, ein kantiges Kinn und die augenscheinlich starken Schultern unter seinem weichen marineblauen Polohemd. Ein Anzug mit Krawatte hätte ebenso angemessen an ihm ausgesehen wie eine Lederjacke und ein blaues Auge. Also ein Veilchen, denn blaue Augen hatte er ja ohnehin. Ich wollte ihn nicht anhimmeln, aber dieser Zug war bereits abgefahren.
Auf der Toilette gab es über den Waschbecken eine lange Reihe Spiegel, und ich konnte nicht widerstehen mir anzuschauen, was er gesehen haben könnte. Leider war es der übliche Standardanblick. Mein durchschnittliches, langes braunes Haar war vom Schlaf zerzaust, aber nicht auf die sexy Victoria’s-Secret-Art, und meine durchschnittlichen braunen Augen wirkten aufgrund der frühen Uhrzeit und des Koffeinmangels ein wenig müder als sonst. Dazu passten der gestreifte Maxirock und das weiße Tanktop, die ich über meinen durchschnittlich großen und mit einem durchschnittlichen Gewicht ausgestatteten Körper gezogen hatte. Das einzig Überraschende an mir war mein Name – Clementine. Doch es war eher unwahrscheinlich, damit meinen Liebesromanhelden beeindrucken zu können, nachdem ich ihm fast in den Schoß gefallen wäre und seine Sachen zerstört hätte. Gut gemacht, Clementine.
Der Lautsprecher erwachte erneut zum Leben. »Jetzt möchten wir alle Passagiere des Fluges 1873 nach San Diego an Bord begrüßen.«
Nachdem ich mir die Hände gewaschen hatte, fuhr ich mir mit den nassen Fingern durchs Haar und versuchte, den durch das Schlafen entstandenen Schaden wenigstens ein wenig zu beheben. Meine Großmutter wäre mit meiner Erscheinung nicht zufrieden gewesen. Sie glaubte immer noch daran, dass man sich fürs Reisen schick machen sollte, während meine Garderobe größtenteils aus Yoga-Kleidung bestand, die sehr wenig Yoga zu sehen bekam. Ich wusste zwar noch nicht so genau, was ich aus meinem Leben machen wollte, aber ich hatte bereits alles ausgeschlossen, was ein Damenkostüm und Stöckelschuhe voraussetzen würde.
Und auch wenn ich theoretisch gesehen im Namen unseres Daly-Familienunternehmens unterwegs war, hätte ich mir vielleicht doch etwas mehr Mühe geben können.
Jetzt war es zu spät dafür.
Wieder draußen im Gate-Bereich blieb ich erstaunt stehen, als ich Fremde auf den Plätzen sah, auf denen ich gerade noch mit Honor gesessen hatte. Ich hätte mich auch irren können, aber der süße Typ war noch da.
Ein kurzer Pfiff zog meine Aufmerksamkeit auf die Gangway-Tür, wo mein Bruder stand und mich wütend ansah. »Komm schon.«
»Mein Handy war da noch eingesteckt …« Ich deutete auf die Ladesäule an unseren Plätzen.
»Ich habe es«, rief er. »Los jetzt!«
Komplett verwirrt eilte ich zu ihm. Es war keine große Sache, aber die Vorstellung, dass er all mein Zeug zusammengepackt hatte, verstörte mich irgendwie. Wahrscheinlich hatte er alles an den falschen Platz gesteckt, und ich würde nichts mehr wiederfinden.
Er gab mir meine Bordkarte und meinen Trolley, dann bedeutete er mir mit einer Geste der Ungeduld, mich zu sputen. Als die Angestellte meinen Barcode einscannte, nickte sie mir zu. »Willkommen an Bord, Miss Daly.«
Während wir die Gangway hinuntereilten, tastete ich die Taschen meines Gepäcks ab.
»Wo hast du mein Handy hingetan?«
»Es ist irgendwo da drin«, sagte er. »Ich hab es schon auf Flugmodus gestellt. Mach dir keine Gedanken.«
Ich schnitt ihm hinter seinem Rücken eine Grimasse, aber er bekam es offensichtlich nicht mit.
Wir waren wirklich die letzten Personen, die an Bord kamen. Waren alle ins Flugzeug gerannt, oder war ich so lange auf der Toilette gewesen? Glücklicherweise war es nicht schwer, unsere Plätze zu finden – die letzten beiden freien in der ersten Klasse. Die Stewardess stand im Gang und wartete respektvoll auf uns.
»Mr Daly, Miss Daly«, sagte sie. »Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten, während Sie es sich bequem machen?«
Ich muss zugeben, dass ich sehr froh war, nicht als Ms Daly betitelt zu werden. Ich hatte fest damit gerechnet, auf dieser Reise ständig für die Frau meines Bruders gehalten zu werden. Denn obwohl die Tatsache, dass wir uns als Geschwister außerordentlich ähnelten, ein Hinweis hätte sein können, war es schon oft genug vorgekommen.
Honor und ich bestellten uns etwas zu trinken – er entschied sich für etwas Alkoholisches, aber ich wollte nur Kaffee –, und dann durchforstete ich meine Tasche, bis ich den E-Reader gefunden hatte, den mein Bruder gnadenlos irgendwo hineingesteckt hatte. Auf dem Boden der Tasche sah ich außerdem mein Handy, was bedeutete, dass ich Honor doch nicht würde umbringen müssen. Ein großes Plus. Ich seufzte glücklich, machte es mir auf meinem Platz gemütlich und bereitete mich auf einen langen Flug vor, auf dem ich lesen konnte, ohne gestört zu werden.
Ich hätte es besser wissen müssen.
»Du liest doch jetzt nicht die ganze Zeit, oder?«, fragte Honor.
»Doch, das ist so ziemlich mein Plan.« Ich lese nicht im Durchschnitt ein Buch pro Tag, indem ich nicht lese.
»Du willst mich einfach ignorieren?«
»Technisch gesehen nicht. Ich sitze ja direkt neben dir. Wir können es stilles Miteinander nennen, wenn du dich dadurch besser fühlst.«
Die Stewardess kehrte mit unseren Getränken zurück und fragte, ob wir sonst noch etwas brauchten.
»Nein danke, wir sind erst einmal gut versorgt.«
»Mein Name ist Serena, und ich bin während des ganzen Fluges für Sie da. Bitte zögern Sie nicht, sich zu melden, wenn Sie irgendetwas brauchen. Egal was.« Dabei strahlte sie uns so sehr an, dass ich schon befürchtete, sie würde platzen.
»Vielen Dank, Serena.« Honor prostete ihr zu.
»Sie ist ganz schön … eifrig für sechs Uhr früh.«
»Vielleicht war es doch kein Fehler, geschäftlich zu fliegen«, sagte Honor mit seinem nasalen Schickimicki-Akzent.
Ich sah ihn ausdruckslos an. »Großmama würde sagen, dass du aufhören sollst, so nouveau riche zu sein.«
»Großmama hätte den Privatjet genommen«, konterte Honor.
Wenn die Rede von Leuten ist, die mit einem Silberlöffel im Mund zur Welt gekommen sind, geht es um Menschen wie uns. Meine Familie ist das, was man als »alten Geldadel« bezeichnet. Die Dalys waren schon vermögend zur Zeit der Rockefellers, der Astors und der Carnegies – und durch eine Reihe geschickter Investitionen und vorteilhafter Eheschließungen waren sie das noch immer. Auch wenn diese Familien damals als »neureich« bezeichnet wurden. Und verglichen mit den europäischen Aristokraten, mit denen sie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gesellschaftlich verkehrten, waren sie auch neu. Aber heutzutage ist ein Name wie Rockefeller – oder Daly – legendär.
Anders als die meisten meines Alters musste ich mich niemals um Studienkredite oder Miete sorgen. Als ich mit dem College anfing, kaufte meine Familie sogar ein Haus in der Nähe des Campus, in dem ich wohnen konnte.
Jetzt, nach meinem Abschluss, lebte ich immer noch dort, während ich herauszufinden versuchte, was ich als Nächstes tun wollte. Ich hatte einen Abschluss in Geschichte und englischer Literatur, und das qualifizierte mich für praktisch nichts, außer Getränke einzuschenken oder mit einem Koffer voller pharmazeutischer Proben von Krankenhaus zu Krankenhaus zu ziehen. Ich wollte und brauchte keinen Job anzunehmen, nur um über die Runden zu kommen, was mich zu einem weiteren arbeitslosen Mitglied unserer arbeitslosen Generation machte.
Ich weiß, ich weiß, armes reiches Mädchen. Leute wie ich haben es ja ach so schwer. Darum beschwere ich mich auch nicht laut. Ich will mich ja eigentlich gar nicht beschweren, aber irgendwie hatte ich eben erwartet, dass mir das College mehr bringen würde, als meinen Kopf mit interessantem Trivialwissen zu füllen.
Ein kleiner Ruck ging durch das Flugzeug, und es begann rückwärts vom Gate wegzurollen. Das Bordpersonal fing mit der üblichen Sicherheitseinweisung an. Als es zu dem Teil mit der Wasserlandung kam, lehnte sich Honor zu mir herüber und flüsterte: »Das wäre ganz schön verrückt, oder?«
Wir waren auf dem Weg nach Kalifornien, um meinen Onkel Nelson zu besuchen und uns von ihm durch sein Immobilienimperium führen zu lassen. Mein Bruder machte diesen Sommer ein Praktikum in der Daly-Stiftung, also ergab diese Reise für ihn irgendwie einen Sinn. Ich hingegen war mir ziemlich sicher, dass meine Beteiligung nur ein weiterer Versuch meiner Großeltern war, mir dabei zu helfen, meinen Platz im Leben zu finden. Der Daly-Familienbesitz bot mit Sicherheit eine Menge Möglichkeiten. Und die Vetternwirtschaft dieser vornehmen Institution bedeutete, dass ich die freie Auswahl hatte.
Es war eines dieser typischen Erste-Welt-Probleme, und ich wollte nicht einmal mit meinen Brüdern oder meiner Schwester darüber reden, obwohl Letztere mich bestimmt verstanden hätte. Die Älteste, meine Schwester Prudence, war in ihrem dritten Jahr an der medizinischen Fakultät der Rush-Uni. Mein ältester Bruder Merit schrieb an seiner Doktorarbeit in Wirtschaftswissenschaft und leitete parallel Kurse an der Universität von Chicago. Und Honor, der Jüngste der Sippe, machte gerade seinen Abschluss in Betriebswirtschaft in Princeton, wenn er nicht über die Sommerferien daheim war.
Ich wäre ja der Familientradition gefolgt und auf eine prestigeträchtige Universität gegangen – in diesem Fall also die Universität von Chicago –, aber ich schien die Einzige zu sein, die keine Ahnung hatte, was sie aus ihrem Leben machen sollte. Vielleicht hatte ich irgendwo einen Kurs mit dem Namen Erwachsen werden für Anfänger verpasst.
Was ich wirklich gerne tat, war lesen. Das tat ich mit Leidenschaft. Meine Augen sehnten sich nach Wörtern und gabelten sie überall auf. Unter der Dusche las ich die Inhaltsangabe von Shampooflaschen, beim Frühstück die Rückseite der Cornflakes-Packung und im Restaurant jeden einzelnen Punkt auf der Speisekarte. Sobald ich ein Buch beendet hatte, begann ich auch schon mit dem nächsten. Der Tag, an dem ich meinen E-Reader bekommen hatte, war einer der glücklichsten meines Lebens gewesen, weil er bedeutete, dass mir niemals wieder die Bücher ausgehen würden.
»Oh, jetzt mach schon«, sagte Honor genervt.
»Was denn?«
»Lies dein dämliches Buch.« Er deutete auf meinen Schoß, auf dem mein E-Reader lag. »Du streichelst immer wieder den Einschaltknopf. Es ist erbärmlich.«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. »Wer hat dich denn gefragt?«
»Du bist wie ein Junkie. Du hast ja schon Entzugserscheinungen.« Er zitterte dramatisch mit den Händen.
»Du kannst mich mal, Honor.« Aber ich schaltete dennoch den E-Reader ein und tauchte wieder in meine historische Liebesgeschichte ab.
Als wir landeten, hatte ich diesen Roman beendet und mit dem nächsten Band angefangen – am liebsten lese ich alles von einem Autor hintereinander weg. Ich hatte vor, eine Rezension der gesamten Reihe für meinen Buchblog zu schreiben. Das schien mir eine gute Idee zu sein, da es sich um ältere Bücher handelte. Normalerweise rezensierte ich Neuerscheinungen, aber ich schob gelegentlich gerne ein paar meiner älteren Lieblingsbücher dazwischen.
»Meine Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen unseres Bordpersonals in San Diego begrüßen. Die Ortszeit beträgt …« Ich blendete den Rest der Durchsage aus und bemühte mich, noch schnell das Kapitel fertig zu lesen, bevor ich meinen E-Reader wieder wegstecken musste, aber Honor schaltete bereits sein Handy wieder ein.
»Ich schreibe Nelson schnell, dass wir gelandet sind. Würdest du Großmama Bescheid sagen? Du weißt doch, wie sie ist.«
Das war noch milde ausgedrückt. Unsere Großmutter verärgerte man lieber nicht. Für sie war ich sogar bereit, mein Buch wegzulegen. Ich zerrte meine Tasche aus dem Fach und ging die einzelnen Fächer durch. Endlich stieß meine Hand an das kühle Display. »Aha.«
Ich schaltete das Handy aus dem Flugmodus wieder in den normalen Betrieb und ließ es nach einem Signal suchen. Sofort begann es, vor Dutzenden eingehender Nachrichten und Anrufe zu summen.
Sie waren alle von einer sehr vertraut wirkenden Nummer, aber ich brauchte wirklich ein paar Sekunden, um zu begreifen, was ich sah.
Es war meine eigene Nummer.
2
»Was zum Teufel …?«
Honor sah zu mir herüber. »Was ist los?«
»Mein Handy spinnt total. Es hat mir einen ganzen Haufen Textnachrichten von mir selbst geschickt. Guck dir das mal an.« Konnte man sich mit dem Handy einen Virus einfangen? Ich hielt das Telefon meinem Bruder hin.
Honor starrte es blinzelnd an, dann sagte er mit schreckgeweiteten Augen: »Oh Mist.«
»Was denn?«
»Das ist nicht dein Handy.«
»Was?!« Ich riss es wieder an mich, um mich selbst davon zu überzeugen.
Unter meiner Nummer war der Inhalt der Nachrichten nur teilweise sichtbar, aber es war nicht schwer, sich den Rest zusammenzureimen.
+1 (847) 555-2015
Sie haben mein Handy! Bitte kommen Sie zurück zum …
+1 (847) 555-2015
Wer sind Sie? Ich habe Ihr Handy …
Oh. Mist.
Ich entsperrte das Handy und suchte hektisch nach der Messenger-App. Sie war nicht dort, wo ich sie auf meinem Display hatte. Als ich sie fand, stand dort in einem kleinen roten Kreis die Zahl 15. Bei den Anrufen befand sich ebenfalls ein Kreis, darin stand die Nummer sechs.
Oh. Doppelmist.
Ich sprach es laut aus. »Das ist definitiv nicht mein Handy.«
»Hab ich doch gesagt. Wem gehört es?«
Ich scrollte durch die zunehmend verzweifelten Nachrichten von meiner Nummer. Wer immer auch mein Handy hatte, gab nicht seinen Namen an.
Ich wählte meine Nummer. Vor Aufregung drehte sich mir der Magen um, und plötzlich war ich hellwach.
Ring.
Nein nein nein nein nein nein nein, so etwas konnte mir doch nicht passieren.
Ring.
Honor musste am Flughafen das falsche Handy genommen haben!
Ring.
Wer zum Teufel hatte mein Handy?
Ring.
Gott, es könnte überall sein. Es könnte sich schon auf halber Strecke nach Kathmandu befinden!
Der Klang meiner eigenen Stimme ließ mich zusammenzucken. »Hi, dies ist der Anschluss von Clementine. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.«
Während mir die automatisierte Stimme am Ende meine Optionen vortrug, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, was ich sagen sollte. Aber jetzt war es zu spät, darüber nachzudenken. Piep.
»Ähm, hi. Ich bin die Person, die Ihr Handy hat. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ähm … ich, äh … bitte rufen Sie mich zurück, damit wir überlegen können, was wir tun können.«
Als ich auflegte, warf ich Honor einen tödlichen Blick zu. »Du hast das falsche Handy mitgenommen!«
»Da war sonst keines mehr!«, protestierte er.
»Offensichtlich nicht.« Meine Hände krümmten sich fest um das fremde Handy, während ich gegen den Drang kämpfte, ihm gegen die Schulter zu boxen.
»Ich schwöre es, Clementine, es war das einzige, das noch da war. Du hast es eingesteckt gelassen, ich habe es genommen, Ende der Geschichte.«
»Aber was ist denn da passiert?«
»Woher soll ich das wissen?«
Serena, die Stewardess, erschien besorgt im Gang. »Alles in Ordnung?«
»Alles wunderbar«, blaffte Honor.
»Sei kein Idiot. Es ist nicht ihre Schuld.«
»Meine ist es aber auch nicht«, erwiderte er.
»Tja, meine ist es auf keinen Fall!«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen, dann sah ich Serena an. Zeit, meine Großmutter zu imitieren. Ich schenkte ihr mein bestes Miriam-Schulman-Daly-Patrizier-Lächeln. »Alles in bester Ordnung. Nur ein kleines Problem mit meinem Handy. Vielen Dank.«
Der Pilot bremste die Maschine ab, als wir an unserem Gate ankamen. Das Flugzug füllte sich mit dem metallischen Klicken von Sitzgurten. Serena eilte zurück in den vorderen Teil des Flugzeugs, und Honor stand eilig auf, als sei er entschlossen, der Erste zu sein, der das Flugzeug verlässt. Ich nahm an, dass dies seine Art war, nicht länger über diese Sache reden zu müssen.
Wahrscheinlich war es so auch am besten. Weil ich ihn nun doch töten würde.
Er schien die ganze Zeit entschlossen, Abstand zu mir zu halten, was ihm mithilfe seiner langen Beine auch gelang, vom Terminal über die Aufzüge zur Gepäckausgabe. Als ich ihn endlich eingeholt hatte, war ich ganz außer Atem, aber das würde mich nicht aufhalten. Oh nein. Je länger ich darüber nachdachte, desto wütender wurde ich. Ich pikte meinem Bruder in den Hinterkopf.
»Ich schwöre dir, Honor, wenn wir nicht von Zeugen umgeben wären …«
Mürrisch drehte er sich um. »Es ist möglich, dass doch zwei Handys eingesteckt waren, okay?«
»Ach ja, meinst du?«
Genau in diesem Moment begann das Handy in meiner Hand zu vibrieren.
»Oh Gott, das ist er – sie – wer auch immer.« Nicht einmal das wusste ich, da ich mir die zweifellos wütenden Voicemails nicht angehört hatte. Die Textnachrichten hatten mir schon gereicht.
Ring.
Würde man mich anbrüllen?
Ri–
»Geh endlich dran«, explodierte Honor.
Ich wischte über das Display. »H-hallo?«
»Hallo?«, sagte eine männliche Stimme, und ich erschreckte mich fast zu Tode. Es bestand eine fünfzigprozentige Chance, dass es ein Mann ist, du Genie.
»H-hi«, stotterte ich. »Ich bin die Idiotin, der unsere Handys verwechselt hat.« Es war wahrscheinlich am besten, es auf die demütige Tour zu versuchen.
Er seufzte, und ich hörte Rauschen im Ohr. »Hi. Danke, dass Sie angerufen haben.«
»Es tut mir sehr leid«, sagte ich.
»Ja, mir auch.« Er klang resigniert. »Was machen wir jetzt?«
»Ähm …« Ich hatte keine Ahnung. Was für Möglichkeiten hatten wir denn? Wahrscheinlich wäre es für mich am unkompliziertesten, mir ein neues Handy zu kaufen, mein altes stilllegen und meine Nummer auf das neue Handy übertragen zu lassen. Aber dann hätte dieser Fremde nur ein nicht funktionierendes Handy und ich immer noch seines. Er könnte theoretisch dasselbe tun, aber das setzte voraus, dass er dort, wo er war, ein neues Handy bekam. Und dass er genug Geld hatte.
»Ich könnte es Ihnen per FedEx zuschicken«, bot ich an. Mein Herz blutete bei dem Gedanken, mein kostbares Handy einem Lieferdienst anzuvertrauen.
»Und in der Zwischenzeit sind wir beide ohne Handy.«
»Stimmt.« Ich folgte Honor auf Autopilot zur Gepäckausgabe. Meine ganze Konzentration war auf das Handy gerichtet.
»Und es setzt voraus, dass sie unsere Päckchen nicht verlieren.«
»Stimmt«, sagte ich und klang dabei viel lässiger, als ich mich fühlte. »Ist nicht meine Lieblingslösung …«
»Meine auch nicht …«, sagte die Stimme sanft. »Die Vorstellung, mein Handy niemals wiederzusehen, ist für mich schlimmer, als ich eigentlich zugeben möchte.«
Ich lachte und war froh, dass es nicht nur mir so ging. Wenn auch wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen. »Okay, was dann?«
»Wo wohnen Sie?«
»Chicago. Aber ich bin bis Freitag in Kalifornien.«
»Sie kommen aus Chicago?«, fragte er. »Ich auch. Aber ich bin in Florida bis Freitag.«
»Also warten wir einfach, bis wir beide wieder zurück sind, und tauschen?«
Er machte ein wimmerndes Geräusch. »Ich schätze, das müssen wir.«
»Ich verspreche Ihnen, dass ich es mit meinem Leben bewachen werde, bis ich wieder in Chicago bin.«
»Ich werde auf Ihres auch gut achtgeben.«
Ich fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. Ein Gefühl hatte von mir Besitz ergriffen, das ich das letzte Mal vor drei Jahren empfunden hatte, als wir darauf gewartet hatten, dass meine Großmutter aus dem OP-Saal nach ihrer Hüftoperation gefahren wurde. Was einfach lächerlich war in Anbetracht der Tatsache, dass ich dieses Handy für ein paar Hundert Dollar ersetzen konnte. Ich konnte meines und seines schnell mit ein paar Telefonanrufen und meiner American-Express-Karte erneuern.
»Es tut mir wirklich leid«, wiederholte ich.
»Wenn Sie es nicht mit Absicht getan haben, können Sie aufhören, sich zu entschuldigen. Wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen.«
»Stimmt.« Ich biss mir auf die Zunge.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
Meine Nerven zitterten vor vertrauter Anspannung. Aber er hatte mein Handy. Es gab nichts, was ich tun konnte, sollte er sich entschließen, Detektiv zu spielen. Oh Gott, ich hatte so hart daran gearbeitet, es sauber zu halten. Hatte ich irgendetwas übersehen? Etwas, das er benutzen konnte? Schließlich sagte ich: »Clementine.«
»Clementine?«, wiederholte er im Tonfall totaler Skepsis. Es war eine typische Reaktion.
»Ja.«
»Ich bin Justin. Ich würde ja sagen, es ist nett, Sie kennenzulernen, aber …«
»Ja, na ja. Danke, dass Sie es so locker nehmen, Justin.«
»Kein Problem. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Ihre Nummer ein paar Leuten gebe?«
Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was er meinte. Er brauchte immer noch ein Telefon, und momentan war meines das einzige, das er hatte.
»Nein, das ist schon in Ordnung. Machen Sie nur. Ich glaube nicht, dass ich allzu viele Anrufe bekommen werde. Alle wissen, dass ich unterwegs bin.«
»Sie können meine Nummer rausgeben, wenn Sie müssen.«
»Gleichfalls.«
»Okay …« Er wurde leiser und schien unsicher. »Ich nehme an, dass ich … Sie einfach verständige, wenn Sie eine Nachricht bekommen.«
»Ähm … das wäre gut … dann sprechen wir uns also später.«
Ich beendete das Gespräch und bemerkte, dass mich mein Bruder anstarrte. »War er sauer?«, fragte er.
»Er war aufgeregt, aber nicht wütend.«
»Warum ersetzt ihr sie nicht einfach? Sag ihm, er soll sich im nächsten Laden ein neues Handy kaufen.«
»Daran habe ich auch gedacht, aber vielleicht hat er gar nicht das Geld, um sich ein neues zu kaufen.«
»Dann gib es ihm.«
»Die Leute sind bei so etwas häufig komisch. Denkst du außerdem wirklich, dass ich ihn mit der Nase darauf stoßen sollte, dass er die persönliche Telefonnummer eines der reichsten Menschen des Landes hat? Wir haben doch keine Ahnung, was das für ein Typ ist.«
Er verzog das Gesicht, aber er wusste, dass ich recht hatte.
Die ganze Sache war echt übel. Meine Großeltern würden mich umbringen. »Oh mein Gott, Honor, du musst sofort Großmama anrufen!«
Er zögerte keinen Moment, sondern holte einfach sein Handy heraus und wählte. Er wusste, wie sie war. Wenn wir ihr nicht sagten, dass wir sicher gelandet waren, würde sie versuchen, mich anzurufen. Und das letzte, was der arme Kerl, dessen Tag ich bereits ruiniert hatte, brauchte, waren eine Million Anrufe von Miriam Schulman-Daly, die es so lange probieren würde, bis jemand dran ging.
»Sag ihr nicht, dass ein Fremder es hat! Sag ihr, ich hab es zu Hause vergessen!«, fügte ich schnell hinzu und zog Honor dabei am Ärmel, um mich zu vergewissern, dass er es mitbekam.
Er winkte ab, aber ich nahm an, dass er die Ausrede schon weitergeben würde. Während ich darauf wartete, dass Honor die Situation erklärte, summte das Handy mit einer neuen Nachricht von meiner Nummer.
Tut mir leid, wenn ich am Telefon ein Idiot war. Ich bin nur frustriert.
Ich erwiderte: Waren Sie nicht. Keine Entschuldigung nötig.
Wir haben uns jetzt erst mal gegenseitig am Hals. Eine Entschuldigung ist definitiv nötig.
Ich bin diejenige, der es leid tut. Mein dämlicher Bruder hat das falsche Handy genommen.
In Ordnung, dann tut es uns eben beiden leid, und die Schuld geben wir Ihrem Bruder, einverstanden?
Ich lächelte. Wer war dieser Kerl?
Einverstanden.
3
Während der Fahrt vom Flughafen zum Haus meiner Tante und meines Onkels tippte Honor fröhlich auf seinem Handy herum. Beantwortete E-Mails, las Nachrichten, chattete mit seinen Exfreundinnen – was Beziehungen anging, hatte mein Bruder nie solche Hemmungen wie ich. Aber sein gesamtes Leben war auch nicht von einer Exfreundin auf den Kopf gestellt worden.
Ich entschloss mich, wieder in mein Buch einzutauchen. Dort drin fühlte ich mich sicherer, da die Probleme nicht meine waren und garantiert innerhalb von vierhundert Seiten oder weniger gelöst würden.
Nach ein paar Minuten zeigte mir Honor sein Display, damit ich eine Textnachricht von unserer Schwester Prudence lesen konnte.
Bitte sag mir, dass auf ihrem Handy nichts ist, was uns in Schwierigkeiten bringen könnte!
Scham schoss mir heiß in die Wangen, und der Magen drehte sich mir um. »Schreib ihr, dass alles in Ordnung ist«, sagte ich steif.
Honor tippte schnell eine Antwort und sah mich dann mit ungewohnter Ernsthaftigkeit an. »Da ist doch nichts, oder?«
»Nein«, antwortete ich und sah aus dem Fenster.
Es war vier Jahre her, und trotzdem traute mir immer noch niemand. Ich würde die Vergangenheit niemals hinter mir lassen können.
Ich versuchte mich wieder meinem Buch zuzuwenden und mich darin zu verlieren, wie ich es immer tat, wenn ich gestresst war, aber dieses Mal konnte ich mich einfach nicht auf die Intrigen vergangener Jahrhunderte einlassen. Ich fühlte mich dazu verpflichtet, auf das Handy eines Fremden aufzupassen, und diese Verantwortung nagte an mir. Als ob er mir sein Kind anstelle eines Haufens Mikrochips und Metall im Wert von ein paar Hundert Dollar anvertraut hätte.
Mein – nicht mein – Handy summte in meiner Hand, und ich warf einen Blick auf das Display. Die Nummer kannte ich nicht. Das würde jetzt wahrscheinlich dauernd passieren, wurde mir bestürzt klar.
Die Nachricht lautete: Wir könnten am Dienstag einen Ersatzspieler für Dart gebrauchen. Bist du dabei?
Ich runzelte die Stirn und überlegte, wie oft ich mich mit den Updates anrufen sollte. Nichts hatte mich auf eine solche Situation vorbereitet, und so war ich vollkommen ahnungslos, wie man sich verhielt, wenn die Person, deren Handy man aus Versehen ans andere Ende des Landes mitgenommen hatte, Nachrichten bekam.
»Würdest du eine Nachricht darüber, Dart am Dienstagabend zu spielen, lieber so schnell wie möglich hören oder lieber erst dann, wenn noch ein paar weitere Nachrichten eingegangen sind?«
Honor blinzelte mich an und versuchte diese seltsame und sehr spezifische Frage zu verstehen. »Ich habe keine Ahnung.«
»Sehr hilfreich, vielen Dank.«
Er wandte sich wieder seinen eigenen Nachrichten zu. »Gern geschehen.«
Ich verzog mein Gesicht. »Vielleicht texte ich es ihm einfach.«
»Du denkst viel zu viel darüber nach.«
»Das ist deineSchuld«, erinnerte ich ihn.
»Ja, ja.«
Meine Tante Janine und mein Onkel Nelson wohnten in einem großen Haus an einer Klippe in La Jolla, nördlich von San Diego. Der Meerblick war einfach atemberaubend. »Warte erst bis zum Sonnenuntergang«, sagte Janine zu mir. »Du wirst begeistert sein.«
Das konnte ich mir gut vorstellen.
Nelson und Honor begannen fast sofort über das Geschäft zu sprechen. Ich leistete ihnen ein paar Minuten dabei Gesellschaft und war von der Vorstellung, dass die beiden das tatsächlich interessant fanden, vollkommen fasziniert. Es kam mir undenkbar vor, aber Honor hatte dieses Leuchten in den Augen, das mich an das Leuchten erinnerte, das er bekam, wenn er es mit einem guten Tennisgegner aufnahm.
Meine Cousine Robyn kam aus dem Garten. Sie trug einen Bikini und hatte darüber einen Sarong um ihre Hüften geschlungen.
»Hey Leute!« Sie eilte zu mir und umarmte mich. Ihre Haut war noch warm von der Sonne. Honor unterbrach die Diskussion, um sich ebenfalls von ihr umarmen zu lassen.
»Hey Robbie«, sagte er. »Wusste gar nicht, dass du da bist.«
»Doch, doch. Ihr Glücklichen. Ich bin den Sommer über zu Hause.« Robyn war mit zwanzig drei Jahre jünger als ich und studierte an der USC. »Bleibt ihr bei uns?«
»Das tun sie.« Janine deutete auf einen langen Korridor, dessen Ende ich nicht sehen konnte. »Bringst du Clementine zum Blauen Zimmer?«
Gerne folgte ich meiner Cousine den Korridor entlang durch einen überdachten Innenhof zu einem kleinen angebauten Gästehaus. Es war eine ausgezeichnete Möglichkeit, der ernsthaften – und total langweiligen – Diskussion im Wohnzimmer zu entkommen.
»Und warum bist du hier?«, fragte Robyn im Gehen.
»Um Honor Gesellschaft zu leisten«, antwortete ich achselzuckend. »Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass Großmama und Großpapa hoffen, dass ich mich in die Welt des Immobiliengeschäfts verliebe.«
Robyn lachte. »Mmm, mein Dad hofft, dass das Gleiche mit mir passieren wird.«
»Und?«
»Und da wird er noch eine Weile länger hoffen müssen.« Sie öffnete die Tür zu einem großen Schlafzimmer mit durchweg weißen Möbeln und kühlen blauen Wänden. »Was ist mit deinen Eltern? Finden sie auch, dass du dich mit Immobilien beschäftigen solltest?« Ihr Ton war ruhig, aber in ihrem Blick konnte ich einen Hauch Belustigung entdecken.
Meine Eltern waren so etwas wie die schwarzen Schafe der Dalys.
»Na ja, ich weiß nicht genau. Sie sind gerade wieder in Vietnam, und ich glaube, sie haben die Erlaubnis bekommen, ins Landesinnere zu reisen, also ist die Verbindung nicht besonders zuverlässig.« Wenn es um meine Eltern ging, war es immer einfacher, schlichte Tatsachen weiterzugeben. Diesen Trick hatte ich schon früh in der Schule gelernt, als mich meine Mitschüler immer wieder fragten, warum ich bei meinen Großeltern lebte, und mich die Antwort jedes Mal zum Weinen brachte.
Robyn schüttelte sich. »Ich bin froh, dass sie glücklich sind und all das, aber für mich wäre das nichts, so fernab jeglicher Zivilisation.«
Ich lächelte, sagte aber nichts. Ich hatte selbst gemischte Gefühle dabei. Ich war mit meinen Eltern viel gereist, auch abseits der Touristenpfade. Tatsächlich hatte ich bis zum Alter von fünf nie mehr als ein paar Wochen in den USA gelebt. Ich war sogar im Ausland geboren – eigentlich war ich sowohl indische als auch amerikanische Staatsbürgerin. Aber als ich dann bei meinen Großeltern lebte, hätte das Leben kaum unterschiedlicher sein können. Wenn sie reisten, war es immer sehr luxuriös. Meine Großmutter würde in einigen der Dörfer, in denen meine Eltern monatelang gelebt hatten, nicht einmal nach dem Weg fragen wollen.
Es war schwer, sich zwei extremere Versionen des Lebens vorzustellen. Ich sah die Vorteile von beiden. Vielleicht lag die perfekte Lösung irgendwo in der Mitte, oder vielleicht gab es auch keine perfekte Lösung. Ich wusste es nicht.
Während Robyn die Jalousien hochzog, um mir den Meerblick vom Gästezimmer aus zu zeigen, summte wieder Justins Handy in meiner Tasche, und ich sah auf das Display. Es war nicht meine Nummer.
»Musst du drangehen?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht so genau.« Schnell erklärte ich ihr die Verwechslung. »Ich glaube nicht, dass ich drangehen muss, oder? Er erwartet doch bestimmt nicht von mir, dass ich seine Sekretärin spiele.«
»Lass das die Mailbox tun, dann hör es dir an. Du willst doch nicht jedem, der anruft, die ganze Geschichte erzählen müssen, oder?«
»Auf keinen Fall.«
»Und was, wenn seine Frau anruft und irgendeine fremde Frau an sein Handy geht? Ich bezweifle, dass er dir dafür danken wird.«
Mir war gar nicht in den Sinn gekommen, dass Justin eine Frau haben könnte. Ich hatte ihn mir überhaupt noch nicht als Person vorgestellt. Er war nur eine Stimme. Aber er musste doch auch einen Körper haben, nicht wahr? Einen Kopf, Augen, Hände und ein Leben. Wahrscheinlich auch einen Job. Er konnte genauso gut bereits fünfzig sein und Kinder in meinem Alter haben.
Es wäre so viel einfacher, wenn er ein glücklich verheirateter Banker Mitte fünfzig war. Jemand, der mich nicht als Lotterieticket ansah, wenn er herausfand, wessen Handy er da hatte.
Als das Handy erneut summte, um mich wissen zu lassen, dass der Anrufer auf die Mailbox gesprochen hatte, zögerte ich. Mir die Nachricht anzuhören, kam mir wie eine Verletzung seiner Privatsphäre vor. Ohne Erlaubnis würde ich nicht einmal die Voicemail meiner eigenen Schwester anhören, und das hier war ein vollkommen Fremder. Andererseits hatte ich versprochen, Nachrichten weiterzugeben. Ich verzog den Mund, während ich alle Möglichkeiten erwog, dann atmete ich tief durch und rief die Mailbox auf.
Es war ein Spendenaufruf von der Universität von Florida. Nicht gerade dringend, nahm ich an. Das war also die Summe aller Dinge, die ich über ihn wusste: Er spielte Dart, hatte in Florida studiert, und genau wie ich mochte er es nicht, sein Handy mit einem Zahlencode zu sichern. Was uns beide wohl ein wenig dumm dastehen ließ. Seit dem Zack-Vorfall setzten mich alle unter Druck, etwas sicherheitsbewusster zu sein. Aber mein Handy war so wenig personalisiert, dass ich es sinnlos fand, es immer wieder entsperren zu müssen. Ich hatte alle Social-Media-Apps gelöscht, ich hatte kein E-Mail-Programm auf dem Handy, und meine Kontaktliste war nicht mehr als eine Ansammlung von Spitznamen. Ich durfte nicht einmal E-Mail-Adressen darin abspeichern. Es zu sperren war mir einfach viel zu lästig. Und ich war schließlich nicht die einzige Person, der das so ging. Justin zum Beispiel machte es auch so.
Na also, Dalys.
Robyn starrte mich neugierig an, während ich das Handy vom Ohr nahm. »Und? Was Wichtiges?«
»Ich glaube nicht«, antwortete ich achselzuckend.
»Was ist das überhaupt für ein Typ?«
Wieder zuckte ich mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Er heißt Justin.«
»Wie klang er denn? Alt? Jung? Hatte er zufällig einen aufregenden australischen Akzent?«
Ich lachte. »Ähm, nein. Ich schätze, er klang ganz normal. Nicht wie ein Opa oder so. Und auch nicht wie ein Kind.«
»Klang er gut aussehend?«
»Wie kann man denn gut aussehend klingen?«
»Oh, das weißt du dann schon. Zum Beispiel wenn er einen aufregenden australischen Akzent hat.« Sie warf ihr Haar über ihre Schulter und kam zu mir. »Wie sieht er aus?«
»Keine Ahnung!«
»Ähm, hallo? Handy-Ka-me-ra?« Sie sprach das Wort aus, als sei ich ein wenig begriffsstutzig.
Mein Herz begann wie wild zu schlagen, als mich eine wilde Mischung aus Reaktionen überkam. Natürlich hatte er Fotos von sich auf dem Handy! Meine erste, heftigste körperliche Reaktion war Entsetzen bei der Vorstellung, sie mir ohne sein Wissen anzusehen. Nach dem, was Zack mir angetan hatte, war ich sehr empfindlich, was Privatsphäre anging. Meine und die anderer. Doch es fiel mir schwer, so zu tun, als sei ich auf diesen Kerl nicht neugierig. Aber neugierig genug, um mir die Fotos anzusehen? Spielte es überhaupt eine Rolle, wie er aussah?
Moment mal.
Gott, hatte er sich meine bereits angesehen?
Hektisch ging ich alle möglichen Fotos aus meinem Handy durch. Oh verdammt, es waren mindestens ein Dutzend dämlicher Selfies mit meinen Freunden und der Himmel weiß, was noch … Aber wichtiger war, was ich nicht gelöscht hatte.
»Clem.« Robyn stieß mich an. »Hör auf, so komisch zu sein. Lass sie uns einfach angucken.«
»Das kommt mir nicht richtig vor.«
»Du willst wirklich nicht wissen, wie die Person aussieht, die dein Handy hat?«
Natürlich wollte ich das, aber …
Robyn verdrehte die Augen und schnappte sich das Handy aus meiner Hand. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich sie nicht aufhielt, als sie sich auf der Suche nach seinem Fotoalbum durch das Menü tippte. Sie fand es und begann, schnell die Bilder zu überfliegen. »Anscheinend steht der Kerl auf Gebäude«, murmelte sie. »Woher sollen wir überhaupt wissen, welcher von denen er ist? Mann, dieses ganze Handy ist voller nichtssagender Schnappschüsse.«
Sie hielt es mir enttäuscht hin, als ob ihr klar geworden wäre, was für eine dumme Idee es gewesen war, aber plötzlich wusste ich ganz genau, wem dieses Handy gehörte. »Das glaube ich einfach nicht.«
»Was?«
Ich benutzte zwei Finger, um in das Gruppenfoto hineinzuzoomen, das sie als Letztes geöffnet angetippt hatte. »Das ist er.«
»Wow, heilige Scheiße, Clem!« Robyn riss mir das Handy aus der Hand und hielt es sich so dicht vor die Augen, dass das Display beschlagen wäre, wenn sie gewagt hätte, zu atmen. »Er ist … wow. Woher weißt du, dass er das ist?«
»Weil ich ihm heute Morgen am Flughafen fast auf den Schoß gefallen wäre.« Plötzlich kamen mir seine Grübchen wieder in den Sinn, als er mich angelächelt hatte.
»Wie bitte?«
Schnell erzählte ich die Geschichte, wie ich in Chicago fast einem Fremden auf den Schoß gefallen wäre, als ich aufgestanden war, um auf die Toilette zu gehen. Er hatte direkt neben mir gesessen und musste sein Handy in dieselbe Aufladesäule gesteckt haben wie ich. Honor hatte seines erwischt.
Das hätte jedem passieren können.





























