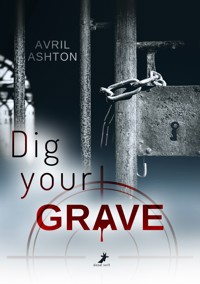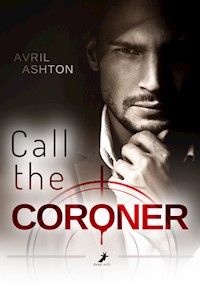
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der preisgekrönten Autorin des Bestsellers BROOKLYN SINNERS kommt eine düstere, verdrehte Geschichte über Schmerz, Rache und das tödlichste aller Gefühle - die Liebe. Ein Kampf ums Überleben zwischen Raubtieren ... Er hat lange Zeit im Untergrund gelebt, aber das Einzige, was Daniel Nieto garantiert an die Oberfläche zurückbringt, ist die Identität des Mörders seiner Frau. Mit dem Flüstern eines einzigen Namens setzt er alles aufs Spiel, um Rache zu nehmen. Er hat Pläne für Stavros Konstantinou. Der Titel des "Monsters" passt zu gut zu ihm, als dass Stavros etwas anderes sein möchte als genau das. Die Zeit, die er in Daniel Nietos Kerker verbringt, angekettet und gefoltert, wird daran nichts ändern. Hungrig nach Nahrung, Sonnenlicht und Freiheit wartet er auf eine Gelegenheit, den Spieß gegen den einzigen Mann umzudrehen, der ihm je nahe genug gekommen ist, um ihm Angst zu machen. Irgendwo zwischen dem Gleiten des Messers auf der Haut und dem Tropfen von Blut auf kalten Beton ändern sich die Dinge. Trauer und Hass kollidieren mit Lust und Besessenheit, und diesmal stehen Daniel und Stavros auf derselben Seite. Diesmal kämpfen sie einen aussichtslosen Kampf gegen eine Verbindung, die durch viel mehr als nur die Liebe zu Gewalt und Blutvergießen entstanden ist. Dark Mafia Romance Inhaltswarnung: Gewalt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Avril Ashton
Call the Coroner
Staniel Series 1
Aus dem Englischen von Mia Rusch
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2022
http://www.deadsoft.de
© the author
Titel der Originalausgabe: Call the Coroner (Staniel 1)
Übersetzung: Mia Rusch
Cover: Irene Repp
http://www.daylinart.webnode.com
Bildechte: © conrado – shutterstock.com
1. Auflage
ISBN 978-3-96089-542-8
ISBN 978-3-96089-543-5 (epub)
Inhalt:
Von der preisgekrönten Autorin des Bestsellers BROOKLYN SINNERS kommt eine düstere, verdrehte Geschichte über Schmerz, Rache und das tödlichste aller Gefühle - die Liebe.
Ein Kampf ums Überleben zwischen zwei Raubtieren …
Er hat lange Zeit im Untergrund gelebt, aber das Einzige, was Daniel Nieto garantiert an die Oberfläche zurückbringt, ist die Identität des Mörders seiner Frau. Mit dem Flüstern eines einzigen Namens setzt er alles aufs Spiel, um Rache zu nehmen. Er hat Pläne für Stavros Konstantinou.
Der Titel des „Monsters“ passt zu gut zu ihm, als dass Stavros etwas anderes sein möchte als genau das. Die Zeit, die er in Daniel Nietos Kerker verbringt, angekettet und gefoltert, wird daran nichts ändern. Hungrig nach Nahrung, Sonnenlicht und Freiheit wartet er auf eine Gelegenheit, den Spieß gegen den einzigen Mann umzudrehen, der ihm je nahe genug gekommen ist, um ihm Angst zu machen.
Irgendwo zwischen dem Gleiten des Messers auf der Haut und dem Tropfen von Blut auf kalten Beton ändern sich die Dinge. Trauer und Hass kollidieren mit Lust und Besessenheit, und diesmal stehen Daniel und Stavros auf derselben Seite. Diesmal kämpfen sie einen aussichtslosen Kampf gegen eine Verbindung, die durch viel mehr als nur die Liebe zu Gewalt und Blutvergießen entstanden ist.
1
Der Anruf kam in der Nacht. Es war eine dieser Nächte, in denen Daniel Nieto keinen Schlaf fand. Die Luft war von Hitze geschwängert, sodass ihm unter seinem Shirt Schweiß die Wirbelsäule hinabrann. Nur ab und zu erhellte ein Glühwürmchen mit seinem Licht die Dunkelheit. Er saß draußen auf der Veranda seines im griechischen Stil erbauten Hauses. Drinnen lauerten die Erinnerungen.
Das Prepaid-Handy vibrierte an seinem rechten Oberschenkel, brachte seine Haut zum Kribbeln und unterbrach für einige Sekunden auf unangenehme Art die monotone Stille. Nicht einmal fünf Menschen hatten seine Handynummer. Doch es gab eine andere, die man wählen konnte, wenn man ihn erreichen wollte. Eine Frau leitete den Anruf dann an seine derzeitige Nummer weiter, aber nur, wenn sie den Anrufer für wichtig befand. Anscheinend hatte dieser hier ihren Test bestanden.
»¿Bueno?« Er lauschte mit geschlossenen Augen, als sie den Namen des Anrufers nannte. Die Neugier gewann. »Stell ihn durch«, sagte er.
Sie verabschiedete sich nicht, er hörte nur ein leises Klicken; ein Zeichen dafür, dass der Anruf weitergeleitet wurde.
»Tek«, grüßte er den Mann mit einer Vertrautheit, die er zum Glück nicht spielen musste. »Was verschafft mir die Ehre?«
»Du wolltest wissen, wer deine Frau getötet hat.«
Er riss die Augen auf, sein Magen begann zu schlingern, als er aufsprang. Schon allein die Erwähnung seiner Frau raubte ihm den Verstand. Er hatte vom ersten Tag an gewusst, wer sie getötet hatte. Doch Unwissen war manchmal ein Segen, und auch jetzt täuschte er Ahnungslosigkeit vor, obwohl sich sein Kiefer verkrampfte, als er mit den Zähnen knirschte. »Du weißt es.«
»Ja.«
Daniel beobachtete gerne Menschen. Wie sonst könnte er ihre Schwächen herausfinden? Er kannte den Mann am anderen Ende der Leitung, aber nicht sehr gut. Diesen Anruf hatte er nicht erwartet, nie im Leben. Er wusste, welchen Namen Tek gleich nennen würde, aber statt ihm das mitzuteilen, bat er: »Sag es mir.«
»Stavros Konstantinou.«
Daniel grinste in die stille Nacht hinein und streckte die Beine aus. »Was du nicht sagst.« Wenn man bedachte, was er über Tek und den Mann, dessen Namen er gerade genannt hatte, wusste … Dann musste er sich die Frage stellen, wie es zu dem plötzlichen Verrat gekommen war. Eigentlich machte es keinen Unterschied, aber für jemanden wie ihn war jede Information eine nützliche Waffe.
»Ich kann dir alles über ihn sagen, was du wissen musst. Auch, wo du ihn findest.«
Der Zorn, in letzter Zeit sein ständiger Begleiter, wallte heiß in ihm auf, aber dennoch lachte er. »Und wo bleibt dann der Spaß, mi amigo?« Zuvor war es eine rein geschäftliche Angelegenheit gewesen. Doch jetzt? Pures Vergnügen. Die einzige Art, wie er in letzter Zeit Vergnügen empfinden konnte.
»Wie du willst.«
Das Zögern in Teks Stimme sagte Daniel, dass sein Ruf ihm am Herzen lag. Guter Mann. »Ich schulde dir was, Tek. Was auch immer du brauchst. Jederzeit.«
»Vielleicht komme ich darauf zurück.«
Daniel ließ das Handy neben sich zu Boden fallen und zertrat es unter seinem Absatz. Dann stand er auf.
Er hatte seinen Plan sorgfältig geschmiedet und war denjenigen, die ihn gerne neben seiner toten Frau unter der Erde sehen wollten, mindestens zehn Schritte voraus. Während sie wie Kinder waren, die im Dreck mit Murmeln spielten, war er im Vergleich zu ihnen ein Schachweltmeister. Die meisten dachten, dass Daniel keine Ahnung hätte, wer die maskierten Männer in sein Haus in Mazatlán geführt hatte. Sie dachten, dass er keine Möglichkeit hätte, Vergeltung zu üben. Dass er sich irgendwo verkrochen hätte, um sich von den Nachwirkungen dieser blutigen Nacht zu erholen. Die physischen Wunden waren verheilt, auch wenn man immer noch die Male sehen konnte, die die Schlinge um seinen Hals hinterlassen hatte. Die Wunden, die man nicht sehen konnte, waren anders. Sie eiterten, breiteten sich immer weiter aus, infizierten alles. Das war gut so. Wenn man es auf einen Mann wie Stavros Konstantinou abgesehen hatte, brauchte man nicht nur List und einen ausgeklügelten Plan, sondern auch Feuer. Mordlust. Der Grieche war ein eiskalter Geschäftsmann, Boss einer Söldnertruppe, die nur für die Höchstbietenden arbeitete. Er tötete für Geld. Ohne Gewissen. Und effektiv. Er war unantastbar. Ein Monster. Nachdem sich Daniel schon sein ganzes Leben lang täglich im Spiegel sah, hatte er viel Erfahrung darin, Monster zu erkennen. Stavros hatte ihm innerhalb von zehn Minuten alles genommen, und seitdem wartete Daniel auf den richtigen Moment. Obwohl er es zu schätzen wusste, war Teks Anruf nicht nötig gewesen.
Er ließ die undurchdringliche Dunkelheit hinter sich und kehrte ins Haus zurück, trat in das Licht der Lampen, das zu grell für seine Augen war. Im oberen Geschoss fand er sie. Sie lag nicht mehr im Bett, in das sie vor einer Stunde gebracht worden war. Ihr Haar hatte sich aus dem Knoten gelöst und floss über ihre Schultern, als sie das Nachthemd raffte, um nicht über den Saum zu stolpern. Mit hohlem Blick aus weit aufgerissenen Augen wanderte sie den Flur entlang.
Er folgte ihr leise und in Alarmbereitschaft. Inzwischen war er daran gewöhnt und doch konnte er den Anblick nicht verkraften. Es war unerträglich, dabei zuzusehen, wie sie langsam dahinsiechte. Er sah trotzdem zu, denn wenn er eines war, dann pflichtbewusst. Und wenn er eines beherrschte, dann war es Selbstgeißelung. Er wusste, wie man Buße tat.
Als sie die Tür zur Veranda öffnete, die er gerade verlassen hatte, eilten die zwei Leute herbei, die sie pflegten. Daniel winkte ab. Er bezahlte sie gut, damit sie sich um sie kümmerten. Aber wenn er hier war, tat er, was er konnte. Wie jetzt, als er ihr nach draußen folgte. Sie standen Seite an Seite, während sie die Brüstung umklammerte, einen tiefen Atemzug nahm und den Kopf gen Himmel reckte. Manchmal registrierte sie seine Anwesenheit, in anderen Momenten, so wie jetzt, blieb sie in ihrer eigenen Welt. Nicht, dass ihre eigene Welt sicher wäre. Denn die, die sie gekannt hatte, war weg.
All seine Pläne galten ihr. Nur ihr. Sie war der einzige Grund dafür, dass er heute Nacht gehen musste. Aber nicht jetzt, in dieser Sekunde. Erst, wenn sie wieder im Bett lag und vielleicht für einen Moment alles vergessen konnte.
Er stand neben ihr in dieser undurchdringlichen Dunkelheit, während der kaum spürbare Wind ihr Haar zerzauste. Es war sinnlos, mit ihr zu sprechen, wenn sie ihn nicht erkannte. Außerdem gab es nichts zu sagen. Stattdessen leistete er ihr Gesellschaft, schenkte ihr durch seine stumme Aufmerksamkeit Kraft.
Ihr leises Schluchzen ließ ihn zusammenzucken. Er zog sie in seine Arme und starrte in ihre Augen, die nicht aufleuchteten, als sie ihn erblickten. Tränen glänzten darin. Ihr Blick war leer. Es tat so weh.
Trotzdem hielt er sie eng gegen seine Brust gedrückt und ließ zu, dass sie ihn mit ihren Tränen benetzte und so das Feuer der Wut anfachte. Auf eine gewisse Art fühlte es sich an, als umarmte er eine völlig fremde Person. Nur ein fernes Echo ihrer selbst war geblieben, und dennoch hielt er sich daran fest. Er sollte keine Schwächen haben, doch er hatte sie.
Sie blieb in seinen Armen, wechselte zwischen leisem Schluchzen und sinnlosem Murmeln, bis seine Arme zu brennen begannen und seine Beine protestierten, weil er so lange reglos dagestanden hatte. Erst dann trug er sie zurück ins Bett, deckte sie zu und fuhr mit der Routine fort. Er bürstete ihr Haar. Dann legte er sich neben sie, die Beine überkreuzt, und hielt ihre Hand. Wenn er fort war, würden die Pflegekräfte das übernehmen. Jeden Abend. Sie würden ihr Haar bürsten, ihre Hand halten und beten, dass der Schlaf sie übermannte.
Es dauerte achtunddreißig Minuten, bis sie die Augen schloss. Erst als der Druck ihrer Hand um seine Finger verschwand, bemerkte er, wie fest ihr Griff gewesen war. Daniel hob die Hand an sein Gesicht und runzelte die Stirn, als er die Abdrücke sah, die ihre Fingernägel hinterlassen hatten. Er strich darüber, dann legte er die Hand auf ihre Stirn und strich ihr das Haar hinter die Ohren. Nachdem er einen Kuss auf ihre Wange gehaucht hatte, stand er auf. Wenn er noch länger blieb, würde er niemals gehen. Er hatte Pläne.
Mit einem letzten Blick auf ihren friedlichen Ausdruck verließ er das Schlafzimmer. Bevor er ging, sprach er noch kurz mit ihren Pflegekräften. Jedes Mal, wenn er ging, stieg diese schreckliche Mischung aus Erleichterung und Schuld in ihm auf. Beides begleitete ihn, als er wegfuhr. Bis er etwa acht Kilometer entfernt am kleinen Flughafen in einen Privatjet stieg.
»Bereit?«
Er schnallte sich an, erst dann erwiderte er den Blick des Mannes, der vor ihm stand. »Estoy listo.«
Ich bin bereit.
Ein Lächeln zerrte an Toros Mundwinkeln. »Fast tut er mir leid.« Er setzte sich neben Daniel und zwinkerte ihm zu. »Aber ein Fast zählt nicht.«
Nein, es zählte nicht.
****
Stavros Konstantinou ließ das Feuerzeug klicken. Dann drückte er die blassblaue Flamme zusammen und löschte sie so wieder. Mit einer Bewegung seines Daumens entzündete er sie erneut und erstickte sie ein weiteres Mal mit dem Daumen und Zeigefinger der anderen Hand. Es war eine Gewohnheit, sie stammte noch aus seiner Teenagerzeit.
Er saß im Garten seiner Villa in Lissabon. In der Dunkelheit. Die Männer, die sein Haus bewachten, wussten, dass sie sich besser von ihm fernhielten, wenn er nach draußen kam. Er war nur selten im Garten. Aber kürzlich war er aus den Staaten zurückgekommen und er fühlte sich … rastlos. Einer der Gründe dafür, warum er die Villa verkaufen würde. Er hatte sie nur gekauft, um einer Frau nahe zu sein, doch sie war jetzt weg. Was das Familiengeschäft anging, die Söldnertruppe, hatte er sich aus dem Business zurückgezogen. Eigentlich war er sowieso nur involviert gewesen, um seinem Vater nahe zu sein. Doch der alte Mann war nun auch weg. Genau wie seine Frau, Stavros’ Stiefmutter. Bis auf einen einzigen Onkel, der noch lebte, war seine gesamte Familie ausgelöscht. Die einzige Person, um die er getrauert hatte, war die Frau gewesen, die er geliebt hatte. Doch es kümmerte ihn nicht mehr. Er hatte sie niemals haben dürfen. Seine Stiefschwester. Es hatte ihm nie gefallen, dass er Gefühle für Annika gehabt hatte. Gefühle waren nichts weiter als Schwäche. Deshalb hatte er stets versucht, sie zu unterdrücken.
Er ließ das Feuerzeug erneut klicken. Der Mondschein, der sich im Wasser des Swimmingpools spiegelte, fiel ihm ins Auge. Schönheit. Stavros wusste Schönheit zu schätzen. Er hatte schon viel Schönes zerstört, aber das hieß nicht, dass er es nicht zu erkennen wusste. So wie in diesem Moment. Er zog eine Zigarette aus der Packung in seiner Jackentasche, ließ das Feuerzeug wieder klicken und entzündete sie. Er hatte schon mehrmals zu rauchen aufgehört, und es würde ihm wieder gelingen. Aber heute Nacht … Heute Nacht tötete er sich selbst. Langsam. Er nahm einen tiefen Zug, schlüpfte aus dem Mantel und ließ ihn neben sich zu Boden fallen.
Der Mondschein und das orangerote Glühen der Zigarette waren die einzigen Lichtquellen hier in seiner Ecke. Er legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Ein Mann wie er kannte keinen Frieden und er wüsste wahrscheinlich auch gar nicht, was er damit anfangen sollte. Aber er akzeptierte den Moment als das, was er war: ein Rückzug vor dem nächsten Kampf. Noch konnte er nicht sagen, warum oder wann der nächste Kampf stattfinden würde, doch er vertraute seinem Bauchgefühl, seinem Killerinstinkt, wie sein Vater es genannt hatte. Er hatte eine Nase für Blutvergießen. Und Freude daran. Ohne Zweifel würde die Zeit kommen, in der er wieder in der purpurnen Flüssigkeit schwämme.
Das Geräusch von Schritten auf Kies ließ ihn aufhorchen. Er hielt die Zigarette fester, rührte aber ansonsten keinen Muskel. Langsam blies er den Rauch aus seinen Lungen und grinste den Mond an.
Ja.
Früher, als er erwartet hatte, aber es sollte ihm recht sein.
Zu seiner Linken raschelten Blätter. Er hatte Gesellschaft. Stavros leckte sich über die Lippen und schnippte die Asche von seiner Zigarette. »Es ist dunkel und meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren«, sagte er leise an seinen unwillkommenen Besucher gewandt. »Du bist den ganzen Weg hierhergekommen. Also warum zeigst du dich nicht?«
Kein Geräusch mehr. Dennoch erblickte er einen Moment später den Mann. Direkt vor sich. Der Mondschein erhellte seinen Haarschopf, ließ ihn glänzen, doch sein Gesicht lag im Dunkeln. Er war groß und dürr, so viel konnte Stavros erkennen. Und mutig, sonst stünde er nicht dort. Stavros kannte viele mutige Männer, aber keiner von ihnen war selbstmörderisch.
Er betrachtete den Umriss im Schatten und verengte die Augen, als der Rauch in sein Gesicht wehte. »Du bist mutig«, murmelte er. »Ich bewundere Mut, auch wenn ich ihn für Verschwendung halte.«
»Diese Dinger werden dich umbringen, weißt du das, ¿verdad?«
Eine hässliche Stimme. Rau und verbraucht, als hätte man sie mit einer Machete zerstückelt und dann in einen Mixer geworfen. Nur ein Mann hatte solch eine Stimme. Stavros hatte sie nur einem Mann gegeben. Erleichterung durchströmte ihn. Er kannte seinen Feind, wusste, was er wollte. Seit vier Jahren wartete er auf diesen Moment.
Langsam erhob er sich und bereute es sofort, nun nicht mehr bequem zu sitzen. Mit gespreizten Beinen reckte er das Kinn und pflückte die Zigarette aus seinem Mundwinkel. »Mr. Nieto, Sie sind weit von zu Hause weg.«
»Ich bin da, wo ich sein sollte.«
Stavros hatte Daniel immer mit einem tollwütigen Hund verglichen, der von Mordlust erfüllt war und Schaum vor dem Maul hatte. Unaufhaltbar. »Ist das so?« Er ließ die Zigarette zu Boden fallen und trat sie aus. Dann zählte er bis zwei und schnellte nach vorn, die Pistole in der Hand. Er erreichte Nieto nicht. Plötzlicher, brennender Schmerz schoss durch seine Schulter, nahm ihm jegliche Kraft, und als er langsam blinzelte, sackte er schon vor Nieto auf die Knie.
»Ich habe einen interessanten Anruf erhalten. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Tod meiner Frau befohlen hast.« Nieto rührte sich nicht. Nur sein Blick funkelte, als er auf Stavros hinabsah.
Er konnte sich nicht rühren, begann zu beben, als eine Welle aus Kälte durch ihn hindurchschwappte. Irgendwie hatte er gedacht, dass der Tod mehr sein würde als das hier. Weniger … enttäuschend. Aber er konnte es sich nicht leisten, wählerisch zu sein. Er lächelte zu Nieto hoch, während sich Schatten am Rande seines Sichtfelds zusammendrängten. »Dein Vögelchen lag falsch. Ich habe sie selbst getötet. Aber das wusstest du schon, nicht wahr?«
Als er wieder zu sich kam, fühlte es sich an, als würde ein Lappen in seinem Mund stecken. Sein Haar war schweißnass und eine schwere Eisenkette lag um seinen Hals. Er biss die Zähne zusammen, als der Schmerz ihn überfiel und ihn zittern ließ. Die Kette rasselte. In diesem Moment wurde das Licht angeschaltet.
Er befand sich in einer Art Zelle, einem riesigen, deckenhohen Käfig, der an einen Haikäfig erinnerte. Der Raum wirkte wie eine Fabrikhalle und war bis auf den Käfig leer. Doch er war nicht allein. Der Mann, der in der Ecke stand, schnippte mit den Fingern. Ein Mechanismus, den Stavros nicht sehen konnte, zog ihn zu Boden. Die Kette lag immer noch um seinen Hals, seine Hände waren hinter seinem Rücken gefesselt, also konnte er sich nicht bewegen, nur ein paar Zentimeter hin und her rutschen. Er legte den Kopf schief, als sich Nieto neben ihn kniete.
»Willkommen in meiner Welt, Konstantinou. Ich freue mich, dass du hier bist.«
»Du hast mich gefangen genommen?«, fragte er und lachte bellend, obwohl es ihm einiges abverlangte. »Wie … originell.«
Der Mann zwinkerte ihm zu. »Originell ist doch das Beste. Du und ich, Männer wie wir, wir wissen das Beste zu schätzen, nicht wahr?« Er berührte die Kette um Stavros’ Hals. »Du hast mir meine Frau genommen, also nehme ich dir dein Leben. Langsam.«
»Es ist egal, wie lange du mich hier einsperrst. Ich werde einen Weg aus diesem Käfig finden.« Stavros versuchte, mit den Schultern zu zucken. »Und wenn ich einen Weg finde«, er leckte sich über die aufgesprungenen Lippen, »dann beginnt der wahre Kampf.«
2
Menschenhandel. Diesen Teil des Geschäfts hatte Petra immer gehasst.
Ein kleines, liebevolles Lächeln zog an Daniels Mundwinkeln, als er sich daran erinnerte, wie oft sie sich wegen dieses Themas gestritten hatten. Mit Morden und Drogen hatte seine Frau kein Problem gehabt, aber sie war strikt dagegen gewesen, dass das Nieto-Kartell mit Menschen handelte. Es war ihr Glück gewesen, dass Daniel diese Meinung immer geteilt hatte. Aber leider hatte sein Vater das nicht so gesehen, als er noch das Sagen gehabt hatte. Eduardo Nieto war immer nur hinter dem Geld her gewesen. Nun, als Daniel auf Stavros Konstantinou hinabstarrte, war er zum Teil dankbar für seine Verbindungen zur Schmugglerszene. Nur so hatte er es geschafft, den Griechen von Lissabon in die Staaten zu transportieren. Sein Gefangener hatte eine Woche auf einem Frachtschiff verbracht und nichts von seinem Kampfgeist verloren. Daniel gefiel das.
Sie hatten Stavros die Augen verbunden und ihm Noise-Cancelling-Kopfhörer aufgesetzt, sodass er die ganze Reise über nur Stille gehört hatte. Aber nun waren sie endlich an ihrem Ziel angelangt. Zeit, zu spielen.
So lange hatte er darauf gewartet. Er besaß die Geduld, die Zeit und die Ressourcen, um Stavros Konstantinou für alles bezahlen zu lassen, was er ihm angetan hatte. Die Nietos waren einigen Leuten mit viel Macht ein Dorn im Auge gewesen, denn sie hatten sich weder manipulieren noch kontrollieren lassen. Sie hatten sie aus dem Weg schaffen wollen, also hatten sie Stavros engagiert. Doch der Grieche hatte stattdessen Daniels Frau getötet.
Daniel umrundete den Stuhl, auf dem Stavros gefesselt war. Seine Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden, Eisenketten lagen um seine Fußknöchel. Daniel stellte sich hinter ihn und entfernte die Augenbinde. Dann die Kopfhörer.
»Hallo noch mal, Mr. Konstantinou.«
Stavros zuckte zusammen.
Daniel trat vor ihn, sodass er direkt neben Henan stand. Henan war ein alter Kindheitsfreund von Petra, und Daniel hatte ihn damit beauftragt, Stavros zu bewachen. Die Wimpern seines Gefangenen flatterten, doch er öffnete die Augen nicht. Trotzdem schien es so, als würde er sie verdrehen.
»Ich mochte den anderen Ort lieber«, sagte Stavros mit rauer Stimme. Eine dünne Schicht aus Staub und Dreck bedeckte seinen muskulösen Körper, der die Fesseln fast zu sprengen schien.
Henan schnaubte und zog das Messer, das an seinem Gürtel hing. Er sah Daniel an.
Daniel schüttelte den Kopf und ignorierte Henans enttäuschten Blick. Das hier würde nach seinem Zeitplan ablaufen. »Ach?« Daniel trat einen Schritt auf Stavros zu und beugte sich nach vorn, um ihm ins Ohr zu murmeln. »Aber du hast dich doch noch gar nicht umgesehen.«
»Ich kann es aber riechen.« Stavros sog hörbar die Luft ein. »Nein danke.«
Daniels Lippen zuckten, als er in Henans Richtung nickte. »Das ist zu schade.« Er griff nach der Kette, die um Stavros’ Hals lag und zerrte daran, bis er aufrecht stand. Stavros kam ins Wanken und hielt sich nur mühsam auf den Beinen. »Lass mich raten: Du bist hungrig. Du bist durstig. Und du willst das so schnell wie möglich zu Ende bringen.«
Stavros hielt die Augen immer noch geschlossen, während Henan ihn packte und ihn in Position hielt. Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe mich gefragt, wie lange du mich mit dem Klang deiner Stimme foltern willst.« Endlich öffnete er die grauen, blutunterlaufenen Augen. »Aber weißt du was? Langsam wächst sie mir ans Herz. Mach nur weiter.« Er ruckte mit dem Kinn in Daniels Richtung. »Rede ruhig, so viel du willst, erzähl mir etwas.«
Daniel sah zu Henan. Dieser nickte und griff mit einer Hand nach Stavros’ Genick, während er in der anderen immer noch das Messer hielt.
Daniel ergriff das Wort. »Sie war wunderschön, weißt du? Mutig und unerschütterlich.« Es war, als würde er die Erinnerung an Petra beflecken, weil er ihrem Mörder von ihr erzählte. Noch hatte er seine Emotionen im Griff, doch es fiel ihm nicht leicht. Es schmerzte. »Und blutrünstig.« Er streckte die Hand aus, ohne den Blick von Stavros zu nehmen. Henan reichte ihm das Messer. Es war schwer und warm. »Sie wollte deinen Tod.« Er bewegte sich blitzschnell und schlitzte Stavros’ linke Wange auf.
Henan packte Stavros’ Haar, riss seinen Kopf nach hinten und trat ihm in die Nieren. Er sackte auf die Knie, dann fiel er bäuchlings zu Boden.
Daniel kniete sich vor ihn, griff nach ihm und zwang ihn, seinen Blick zu erwidern. »Sie wollte dein Blut.« Er lächelte Stavros an, als der metallische, berauschende Geruch in seine Nase drang. »Auch wenn sie tot ist«, flüsterte er und ritzte mit der blutigen Klinge über Stavros’ Hals. »Auch wenn sie tot ist, ich erfülle den Willen meiner Frau.«
Blut floss über Stavros’ Gesicht, in seinen Mund, über seinen Hals. Er schien es nicht zu bemerken. »Dann tu es. Töte mich.«
Daniel erhob sich. Ein freudloses Lachen drang aus seiner schmerzenden Kehle. »Nicht so einfach. Und nicht so schnell.« Er platzierte den rechten Fuß auf Stavros’ Hals und drückte ihn gegen die dicke Kette. Stavros wand sich, versuchte, dem Druck zu entkommen, doch es war zwecklos. »Immer, wenn ich hier bin, werde ich meinen Fuß auf deine Kehle stellen. Vergiss niemals, dass dein Leben jetzt in meinen Händen liegt. Immer. Auch wenn ich nicht hier bin.«
Henan hielt ihm den elektrischen Viehtreiber hin.
Genugtuung breitete sich in Daniels Bauch aus, als Stavros die Augen aufriss und zu zappeln begann. »Wolltest du irgendwo hin?« Er hielt den Viehtreiber an Stavros’ Rippen und jagte einen Elektroschock durch seinen Körper. Er zuckte und blieb dann in Embryonalstellung liegen. Daniel drückte den Viehtreiber in sein Kreuz und schockte ihn noch dreimal, bis Stavros sich nicht mehr rührte und keinen Laut mehr von sich gab. Dann trat er einen Schritt zurück. »Bind ihn wieder fest«, bellte er an Henan gewandt. »Ich komme zurück.«
****
Und er hatte tatsächlich gedacht, auf diesem verdammten Schiff festzusitzen, wäre das Schlimmste. Stavros starrte zu Boden. Daniel Nietos Wachmann hatte ihn wieder festgebunden. Er hing in den Ketten, den Kopf auf der Brust. Seine Arme konnte er schon lange nicht mehr spüren. Der Schnitt auf seiner Wange brannte, und wenn er die Augen zusammenkniff, konnte er die Male sehen, die der verdammte elektrische Viehtreiber hinterlassen hatte. Scheiße, tat das weh.
Seine Füße berührten den Boden nicht, obwohl nur ein kleines Stück fehlen würde. Die Ketten um seine Handgelenke und seine Kehle schnitten in seine Haut. Er konnte sich auch nicht erinnern, wann er zum letzten Mal etwas zu essen bekommen hatte. Seine Kehle war trocken wie Schmirgelpapier und es tat weh, wenn er schluckte. Folter, nicht wahr? Man wurde nicht zu einem Mann wie Stavros Konstantinou, ohne Folter ertragen zu können. Wenn man nicht mit körperlichen Schmerzen umgehen konnte, wäre man nicht so gefürchtet wie er. Er tötete für Geld und hatte das Kommando über eine internationale Truppe aus Killern. Es würde um einiges mehr brauchen als Daniel Nietos Viehtreiber, um ihn in die Knie zu zwingen. Trotzdem, ein Glas Limonade wäre gerade schön. Oder zumindest Wasser mit einem Zitronenschnitz.
Daniel und sein Wachhund Henan sollten sich besser nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Denn Stavros hatte nicht vor, allzu lange zu bleiben.
Henan betrat den Käfig als Erster. Sein Gefängnis erinnerte an das in Lissabon, es war nur etwas niedriger. Er grinste, als Stavros den Kopf hob. Pure Bösartigkeit funkelte in seinem Blick. Bei Daniel war es anders, denn es war, als wären seine Emotionen von ihm abgekoppelt. Stavros konnte das gut nachvollziehen. Aber bei Henan? Henans Hass war ihm deutlich anzusehen, flackerte über seine Miene und färbte sein Gesicht rot. Das war eine Schwäche.
»Du bist aber rasch zurückgekommen«, sagte Stavros. »Gerade wollte ich ein Nickerchen machen. Ich brauche schließlich meinen Schönheitsschlaf.«
Henans Nasenlöcher blähten sich. Er wollte eindeutig, dass Stavros vor Angst zitterte, doch die Tatsache, dass er ihm diesen Gefallen nicht tat, schien den großen, glatzköpfigen Mann mit den muskelbepackten Armen ernsthaft zu stören. »Du wirst sterben«, sagte Henan.
»Wirklich?«, fragte Stavros gespielt entsetzt und sah sich im Käfig um. »Ich sehe aber niemanden, der Manns genug ist, mich umzubringen.«
Henan lachte und legte die dicken, fleischigen Finger um Stavros’ Kehle. Dann drückte er zu.
Stavros würgte. Er pendelte in seinen Fesseln hin und her, doch es reichte nicht ganz, um Henans Griff zu entkommen. Er hielt still, ließ seinen Kopf in den Nacken fallen. Und als Henan näher kam, nahm er all seine verbliebene Kraft zusammen und verpasste dem Mann einen Kopfstoß. Gottverdammt.
Henan wimmerte auf und stolperte einen Schritt nach hinten. Stavros hing weiterhin in seinen Fesseln und schwang hin und her. Ihm war schwindlig. Ein kleines Blutrinnsal tröpfelte von seiner Nase.
Daniel erschien vor dem Käfig. Wie ein Todesengel stand er da, vollkommen still und ganz in Schwarz gekleidet. Mit regloser Miene.
»¡Hijo de la chingada!« Henan wirbelte herum und zielte mit seiner Waffe auf Stavros.
»Henan.« Daniel hatte nur ein Wort gesagt, doch der Tonfall, düster und autoritär, ließ Stavros’ Herz für eine Sekunde stehen bleiben.
Henan erstarrte.
»Dein Herrchen hätte dich besser vorbereiten müssen«, sagte Stavros an Henan gewandt. »Lass niemals zu, dass dir der Feind unter die Haut fährt. Wir haben gerade erst begonnen, aber du hast das Spiel schon verloren, Henan.« Er lächelte und schmeckte Blut, als er sich über die Lippen leckte. »Wenn du mein Untergebener wärst, hätte ich dich für diesen Fehler umgebracht.«
Wut verzerrte Henans ohnehin schon rotes Gesicht. Er trat einen Schritt vor.
»Henan«, sagte Daniel erneut, ließ Stavros aber nicht aus den Augen. »Lass uns allein.«
Man musste Henan zugutehalten, dass er keine Sekunde zögerte. Er drehte sich um und verließ die Zelle, verschmolz mit den Schatten, als Daniel statt seiner in den Käfig trat und mit langen Schritten auf Stavros zuging.
»Deinem Wachhündchen fehlt Disziplin«, meinte Stavros. »Aber das ist natürlich allein die Schuld seines Herrchens.«
Daniel sah ihn an, die Hände in den Taschen des schwarzen, knielangen Wollmantels vergraben. Kleine weiße Punkte sprenkelten den Kragen und das Revers. Sie verschwanden unter Stavros’ Blick, schmolzen dahin. Schnee.
Wortlos starrten sie einander an. Obwohl sich Stavros Mühe gab, gelang es ihm nicht, Daniel einzuschätzen. Das frustrierte ihn. Normalerweise konnte er in jedem lesen wie in einem offenen Buch, konnte die Schwächen seines Gegenübers erkennen und sie zu seinem Vorteil nutzen. Aber Daniel Nieto hatte nur eine Schwäche gehabt, und Stavros hatte sie getötet.
»Wie lange willst du mich hier gefangen halten?«, fragte er, hauptsächlich um diese verdammte Stille zu durchbrechen, die mit jedem Moment undurchdringlicher wurde.
Daniels Miene regte sich nicht. Sie blieb starr. »Was denkst du, wie lange es dauert, bis deine Buße getan ist? Wie lange dauert es, bis deine Taten gesühnt sind? Du bist in mein Zuhause gekommen und hast mir meine Frau genommen …«
»Du weißt aber schon, dass das nichts Persönliches war, oder?«, fragte Stavros und runzelte die Stirn. »Es war ein Auftrag.«
»Um die Leute, die dir diesen Auftrag gegeben haben, habe ich mich schon gekümmert.« Daniels Lippen zuckten, doch seine Augen blieben eiskalt. »Jetzt bist du dran. Ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben.«
»Ich fühle mich geehrt.«
»Deberías de estarlo.«
Solltest du auch, bedeutete das.
Daniel berührte die Kette um Stavros’ Hals und für den Bruchteil einer Sekunde glitten seine rauen Finger über Stavros’ Haut. Er zuckte zusammen. »Um einen Mann wahrhaft zu brechen, müssen gewisse Grenzen überschritten werden.« Daniel ließ die Hand sinken und steckte sie wieder in die Tasche seines Mantels. »Ein Glück für uns beide, dass ich diese Grenzen schon vor Jahrzehnten überschritten habe.«
3
US-amerikanische und mexikanische Behörden bestätigen Entdeckung eines unterirdischen Tunnels zwischen Tijuana und San Diego.
Daniel warf die Zeitung achtlos beiseite. Als er aus seinem selbst auferlegten Exil wieder aufgetaucht war, hatten sich die Gerüchte verbreitet. Gerüchte, dass er zurückgekehrt war, um das zu beanspruchen, was den Nietos gehörte. Ihm. Es war sein Erbe. Er hatte nichts gegen die Gerüchte unternommen. Im Gegenteil, er hatte sie noch angefacht. Doch all das war nur Fassade, um seine wahren Pläne zu verschleiern. Er würde nicht in sein Leben als Kartellführer zurückkehren. Keine Waffen mehr schmuggeln, keine Drogen und keine Menschen. Das war nicht seine Zukunft. Nicht mehr. Die Frau, die sich nicht mehr an ihn erinnerte … Er schuldete ihr etwas. Entweder sie oder der Tod. Nicht mehr, nicht weniger. Doch wenn er sich eines Monsters entledigt hatte, lauerte schon das nächste auf ihn. Er musste sich darum kümmern.
Felipe Guzmán gab Daniel die Schuld am Schicksal seiner Schwester. Petras Bruder ertrug es nicht, dass Daniel lebte und frei war; im Gegensatz zu seiner Schwester. Felipe war einer von Daniels Soldaten gewesen, und während seiner Abwesenheit hatte er eine neue Organisation gegründet: die Ghost Gang. Felipe jagte ihn, hoffte ihn hervorzulocken. Aber Daniel war nicht geworden, wer er war, weil er sich von Emotionen leiten ließ. Er hatte Pläne. Pläne wie diese Schlagzeile in der Zeitung. Ein paar geflüsterte Worte zu den richtigen Leuten und nun wusste jeder von den Tunneln, die Guzmán fürs Drogenschmuggeln benutzte.
»¿Jefe?«
Er blickte seinen Neffen an. Sein Bruder, Antonio, hatte sich nie großartig um seinen Sohn gekümmert. Doch in Toros Augen brannte das Feuer der Nietos. Der Durst nach Blut und Macht, den sie allesamt von dem alten Mann geerbt hatten.
»Die Lieferung«, sagte er auf Spanisch an Toro gewandt. »Wo ist sie?«
Toro deutete mit dem Daumen über die Schulter und zeigte auf seinen schwarzen Sedan, der hinter ihm parkte.
»Zeig sie mir.«
»Die zweite Lieferung haben wir auch schon in unseren Besitz gebracht«, sagte Toro und öffnete den Kofferraum.
Lieferung Nummer eins lag darin, mit gefesselten Knöcheln und Handgelenken und zugeklebtem Mund. Der Mann hatte eine schwarze Einkaufstüte mit kleinen Löchern über dem Kopf, sodass er atmen konnte. Er stöhnte schmerzerfüllt auf.
Daniel lächelte. Es war nicht schwer, einen Bandenkrieg anzuzetteln. Nicht, wenn man wusste, in welches Wespennest man stechen musste. Felipe Guzmáns direkte Konkurrenz waren die Perez Boys. Nach und nach schaltete Daniel Mitglieder beider Gangs aus. Er konzentrierte sich auf die, die in der Mitte der Rangordnung standen. Wenn man die rangniedrigen Fußsoldaten tötete, war das allen egal. Diese Jungs arbeiteten für jeden, der ihnen genug Geld bot. Wenn man die wichtigsten Männer ausschaltete, wurden sie schnell ersetzt. Man musste sich auf die Mitte konzentrieren, das Herz einer Organisation. Nur so konnte man eine Gang in die Knie zwingen.
Als Daniel nickte, begann Toro die schwarze Tüte aufzureißen. Der Mann richtete sich auf. Die Geräusche, die er von sich gab, wurden von dem schwarzen Klebeband über seinem Mund erstickt. Er begann wie wild zu blinzeln. Sein Gesicht war fast bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen und nur noch eine geschwollene, blutige Masse. Toro mochte seine Schlagringe. Obwohl die Augen des Mannes blutunterlaufen und fast völlig zugeschwollen waren, konnte Daniel genau den Moment erkennen, in dem er ihn erkannte. Seine Nasenlöcher blähten sich und die erstickten, gedämpften Schreie wurden lauter.
»Sí, soy yo.« Er riss das Klebeband ab. Der Mann begann zu schreien und verstummte erst, als Daniel ihn an der Kehle packte.
Er trug heute seine schwarzen Lederhandschuhe und wünschte, er hätte sie nicht angezogen, denn er konnte den rasenden Puls des Mannes kaum spüren. Trotzdem drückte er zu, und als er zu zappeln begann, war Toro da, um ihn festzuhalten. Tränen liefen über das blutige, zerschlagene Gesicht.
»Ich würde dich ja zu Perez zurückschicken, damit du ihm eine Botschaft von mir ausrichten kannst«, murmelte Daniel, »aber ich glaube, dein Tod ist Botschaft genug.«
Es war längst seine zweite Natur, ein natürlicher Reflex, nach dem Messer zu greifen, das Toro ihm reichte. Er ließ die Klinge hervorschnellen und zog sie über die Kehle des Mannes. Blut spritzte aus der durchtrennten Halsschlagader und durchtränkte sofort die Ärmel seines Mantels und Toros gesamten Kofferraum.
Daniel atmete tief durch und trat einen Schritt zurück. »Kümmere dich darum«; befahl er an Toro gewandt. »Um die Leiche und das Auto. Sofort. Ich will, dass er ausgeliefert wird. An alle.«
Toro legte den Kopf schief. »Wie soll ich …?« Doch sofort unterbrach er sich, nickte und lächelte. »Sí, jefe.«
Alle Ranghöchsten der Perez Boys würden ein Stück des Mannes im Kofferraum bekommen. Eine Botschaft, die unmöglich missverstanden werden konnte.
»Und die zweite Lieferung?«, fragte Toro.
»Lagert ihn irgendwo zwischen«, sagte Daniel. »Unternehmt nichts, bis ihr von mir hört.«
Toro nickte pflichtbewusst. Er wusste, was Daniel meinte, hatte all dies schon öfter getan. Und er würde es wieder tun.
Daniel schlüpfte aus dem Mantel und warf ihn in Toros Richtung. »Reinige ihn.«
»Wir sollten ihn loswerden, jefe«, meinte Toro und runzelte die Stirn.
Als ob Daniel das nicht selbst eingefallen wäre. »Nein.«
»Jefe …«
»Ich habe nein gesagt«, schnappte Daniel.
Sofort lenkte Toro ein. »Natürlich. Perdón, jefe.«
Nieto musterte ihn eingehend. Er sah Antonio so ähnlich. »Als du jünger warst, hast du mich immer Onkel genannt. Warum hast du damit aufgehört?«
Toro starrte ihn an. Er war noch jung, erst sechsundzwanzig, doch für Daniel zu arbeiten, hatte bereits Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Die meisten davon wurden von einem dichten Bart verborgen. Toro war der Inbegriff seines Spitznamens: muskulös, gefährlich und aggressiv. Er hatte Antonios wachsame Augen, denen nichts entging. Und er war viel intelligenter, als er zeigte. Wie sein Vater, hatte Toro diese großspurige, teuflische Fassade, hinter der er sich verbarg. Sie war viel angenehmer als das, was dahinter schlummerte. Daniel wusste das nur zu gut.
»Du bist der Boss«, antwortete Toro endlich und zuckte mit den Schultern.
»Sí.« Er klopfte Toro auf die Schulter. »Aber in erster Linie bin ich dein Fleisch und Blut. Das ist …«. Er deutete zwischen sie. »Das bedeutet bei uns alles.« Damit wandte er sich ab und ging auf sein eigenes Auto zu. »Kümmere dich um den Mantel. Es ist mein Lieblingsmantel.«
»Sí, jefe.«
Natürlich erzählte er Toro nicht, dass Petra diejenige gewesen war, die ihm den Mantel gekauft hatte. Ihr letztes Geschenk. Manchmal fühlte er sich ihr näher, wenn er ihn trug. In diesen Momenten wusste er, dass sein Geist immer mehr verblasste und nur einen gebrochenen Körper zurückließ. Tja. Irgendwann musste es ja so kommen.
****
Gewalt. Sie legte sich um Daniels Schultern wie eine warme Decke. Zerschlissen. Beruhigend. Vertraut. Für einen Moment schloss er die Augen und gestattete sich ein Lächeln. Er genoss es. Gewalt lauerte an diesem Ort, an dem Stavros auf ihn wartete. Angekettet in diesem kalten Keller des Hauses aus Sandstein, das Daniel extra für diesen Zweck besorgt hatte.
»Sir.« Boyd stand neben ihm, in der Hand seine medizinische Ausrüstung. Er wartete auf Daniels Befehle. Trotz des Kittels, der durch den Dreck hellbraun statt weiß war, und trotz des Stethoskops, das um seinen Hals lag, war Boyd kein Arzt. Nur ein Mann, der sich einige Dinge selbst beigebracht hatte. Er war auch ein Mann, der Daniel ein oder drei Gefallen schuldete. Eine Hand wusch die andere.
Sein Gefangener hatte die Augen geschlossen. Ein ruhiger, arroganter Ausdruck lag auf seinem Gesicht. Er drehte sich auf dem kalten Metallboden. »So schnell zurück?«, fragte er, setzte sich langsam auf und hob den Kopf, um durch die Gitterstäbe zu linsen. Er wirkte etwas unterwürfiger als gestern, wahrscheinlich wegen der Tracht Prügel.
Henan hatte seinen Zorn für alle deutlich sichtbar getragen wie einen Talisman. Natürlich hatte Stavros es sofort bemerkt und es gegen ihn verwendet. Seine arrogante Art hatte Henan nur noch weiter angestachelt. Wenn es nach Henan gegangen wäre, hätte er Stavros längst erschossen. Aber natürlich würde der Gefangene noch lange nicht sterben. Das hier war Daniels Welt. Und auch Stavros’ Welt. Sie waren einander so ähnlich, dass es fast tröstlich war. Daniel würde ihn töten. Oder vielleicht würde Stavros auch das bekommen, was er vor Jahren hatte nehmen wollen: Daniels Leben. Doch damals hatte er stattdessen das Leben seiner Frau genommen.
»Hast du mich vermisst?«, fragte Stavros. Er wirkte … unbeeindruckt. »Du kannst es ruhig zugeben. Ich habe diesen Effekt auf Menschen.« Sein Zwinkern war fast freundschaftlich.
Damals, nach dieser blutigen Nacht, hatte Daniel gedacht, dass die Leute, die ihm Stavros auf den Hals gehetzt hatten, verrückt sein mussten. Immerhin hatten sie seinen Zorn auf sich gezogen. Er hatte recht gehabt. Doch seine geliebte Frau zu verlieren, hatte auch ihn verrückt gemacht. Nun waren sie sich ebenbürtig.
»Sir.«
Daniel riss seinen Blick von Stavros los. »Hat er zu essen bekommen?«
Boyd nickte. »Wie Sie angeordnet haben.«
Brot und Wasser. Einmal täglich.
»Dann komm.« Daniel trat vor den Käfig und öffnete ihn mit dem Schlüssel, der an einem Rosenkranz hing. Petras Rosenkranz. Er trug ihn um sein Handgelenk wie ein Armband. Ihr Blut klebte immer noch darauf. Er hatte es nie abgewaschen. Jahre waren vergangen, also musste man genau hinsehen, um die roten, eingetrockneten Spuren noch zu erkennen. Daniel sah sie jedes Mal, wenn er auf sein Handgelenk blickte.
Die Tür des Käfigs schwang mit einem lauten Knirschen auf. Stavros legte den Kopf in den Nacken und lachte. »Komm ruhig rein«, murmelte er und starrte Daniel unter langen Wimpern an. Er zerrte an den Ketten, die um seine Handgelenke geschlungen waren.
Mit drei Schritten war Daniel bei ihm, kniete nieder und umfasste sein Kinn.
Stavros starrte ihn mit seinem typisch herablassenden Blick an. Er war ein Mann, der keine Angst kannte. Kein Wunder bei der Gesellschaft, mit der er sich umgab. Doch Daniel hatte ihn beobachtet und wusste ganz genau, wo sein wunder Punkt lag.
Als hätte sein Gedanke sie heraufbeschworen, erklangen nun Schritte auf den Metallstufen, die hinab in den Bunker führten. Falls Stavros sie hörte, reagierte er nicht darauf. Er sah weiterhin Daniel an und wartete. Vielleicht hatte er eine Vermutung, was gleich geschehen würde, aber Daniel war noch nie leicht durchschaubar gewesen. Deshalb lebte er noch.
Das Klappern von High Heels wurde lauter. Ihre Besucherin war fast da. Daniel ließ Stavros’ Kinn los und rutschte beiseite. Bedächtig starrte er die Frau außerhalb des Käfigs an und nickte ihr zu. Wilhelmina schmiegte sich gegen die Gitterstäbe. Sie war groß und von klassischer Schönheit. Ihre dunkle, walnussbraune Mähne floss über ihre Schultern. Auf eine gewisse Art und Weise hatte sie ihn immer an Walnüsse erinnert. Ihre Schale war hart zu knacken, obwohl ihre großen Augen so unschuldig wirkten. Schwarzes, hautenges Leder verdeckte den Großteil ihrer glatten, sandbraunen Haut, betonte jedoch ihr beeindruckendes Dekolleté.
Stavros drehte sich zu ihr und … erstarrte.
Wilhelmina verzog ihre knallroten Lippen zu einem Lächeln. Sie wirkte fast schüchtern, als sie in den Käfig trat und auf Stavros zuging. Alles an ihr war hypnotisierend: die Art, wie sie sich bewegte, der Ausdruck ihres Blicks, als sie Stavros ansah.
Daniel beobachtete ihn. Seine Augen wurden weit, als sie in die Knie ging und sich auf seinen Schoß setzte, um die Beine um ihn zu schlingen.
»Annika.«
Seine tote Schwester. Daniel hatte ihn lange genug beobachtet, um zu wissen, dass Stavros sie geliebt hatte. Sie waren nicht blutsverwandt. Er hatte sie begehrt. Aber er hatte sie niemals haben können.
»Annika …« Der Name kam nur als zittriger Hauch über Stavros’ Lippen. Er streckte eine Hand aus, wollte sie berühren, doch die Ketten hinderten ihn daran.
Daniel würde es nicht zulassen.
Wilhelmina, Nenn mich Willy, Baby, wand sich auf dem nackten Griechen, küsste ihn und hinterließ rote Spuren aus Lippenstift. Daniel war nahe genug, um Stavros’ rasselnden Atem zu hören. Er saß da und beobachtete. Sie begann Stavros’ Rücken zu streicheln, dann vergrub sie die Finger in seinem Haar und erwiderte seinen Kuss mit einem hungrigen, sehnsüchtigen Stöhnen. Sie wirkte gierig, als ob sie endlich das bekam, worauf sie Jahre gewartet hatte. Willy legte ihre Hände sanft um Stavros’ Hals. Es war wie die Berührung einer Geliebten.
Boyd betrat den Käfig.
Wilhelmina packte seinen Hals fester. Doch Stavros schien es nicht zu bemerken. Er war zu beschäftigt, sich das zu nehmen, was er noch nie zuvor gehabt hatte. Willy war ein Profi. Sie hörte nicht auf, zuckte nicht einmal mit der Wimper. Sie verstärkte ihren Griff und drückte zu. Als Stavros endlich verstand, was vor sich ging, versetzte sie ihm einen Kopfstoß. Sein nackter Körper zuckte, aber sie ließ seinen Hals nicht los.
Daniel wandte den Blick nicht ab. Er sah zu, wie die wunderschöne Frau mit ihren zarten Händen das Leben des Griechen nahm. Sie stahl es ihm und Daniel war eifersüchtig, weil sie nun wusste, wie es sich anfühlte, Stavros’ Leben zu nehmen. Doch er hatte es so geplant. Er akzeptierte es.
Als Stavros sich nicht mehr bewegte, löste sie die Hände von seinem Hals und hob sie. Eine fast kapitulierende Geste. Sie dehnte ihre Finger, ballte die Hände zu Fäusten und öffnete sie wieder. Dann erwiderte sie Daniels Lächeln. Lust brannte in ihrem Blick. »Erledigt.«
»Boyd.« Daniel winkte den Mann herbei, während die Frau von Stavros’ nacktem Körper stieg und zur Tür des Käfigs schritt.
»Falls du meine Dienste benötigst«, schnurrte sie, »du weißt, wo du mich findest.«
Daniel nickte. Toro hatte ihre Kontaktdaten, sie verkehrten in denselben Kreisen. Sie war schon bezahlt worden, also entließ Daniel sie mit einer Geste. »Auf Wiedersehen, Wilhelmina.«
Ihre Absätze klackerten, als sie ging, doch Daniel hatte seine Aufmerksamkeit schon auf Boyd gerichtet. Unbeeindruckt sah er dabei zu, wie Boyd mit der Herzdruckmassage begann, um Stavros zurück ins Leben zu holen. Er durfte nicht tot bleiben. Noch nicht. Er hielt seine Miene unbeteiligt, die Finger verschränkt. Seine Zeigefinger berührten seine Lippen. Boyd keuchte, während er atemlos mitzählte. Langsam begann er zu schwitzen, denn er wusste, wenn Stavros nicht mehr aufwachte, wäre dies auch sein Tod.
Stavros’ Körper begann zu zucken. Seine Wimpern flatterten, als er hustete und aufstöhnte. Er war leichenblass, seine Augen waren blutunterlaufen und sein Blick war abwesend.
Boyd stand auf, trat zurück und seufzte.
Stavros drehte den Kopf und sein Blick wurde klarer, als er Daniel direkt in die Augen starrte. Sein Adamsapfel hob und senkte sich.
Daniel lächelte. »Willkommen zurück.« Er salutierte. »Jetzt kann der Spaß beginnen.«
4
Er hatte sich an die Stille gewöhnt. Inzwischen wusste er, was sie bedeutete; was sie repräsentierte. Die Ruhe vor dem Sturm.
Stavros hatte sich in der Mitte der kalten Zelle zusammengekauert, das Blut trocknete noch unter seinem nackten Körper. Er machte sich nicht die Mühe, den Kopf zu heben. Sein Körper schmerzte, doch Schmerz war zu seinem ständigen Begleiter geworden, sodass er ihn hinter den Rand seines Bewusstseins schieben konnte. Wenn er seine Finger bewegen könnte, hätte er sie zu Fäusten geballt, doch sie hingen nur schlaff herab. Auch das Atmen, diese lästige Notwendigkeit, tat weh. Seine Lungen mit Luft zu füllen, war zu einer schwierigen Herausforderung geworden, die er versuchte zu bewältigen, während er zusammengekrümmt dasaß. Nur eine Sache konnte durch solch allgegenwärtige Stille schneiden und Stavros wartete darauf. Er hatte schon immer gut warten können. Und töten. In letzter Zeit nahm das Warten überhand. Er wartete darauf, zu töten. Oder getötet zu werden. Das war die Kehrseite der Medaille. Ihm war beides recht.
Schon in jungen Jahren hatte er gelernt, zu töten. Viel früher, als ein Junge dies lernen sollte. Aber sein Vater hatte an Perfektion geglaubt und daran, dass man ständig bereit sein musste. Er war sichergegangen, dass sein Sohn stets mit Gewalt in Berührung kam. Schon vor seinem achtzehnten Geburtstag war Stavros abgestumpft gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auch schon einige Menschen getötet. Der Stolz in den Augen seines Vaters hatte dafür gesorgt, dass das Blut weitergeflossen war. Er war ohne Mutter aufgewachsen, sein Vater war viel auf Reisen gewesen, hatte sich als Diplomat getarnt. Also hatte es nicht viele Gelegenheiten gegeben, jemanden stolz zu machen. Die Lehrer an den diversen Internaten zählten nicht. Sein Theíos, also sein Onkel, Christophe hatte sich um ihn gekümmert, ja, aber Christophe war nicht Stavros’ Vater. Also hatte er jede Gelegenheit genutzt, seinen Vater stolz zu machen.
Er öffnete die Augen und starrte in die Dunkelheit. Zeit hatte in seinem Gefängnis keine große Bedeutung. Er hatte keine Uhr und auch am Licht der Sonne konnte er sich nicht orientieren. Hier gab es nur Kälte und Dunkelheit. Er wusste nicht, wie lange er schon hier gefangen gehalten und von Daniel Nieto gefoltert wurde.
Als hätten Stavros’ Gedanken ihn heraufbeschworen, hörte er das Geräusch leiser Schritte auf dem staubigen Boden. Er zwang sich, den Kopf zu heben, obwohl es sich anfühlte, als würde ein Block aus Beton auf seinem Nacken liegen. Mehrmals musste er blinzeln, bis er etwas erkennen konnte. Die Dunkelheit wurde nun vom Schein einer Glühbirne erhellt und sein Peiniger stand vor ihm.
»Mr. Konstantinou.« Daniels Stimme ließ Stavros erbeben.
»Nenn mich …« Es war so merkwürdig, seine eigene Stimme zu hören. »Nenn mich Stavros.« Als Stavros lächelte, sprangen seine rissigen Lippen auf. Frische Blutstropfen liefen über sein Kinn. »Wir sind uns ja schließlich schon nähergekommen, oder?«
Der Mann vor ihm, der ihn so genau beobachtete, reagierte nicht. Das hatte Stavros auch nicht erwartet. Daniels Blick war fast entspannt, irgendwie gelangweilt. Er erwartete, dass er Stavros noch brechen würde. Daniel Nieto hätte sich erkundigen sollen, wie Stavros reagierte, wenn man etwas von ihm erwartete. Er tat nie das, was man von ihm erwartete.
»Freust du … Freust du dich, mich zu sehen?« Sprechen und Atmen taten weh, also hielt er kurz inne, um dann die nächsten Worte herauszuzwingen. »Ich habe …« Er hob das Kinn und der Schmerz war so gleißend, dass er ihm für einen Moment die Sicht raubte. »Ich habe dich nämlich vermisst, Nieto.« Er leckte sich das Blut von den Lippen. »Es ist immer … immer so spannend, wenn du hier bist.«
Das war es wirklich. Wenn Daniel hier war, spielten sie. Sie spielten das Spiel, bei dem Daniel Gott war. Er tötete Stavros, dann holte er ihn zurück. Er hatte noch nie Angst vor dem Tod gehabt. Jetzt wusste er dank Daniel sogar, was auf der anderen Seite auf ihn wartete.
Die Tür des Käfigs schwang auf und Daniel betrat die Zelle. Groß und schlank, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Sein Blick ruhte auf Stavros. Die glänzenden Augen verhießen nichts Gutes. Stavros bereitete sich mental vor, als er immer näher kam. Das einzig Berechenbare an Daniel Nieto war seine Unberechenbarkeit. Stavros fand es … faszinierend.
»Mr. Konstantinou.« Daniel kniete sich neben ihn auf den Boden, direkt in die kleine Blutlache. Er griff nach Stavros’ Nacken. Diesmal ohne Handschuhe. Seine Finger bohrten sich in Stavros’ Haut, als er seinen Kopf nach hinten riss.
Er biss fest die Zähne zusammen. Tränen schossen ihm in die Augen, als der Schmerz durch seinen Körper raste.
»Ich bin froh, dass du bei Bewusstsein bist«, murmelte Daniel. »Du sollst unbedingt miterleben, was ich als Nächstes geplant habe.«
Stavros zwang sich zu einem Lächeln. Er würde keine Schwäche zeigen. Niemals. Doch in seiner Brust saß ein Klumpen aus eiskalter Angst. Daniels Unberechenbarkeit, das, was ihn an ihm so faszinierte, hatte ihm tatsächlich einmal Angst eingejagt. Als er wieder zu sich gekommen war und eine überaus lebendige Doppelgängerin seiner toten Stiefschwester auf ihm gesessen hatte. Nackt. Sie hatte sich auf seinem Schoß gewunden, ihn angefleht, sie zu berühren. Sie zu nehmen. Für einen Moment hatte er den Tod willkommen geheißen. Er hatte bei ihr sein wollen. Sich endlich nehmen wollen, wonach er sich sehnte, seit ihre Mutter seinen Vater geheiratet hatte. Damals waren sie beide noch Teenager gewesen. Ja, er hatte sich ihren Berührungen hingegeben. Ihren Lippen. Als sie noch am Leben gewesen war, hatte er das nie gewagt. Sie hatte es nie zugelassen. Oh, aber sie hatte ihn oft genug gequält. Hatte ihn denken lassen, dass er eine Chance hätte, nur um im letzten Moment einen Rückzieher zu machen. Diesmal war es nicht anders gewesen. Bis auf ihre weichen Hände um seine Kehle, die fest zugedrückt hatten. So, wie er es mochte. Die falsche Annika hatte alles über ihn gewusst, all seine sexuellen Vorlieben. Aber ihre Berührungen waren eine Lüge gewesen. Wie ihr Gesicht. Sie war nur eine Doppelgängerin gewesen, die Daniel irgendwo aufgetrieben hatte. Anscheinend wusste er mehr über Stavros, als ihm klar gewesen war. Den Feind zu unterschätzen, war ein tödlicher Fehler.
»Ich bin bereit«, sagte er stockend an Daniel gewandt. »Was auch immer du dir ausgedacht hast, leg ruhig los. Ein Steak wäre übrigens ganz nett.« Die beschissene Brot-und-Wasser-Diät taugte nichts. Kombiniert mit der allgegenwärtigen Kälte und der Prügel, die er von dem mürrischen Henan fast täglich bekam, hatte ihn der Hunger in einen Zustand unbeschreiblicher körperlicher Schwäche versetzt.
Daniels Lippen kräuselten sich. Es war ein grausamer Mund, der in einem scharf geschnittenen Gesicht saß.
Stavros hatte Grausamkeit immer bewundert. Auch in diesem Moment war es nicht anders. Er sollte sich verzweifelt an den letzten Rest seines Verstandes klammern. Und doch bewunderte er Daniel Nietos Mund.
»Ich denke, ich hätte dich sogar mögen können«, sagte Daniel. »Wenn du nicht so gewissenlos wärst.« Die Berührung in Stavros’ Nacken wurde sanfter, dann zog Daniel die Hand weg. »Wenn du mir nicht das Wichtigste in meinem Leben genommen hättest.«
Daniels Tonfall war fast harmlos, als würden sie eine angenehme Unterhaltung führen, aber er jagte eine Gänsehaut über Stavros’ Rücken. All seine Alarmglocken begannen zu schrillen und er wappnete sich. Keinen Moment zu früh. Der scharfe Schmerz in seiner linken Seite ließ ihn aufkeuchen. Er riss seinen Blick von Daniels Gesicht weg und sah an sich herab. Ein Messer steckte in seiner Seite. Daniel umschloss den Griff mit einer fast zärtlichen Berührung. Seine Fingerknöchel glitten über Stavros’ Haut, als das Blut zu fließen begann und sich zu dem längst getrockneten Blut auf dem nackten, kalten Boden gesellte.
Nieto wollte, dass Stavros um den Tod bettelte. Dass er flehte, damit die Folter aufhörte.
Sein Blick verschwamm und ein verräterisches Geräusch kam über seine Lippen, als er eine Hand hob. Langsam. Er berührte den Arm des Mannes, der die Klinge hielt, die in ihm steckte. Eine neue Wunde, die sich zu den unzähligen anderen gesellte. So viele waren hinzugekommen, seit er zum ersten Mal in Daniels Käfig erwacht war. Wunden über Wunden. Auch diese würde bluten, schmerzen und schließlich zu einer Narbe werden, so wie die anderen. Aber sie würde sein Leben nicht bedrohen. Noch nicht. Daniel wollte ihn leiden sehen. Dafür musste Stavros am Leben bleiben. Er hatte keine Kraft mehr, klammerte sich nur an Daniel fest. Seine Haut war nass und glitschig.
Als sein Peiniger das Messer aus ihm herauszog, erklang ein schmatzendes Geräusch, das Stavros gut kannte. Die Wärme des Blutes vertrieb die Kälte zumindest ein wenig. Er hob die Hand vor sein Gesicht und betrachtete das tropfende Rot an seinen Fingern.
»Du magst es, wenn ich blute.« Sogar für ihn selbst hörte sich seine Stimme schwach an. Zittrig.
»Du bist so gut darin.« Daniel klang seltsam stolz, als würde er das Blut bewundern, das in Rinnsalen über Stavros’ Hüfte floss und sich neben ihm am Boden sammelte. »Außerdem genieße ich es so sehr, dich leiden zu sehen.«
Stavros’ Bewusstsein schwand, doch er hob die blutigen Finger an seine Lippen und leckte das Rot ab. War es nur sein Blut oder hatte sich etwas von Daniels daruntergemischt? Eisern hielt er Daniels Blick stand. »Ich genieße es …« Seine Stimme wurde leiser und leiser, undeutlicher, während ihm die Sicht schwand, bis er nur noch den Mann neben sich sah. Den Mann, der Stavros’ Todesurteil um seinen Hals trug. Den Mann mit dem undurchdringlichen Blick und dem wunderschön grausamen Mund. »Ich genieße es, dir dabei zuzusehen, wenn du versuchst, mich leiden zu lassen.«
****
»Wie geht es unserem gemeinsamen Freund?« Syren Rua lehnte sich zurück, streckte die Beine aus und überkreuzte die Füße. Er sah Daniel milde neugierig an. »Er lebt doch noch, oder?«
Sein unbeteiligter Tonfall täuschte Daniel nicht, nicht einmal eine Sekunde. Syren sagte oder tat nie etwas grundlos. Daniel mochte das an ihm. Das machte es leichter, ihn zu ertragen. »Ich hoffe es zumindest.«
»Du weißt, dass du ihn nicht umbringen kannst, oder?«
Syren zuckte nicht einmal mit der Wimper, als Daniel ihn anstarrte. Er hatte schon vor längerer Zeit gelernt, dass er dem kleinen Mann mit dem schlohweißen Haar keine Angst einjagen konnte. Sein Gegenüber erwiderte den Blick aus Augen von der Farbe, die ihn an die Lavendelstauden erinnerte, die Petra in ihrem Garten gehabt hatte. »Weiß ich das?«, fragte er herausfordernd.
Syren verdrehte nur die Augen. »Ja, weißt du.« Er stand auf und ging an ihm vorbei, trat ans Fenster seines Apartments im zehnten Stock, von dem aus man einen guten Blick über die Innenstadt Atlantas hatte. »Tu mit Stavros, was du willst«, sagte Syren, als er sich wieder zu Daniel umwandte, »aber halte ihn am Leben. Du brauchst ihn.«
Was für eine lächerliche Vorstellung. »Er muss sterben«, sagte er ohne Zorn in der Stimme. Heutzutage brauchte es einiges, um ihn zornig zu machen. »Es ist unausweichlich. «
»Oh?« Syren hob einen Finger. Seine Nägel waren grellviolett lackiert. »Warum hast du dann so lange gewartet, deinen Plan in die Tat umzusetzen?«
Das musste eine rhetorische Frage sein, denn Syren wusste genau, warum sich alles verzögert hatte. Er war eng mit dem Anführer der Gruppe befreundet, die zu dem Zweck gegründet worden war, Daniels Business zu stürzen. Syren war derjenige gewesen, der Daniel immer über die nächsten Schachzüge der FBI-Agenten informiert hatte. Er wusste, dass Daniel eine Verpflichtung gegenüber der Frau hatte, deren Verstand nun von Sekunde zu Sekunde weiter schwand. Syren hatte auch zu der Gruppe gehört, die von Stavros zu Daniel geschickt worden war. Er hatte als Einziger gegen den Angriff gestimmt. Im Nachhinein hatte er sich an Daniel gewandt und ihm Hilfe angeboten. Hilfe, sich wieder zurückzuerobern, was ihm genommen worden war. Ja, seine Freiheit ließ sich wiederherstellen. Aber was mit Petra geschehen war, ließ sich nie wieder rückgängig machen. Nur wegen ihr sann Daniel nach Rache. Syren wusste das. Syren wusste, dass solche Dinge Zeit brauchten, immerhin hatte er sich undercover in eine kriminelle Organisation eingeschleust, um sich am Tod seiner Familie zu rächen. Solche Dinge brauchten Zeit und vor allem Geduld. All dies sagte Daniel nicht. Dennoch schien der kleine Mann, gekleidet in einen maßgeschneiderten grauen Anzug, schwarzes Hemd und dunkelbraune Lederschuhe, ihm all seine Gedanken von der Stirn abzulesen.
»Sag mir eines.« Syren setzte sich wieder und schnipste etwas Unsichtbares von seinem Revers. »Und sei ruhig ehrlich, okay? Wenn du deine Klinge in Stavros’ Fleisch rammst, ist es dann das Blut, das dich weitermachen lässt?« Er erwiderte unverwandt Daniels Blick. Seine Augen sagten mehr als seine Stimme, sagten Daniel, dass er die Antwort schon kannte. »Oder ist es speziell der Anblick von Stavros Konstantinous Blut?«
Daniel verengte die Augen.
»Ist es der Gedanke, ihn für das bezahlen zu lassen, was er Petra angetan hat? Ist es das, was dein Blut in Wallung bringt? Oder ist es einfach der Gedanke an ihn? Ist es sein Anblick, der dafür sorgt, dass du die Selbstkontrolle verlierst?« Syren hob eine Hand. »Denn ich muss dir leider sagen: Egal, wie sehr du versuchst, es zu verbergen, du verlierst die Selbstkontrolle, mein Freund.«
Sie waren keine Freunde. Eigentlich waren sie kaum Bekannte.
»Du verwechselst mich mit jemandem, der manchmal die Kontrolle verliert, amigo«, knurrte er und Syrens Lippen zuckten. »Sprich nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst.«
»Wenn du meinst.« Syren hob ergeben die Hände, doch sein Blick war spöttisch. »Was ist dein nächster Schritt?«
»Alles schon in die Wege geleitet.« Daniel erhob sich. Er konnte Syrens Stimme nicht mehr ertragen. Ja, er musste mit dem Brasilianer Geschäfte machen, aber er weigerte sich, es persönlich werden zu lassen.