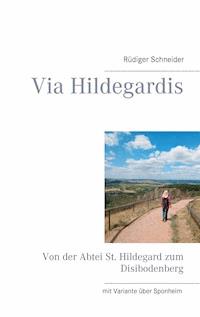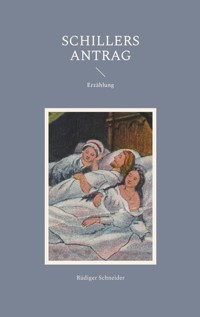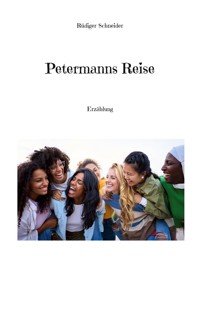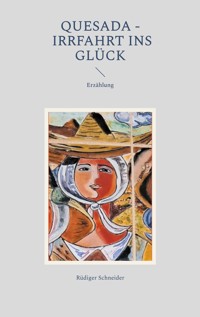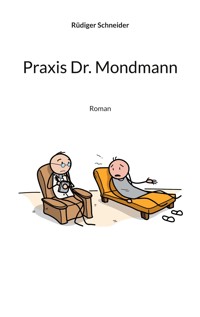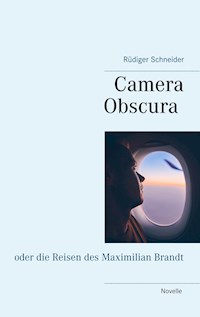
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maximilian Brandt reist um die Welt. Im Gepäck hat er kleine, schwarze Filmdosen, die er als Camera Obscura an ausgesuchten Plätzen unauffällig mit einem Kabelbinder anbringt. Zu Hause in der Dunkelkammer entwickelt er die Fotos, erlebt bei einem Bild eine große Überraschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Personen und Handlung sind frei erfunden, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Namen rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
1
Eine Zeit lang war ich zufrieden mit meinem Beruf. Ich bin Flugbegleiter bei der Lufthansa, trage im Dienst eine elegante, dunkelblaue Uniform mit meinem Namensschild: M. Brandt. Das M. steht für Maximilian. Ich kam, wie ich es mir anfangs gewünscht hatte, in der Welt herum, landete in Singapur, Hong Kong, Manila, Bangkok, Seoul, Djakarta, San Franzisko, Delhi, Casablanca und in vielen anderen Orten. Aber im Laufe der Zeit verblasste die Reiselust. Der Job wurde zur Routine und eigentlich sah ich auch nicht viel von den Städten, von den Ländern sowieso nichts. Denn es war immer nur Hinflug, Hotel, Rückflug.
Sicher, ich hätte auch einen anderen Beruf wählen können. Das Abitur hatte ich. Ein Jahr lang trieb ich mich an der Bonner Universität herum, war eingeschrieben für Philosophie, wusste aber nicht, was ich damit beruflich anfangen sollte. Mich interessierten aber die existentiellen Fragen. Nach dem Woher und Wohin des Menschen, nach seiner Stellung im Universum. Ich wollte wissen, geschieht etwas aus Zufall oder ist es Fügung. Die Philosophie, die an der Universität gelehrt wurde, gab mir keine Antwort. Und als dann einmal in einer Vorlesung über Hegels ‚Gestänge in Zeit und Raum‘ doziert wurde, schmiss ich hin, wollte lieber Geld verdienen, von den Eltern unabhängig sein, Abenteuer erleben, etwas von der Welt sehen. Da war ich Anfang 20.
Die Ausbildung zum Flugbegleiter war erfreulich kurz, dauerte nur vier Monate. Dann war ich regelmäßig in der Luft. Aber wie gesagt: Es wurde im Laufe der Jahre zur Routine, war nicht besonders abwechslungsreich. Nach dem Briefing mit der Crew und der Ansprache des Kapitäns musste ich meinen Kabinenabschnitt kontrollieren, die Verpflegung mit dem Catering Agenten überprüfen, die Galley checken, Reisende mit einem Lächeln begrüßen, beim Gepäck helfen, Sicherheitshinweise geben, Rutschendruck und Sauerstoffflaschen checken, bis dann der Purser das Kommando gab: „Cabin crew, all doors in flight!“ Ich meldete dann „Kabine klar!“ ins Cockpit. Die Maschine rollte zur Startbahn. War die Reiseflughöhe von 10 000 Metern erreicht, gab es noch mal ein Briefing in der Galley. Danach hatte ich die Menükarten auszuhändigen und für den Service zu sorgen.
Im ersten Jahr meines Jobs war ich der Philosophie noch treu geblieben, suchte weiter nach Antworten auf meine Fragen, las ein paar Bücher. Zum Beispiel vom Dalai Lama, der fragte: „Was aber ist Glück?“ Ich beließ es beim Lesen. Der Eintritt ins Glück gelang mir nicht. Es mangelte an der Umsetzung. Ich wagte mich an Thomas von Aquin ‚De Ente et Essentia‘, vom Sein und vom Wesen. Es war zu kompliziert. Ich blätterte in ‚Gott oder nichts‘. Vergebens. Ich wollte Abenteuer erleben und nicht in einer Klosterzelle beengt sein. Auch Stephen Hawkings ‚Kurze Antworten auf große Fragen‘ half mir nicht. Den Urknall hielt ich schlicht für den allergrößten Blödsinn. Er steuerte nichts zu meinem Verständnis der Welt bei. Dass das Universum spontan aus nichts entstanden sein sollte, konnte ich mir nicht vorstellen. Auch das Werk des Boethius ‚Trost der Philosophie‘ ließ mich ratlos zurück. „Gibt es einen Gott - Woher das Übel? Gibt es keinen – Woher das Gute?“ Lauter Fragezeichen also. Ich stellte meine privaten Studien nach einem Jahr ein, las nicht mehr, hatte sogar einen Widerwillen gegen Gedrucktes. Lieber wollte ich die bunten Bilder der Welt in mich hineinlassen.
Jetzt bin ich 32, freue mich mehr darauf, wieder zu Hause in meiner Bonner Wohnung zu sein.
Fotografiert, geknipst mit meinem Smartphone, hatte ich reichlich. Aber die sogenannten Sehenswürdigkeiten waren schließlich immer dieselben. Da veränderte sich nichts. Stillstand.
Ich will die digitale Fotografie nicht verunglimpfen. Man spart sich das Entwickeln, kann Fotos sogleich versenden, sie im Computer speichern, auf beliebige Formate bringen, bearbeiten, verändern und vor allem: Sie kosten nichts. Ich kann tausendmal dasselbe Motiv ablichten, tausendmal den Auslöser drücken. Es kostet nichts. Alles ist sofort. Kaum habe ich den Auslöser gedrückt, verfüge ich auch schon über das Foto.
„Wie langweilig!“ dachte ich. Die Bilder sind gefroren. Bewegung? Keine!
2
So kam ich auf die Idee, mich der analogen Fotografie zuzuwenden. Ich wollte mich um ein Bild wieder bemühen, sehen, wie es entsteht, wie die Konturen im Rotlicht der Dunkelkammer erscheinen, stärker werden, bis der Zeitpunkt kommt, wo man das lichtempfindliche Papier aus der Schale mit dem Entwickler nimmt, mit Wasser abspült, um es dann in ein Fixierbad zu tauchen, damit das Motiv erhalten bleibt und nicht durch das Licht außerhalb der Dunkelkammer schwarz wird.
In einem Fotogeschäft, das neben digitalen Apparaten auch Fotografika anbot, kaufte ich mir eine Agfa Synchro Box von 1951. Sie hatte das Aussehen eines Kästchens, war aus schwarz gefärbtem Stahlblech. Mit einem seitlichen Schieber, einem Lochblech, konnte man drei Blendenstufen einstellen, sah von oben durch einen Sucher auf das Motiv. Die Belichtungszeit war festgelegt. Es gab nur diese eine. Man drückte auf einen Auslöserhebel. Es machte ‚Klack‘, das Licht fiel für eine dreißigstel Sekunde durch das Objektiv auf einen eingespulten Film im Innern der Box. Aber diese so simple Kamera hatte eine Funktion, die bei den digitalen fehlte. Die Langzeitbelichtung. Drückte man den Auslöserhebel nach unten, hielt ihn in dieser Position, so blieb der Verschluss, solange man wollte, geöffnet. Das ermöglichte mir, in einen Bereich zu kommen, wo das Foto nicht mehr scharf den Moment wiedergab, sondern den Ablauf einer Bewegung. Im Internet fand ich einen Berliner Laden, bei dem man immer noch Filme und Fotopapier und alles, was man für eine Entwicklung und Fixierung des Bildes brauchte, bestellen konnte. Ich kaufte keine Filme, sondern lichtempfindliches Fotopapier, schnitt es auf das Format 6x9, befestigte es innen an der Rückwand der Box.
Die Gästetoilette meiner Wohnung richtete ich mir als Dunkelkammer ein, versiegelte das kleine Fenster mit schwarzer Pappe, wechselte die helle Birne gegen eine rote, schob einen Tisch über die Toilettenschüssel, bestellte in dem Fotoladen die Grundausrüstung. Schalen, Flaschen mit Entwickler- und Fixierlösung, eine Chemiezange, um das Foto in den Flüssigkeiten schwenken und heraus nehmen zu können. Der Entwickler arbeitete auf Vitamin C-Basis. Ihn konnte ich, war er verbraucht, in das Waschbecken schütten. Die Lösung mit dem Fixiersalz sammelte ich in einem Kanister, den ich beim Schadstoffmobil abgeben konnte. Da ich, um den Ablauf einer Bewegung festhalten zu können, längere Belichtungszeiten brauchte und die Unruhe der Hände verhindern musste, schaffte ich mir für die Box natürlich auch ein Stativ an.
3
Für meine erste Aufnahme wartete ich eine Nacht ab, in der die Venus dicht vor einem Sichelmond wanderte, baute die Kamera mit dem Stativ auf meinem Balkon auf, richtete die Box zum Himmel, stellte die kleinste Blende ein, drückte den Auslöserhebel nach unten, fixierte ihn mit einer Schnur am Stativ, hielt ihn für eine ganze Stunde geöffnet, während Mond und Venus weiter wanderten.
Was ich dann nach dem Entwickeln und dem Fixieren sah, war eine zunächst breite, dunkle Bahn des Mondes und eine längere, strichförmige der Venus, die dem Erdtrabanten davoneilte. Da, wo das Licht auf das Fotopapier getroffen war, hatte sich grauschwarzes Silber ausgeschieden. Aber auch andere Lichtquellen mussten sich eingeschaltet haben und lagen wie ein geheimnisvoller Schimmer auf dem Bild. Es mochten Reflexe sein von Laternen, erleuchteten Fenstern oder Autoscheinwerfern. Zunächst hatte ich nur ein Negativ. Ich klemmte es unter ein Episkop, projizierte das Negativ auf Fotopapier, verwandelte es in ein Positiv. Nun wurde das hell, was zuvor dunkel war, und was hell war, wurde dunkel. So entsprach es den wirklichen Lichtverhältnissen. Im Vergleich zur digitalen Fotografie schien das alles sehr umständlich und zeitraubend. Es machte mir aber Freude, ein Bild im Entstehen, im Werden zu beobachten. Vor allem aber hatte ich einen Bewegungsablauf fotografiert, ein Stück Leben, wie ich es nannte. Ich sah die Bahn des Mondes und die viel zartere der Venus davor. Und ich sah den Schimmer anderer Lichtquellen. Das Foto strahlte eine geheimnisvolle Stimmung aus, so als hätte es ein surrealistischer Maler komponiert.