
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Camp Honor
- Sprache: Deutsch
In diesem Camp wirst du zum Helden! Verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat – der 15-jährige Wyatt ist verzweifelt. Doch dann taucht ein mysteriöser Fremder auf und bietet ihm einen ungewöhnlichen Deal an: Wenn sich Wyatt in einem geheimen Camp der US-Regierung ausbilden lässt, wird seine Vorstrafe aus den Akten getilgt und er bekommt die Chance auf einen Neuanfang: als jugendlicher Elite-Agent! Doch das Training ist knallhart ... Explosive Action ab 14 vom Co-Autor des SPIEGEL-Bestsellers "American Sniper" Eine abgelegene Insel. Ein geheimes Trainingslager der US-Regierung. Und eine Gruppe von Jugendlichen, die zu den besten Geheimagenten der Welt ausgebildet werden soll. Willkommen im CAMP HONOR! *** Explosive Action, heldenhafte Missionen und ein Team, das füreinander durchs Feuer gehen würde – Band 1 der Action-Reihe für Leser*innen ab 14! *** Weitere Action-Thriller von Ravensburger: Deep Sleep Band 1: Codename: White Knight Band 2: Auftrag: The Whisperer Band 3: Mission: Good Mother Last Line of Defense Band 1: Der Angriff Band 2: Die Bedrohung Band 3: Der Crash Alex Rider Band 1: Stormbreaker Band 2: Gemini-Project Band 3: Skeleton Key Camp Honor Band 1: Die Mission Band 2: Der Auftrag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2019Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2019 Ravensburger Verlag GmbHDie Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Camp Valor bei St. Martin’s Press.Copyright © 2018 by Scott McEwen and Tod H. WilliamsPublished by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.Übersetzung: Christian DrellerUmschlaggestaltung: Frauke Schneider unter Verwendung von Motiven von ayakovlev_com, prometeus, innervision, carlosphotos, Iryna_Rasko und Mr_Twister (alle Depositphotos)Grafik im Innenteil: Jag_cz (Adobe Stock)Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-47952-8www.ravensburger.de
Dies ist unseren Kindern gewidmet. Wir haben euch eine schwierige Welt hinterlassen, und wir können nur hoffen, euch die Fähigkeiten mitgegeben zu haben, um in ihr zu überleben und aufzublühen.
Prolog
14. APRIL 1984, ABENDS GEHEIMER ANKERPLATZ VOR DER INSEL ELEUTHERA, BAHAMAS
Es war Tag neun einer zehntägigen Kreuzfahrt auf der honduranischen Megajacht La Crema. Für die meisten Familien eigentlich ein Traumurlaub: kein einziger Regentropfen, spiegelglatte See, geringe Luftfeuchtigkeit. Dennoch hatten die zwei Jungen – beide waren im ersten Jahr an der Highschool – ihre Kabinen kaum verlassen. Der Grund: Videospiele. Donkey Kong, um genau zu sein. Und Colonel Victor Marvioso Madrugal Degas hatte die Nase gestrichen voll.
Am liebsten wäre der Colonel in die Kabine seines Sohnes gestürmt, um den Nintendo von der Wand zu reißen und die Konsole durch die nächstbeste Luke ins Karibische Meer zu schleudern. Dort hätten die Jungen eigentlich die ganze Zeit schwimmen und schnorcheln sollen. Aber sein Sohn Wilberforce – oder Wil, wie er sich neuerdings auf seinem amerikanischen Internat nannte – hatte abgesehen von Elektronikspielen anscheinend keinerlei Interessen. Und Claudia, die Ehefrau des Colonels, wäre vermutlich per Hechtsprung der Konsole hinterhergetaucht. Nur damit, Gott bewahre, ihr Sohn nicht auf den allmächtigen Kong verzichten müsste.
Für einen erfahrenen Befehlshaber von Todesschwadronen zeigte der Colonel eine bemerkenswerte Selbstbeherrschung. Er nippte geduldig an seinem Rum, paffte Zigarillos und beschiss beim Poker, bis es zehn Uhr abends war. Dann erhob er sich vom Kartentisch und verkündete seinen Gästen, dass er bald zurück sein werde. Mit einem Ruck seines Kinns bedeutete er Claudia und zwei Bodyguards, ihm zu folgen. Vámonos: Zeit, Frauen und Blagen ins Bett zu bringen.
Die Jungen hörten nicht, wie die Tür aufging. Doch der Geruch von Rum und Zigarillos flutete den Raum. Keiner von beiden rührte sich, während sie vor dem verpixelten Monitor auf dem Boden hockten und aus Wils Jambox »Purple Rain« von Prince plärrte. Der Colonel verzog schaudernd das Gesicht. Diese Musik war was für Bekloppte.
Wils Mutter trat zuerst ein. Sie schwankte noch stärker als gewöhnlich. Prompt trat sie aus Versehen auf Wils Bein und der spitze Absatz ihres High-Heel-Schuhs bohrte sich in seine Wade.
»Herrgott, Mom! Pass doch auf, wo du hintrittst!«, beschwerte Wil sich.
Claudia drückte ihm einen feuchten Schmatzer auf die Wange und murmelte als Entschuldigung etwas von Reisetabletten und Wein. Halt suchend, krallte sie ihre langen Fingernägel in die Wände und torkelte wieder in den Gang hinaus. Wie eine Billardkugel zwischen den Banden eierte sie zu der Kabine, die sie mit dem Colonel bewohnte.
»Zehn Uhr, Jungs«, sagte der Colonel und klatschte in die Hände. »Zeit fürs Bett!«
»Nein, Daddy. Bitte nicht. Nur noch ein Spiel. Bitte«, bettelte Wil. »Ich bin kurz davor, meinen Highscore zu knacken.«
Aber Wils Freund stand auf. »Wil«, sagte der Junge. »Wir haben versprochen, um zehn aufzuhören. Es ist Zeit.« Er gähnte. »Außerdem glaube ich, dass du morgen dann noch besser sein wirst.«
»Hast recht!« Wil schaltete erst das Spiel und dann die Musik aus.
»Danke, Wil«, sagte der Colonel und tätschelte seinem Sohn den Kopf. Insgeheim war er jedoch irritiert, dass Wil seinem Freund viel schneller gehorcht hatte als ihm. »Okay, ihr solltet jetzt Zähne putzen und dann ab in den Schlafanzug. Und was dich angeht«, fuhr der Colonel fort und wies auf den Freund seines Sohnes, »so wird Manuelito dich in deine Kabine begleiten. Gute Nacht.«
Kaum war sein Freund außer Hörweite, fragte Wil: »Warum kann Chris nicht in meiner Kabine übernachten? Warum muss er hinten im Schiff bei den Bediensteten schlafen?«
»Weil du fast fünfzehn bist. Zu alt für Pyjamapartys und …« Er zeigte auf den Nintendo. »… Videospiele und dieses Traumweltzeugs mit Zauberern und all dem Schwachsinn, das du da spielst.«
»Du meinst Dungeons and Dragons?«
»Ja«, erwiderte der Colonel. »Mit diesen Kindereien wird bald Schluss sein. Sobald es in unserer Heimat wieder sicher für dich ist, werde ich dafür sorgen, dass du bei deiner Abuela lebst, deiner Großmutter«, sagte der Colonel und lächelte bei der Erinnerung an seine eigene Jugend. »Du wirst in dem Dorf aufwachsen, in dem ich groß geworden bin. Tagsüber gehst du auf die Militärakademie und die restliche Zeit kümmert sich deine Großmutter um dich. Bringt dich auf Zack und sorgt dafür, dass aus dir ein Mann wird. So, wie sie es mit mir getan hat.« Der Colonel sog tief die Luft ein, klopfte sich auf den Brustkorb und nahm eine stolze Pose ein.
Aber Wil gruselte sich vor seiner Großmutter. Sie lief den ganzen Tag im Nachthemd herum, hatte einen dicken Schnurrbart und roch wie eine nasse Windel. »Dann hoffe ich, es wird dort nie sicher sein«, platzte es aus Wil heraus.
Die Faust des Colonels bewegte sich schneller als sein Verstand. Ansatzlos schoss seine rechte Gerade vor. Der Kopf des Jungen flog zurück. Wil klappte vor den Gucci-Slippern seines Vaters zusammen. Blut quoll aus einer Wunde am Kinn. Die hatte er dem Ring des Colonels zu verdanken, den dieser am kleinen Finger trug: ein Protzteil aus Gold mit rosa Riesendiamanten. Wil gab ein lang gezogenes, lautes Heulen von sich, das den Colonel an einen altmodischen Feuermelder erinnerte. Der Colonel war angewidert. Weine wie ein Mann, wollte er eigentlich sagen. Dann versuchte er sich eine Gelegenheit vorzustellen, bei der es für einen Mann in Ordnung war zu weinen. Auf dem Siegerpodest bei den Olympischen Spielen vielleicht? Hm … egal! Also sagte der Colonel das, was Väter immer sagen: »Wir reden morgen drüber.« Damit stieg er über seinen flennenden Sohn hinweg und verließ den Raum.
»Schließ ihn ein«, wies er die Wache an, die auf dem Gang wartete. »Und seinen Freund hinten im Schiff auch. Und sorge dafür, dass keiner von beiden heute Nacht die Kabine verlässt.«
Der Colonel machte auf dem Absatz kehrt und genoss das seidige Gefühl seiner Slipper auf dem korallenroten Plüschteppich. Er begab sich zurück in den Spielsalon. Er konnte es gar nicht erwarten, zu seinem geliebten Glücksspiel zurückzukehren. Aber ein unangenehmer Gedanke nagte an ihm. Es war nicht so, dass er Wils Freund, dessen Name ihm dauernd nicht einfiel, nicht mochte. Ken, Carl, Chris? Irgendetwas Langweiliges in der Art. Chris Gibbs. Ja, das war sein Name.
Nein, das mit Chris war okay für den Colonel. Tatsächlich hielt er diesen Gibbs-Jungen für ziemlich annehmbar – vital, groß, schönes volles Haar, gute Zähne. Noch dazu aus diesem gewissen, drahtig-athletischen Holz geschnitzt, aus dem einmal gute Baseball-Pitcher oder Fußballtorwarte werden. Chris war eigentlich die Art Junge, von der sich der Colonel wünschte, dass Wil sie sich als Vorbild nehmen würde.
Es war etwas anderes, was ihn an Wils Freund störte. Er konnte sich einfach nicht erklären, warum er mit seinem Sohn befreundet war. Wilberforce war anders. Merkwürdig. Er war ein Latino-Teenager ohne Feuer, blass und schwermütig. Er hatte schiefe gelbe Zähne, rupfte sich gedankenverloren die Haare aus und roch seltsam. Warum sollte dieser normale, aufrechte amerikanische Junge Zeit mit seinem komischen kleinen Sohn verbringen? Benutzte der Junge Wil, um an Geld und Macht zu kommen? Gut möglich. Schließlich hatte der Colonel selbst sämtliche Freunde, die er jemals besaß, ausgebeutet und letztendlich betrogen. Selbst das wäre verständlich.
Oder noch beunruhigender: Was, wenn der Junge seinen Sohn nicht ausnutzte? Was, wenn die Freundschaft ein Zeichen für etwas anderes war? Etwas Unnatürliches? Ihre Freundschaft fühlte sich einfach nicht natürlich an. Der Colonel konnte nicht genau greifen, was ihn nun an diesem Jungen störte. Aber er war sich absolut sicher, dass da etwas nicht stimmte. So hilfsbereit, freundlich und höflich der amerikanische Junge auch schien: Der Colonel spürte eine Bedrohung. Und was das anbelangte, verfügte er über ausgezeichnete Instinkte.
Der Colonel machte sich zu Recht Sorgen. Der Junge – dessen wahre Identität und richtiger Name als topsecret klassifiziert und nur höchsten US-Militärs bekannt waren – kletterte ins Bett und wartete.
Als die Wache draußen die Tür abschloss und ihn quasi gefangen setzte, stand er auf. Er schlich zur Tür und presste das Ohr dagegen. Er lauschte nach den Schritten der Wache, die sich entfernten. Doch es war nichts zu hören. Der Colonel musste seinem Aufpasser befohlen haben, draußen Posten zu beziehen. Dem Jungen war es recht. Das Team, von dem er auf diese Mission vorbereitet worden war, hatte jede denkbare Eventualität einkalkuliert – einschließlich dieser.
Wie beiläufig schaltete er das Radio neben dem Bett ein und erwischte einen von Knistern und Rauschen untermalten Reggae-Sender aus Nassau. Der Junge bewegte sich zum Fenster und registrierte das Wetterleuchten, das über den westlichen Horizont flackerte.
Die Fensterluke war ungefähr fünfundzwanzig Zentimeter breit und sechzig Zentimeter hoch – gerade groß genug, um durchzupassen. Gewissermaßen war es Glück gewesen, dass der Colonel ihn in einer der Kabinen im Heck der Jacht untergebracht hatte. Die schöneren Bugkabinen besaßen viel kleinere Luken – zu klein für einen Jungen seiner Größe. Was die Luken in den Kabinen der Bediensteten anbelangte, so bestand die einzige Herausforderung darin, dass sie mit einem Messingschloss gesichert waren. Doch dies war nur ein weiteres Hindernis, auf das man den Jungen vorbereitet hatte. Er holte einen Ringbuchordner aus der Tiefe seines Rucksacks. Aus dem Ordnerrücken fischte er einen Metallstreifen sowie eine Haarnadel hervor. Nachdem er den Metallstreifen an einem Ende gebogen hatte, führte er das gekrümmte Stück in das Schlüsselloch ein, gefolgt von der Haarnadel. Konzentriert stocherte er mit beiden darin herum, bis sich das Schloss mit einem Klicken öffnete. So weit, so gut. Der Junge löste die Verriegelung, drückte die Schulter gegen das Glas und das Fenster schwang auf. Frische Seeluft strömte herein. Die Luft roch schwach nach Ozon. Er nahm fernes Donnergrollen wahr. Jeden Moment würde es regnen.
Mit schnellen, geschmeidigen Bewegungen riss der Junge die Laken vom Bett und verknüpfte sie mit einem Kreuzknoten. Nachdem das eine Ende am Bettrahmen vertäut war, ließ er das andere aus dem Fenster gleiten. Es flatterte fast bis zur Wasseroberfläche hinab. Kaum war das erledigt, schlüpfte er in seinen Neopren-Shorty und klaubte Taucherflossen und Tauchergürtel aus seinem Gepäck – ausnahmslos Dinge, die er noch kein einziges Mal benutzt hatte, weil Wil nie Lust auf Schwimmen gehabt hatte.
Dann steckte der Junge den Kopf aus dem Fenster und lugte nach oben zum Hauptdeck. Er sah Licht flackern, während die Wachen ungefähr sechs Meter über ihm auf- und abtigerten. Anscheinend blickten sie nicht nach unten, zumindest nicht direkt. Er quetschte sich durch die Fensteröffnung wie eine Ratte durch eine Mauerritze, seilte sich an den Bettlaken ab und ließ sich in das warme Wasser der Karibik gleiten. Es fühlte sich gut an, im Meer zu sein. Viel besser, als die ganze Zeit in der Kabine mit Wil zu hocken, dieser lebenden Furzmaschine von einem Videospieljunkie.
Er sog die Lungen voll frischer Luft und tauchte. Dem Schiffsrumpf in die Tiefe folgend, schwamm er unter der Jacht hindurch und kam auf der anderen Seite wieder an die Oberfläche: gut viereinhalb Meter unter dem Balkon der Suite, die dem Colonel gehörte. Aus einer verborgenen Tasche seines Tauchergürtels holte der Junge zwei Saugnäpfe, die er gegen die Schiffswand presste. Rasch schlüpfte er aus den Taucherflossen und trennte die Fußhalterungen von den Gummiflossen – dem äußeren Anschein nach beides ganz normales Tauchequipment, jedoch speziell für diese Mission gefertigt. Er schnallte die Gummiflossen an den Knien fest, stülpte die Fußhalterungen über die Saugnäpfe und drückte zu. Mit einem Klick rasteten die Halterungen ein und waren nun einsatzbereit als Handgriffe. Mithilfe der Saugnäpfe und der Gummiknieschoner kraxelte er die Backbordseite hoch. Er erzeugte nicht mehr als ein leises Quietschen, als seine nasse Haut hin und wieder über das polierte Fiberglas des Schiffsrumpfes glitt.
Die doppelflügelige Glastür zum Balkon war offen gelassen worden. Sanft wiegten sich die Seidenvorhänge in der Brise. Der Junge schwebte draußen an der Bordwand und lauschte. Neben dem fernen Grollen des Gewitters vernahm er, wie Claudia drinnen hingebungsvoll vor sich hinschnarchte. Die Valium, die er ihr beim Dinner heimlich in den Drink getan hatte, tat eindeutig seine Wirkung. Was den Colonel anbelangte, so würde der wie jede Nacht bis zum frühen Morgen am Kartentisch sitzen.
Der Junge kletterte über die Balkonbrüstung und lugte vorsichtig in die Kabine. Eine menschliche Gestalt lag rücklings auf dem Bett. Die schweißbedeckte Haut glitzerte im Mondlicht. Claudia war immer noch angezogen. Ihre Augen waren von einer samtenen Augenmaske bedeckt und zu beiden Seiten des Kopfes ergoss sich ihre teure Dauerwelle über das Laken. Der restliche Raum war fast ganz in Dunkelheit gehüllt. Lediglich eine einzelne Leselampe und die irrlichterhaft zuckenden Blitze sorgten für schwaches Licht. Mit den Händen streifte er sich das Wasser von der Haut, das sich in einer Pfütze zu seinen Füßen sammelte. An den Vorhängen vorbei beugte er sich in den Raum und blickte sich um. Fast augenblicklich nahm er den schwachen Geruch von Zigarillos wahr. Er erstarrte. Suchte fieberhaft nach irgendwelchen Zeichen, die für die Anwesenheit des Colonels sprachen. Doch die Luft schien rein zu sein. Er begab sich zu dem vergoldeten Telefon, das auf dem Schreibtisch des Colonels stand. Er musste den Sender entfernen, den er am ersten Abend der Reise in der Sprechmuschel platziert hatte. Dieser übertrug ein schwaches Radiosignal zu einem Nagra-Minitonbandgerät, das in einer Spielekassette in Wils Kabine verborgen war. Mittels des versteckten Senders und des Nagras hatte er etliche Gespräche zwischen dem Colonel und politischen Führern aus Lateinamerika und Europa aufgenommen. Gespräche, die sich für die US-Regierung als enorm wertvoll erweisen würden, solange die Aufnahmen geheim blieben und die Bänder unversehrt dem US-Geheimdienst zugespielt wurden. Der Schlüssel einer erfolgreichen Operation bestand nicht nur darin, sich Informationen zu beschaffen. Vielmehr ging es auch darum, dies unbemerkt zu bewerkstelligen. Weswegen der Junge nun dabei war, die Suite des Colonels zu entwanzen. Anschließend hieß es nur noch über Bord mit dem Sender und zurück in seine Kabine. Wieder einmal würde eine Camp-Honor-Mission mit durchschlagendem Erfolg enden.
Der Junge langte gerade nach dem protzigen Telefon, als erneut ein Blitz aufzuckte.
Vor sich nahm er seinen Schatten auf dem Boden wahr – und daneben einen zweiten. Eine Gestalt, die sich von hinten näherte. Die Kontur eines Mannes – der eindeutig eine Waffe auf seinen Hinterkopf richtete!
Die antrainierten Instinkte übernahmen. Statt auszuweichen, sprang er nach hinten, um die Distanz zu verkürzen. Blitzschnell hieb seine Hand von oben auf die Waffe herab und krallte sich um den Pistolenschlitten. Doch der Lauf änderte nicht die Richtung. Stattdessen stieß der Hahn herab und biss sich in das Gewebe zwischen Daumen und Zeigefinger. Es schmerzte wie Hölle. Aber die Waffe ging nicht los.
Der Junge sah nun, wen er vor sich hatte. Den Colonel! Die Augen weit aufgerissen, das Weiße darin größer als normal. Offenbar geschockt. Mit aller Macht versuchte der Junge, die Pistole in seine Gewalt zu bekommen, während der Hahn ein zweites Mal herabstieß. Der Junge wartete nicht auf das dritte Mal und entriss seinem Gegner die Waffe.
»Hilfff…«, begann der Colonel zu schreien. Doch der Junge rammte ihm die Faust in den Solarplexus. Explosionsartig wich der Atem aus der Kehle. Die Luft wurde buchstäblich aus den Lungen gepresst. Der Colonel versuchte, sich auf den Jungen zu stürzen. Doch der duckte sich einfach. Mit einem simplen Ringermanöver schlüpfte er hinter den Colonel, nahm den Mann in den Würgegriff und trat ihm die Beine unter dem Körper weg. Fest grub sich der Unterarm des Jungen in die Carotis-Arterie des Colonels – was zugleich den Atem und den Blutfluss zum Gehirn blockierte. Das war’s so ziemlich.
Der Colonel konnte es nicht fassen. Er hatte den Vorteil derart schnell verloren. Es kam ihm weder fair noch real vor. Er verdiente einen zweiten Versuch. So wie die Figuren in den Videospielen seines Sohnes. Aber dieses Kind, dieser Junge aus den Vereinigten Staaten, spielte nicht. Er war ein Profi. Der Colonel wusste, dass er sterben würde, und er konnte nicht das Geringste dagegen tun. Hätte er sprechen können, hätte er um sein Leben gebettelt. Gebettelt wie Tausende zuvor, die ihn um ihr Leben angefleht hatten.
Ich hatte einen ziemlich guten Lauf, musste sich der Colonel selbst eingestehen. Und jetzt hat mich dieses Kind, diese kleine Kackwurst, im Todesgriff.
Er empfand fast so etwas wie Hochachtung.
Etwa eine Stunde später war der Junge wieder in seiner Kabine am Heck der Jacht. Er lag auf dem Bett, das Radio spielte und die Wache döste auf dem Gang. Alles war wieder an Ort und Stelle: die Laken auf dem Bett, das Lukenfenster verschlossen, Taucherflossen und Tauchergürtel verstaut. So als wäre er nie fort gewesen.
Und dennoch war gar nichts in Ordnung. Eine Leiche trieb im Golfstrom dahin, beschwert mit einem bleiernen Türstopper. Eine Leiche, die der Junge dorthin befördert hatte. Ja, es gab einen Massenmörder weniger, der auf dem Planeten wandelte. Aber zugleich auch einen Verbrecher weniger, der die anderen in Schach hielt. Einen beschissenen Ehemann weniger. Einen Vater weniger.
Der Junge lag wach. Er lauschte dem Regen und fragte sich, was die Kette der Ereignisse, die er gerade in Gang gesetzt hatte, in den kommenden Tagen und Jahren mit sich bringen würde. Welche Veränderungen würde der Tod des Colonels nach sich ziehen? Was würde aus Wil werden, was aus dem Land des Colonels? Am dringendsten beschäftigte den Jungen jedoch die Frage, ob er seine Spuren perfekt verwischt hatte – oder ob man ihn morgen schnappen würde.
Er war sich da nicht sicher. Doch dafür hielt er eine kleine Schachtel Zyankali bereit. Schwer ruhte sie in seiner verschwitzten Hand – nur für den Fall, dass er doch einen Fehler begangen hatte.
Kapitel 1
ANFANG JUNI 2017MILLERSVILLE COUNTY, USA
Es waren nur noch zwei Tage bis zu den Sommerferien und Wyatt konnte einfach keine Ruhe finden. Schlaflos lag er bei offenem Fenster im Bett. Der auf ihn gerichtete Ventilator surrte auf Hochtouren. Aber die hereinströmende Luft war nicht viel kühler als der heiße Mief, der hinauszog. Und sie roch nach Zement, Teer und dem, was auch immer in der Mülltonne unmittelbar vor dem Fenstersims vor sich hingärte. Sprich: den Resten davon, was Wyatts Tante Narcissa verputzt und mit routiniertem Schnipp ihrer Wurstfinger zur Tür rausgepfeffert hatte. Eine Styroporbox, beschmiert mit Resten von Sesamhühnchen, leere Frühlingsrollen-Verpackungen, eine Dose SpaghettiOs, eine Packung Würstchen im Schlafrock, bis auf die Knochen abgenagte Grillrippchen …
Tante Narcy und ihre Knochenhaufen waren nicht immer dagewesen. Es war noch gar nicht lange her, da hatte Wyatts Mom zum Frühstück Pancakes in Superheldenkontur gezaubert oder Limonade gebracht, wenn sein kleiner Bruder und er ein Baseballspiel hatten. Sie organisierte Fahrgemeinschaften, half bei den Mathehausaufgaben … Aber diese Tage hatten vor acht Monaten ihr Ende gefunden. Wie jeden Monat hatte Wyatts Dad seine Tasche gepackt, um in seinen Sattelschlepper zu steigen und davonzubrausen. Nur dass er diesmal nie mehr nach Hause zurückkehrte. Kein Wort. Kein Anruf.
Die Tage verstrichen. Die Feiertage kamen und gingen: Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr. Mit jedem Trick, den er kannte, durchkämmte Wyatt das Internet, um seinen Dad zu finden. Nicht eine einzige Spur, trotz Boolescher Suche und Vorstößen in die fernsten Weiten des Deep Web. Die Millersville Police war auch keine große Hilfe. Sie legte natürlich eine Vermisstenakte an, aber sie konnte nicht einmal seinen Truck aufspüren. Und da Monat für Monat Geld auf dem Konto von Wyatts Mutter einging, ging die Polizei davon aus, dass sie es nicht mit einem Mord zu tun hatten.
»Mrs Brewer«, sagte der leitende Ermittler eines Nachmittags in der Küche zu seiner Mutter. »Sie sollten die wahrscheinliche Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Ihr Ehemann am Leben ist, aber untertauchen wollte.«
Die Vorstellung, verlassen worden zu sein, vernichtete Wyatts Mom regelrecht. Tagelang verkroch sie sich ins Bett. Es gab keine Pancakes mehr. Schließlich stellte sie das Kochen und Putzen völlig ein und die Schule wurde zur Nebensache. Ihre Schwester Narcy zog ein – angeblich, um zu helfen. Aber mit Narcy wurde alles sogar noch beschissener. Sie zog ständig über Wyatts Dad her und brachte seine Mom dazu, das Schlimmste zu denken: »Würde mich nicht wundern, wenn er eine andere Familie hätte«, raunte Narcy seiner Mutter eines Nachmittags zu.
Eine andere Familie? Noch abends im Bett musste Wyatt unaufhörlich daran denken. Mit weit geöffneten Augen lag er da, gebadet in Schweiß und den Ausdünstungen des Mülls vor dem Fenster. Plötzlich nahm er einen kleinen Lichtfleck wahr. Er kam von Fußende des Etagenbettes, das er sich mit seinem jüngeren Bruder Cody teilte. Sein Handy. Flimmernd spielte das Licht des Displays auf der Wand.
Wyatt beugte sich vor und lugte ins untere Bett hinab, um zu sehen, ob Cody wach war. Sein Bruder lag in Unterwäsche auf einem schweißgetränkten Star Wars-Laken. Sein Körper glänzte. Das lange Haar war ans Gesicht geklatscht, in dem es schwach zuckte. Wahrscheinlich hatte er gerade wieder einen seiner Albträume. Etwas, das in diesen letzten acht Monaten regelmäßig vorgekommen war.
Wyatt schnappte sich sein Handy, hüpfte vom Bett herunter und nahm den lautlosen Anruf entgegen. »Hallo«, flüsterte er.
Er konnte förmlich das Lächeln in der Stimme seines Freundes Derrick hören. »Wusst ich’s doch! Wenn’s drauf ankommt, bist von allen Kumpeln du derjenige, der rangeht. Bin froh, dass wir bald ein Jahr zusammen in Maple sind.«
Maple war die örtliche Highschool. Wyatt würde dort sein erstes Jahr als Freshman antreten, während Derrick dann schon Senior wäre. Sein Ruf als landesbester Runningback half zu kaschieren, dass er komplett verkommen war. Auch Wyatt war immer ein wenig wild gewesen. Doch das hatte sich nie in seinen Noten bemerkbar gemacht. Bis zum Verschwinden seines Dads hatte er jedes Halbjahr als Klassenbester abgeschnitten. Nachdem sein Vater sie jedoch verlassen hatte, wurde Wyatt im Handumdrehen zum Rabauken. Nicht lange und er verwandelte sich in die Art von Kid, das man besser im Auge behielt, damit es nicht klaute. Oder bei dessen Anblick man lieber die Straßenseite wechselte. Man hätte sich nicht vorstellen können, dass er als Achtklässler schon Highschool-Kids Nachhilfe in Mathe und Computerwissenschaft gab – vor allem, was die Programmierung in CSS, HTML, AJAX und einigen anderen Grundsprachen anbelangte. Tatsächlich war es der Nachhilfeunterricht, durch den er Derrick kennengelernt hatte. Die Sportskanone und der Nachwuchshacker mit einem Faible für Mathe und Regelbrüche: Die Chemie hatte sofort gestimmt.
»Weißte was, Bra?«, fuhr Derrick fort. »Ich brauch genau jetzt ’nen Freund. ’nen kleinen Bad Boy wie dich, dem ich trau’n kann. Ich red nich groß drumrum, Kumpel. Ich steck in Schwierigkeiten und ich möchte, dass du mich da rausholst. Kann ich auf dich zählen, Bra?«
»Bis in die verdammte Ewigkeit!«, antwortete Wyatt. Ihm wurde bewusst, dass er begonnen hatte, auf- und abzutigern. Ein erregendes Gefühl machte sich in ihm breit.
Wyatt öffnete die Tür einen Spalt. Narcy saß auf der Couch und glotzte QVC. Das blaue Licht des Flachbildschirms meißelte die Umrisse ihres Hinterkopfs heraus. Das krause kurze Haar erglühte wie ein tiefgefrorener Heiligenschein. Ihre Hand stieß in die Schüssel neben ihr hinab und hob sich wieder an den Mund. Mampf. Knusper.
Der Fernseher war leise genug gestellt, dass Wyatt das Gekaue, Geschmatze sowie eine Art Brummen hörte, das wie ein Stöhnen klang. Die Glotze hatte sie in ihren Bann gezogen, kein Zweifel. Aber dennoch musste Wyatt vorsichtig sein. Narcy mochte nicht die Schnellste auf den Beinen sein. Doch sie hatte Fledermausohren und eine Stimme wie ein Rauchmelder. Er musste sich leise wie ein Ninja bewegen. Er ließ sich auf die Knie sinken, schob die Tür auf und kroch geschmeidig und langsam nach draußen.
Der Flurteppich war dreckig und an einigen Stellen völlig abgetreten. Die durchgelatschten Stellen knarrten bereits, wenn man nur atmete. Also kroch er auf den saubereren, weicheren Rändern entlang, bis er den Vinylboden in der Küche erreichte. Wyatt erhob sich und tastete nach dem Krug, der auf dem Küchentresen stand. Statt die Schlüssel herauszufischen, nahm er lieber gleich das ganze Teil mit, bevor er durch die Hintertür verschwand.
Narcys Schlitten – ein alter, im Carport abgestellter Lincoln – war einst als Wagen eines Autoverleihs im Einsatz gewesen. Laut Tacho hatte Narcy damit über 240000 Kilometer abgerissen und ihr massiger Leib hatte die Springfedern des Fahrersitzes regelrecht platt gewälzt. Dennoch war Wyatt körperlich groß genug, um den Wagen zu fahren. Außerdem hatte sein Vater ihn auf Parkplätzen und Nebenstraßen herumkurven lassen, sodass er sich wegen des Fahrens keinen Kopf machte. Das Problem bestand darin, das Biest ohne Lärm aus dem Carport zu kriegen. Er würde es schieben müssen.
Vorsichtig öffnete Wyatt die Tür, beugte sich hinein, legte den Leerlauf ein und kurbelte das Seitenfenster herunter. Eine Hand ans Lenkrad gekrallt, stemmte er sich gegen den Türrahmen. Nichts bewegte sich. Er wollte gerade einen zweiten Versuch starten, als hinter ihm die Küchentür zur Garage aufging. Wyatt erstarrte und machte sich auf Narcys Gekreische gefasst.
»Wyatt«, flüsterte eine Stimme. Cody. Puh! In Unterhose stand sein kleiner Bruder da und kratzte sich den Bauch. »Hab geträumt. Daddy war in einem tiefen Loch. Hast versucht, ihn rauszuholen. Dann bist du gefallen und auf einem Brett voller Messer gelandet.« Cody rieb sich die Augen und blinzelte, um wach zu werden.
»Schon okay, Kumpel«, sagte Wyatt. »Geh einfach wieder ins Bett. Mach dir eine Geschichte an, wenn du magst.« Wyatt hielt ihm sein Handy hin und rief ein Hörbuch auf. »Versuch’s mit … Huck Finn.«
Das war Wyatts alter Trost und Beistand. Als er noch kleiner gewesen war, hatte sein Vater ihn und Cody öfter mal auf einen Kurztrip mitgenommen. Hoch oben im Fahrerhaus des Sattelschleppers waren sie dahingefahren. Damit sich die Jungen dabei nicht langweilten, hatte ihr Dad Huck Finn abgespielt – wieder und wieder. Jetzt war es Wyatts Lieblingsbuch, und der Geschichte zu lauschen, half den Brüdern so manche Nacht in den Schlaf.
»Denk nur daran, das Handy anzuschließen. Nicht dass es leer ist, wenn wir morgen zur Schule gehen.«
»Okay.« Cody nahm das Handy und rieb sich die Augen. »Aber warum bist du hier draußen? Was machst du da mit Narcys Auto?«
»Es für eine kurze Spritztour ausleihen.«
Cody sah verwirrt aus. »Aber du kannst nicht fahren.«
»Kleine Klarstellung«, erwiderte Wyatt. »Ich darf nicht fahren. Was nicht bedeutet, dass ich es nicht kann. Ich muss einem Freund helfen. Komm, hilf mir schieben.«
Cody war erst elf. Er hatte langes Haar ebenso wie Wyatt und wirkte sehr jung und schmächtig. Aber das täuschte. Er war groß, stark und ähnlich wie Wyatt ein sportliches Naturtalent. Doch im Gegensatz zu seinem Bruder sagten die Trainer über Cody stets, dass er die Selbstdisziplin eines wahren Athleten besäße. Und so zog es Cody zum Sport – was ihm half, sich von Schwierigkeiten fernzuhalten.
»Los, komm schon. Stemm dich mit der Schulter dagegen«, sagte Wyatt.
Cody trat auf den Wagen zu, während in ihm noch die Gedanken ratterten. Er schüttelte den Kopf. »Ich hab ein mieses Gefühl dabei. Du warst in meinem Albtraum. Du darfst nicht gehen.« Mit finsterer Miene verschränkte er die Arme über der Brust und versuchte, den bitteren Geschmack des Erlebten zu verdauen. »Ne. Nicht heute Abend.« Reglos stand Cody da und starrte ihn an.
Wyatt wusste, dass es sinnlos war, mit ihm zu streiten, wenn er so drauf war. »Wie du meinst«, sagte er und wandte sich dem Wagen zu. Er ging in die Hocke, beugte sich vor und drückte mit aller Kraft, die er hatte.
Zentimeterweise kroch der Lincoln voran. Langsam kam er ins Rollen und setzte sich die Auffahrt hinunter in Bewegung. Erst einmal in Schwung geraten, kam er ziemlich in Fahrt und glitt wie ein Piratenschiff leise in die Nacht hinaus. Während er Kurs die kurze Auffahrt hinab nahm, wurde er so schnell, dass Wyatt zurückblieb. Er sprintete los, um ihn einzuholen.
Cody rannte in seiner Unterhose auf dem Bürgersteig neben dem Auto her und zischte: »Wyatt, Narcy wird dich umbringen! Fang das verdammte Auto ein!« Die hintere linke Stoßstange schrammte an einem rostigen Pick-up entlang, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte. Der Zusammenprall der Wagen erzeugte ein furchtbares metallenes Kreischen.
Wyatt warf sich halb durchs Seitenfenster. Hart riss er das Lenkrad nach rechts. Reifen quietschten. Metall knirschte über Metall. Wyatt zog sich vollends hinein und zerkratzte sich dabei höllisch die Brust, bevor er sich hinter dem Lenkrad aufrappeln und den Wagen in die Straßenmitte steuern konnte. Wyatt trat voll auf die Bremse. Mit einem Ruck kam der Lincoln zum Halten – einen Block von ihrem Haus entfernt und mit einer neuen langen Seitenschramme, die nun den zahllosen Dellen und Beulen Gesellschaft leistete. Mit offenem Mund kam Cody auf dem Gehweg angerannt. »Mann, Alter!«, sagte er. »Das Auto! Los, sehen wir zu, dass wir es wieder die Straße hochkriegen.«
»Kein Zurück jetzt«, sagte Wyatt und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Der Motor des Lincoln erwachte wummernd zum Leben.
»Wyatt, lass mich nicht allein«, flehte Cody. »Bitte. Wenn dir was passiert … Ich darf dich nicht verlieren. Nicht dich auch noch.«
Wyatt sah seinen Bruder an. »Es wird alles gut. Ich bin bald zurück. Vertrau mir«, sagte er. »Ich lass dich nicht allein.«
Mit diesen Worten rammte Wyatt den Gang rein und brauste mit quietschenden Reifen davon. Im Rückspiegel sah er, wie Cody den Gehweg hügelaufwärts zu ihrem Haus zurückrannte. Hell leuchtete seine Unterhose in der dunklen Nacht.
Kapitel 2
ANFANG JUNI 2017 MILLERSVILLE COUNTY, USA
Drückende Luft strömte herein und umwehte Wyatt, während der Lincoln über den Asphalt glitt. Da er noch nicht alt genug war, um ein Auto fahren zu dürfen, und keinen Führerschein hatte, hielt er sich an die Nebenstraßen, die parallel zur Schnellstraße verliefen. Eine dünne Schicht aus kaltem Schweiß klebte auf seinem Nacken. Wellen aus Angst und Erregung durchfuhren ihn wie elektrische Entladungen. Es war gut, draußen in der stillen Nacht zu sein, dachte Wyatt.
Dann, ohne Vorwarnung, kamen plötzlich zwei Streifenwagen hinter Wyatt über die Hügelkuppe geschossen. Mit heulenden Sirenen rasten sie heran. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus und trat auf die Bremse. Mit klopfendem Herzen lenkte er den Lincoln an den Straßenrand. Er betete, dass die Cops ihn nicht wegen seiner unerlaubten Spritztour verhaften, sondern mit einer Verwarnung davonkommen lassen würden.
Doch statt Wyatt anzuhalten, zogen sie hinter dem Lincoln auf die Gegenfahrbahn rüber. Mit hundertsechzig Sachen oder mehr rasten sie an ihm vorbei. Vielleicht ein Unfall, dachte Wyatt und stieß vor Erleichterung einen tiefen Seufzer aus. Er schwenkte wieder auf die Straße zurück und zwang seinen Herzschlag zur Ruhe, als er zu seinem Treffen mit Derrick weiterfuhr.
Mit Bergen von weggeschmissenem Zeugs, Bierdosen, rostendem Metall und verstreuten Haufen liegen gelassener Kleidung versprühte das Bahndepot die düstere Atmosphäre eines schäbigen Horrorfilms. Und zu dieser Nachtzeit war es noch dazu totenstill. Nervenzerfetzend still. Wyatt kurbelte die Fenster hoch und steuerte den Lincoln an einer Reihe Waggons entlang. Langsam fuhr er weiter, während der Kies unter den Reifen knirschte und sich die Strahlen der Scheinwerfer in dunkle und verdreckte Winkel bohrten.
Wyatt kannte das Depot gut. Cody und er waren hin und wieder mit ihren Rädern hier rausgefahren, um Flaschen zu zertrümmern und das Zeug zu verbrennen, das die Hobos zurückgelassen hatten. Die kampierten im nahen Wald und schliefen bei Regen in den Waggons. Aber bei Nacht war das Depot etwas ganz anderes – vor allem, wenn man allein war.
Wyatt fuhr so weit er konnte hinein und brachte den Wagen zum Halten. Derrick konnte überall sein. Instinktiv langte Wyatt nach seinem Handy, bevor ihm einfiel, dass er es ja Cody gegeben hatte. Sein Blick folgte den Lichtkegeln der Schweinwerfer. Wo war Derrick?
Wyatt öffnete die Tür. »D? – D? Biste da?«
Ihm war klar, dass Derrick mit einiger Wahrscheinlichkeit seinen Wagen nicht sehen konnte. Oder vielleicht dachte Derrick auch, er wäre ein Bulle – diese nervtötenden Faulenzer patrouillierten nämlich häufig hier im Depot herum.
Wyatt suchte im Handschuhfach nach einer Taschenlampe. Nichts. Er ließ den Motor laufen und stieg aus – sorgfältig darauf bedacht, nicht auf zerbrochenes Glas, eine alte Spritze oder gar einen Obdachlosen zu treten, der sich einfach irgendwo zum Schlafen hingelegt hatte. Er dachte daran, wie er einmal auf dem Depotgelände auf einen Tierkadaver gestoßen war, den man inmitten eines provisorischen Camps auf einem Bratspieß geröstet hatte. Die halb gegessenen Reste des Tieres steckten immer noch auf dem Spieß. An mehreren Stellen waren offensichtlich größere Stücke aus dem Körper herausgesäbelt worden, der immer noch vor sich hinbrutzelte, während die Flammen nach ihm leckten: eine Hobo-Mahlzeit.
Wyatt konnte erst nicht sagen, um was für ein Tier es sich handelte – bis er in der Glut unter dem Spieß das Hundehalsband sah. Danach hatte Wyatt sich geschworen, niemals mehr zurückzukommen. Mit Sicherheit jedenfalls nicht allein. Und trotzdem: Hier war er und wanderte ins Licht der Autoscheinwerfer hinaus.
»Derrick!«, stieß er hervor, halb flüsternd, halb rufend.
Er hörte ein Rascheln und ein leises Stöhnen. Er starrte in das finstere Gehölz und versuchte, den Laut zu lokalisieren.
»Hey, bist du das?«, sagte er.
Wyatt vernahm eine unbekannte Stimme. »Bin ich, aber ich kenn dich nicht.« Vom Boden aus funkelten ihm aus einem schwarzen Gesicht zwei Augen entgegen. Dicht daneben schimmerte eine Flasche. Der Hobo bewegte sich ruckartig, als würde er versuchen aufzustehen. Dann verzog er das Gesicht und gab ein Knurren von sich. »Rrrrrraaahhhhh!!!« Sein Körper bebte vor Wut. Er machte Anstalten, sich hochzustemmen. Doch dann verdrehten sich seine Augen und er stürzte wieder in den Dreck.
Hastig machte Wyatt ein paar Schritte rückwärts, während im Gehölz verschlafene Stimmen ertönten. Vielleicht hatte er da drinnen gerade ein halbes Dutzend Hobos aufgescheucht.
Vergiss die Sache, sagte Wyatt sich. Er wirbelte herum und trat den Rückzug zu Narcys Wagen an. Und dann, wie aufs Stichwort, materialisierte Derrick plötzlich aus der Dunkelheit.
»Mann, was soll das?!«, keuchte Wyatt erschrocken.
»Musste sichergehen, dass du es bist«, erwiderte Derrick, während er neben ihm herlief, leichtfüßig und schnell wie auf dem Footballfeld. Seine schweißbedeckten Muskeln spannten sich im Licht der Scheinwerfer. Er hatte Shorts an und seine dreckbeschmierten Beine waren übel zerkratzt. Er trug eine kleine grüne Gürteltasche.
»Mann«, stieß Derrick hervor. »Jetzt bloß weg hier! Los! Los! Los!« Er trieb Wyatt zum Wagen und warf sich auf den Rücksitz. Wyatt stieg ein und ließ den Motor aufheulen. Derrick quasselte irgendetwas. Aber noch bevor seine Worte zu ihm drangen, kam sein Geruch bei Wyatt an. Der Gestank verbreitete sich wie ein Überschallknall. Derrick roch nicht einfach nur übel, nach Körpergeruch oder einem Furz, sondern nach einem Chemieunfall: ätzend, beißend und dazu noch schwach nach verbranntem Gummi.
Es erinnerte Wyatt daran, wie ihr Kater Tony gerochen hatte. Damals, als seine Mom das Tier in den Kofferraum verfrachtet und zum Tierarzt gefahren hatte. Bei ihrer Ankunft war Tony starr vor Angst gewesen. Er hatte die Krallen in den Teppich gebohrt und einen entsetzlichen Geruch verströmt, der sich allem anheftete. Nicht nur nach Pisse, sondern nach Pisse und Angst. Und genauso roch Derrick jetzt.
Derrick lag flach ausgestreckt auf dem Rücksitz. Wyatt kurbelte das Fenster einen Spalt runter, rammte den Rückwärtsgang rein und jagte eine Wolke aus Staub und Kies in die Luft.
»Geht wieder ins Bett, ihr dreckigen Hobos!«, brüllte Derrick aus dem Fenster.
»Also, was ist los, Mann«, fragte Wyatt, als sie auf dem Highway waren. »In was für Schwierigkeiten steckst du?«
»Da sprechen wir später drüber. Aber erst mal Respekt, Mann.« Derrick knuffte gegen die Rückseite des Fahrersitzes. »Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich schulde dir was, Kumpel. Gleich erzähl ich dir alles.«
Derrick legte die grüne Tasche auf seiner Brust ab, schloss die Augen und sank in den Kunstledersitz zurück.
Stumm fuhr Wyatt weiter und lauschte einem Song im Radio, während er die silberne Front des Lincoln der nächtlichen Finsternis entgegenlenkte.
Das Lied im Radio verklang und die Nachrichten kamen. »Zeit für das Wetter und die Nachrichten. Pünktlich für euch zu jeder Stunde. Heute wird’s kuschelig heiß im Tri-County-Gebiet. Mit Temperaturen im mittleren bis hohen Dreißigerbereich und einer Luftfeuchtigkeit von neunzig Prozent …«
In Wyatts Heimatstadt drehte sich das Gerede im Radio immer um dasselbe: schlechtes Wetter, günstige Schnäppchen und Sportmannschaften, die irgendwie nie den Basketballkorb oder das Tor fanden. Wyatt streckte die Hand aus, um das Radio auszuschalten, als etwas sein Interesse weckte.
»Die Polizei bittet die Einwohner um Wachsamkeit, nachdem die Citgo-Tankstelle in Millersville von einem maskierten Räuber überfallen wurde. Im Verlauf des Überfalls gab der Angreifer zwei Schüsse ab und verletzte einen Angestellten lebensgefährlich, bevor er zu Fuß fliehen konnte. Die Polizei und State Trooper suchen die Gegend ab. Die einheimischen Bürger werden gewarnt, keine Anhalter mitzunehmen. Es wird gebeten, jedes verdächtige Verhalten zu melden. Das Opfer wurde ins St. Mary’s Hospital gebracht und ist in kritischem Zustand.«
Wyatts Gedanken flogen zum Streifenwagen, der vorhin an ihm vorbeigerast war. Er blickte in den Rückspiegel.
Mit geschlossenen Augen lag Derrick reglos da und tat, als würde er schlafen. Aber er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Hätte dir sagen sollen, das Radio auszulassen«, sagte er, ohne die Augen zu öffnen. Diese Nachrichten sind doch nie zu etwas gut.«
»Du hättest mir sagen sollen, was los ist.«
»Hätte ich irgendwann. Wollte nur sichergehen, dass du auch auftauchst.« Sein Lächeln zog sich in die Breite. »Keine Bange, Wyatt. Wir teilen die Kohle. Okay, wir machen nicht fifty-fifty, aber du bekommst deinen Teil.«
»Ich will keinen Teil«, antwortete Wyatt. »Nicht von so was. Das geht zu weit. Hab keine Lust auf solchen Ärger. Ich will das Geld nicht.«
»Willst das Geld nicht, wie?« Derrick grinste, rutschte auf seinem Hintern herum und machte es sich auf dem Sitz bequem. »Bist zu gut dafür. Stimmt’s?«
Wyatt sagte nichts.
»Ich wette, dein Daddy hätte einfach die Kohle genommen und dann nichts wie weg.«
»Halt die Klappe«, sagte Wyatt und trat auf die Bremse. »Ich will, dass du aussteigst.«
»Halt die Luft an. Das ist langsam nicht mehr witzig.« Derricks spielerisches Lächeln verblasste. Er schlug ein Auge auf. Seine Hand glitt in die grüne Tasche. Gleich darauf kam sie wieder zum Vorschein – samt einem silbern schimmernden Revolver mit braunem Griff. »Siehst du den hier?« Er fuchtelte mit der Waffe herum. »Sag mir, dass du ihn siehst. Ich will sichergehen, dass wir uns verstehen.« Seine Stimme nahm einen kalten scharfen Ton an. »Du steckst mit drin. Ob du es nun willst oder nicht … Sind wir uns da einig?«
Ihre Blicke hefteten sich im Rückspiegel aufeinander.
»Ja, du hast’s kapiert«, sagte Derrick schließlich und lächelte erneut. »Und jetzt fahr mich nach Hause und schalt das Radio wieder ein.«
Derrick wohnte auf der Ostseite einer kleinen Anhöhe. Als sie auf der Westseite den Hang hochfuhren, nahm Wyatt vor sich in den Baumwipfeln rotierende Lichter wahr. Sie passierten die Hügelkuppe und unter ihnen erstrahlte Derricks gesamter Vorgarten in einem Meer aus Cop-Blaulichtern. Mindestens vier Streifenwagen parkten vor dem Haus. Die Cops waren überall, leuchteten mit Taschenlampen im Gebüsch herum, quatschten in einer Gruppe miteinander, zündeten sich Zigaretten an. Zwei von ihnen standen an der Haustür und sprachen mit Derricks Eltern. Ganz gebeugt stand Derricks Mom in ihrem schmuddelig pinken Nachthemd da. Ihr Haar war ein Wirrwarr aus plattgedrückten Locken und das tränenverschmierte Gesicht vor lauter Make-up verklebt. Mit verwirrtem Blinzeln starrte sie durch eine Wolke aus Zigarettenqualm, der ihr aus Mund und Nasenlöchern strömte. Derricks Dad stand mit dreist-betrunkenem Grinsen in der Tür und kratzte sich die Eier.
Das Licht von Wyatts Scheinwerfern spiegelte sich blitzend auf einem Streifen nackter Haut im Nacken eines Cops.
Derrick ließ sich wie ein Stein plumpsen, winkelte den Revolver an und drückte ihn Wyatt in den Hals. »Am besten fährst du einfach geradeaus weiter. Keine Bewegung und nicht langsamer werden.«
Der kalte Lauf bohrte sich zwischen Hals und Kiefer in Wyatts Haut. Er fuhr weiter und versuchte, sich so normal wie möglich zu benehmen. Polizeimarken funkelten auf dunklen Uniformen. Derricks Dad war der Erste, der zu ihnen herüberblickte. Mit dumpfem Ausdruck blinzelte er dem Wagen entgegen. Dann, wie auf Kommando, folgten die Cops seinem Blick. Die Zeit dehnte sich, während sie vorbeirollten. Die Hälse der Cops reckten sich, als sie sich umdrehten und Wyatt fixierten. Er spürte förmlich, wie ihre Augen prüfend über die Dellen an der Wagenseite glitten. Dann sein langes Haar musterten – und irgendwie feststellten, dass er erst vierzehn war. Und dass ihm so was von die Düse ging.
Die Zeit rastete wieder ein. Die gaffenden Cops erwachten aus ihrer Starre und stürzten zu ihren Streifenwagen.
Wyatt trat das Gaspedal durch. Mit einem Satz schoss der Lincoln voran.
»Was machste da?!« Derrick stürzte in den Fußraum und fluchte volles Rohr.
»Sie wissen’s!« Wyatt raste der nächsten Hügelkuppe entgegen.
»Hast du mich verpfiffen?«
»Wie denn?«, schrie Wyatt zurück.
Der Lincoln überquerte den Hügel. Wyatt und Derrick hatten einen kleinen Vorsprung vor den Cops, und als sie auf der anderen Seite herunterkamen, lugte Derrick über den Sitz. »Vor uns ist eine kleine verborgene Abzweigung. Fahr rein!«
Wyatt schoss rasend schnell darauf zu. Er riss das Lenkrad hart nach links und trat voll auf die Bremse. Nicht angeschnallt, krachte Derrick von hinten voll gegen den Beifahrersitz. Die Waffe fiel ihm aus der Hand und landete auf der Sitzfläche neben Wyatt. Mit ohrenbetäubendem Knall löste sich ein Schuss. Das Fenster auf der Beifahrerseite zersplitterte.
Mit klingelnden Ohren und einem Herzschlag, der fast durch die Decke ging, machte Wyatt den Motor aus. Ohne nachzudenken, nahm er die Waffe. Wyatt spürte den Revolvergriff in seiner Hand. Die Waffe fühlte sich schwerer und sperriger an, als er gedacht hätte.
Derrick stemmte sich auf den Rücksitz hoch und runzelte die Stirn. »Verdammt. Meine Schuld.«
Wyatt drehte sich um. »Raus!« Er war selbst überrascht, wie entschlossen er klang, als er den Revolver genau zwischen Derricks Augen richtete.
Derrick starrte Wyatt durchdringend an. »Mann, das musst du nicht tun …«
»Raus!«, wiederholte Wyatt, kurz vorm Durchdrehen.
Derrick hielt einen Moment lang inne, bevor sich sein Gesicht zu einem breiten Grinsen verzog. »Viel Glück, Kumpel«, sagte er. Im Nullkommanichts war er aus dem Wagen und eilte aufs angrenzende Gehölz zu.
Selbst mit dem Klingeln in den Ohren konnte Wyatt Derricks Gelächter hören. »Jetzt liegt es an dir«, rief er, während er im Dickicht verschwand.
Im Rückspiegel rasten zwei Lichtkegel an der Abzweigung vorbei und sausten weiter den Highway entlang. Ein anderer Streifenwagen folgte. Gefolgt von zwei weiteren, die in kurzer Folge vorbeihuschten.
Wyatt glitt in den Sitz hinab und überlegte, was er machen sollte. Die Waffe. Er musste das Ding loswerden und irgendwie nach Hause kommen. Er packte das Lenkrad und langte nach dem Zündschlüssel. Was immer daheim dann auch passieren mochte, damit würde er sich später beschäftigen.
Als er noch einmal einen Blick in den Rückspiegel warf, sah er sie: Derricks grüne Tasche. Sie lag auf dem Rücksitz des Lincoln. Die blutbespritzten Geldscheine lugten aus dem Reißverschluss hervor. Also hatte er nun die Waffe und das Geld am Hals. Nicht gut. Er beugte sich nach hinten zum Rücksitz, um sich die Tasche zu schnappen und aus dem Fenster zu schmeißen. Da tauchten hinter ihm zwei Schweinwerfer auf.
Der Wagen, eine Cop-Karre, bog zum Straßenrand ab, bremste und kam vor der Mündung der Abzweigung zum Halten: Wyatts Rückweg zur Hauptstraße war blockiert. Der Cop schaltete den Suchscheinwerfer an. Wie eine Schwertklinge durchschnitt der Lichtstrahl die Landschaft und bahnte sich den Weg durchs Gehölz in seine Richtung. Wyatt hoffte, dass das Licht wie im Film an ihm vorbeigleiten würde. Doch es verharrte auf dem Lincoln. Das Wageninnere mit Wyatt darin erstrahlte wie eine Glühlampe. Wyatt konnte sehen, wie der Cop in seinem Streifenwagen etwas in sein Funkgerät sprach.
Er hatte keine Zeit zu verschwenden. Wyatt drehte den Zündschlüssel und trat aufs Gas. Der Motor heulte auf und der Wagen schoss davon. Der Abzweigung weiter folgend, ging es leicht hügelaufwärts, bevor plötzlich ein Feldweg kreuzte. Wyatt bog rechts ein, ohne mehr zu wissen, als dass er nun Richtung Stadt unterwegs war. Weitere Streifenwagen rückten ihm von hinten auf die Pelle und schnell wuchs die Kette von Cop-Karren, die hinter dem Lincoln herjagten, Glied um Glied.
Eine riesige Öl- und Dreckwolke stieg hinter dem Lincoln auf. Ihr bräunlicher Dunst hüllte die Streifenwagen in einen Mantel, der im Schein der Blaulichter pulsierte wie eine sich vorwärtswälzende glühende Raupe.
Wyatt durchquerte eine Kurve und erblickte auf der Linken zwei provisorische Zuschauertribünen. Sie rahmten die Längsseiten eines sonnenverbrannten Footballfeldes ein, um das sich eine holprige Laufbahn zog. Nun wusste er genau, wo er war. Dort hatte er heute schon im Sportunterricht seine Runden gedreht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Footballfeldes erspähte Wyatt sein Schulgebäude und trat auf die Bremse. Er riss das Lenkrad herum, fuhr geradewegs auf das Footballfeld und nietete den Fängerkäfig der Baseballspieler um. Wyatt wollte zum Parkplatz auf der anderen Seite des Schulgebäudes. Als er haarscharf um das Eckbüro des stellvertretenden Direktors herumschoss, sah er blinkende Lichter vor sich. Sie hielten direkt auf ihn zu.
Er scherte abrupt aus und der Lincoln schlingerte nach rechts. Um Haaresbreite verfehlte er einen Polizei-Van, der eine Vollbremsung hinlegte, um der Streifenwagenkolonne hinter Wyatt auszuweichen. Unkontrolliert schleuderte der Van um die eigene Achse, kippte auf die Seite und krachte geradewegs in das Willkommensschild der Millersville Middle School – eine Ziegelmauer, auf der in austauschbaren Buchstaben prangte: GLÜCKWUNSCHUNSERERSCHULMANNSCHAFTUNDTOLLESOMMERFERIEN!
Schule und Steinhaufen hinter sich lassend, zwang Wyatt den schlitternden Wagen auf die Hauptstraße und trat das Gaspedal bis zum Bodenblech durch. Der lange Rattenschwanz aus Streifenwagen war ihm immer noch auf den Fersen. Aber als er nun durch die Innenstadtstraßen fuhr, die er seit seinem sechsten Lebensjahr fast täglich mit Skateboard und BMX-Rad unsicher gemacht hatte, durchströmte ihn neue Zuversicht.
Der Eastman-Friedhof lag nicht weit vor ihm. Wenn er es bis dahin in einem Stück schaffte, rechnete sich Wyatt zumindest eine geringe Chance aus, davonzukommen. Wenige Kurven und Abzweigungen später tauchte das Tor der Friedhofsmauer zu seiner Linken auf. Mit einem Hüpfer bretterte er über den Bordstein und versuchte zu bremsen. Aber die Reifen rutschten über das nasse Gras und der Wagen knallte gegen die Mauer. Erst nachdem so ziemlich die Hälfte von Narcys Lincoln wegrasiert war, kam er schließlich, mit der Motorhaube gegen das Gemäuer gedrückt, zum Halten.
Wyatt schnappte sich die grüne Tasche, stopfte die Waffe hinein und stieg auf der Beifahrerseite aus.
Mit quietschenden Reifen kam die Polizei auf der Fahrerseite angeschossen. Den Lincoln als Schutzschild und Leiter nutzend, hüpfte Wyatt auf die zusammengefaltete Motorhaube und sprang zur Mauerkrone empor. So gerade eben konnte er seine Arme über die Mauerspitze schlingen. Doch hinüber schaffte er es nicht. Er stemmte die Beine gegen das Mauerwerk und versuchte hinüberzuklettern.
»Keine Bewegung!«, ertönte es im Chor, während die Cops aus ihren Wagen stürzten. Kugeln pfiffen durch die Luft, prallten vom Stein ab und deckten Wyatt mit einem Splitterregen ein. Mit Übelkeit erregender Klarheit wurde Wyatt plötzlich klar, dass die Polizei nicht versuchte, ihn aufzuhalten oder zu fangen. Sie wollte ihn umbringen. Wyatt hatte Videos von Teenagern gesehen – auf der Flucht vor Polizisten, die das Feuer auf sie eröffneten. Weder hatte er sich vorstellen können, dass er in der gleichen Situation weiterlaufen würde, noch, dass die Cops einem Teenager in den Rücken schießen würden. Die schreckliche Erkenntnis versetzte ihm den nötigen Adrenalinschub, um sich über die Mauer zu schwingen.
Wyatts Füße landeten im weichen Gras. Die grüne Gürteltasche wie einen Football unter dem Arm geklemmt, stürmte er schnurstracks eine Grabsteinreihe entlang. Hinter ihm kraxelten die Cops über die Friedhofsmauer. Wyatt erreichte das Ende des Gräberabschnitts und rannte weiter ins Gehölz. Während er unter den großen Eichen dahinsprintete, nahm er plötzlich wahr, wie die mächtigen knorrigen Äste zu schwingen begannen. Wind fegte in schweren Stößen auf ihn hinab und brachte das Geäst zum Knarren. Ein greller Lichtschein durchbrach das Laub der Baumkronen und tastete nach ihm. Wyatt war so verwirrt, dass er unwillkürlich an Aliens dachte.
Im nächsten Moment wurde ihm klar, dass es ein Helikopter war. Ein verdammter Helikopter.
Dann endlich hatte Wyatt sein Ziel erreicht: den Cachoobie River. Er rannte ans Ufer und schleuderte die grüne Gürteltasche so fest und weit er konnte aufs Wasser hinaus. In hohem Bogen segelte die Tasche dem tosenden Wasser entgegen.
Er sah nicht erst zu, wie die Tasche im Fluss landete. Augenblicklich wirbelte er wieder herum und stürmte flussaufwärts davon, um so weit wie möglich von der Stelle wegzukommen. Er lief auf einem Pfad, der sich neben dem Fluss dahinzog.
Zu seiner Linken tanzten die Taschenlampen der Cops durch das Gehölz. Polizeihunde kläfften. Rechts kam der Helikopter unter Baumwipfelhöhe herabgefegt. Im langsamen Rückwärtsflug über der Wasseroberfläche schwebend, nahm er ihn mit seinem Suchscheinwerfer ins Visier und blendete ihn.
Wyatts Lungen brannten. Es ist ausweglos, dachte er. Langsam blieb er stehen und hob die Hände.
»Hände hinter den Kopf«, hallte eine Donnerstimme von oben herab.
Gebeutelt von den Abwinden der Rotoren, gehorchte Wyatt und wartete – sich nur einer Sache sicher: Heute Nacht würde er nicht mehr nach Hause kommen und seinen kleinen Bruder sehen.
Kapitel 3
APRIL 1984 BAHAMAS
Claudia Degas schlug die Augen auf und ertappte ihr Ebenbild dabei, wie es von der verspiegelten Decke auf sie herabstarrte: Arme und Beine von sich gespreizt, die Augenmaske auf die Stirn geschoben, das Make-up verschmiert. Gleich neben ihrem Gesicht war irgendeine Art Snack in das Kissen geschmiert.
Oh nein, es kommt, dachte sie.
Ihr drehte sich der Magen um. Sie rollte sich von Bett, kroch auf allen vieren über den Boden und kotzte in die vergoldete Toilette ihres Gatten. Ob es immer noch die Seekrankheit war, jetzt am zehnten Tag der Reise? Oder nur ein heftiger Kater? Dabei konnte sie sich gar nicht erinnern, so viel getrunken zu haben. Okay, jedenfalls nicht mehr als sonst. Vielleicht war sie schwanger.
Der Gedanke machte sie blind vor Leid. Sie kniete neben der Toilette und betete. »Bitte Gott, keine Kinder mehr. Keine Kinder mehr von ihm. Bitte nicht mehr.«
Wo ist er eigentlich?, fragte sie sich, als sie sich vage bewusst wurde, dass er nicht neben ihr vor sich hinschnarchte. Sie blickte zum Bett zurück. Sein schmieriges Haupt und der weit klaffende Mund waren nicht da.
Vielleicht hat es ihn auf der Couch umgehauen, dachte sie. Sie kroch zur Tür hinüber und beäugte die Suite der Länge nach.
Licht strömte durch die Glastüren, die zum Balkon über dem Wasser führten. Sie sah sich um. Nein, er war auch nicht auf der Couch.
Spielte er etwa immer noch im Salon? Das war möglich. Allerdings hatte selbst der Colonel irgendwann die Nase voll davon, gegen Freunde zu spielen, die ihn Blatt um Blatt gewinnen ließen. Vielleicht steckte er irgendwo in einer anderen Kabine. Zusammen mit einer seiner … Damen der Nacht.
Auch das war möglich. Aber der Anschein war wichtig für den Colonel. Es sah ihm nicht ähnlich, ihre Ehe so offenkundig zu missachten. Nein, die Arbeit war der wahrscheinlichste Übeltäter. Vermutlich war der Colonel früh aufgewacht, um sich dann einer wichtigen Angelegenheit zu Hause zu widmen. Schließlich hatte er dort sozusagen einen Bürgerkrieg angezettelt und sie waren jetzt hier auf Kreuzfahrt. Vielleicht stand ihnen eine unerwartete Unterbrechung bevor, überlegte Claudia.
Sie rappelte sich auf und taumelte durchs Schlafzimmer zum vergoldeten Telefon, das auf dem Schreibtisch ihres Mannes stand. Sie wollte nach Pablo rufen, dem Sicherheitschef des Colonels. Vielleicht konnte er ihren Gatten ausfindig machen. Als sie den Raum durchquerte, erweckte etwas im Augenwinkel ihre Aufmerksamkeit.
Die Hausschuhe ihres Gatten standen draußen auf dem Balkon, sorgfältig nebeneinander drapiert und mit den Spitzen auf das Karibische Meer gerichtet. Sein monogrammbestickter Frotteemorgenmantel hing über der Reling und sie konnte seine vergoldete Pistole in der Tasche sehen. Victor muss wirklich mal an seinem Vergoldungstick arbeiten, dachte sie. Toilette, Telefon, Waffe, Nagelbürste …
Bestimmt hatte er Lust auf ein frühes Bad im Meer gehabt, überlegte sie. Sie ging auf den Balkon und blickte hinaus, in der Erwartung, ihren Gatten im Wasser planschen zu sehen. Es war nicht ungewöhnlich für den Colonel, auf ein kleines Tauchbad vom Balkon zu springen – eines jener Vorrechte, wenn man eine Jacht sein Eigen nannte.
Tatsächlich kam es Claudia sogar in den Sinn, sich Victor anzuschließen. Ein Bad würde helfen, den Kopf wieder klarzubekommen. Aber als sie über die Brüstung blickte, sah sie nichts als azurblaues Wasser, weißen Sand und eine einsame Meeresschildkröte, die auf den Schiffsrumpf zupaddelte.
»Victor!«, rief sie ihren Gatten. »Vicki, wo bist du?«
Keine Antwort.
Sie versuchte, ruhig zu bleiben. Sicherlich war ihr Gatte aus dem Spielsalon zurückgekehrt, hatte beschlossen, ein kleines Bad in der Karibik zu nehmen, und war nach dem Schwimmen noch nicht in ihre Kabine zurückgekommen – was bedeutete, dass er entweder noch im Schwimmanzug auf der Jacht umherwanderte oder …
Hastig ging sie wieder nach drinnen zum Telefon, um Pablo anzurufen.
Sie erwischte den Sicherheitschef in der Kombüse. »Hjaa«, sagte er, den Mund wahrscheinlich voll mit Rührei und Croissants.
»Guten Morgen. Ist mein Mann bei Ihnen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Er wurde gestern Abend in seine Kabine eskortiert, nachdem Sie beide Wilberforce ins Bett gebracht haben«, sagte Pablo.
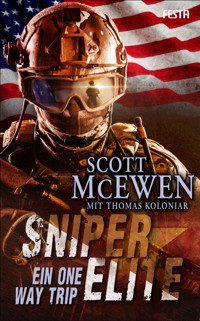
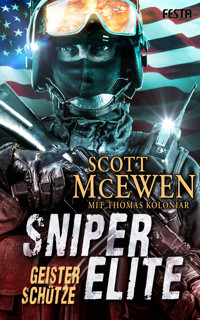
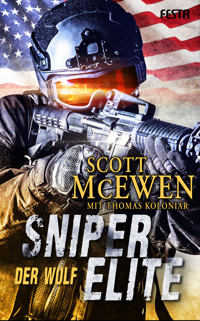















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










