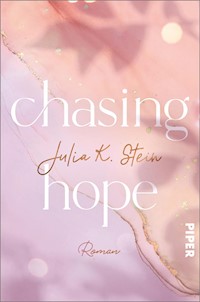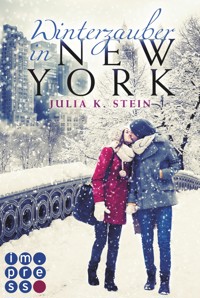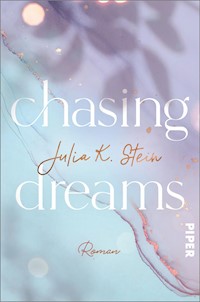
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein College voller junger Künstler und jede Menge Herzklopfen – New Adult aus deutscher Feder Schon früh musste die Tänzerin Yuna lernen, mit ihrer Andersartigkeit umzugehen. Sie ist athletischer als andere Mädchen, weniger zierlich, und fühlt sich mehreren Kulturen zugehörig. Nur beim Tanzen ist sie vollkommen frei. Am Montana Arts College für künstlerisch Begabte verfolgt Yuna deshalb ihren Traum vom klassischen Ballett – ihre modernen Choreografien behält sie vorerst für sich. Im Campuscafé lernt sie den verschlossenen Barista Miles kennen, der sofort von Yunas Ausstrahlung, ihren kontrollierten, eleganten Bewegungen fasziniert ist. Beide sind auf ihre Weise Außenseiter, denn Miles hat jahrelang unter dem Pflegesystem gelitten, seine Gefühle in Bildern verarbeitet. Miteinander können sie endlich sie selbst sein. Wäre da nicht Milesʼ Vergangenheit, die sie einzuholen droht. »Julia K. Stein hat dieses einzigartige Talent, mich gleichzeitig zum Lachen, Fluchen und Weinen zu bringen. Intelligent, voller Gefühl und mit so viel originellem Witz schreibt sie sich mit jedem neuen Buch in mein Leserherz!« Spiegel-Bestsellerautorin Stella Tack Das Zentrum der Reihe bildet das Montana Arts College, ein prestigeträchtiges College mit Schwerpunkt in den darstellenden Künsten. In der Abgeschiedenheit Montanas sollen die Studenten sich auf die Ausbildung ihrer Talente in Tanz, Schauspiel, Film und Kreativem Schreiben konzentrieren. Doch die Natur am Rande der Rocky Mountains ist gewaltiger, die Gefühle intensiver – und das führt nicht nur zu ausdrucksstarker Kunst, sondern auch zu intensivem Funkenflug zwischen den Studenten … Perfekte Lektüre für alle LeserInnen von Sarah Sprinz, Ava Reed und Sophie Bichon. Julia K. Stein stammte aus dem Ruhrgebiet und studierte in Bonn, Berkeley und an der amerikanischen Ostküste, erwarb einen Magister der Philosophie und promovierte über Literatur. Viele Jahre schrieb sie erfolgreich Bücher für Jugendliche und Erwachsene, arbeitete als Dozentin, moderierte Branchenveranstaltungen und sprach und schrieb auf YouTube und Instagram (@julia.k.stein) über das kreative Leben. Sie verstarb im August 2024.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Chasing Dreams« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Das Mottozitat stammt aus:
Van Gogh Museum, Vincent van Gogh. The Letters, Brief Nummer 682 an Theo van Gogh, Arles, 18. September 1888, Zitat übersetzt aus dem Französischen von Julia K. Stein. URL: http://vangoghletters.org/vg/letters/let682/letter.html.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Dieses Werk wurde vermittelt durch Agentur Brauer.
Redaktion: Wiebke Bach
Covergestaltung: Sandra Taufer
Coverabbildung: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Eins
Yuna
Zwei
Miles
Drei
Yuna
Vier
Yuna
Fünf
Miles
Sechs
Yuna
Sieben
Miles
Acht
Yuna
Neun
Miles
Zehn
Yuna
Elf
Miles
Zwölf
Yuna
Dreizehn
Yuna
Vierzehn
Miles
Fünfzehn
Yuna
Sechzehn
Miles
Siebzehn
Yuna
Achtzehn
Miles
Neunzehn
Yuna
Zwanzig
Miles
Einundzwanzig
Yuna
Zweiundzwanzig
Yuna
Dreiundzwanzig
Miles
Vierundzwanzig
Miles
Fünfundzwanzig
Yuna
Sechsundzwanzig
Miles
Siebenundzwanzig
Yuna
Achtundzwanzig
Miles
Neunundzwanzig
Yuna
Dreißig
Miles
Einunddreißig
Miles
Zweiunddreißig
Miles
Dreiunddreißig
Yuna
Vierunddreißig
Yuna
Fünfunddreißig
Miles
Sechsunddreißig
Yuna
Siebenunddreißig
Miles
Achtunddreißig
Miles
Neununddreißig
Yuna
Vierzig
Miles
Einundvierzig
Yuna
Zweiundvierzig
Miles
Danke
Für Johanna
There is nothing more truly artistic than to love people.
Vincent van Gogh
Eins
Yuna
Die neuesten TikTok-Charts dröhnen mir in den Ohren. Studierende aller Jahrgänge mit roten Plastikbechern drängeln sich vorbei und checken sich gegenseitig ab. Wenn ich den Bechern zu nahe komme, zieht mir ein penetrantes Kirscharoma in die Nase. Wahrscheinlich soll der zuckrige Duft Alkohol vertuschen, aber so intensiv, wie die Bowle riecht, könnte er problemlos Zyankali überdecken. Schreiend unterhalten sich alle Neuankömmlinge über die Musik hinweg, aufgeregt, glücklich, dass sie hier sind. Auffällige Klamotten, sexy Tops und aufgedrehte Stimmen. Kurz: Alles weist darauf hin, dass ich hier nichts verloren habe. In meiner natürlichen Umgebung befindet sich normalerweise mindestens eine Ballettstange. Musik gibt es zwar auch, sogar »live«, allerdings meist von einer älteren Dame aus der Slowakei am Klavier vorgetragen. Und hinter den Fenstern sind keine Berge oder Wiesen zu sehen wie hier, sondern – zumindest vom Ballettstudio aus – der Central Park, der jetzt ungefähr eintausendachthundert Meilen östlich liegen dürfte. Ich stehe zusammengequetscht in einer Ecke mit Hazel, dem Mädchen aus dem Schauspielprogramm, das bei der Anmeldung hinter mir stand. Mit einer Mischung aus Flehen und Drohen hat sie mich weichgeklopft mitzukommen: »Die ›New-Game-Fresher-Party‹ ist der Auftakt zu allem. Es gibt niemanden, der nicht kommt. Lass mich nicht allein, du bist die Einzige, die ich hier kenne!« Das beruhte zu dem Zeitpunkt auf Gegenseitigkeit, wir waren ja erst eine Stunde vorher angekommen, später als die meisten anderen. Also hatte ich vorhin meine Sachen in den kleinen Schrank geräumt und mein Bett bezogen, ein paar anderen, die schon in »meinem Haus« eingezogen waren, kurz zugewunken, bevor ich wieder aufgebrochen bin.
Und jetzt vibriert mein Magen so stark von den aggressiven Beats, die aus den extrapotenten Lautsprechern dringen, dass ich befürchte, gleich seekrank zu werden. Es ist ungefähr achtzig Grad, und einige zeigen ähnlich viel Haut wie in der Sauna. Ich tippe auf Tänzer, die sind natürlich stolz auf ihre Körper, in die sie so viel Arbeit gesteckt haben. Aber Personen mit exhibitionistischer Veranlagung gibt es auf einem College für darstellende Künste natürlich einige.
Ich streife meine Lieblingsstrickjacke von der Schulter, die ihre besten Tage schon lange hinter sich hat, und stopfe sie in meine Umhängetasche. Der Raum ist voll, was wohl das Zeichen einer guten Party ist, aber es drängen tatsächlich immer noch mehr Leute herein. Der DJ, ein Student, der mit Kopfhörern hinter einem altmodischen Mischpult steht und betont busy herumwirbelt, wechselt das Tempo und blendet kurz in ein anderes Lied.
Jetzt wird der Beat zusätzlich von gerappten Schimpfwörtern begleitet, die direkt aus der South Bronx stammen könnten. Ich glaube, ich bin allerdings die Einzige hier, die jemals dort war. Die Studenten kommen von überallher, einige sogar aus Europa oder Asien, aber gewiss nicht aus der South Bronx. Normalerweise habe ich nichts gegen laute Musik, aber ich vermute, hier soll vor allem das Vernunftzentrum im Gehirn ausgeschaltet werden, um das Stammhirn ans Steuer zu lassen. »Get the fuck out of my way, you fucking dirty puss, he cummed all on my gown«, singt der DJ noch mal laut ins Mikro mit.
»So viele Schimpfwörter in einem einzigen Satz muss man erst mal schaffen«, bemerke ich.
»Solche Lieder waren an meiner Highschool komplett verboten«, schreit Hazel schmerzhaft laut zurück in mein Ohr. »Cool. Sollen wir uns was zu trinken besorgen?«
»Klar«, brülle ich zurück. »Willst du was holen? Ich warte hier und halte den Platz frei?«, schlage ich vor. Wobei nicht ganz klar ist, welchen »Platz« ich genau frei halte, aber sich durch die Menge zu drängeln erscheint mir noch weniger erstrebenswert, und jeder Quadratmeter muss definitiv verteidigt werden.
Für einen Moment sehe ich Nervosität in Hazels Blick. Dann scheint sie sich zu sammeln. Sie nickt. »Was möchtest du denn?«
»Irgendetwas«, erwidere ich und lächele ihr beruhigend zu. Sie wirkt aufgeregter als ich, bevor ich auf die Bühne muss. Vielleicht ist sie von Natur aus immer hibbelig.
»Möchtest du was von dieser Willkommensbowle?«, fragt sie und zupft ihren Jeansrock weiter nach unten.
»Du siehst gut aus, wirklich. Der Rock ist nicht zu kurz«, bestätige ich ihr. »Er verdeckt deinen Po, was hier nicht selbstverständlich ist.« Ich deute auf ein Mädchen neben uns, dessen Shorts komplett unter ihrem T-Shirt verschwindet, sodass nicht klar ist, ob sie überhaupt eine Hose trägt.
»Ist er zu lang?«, fragt sie und sieht noch verunsicherter aus.
»Er ist perfekt«, sage ich.
Sie blickt mich dankbar an. »Also Bowle?«
»Die Bowle, die sie allen direkt am Eingang andrehen wollen?« So penetrant, wie die älteren Studenten, die diese Party organisiert haben, jedem Neuankömmling die Bowle einflößen wollen, bin ich mir sicher, dass jede Menge harter Alkohol drin ist. Dabei sind die meisten hier unter einundzwanzig, aber vielleicht schaut da in Montana niemand so genau hin. Ich schüttele den Kopf.
»Bier?«, fragt sie eifrig und fährt dabei durch ihre feinen dunklen Haare, um sie neu zu arrangieren. Sie hält ihren Arm hoch, an dem ein dunkelrotes Band klebt, das bestätigt, dass sie Alkohol trinken darf, und zwinkert mir zu. »Das haben die eigentlich an alle verteilt.« Sie hat große Augen und auffallend gerade Augenbrauen. Sie ist hübsch mit einem fast puppenartigen Gesicht und kann bestimmt mit dreißig noch Teenager spielen, was in ihrem Beruf wahrscheinlich von Vorteil ist. Zudem ist sie ungefähr einen Kopf kleiner als ich. Auf ihrem T-Shirt steht: »Ich bin nicht verrückt, ich probe meinen Dialog.« Ich glaube, sie ist ziemlich stolz, hier zu sein.
Ich nicke. »Klar. Bier ist gut.« Ich mag kein Bier, aber ich will es nicht unnötig kompliziert machen. »Ich warte hier«, füge ich auf ihren fragenden Blick hinzu. Sie dreht sich um und schiebt sich durch die Menge Richtung Bar. Sie kommt aus einer Kleinstadt in Ohio und hat mich schon zweimal gefragt, ob ihr Look nach Kleinstadt aussieht, als ich erzählt habe, dass ich aus New York komme. Dabei fühle ich mich definitiv nicht wie das coole Großstadtmädchen mit Fashion-Sense. New York kennt halt jeder, ihr Kuhdorf aus Ohio, wie sie es selbst genannt hat, nicht.
Die Leute kommen an diesen verlassenen Ort an der Grenze von Montana zu Idaho, weil das Montana College of Performing Arts, auch Montana Arts College genannt oder kurz MCPA, einfach eines der besten Colleges ist, wenn man etwas in Tanz, Film oder Schauspiel erreichen will. Ich bin hier, weil man im Ballettprogramm des MCPA neben dem Collegeabschluss eine der besten Tanzausbildungen der USA bekommt. Aber vor allem, weil ich vor anderthalb Jahren, bei dem letzten Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe, ein Stipendium gewonnen habe, das ich nie eingelöst hätte, wenn alles normal verlaufen wäre. Ich hätte New York nie verlassen. Ich liebe New York. Und meine Eltern vermisse ich auch. Die Musik dröhnt, und links neben mir lacht sich eine Gruppe über einen Witz kaputt. Vielleicht demonstrieren sie auch nur, dass sie ihn verstanden haben. Ich fühle mich so unglaublich fehl am Platz. Und dann denke ich an New York, aber anders, als ich eigentlich wollte, ich denke daran, wie mein Gesicht zum letzten Mal an Maxwells Schulter gelegen hat, seine Hand unter meinem Shirt. Ich weiß noch genau, wie es war, wenn er mit seinen Fingern seitlich an meinem Busen entlanggefahren ist, unauffällig unter meiner dicken Jacke, schließlich saßen wir häufig auf einer öffentlichen Bank in der Nähe des Apple-Ladens an der Upper East Side, viele Subwaystationen weg von zu Hause. Sonst wären wir wieder weitergegangen, jedenfalls, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber es war nie leicht gewesen, einen geeigneten Ort zu finden zwischen dem Training und der Schule. Anfangs hatte es ewig gedauert, bis Maxwell überhaupt bei meinem Busen angelangt war, und jede Sekunde davon hatte sich ziemlich gut angefühlt. Es gefiel uns beiden, als wir endlich weitergingen, nur hatte ich selten Zeit. Dann hatte er leise in meine Haare geflüstert. »Es tut mir so leid, aber ich glaube, das geht nicht mehr mit uns.« Was er meinte, war: Ich glaube, ich möchte hier lieber mit Seraphina sitzen und ihren Busen anfassen. Seraphina hatte immer Zeit und wohnte ebenfalls an der Upper East. Nur wusste ich das damals noch nicht, und ich weiß nicht, ob es deshalb mehr oder weniger wehgetan hat. Maxwell hatte einen passenden Zeitpunkt gewählt: genau zwei Wochen nach meiner Diagnose, auch wenn das »nichts damit zu tun hatte« und er mir lieber nicht den Grund erklären wollte, weil das »würde mich ohnehin nur verletzen«. Er war so rücksichtsvoll.
Hazel ist in der Menge verschwunden. Vielleicht sucht sie nach jemandem mit ausgeprägterem Party-Vibe, weil sie spürt, dass ich hier nicht alt werde. Mit mir hat sie jemanden, zu dem sie zurückkommen kann, um nicht allein herumzustehen. Aber für ein paar Dinge waren die letzten anderthalb Jahre auch gut. Allein auf einer Party herumzustehen schreckt mich wirklich nicht mehr. Ich habe kein Problem damit, ihr Party-Anker zu sein, außer dass der Anker hier bald gelichtet wird und ich nach Hause gehen werde. Ich will morgen trainieren. Ich muss trainieren, denn meine alte Form habe ich noch nicht zurück. Ich bin erst heute angekommen, weil ich noch einen Arzttermin in New York hatte, und die sind seit anderthalb Jahren heilig. »Sie sind gesund«, hat der Arzt mir bestätigt. »Vergessen Sie einfach, dass Sie jemals krank waren.« Sehr lustig. Ein Vergessens-Serum hatte er nämlich nicht. Morgen wird das Training ohnehin schlimm, weil meine Beine sich erst mal wieder lockern müssen, nach dieser ewig langen Busfahrt im Greyhound mit den Leuten neben mir, die zwar alle paar Stunden gewechselt, aber immer verlässlich gestunken haben. Nur die Nuance hat gewechselt, mal mehr nach Schweiß, mal mehr nach in Alufolie eingewickeltem Taco, mal nach zu dick aufgetragenem Billig-Aftershave. Allein bei dem Gedanken muss ich mich schütteln.
»Hi, habe ich dich nicht schon mal gesehen?« Die Musik ist minimal leiser geworden, vielleicht hatten noch andere Studenten Angst um ihr Gehör. Neben mir steht ein Typ, dicke hellbraune Haare, eine scharfe Narbe auf der rechten Wange, die nicht entstellend, aber irgendwie auffällig ist, vielleicht, weil der Rest an ihm so makellos ist. Ja, ich habe ihn schon mal gesehen.
»Klar, hey«, sage ich, weil ich seinen Namen vergessen habe.
Jetzt blinzelt er verwirrt.
»Ah, sorry«, sagt er dann. Sein Ausdruck verrät ihn. Er hat keine Ahnung, wer ich bin. Das war gerade nur ein Spruch gewesen. »Wir wohnen im gleichen Haus«, erinnere ich ihn. Dort sind wir uns vorhin im Flur über den Weg gelaufen. Vielleicht ist er auch einer der Typen, die dunkelhaarige Mädchen verwechseln, weil sie nur bei den Blondinen genauer hinschauen.
»Klar weiß ich, dass du aus meinem Haus bist«, stellt er dann fest, stolz über seinen Geistesblitz. »Natürlich habe ich dich erkannt.«
»Natürlich«, bestätige ich ironisch.
Er erinnert mich an bestimmte Typen aus New York, dieser bewusst verkommene Harvard-Club-Chic: beige Hosen, ein teures Hemd, das lässig aus der Hose hängt, und, nun ja, seine rot unterlaufenen Augen sprechen Bände. Vielleicht hat er mich auch nicht wiedererkannt, weil er so neben sich steht.
»Du hast mir deinen Namen aber immer noch nicht verraten. Ich bin Nate. Filmprogramm.«
»Yuna«, erwidere ich. »Klassischer Tanz«, imitiere ich seine Art, sich inklusive Studienschwerpunkt vorzustellen. Machen viele hier so. Jeder verpasst sich sein Studienfachlabel, das habe ich in den wenigen Stunden, seit ich hier bin, schon gelernt.
Ich warte darauf, dass er so was sagt wie »hübscher Name«.
»Hübscher Name«, bemerkt Nate.
Bingo. Manchmal ist meine Menschenkenntnis echt unschlagbar. Er zieht die Worte beim Sprechen. Er ist bekifft, wahrscheinlich auch betrunken. Sein Atem riecht nach irgendetwas Hochprozentigem. Vielleicht ist es auch die ominöse Begrüßungsbowle.
»Ich hoffe wirklich, dass das Studium hier hält, was es verspricht, wenn man dafür schon in dieses Nest kommt. Ich meine, die einzigen Partys, die es hier gibt, sind die auf dem Campus?« Er schüttelt in demonstrativer Fassungslosigkeit den Kopf.
»Ich bin auch weniger zum Partyfeiern gekommen als zum Tanzen«, erwidere ich.
»Du klingst ein bisschen wie meine alte französische Gouvernante«, erwidert Nate schmunzelnd.
Ich fürchte, er hat recht. Schlimmer ist: Ich fühle mich auch wie eine französische Gouvernante. Aber ich bin es gewohnt, der Party-Pooper zu sein, das kann jede Tänzerin.
»Keine Sorge, ich mag das. Hast du auch eine kleine Peitsche in der Handtasche?« Er wackelt mit den Augenbrauen.
Ich verziehe das Gesicht. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass dein Humor ziemlich einfach gestrickt ist?«
»Nicht nur mein Humor, ich bin einfach gestrickt. Ist ja nichts Schlechtes«, sagt Nate. »Frauen mögen das.«
»Wie kommst du darauf?«
»Ich mache Studien darüber, welche Tinder-Bios am besten funktionieren. Und das Ergebnis ist eindeutig.«
Ich verdrehe die Augen.
»Hey, auf Tinder kann man auch einfach so nette Leute kennenlernen.«
»Klar, auf Tinder findet man Freunde, genauso, wie man auf Youporn was über Filmschnitt und Kameraeinstellungen lernen kann.«
Er grinst, und tatsächlich bildet sich ein Grübchen in seiner Wange, das ihn viel jungenhafter erscheinen lässt.
»Hey, hey, hey, das hast du gesagt. Ich bin schockiert.«
»Und, welches sind deine erfolgreichsten Bios?«
Nate denkt nicht lange nach. »Suche Badass Girl. Good Ass schon vorhanden.«
»Nicht dein Ernst. Und darauf antworten Leute?«
Er nickt nachdrücklich. »Richtig gut lief auch der hier: Ich mag safe Sex. Ich binde dich fest, dann fällst du nicht herunter.«
»Ich verliere den Glauben an die Menschheit.«
»Dann sollte ich dir nicht sagen, dass ich habe mommy issues auch gut abging.«
»Ich habe Angst zu fragen, was deine aktuelle Bio ist.«
Er holt sein Telefon heraus, tippt kurz und hält es mir unter die Nase. Unter einem vorteilhaften Foto von Nate mit einem sehr süßen Hund steht:
Vorteile:
Teile mein Netflix-Passwort.
Kann mit der Zunge eine Schleife binden.
Kann 11 Hotdogs auf einmal essen.
Mag Haustiere.
Keine Angst vor Spinnen.
Nachteile:
Hyperaktiv.
Esse 11 Hotdogs auf einmal.
Klaue möglicherweise dein Haustier.
Brauche viel Raum beim Schlafen.
»Du hast einen Hund?«
»Nein, der ist von einem Freund. Tiere klappen gut. Aber am MCPA läuft Tinder nicht. Hier muss man wahrscheinlich oldschool Leute treffen.« Er zuckt mit den Schultern.
Irgendwie klingen der Akzent und die Art, wie er redet, vertraut. Ich habe eine Vermutung. »Woher kommst du?«
»New York«, sagt er tatsächlich, und es schwingt ein bisschen Arroganz mit. Er glaubt wohl, aus der coolsten Stadt der Welt zu kommen und mit einem Landei zu sprechen.
»Ach wirklich«, sage ich beeindruckt. »Das ist ja total cool.«
Er fährt sich durch die Haare. »Ja, ich kann mir noch nicht richtig vorstellen, drei Jahre hier zu verbringen. Weißt du, die meisten haben Vorurteile, was die Menschen dort angeht. Aber New Yorker sind viel freundlichere Menschen, als ihr Ruf vermuten lässt.« Er kneift die Augen zusammen, als wollte er scharf stellen. »Wobei mir diese Party ganz gut gefällt.« Er lächelt mich an, dann gleitet sein Blick wieder über die vielen kurzen Röcke und kleinen Oberteile und bleibt an einem nackten Oberschenkel in unserer nächsten Umgebung kleben.
»Aber wenn du in New York wohnst und es so magst, wieso bist du nicht dort zur Filmhochschule gegangen?«
Er reißt seinen Blick vom Oberschenkel los und mustert mich interessiert mit seinen hellen Augen, als wollte er prüfen, ob ich irgendwelche versteckten Absichten mit dieser Frage verfolge.
»Es war keine Option«, erwidert er vage.
Alles klar. So kann man es auch formulieren, wenn man abgelehnt wird. Aber ich sage es nicht laut. Er wirkt nicht wie jemand, der schon viele Ablehnungen im Leben eingesteckt hat. Ein Typ, der an uns vorbeigeht, stolpert und fällt fast auf mich drauf, dabei verschüttet er seinen Drink zum Teil auf Nates Hose. Nate reißt ihn nach hinten zu sich und schiebt ihn in die Waagerechte. »Pass doch auf, du Arschloch«, sagt er.
Er hält den schlaksigen, blonden Typ fest im Arm vor seiner Brust.
»Du kannst mich jetzt wieder loslassen, außer du stehst auf mich«, sagt der Typ unbeirrt, formt einen Kussmund und zwinkert Nate zu. Der verdreht die Augen und lässt ihn los.
»Falls du mal was Neues ausprobieren willst, melde dich einfach.« Der Typ wendet sich mir zu. »Heeeeey, ich wollte mich eigentlich dir kurz vorstellen. Ich war wohl zu stürmisch.« Er grinst. Ich lächele etwas unsicher.
Nate wirft mir einen prüfenden Blick zu, und ich zucke leicht mit den Schultern. Dann wendet er sich an den Typen. »Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn man innerhalb von dreißig Sekunden mit zwei Leuten flirtet. Das wirkt wahllos, Alter.« Er klopft ihm zum Abschied auf die Schulter und schiebt ihn zur Seite. Hat er mich vorher angeschaut, um abzuchecken, ob ich Interesse an dem Typ habe, als würden wir hier im Team arbeiten?
»Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der eine klare sexuelle Orientierung hat«, bemerkt Nate. »He/him auf der ganzen Linie.« Und so ganz unrecht hat er möglicherweise nicht. Das Montana Arts College gilt als der liberalste Ort in ganz Montana.
»Vielleicht gibt es ja eine Selbsthilfegruppe für reiche, weiße Heterojungs«, schlage ich vor.
»Hey, du kannst ja richtig lustig sein, wenn du den Gouvernanten-Vibe ablegst.«
»Die Party ist nicht viel anders als in New York. Und wenn man viel Gras raucht, ist es bestimmt egal, ob man in New York ist oder hier.«
Immerhin ist er nicht zu bekifft, um aufzuhorchen, und er blickt mich mit neuem Interesse an. »Du wirkst nicht bekifft«, stellt er fest. »Meinst du etwa mich?«
Ich hebe meine Augenbrauen leicht an.
»Warte mal, du kommst auch aus New York? Hast du mich gerade auflaufen lassen und mich von den Vorzügen des Großstadtlebens erzählen lassen, obwohl du sie selbst kennst? Halt, kennen wir uns etwa von dort? Muss es mir unangenehm sein?« Den letzten Satz begleitet ein selbstgefälliges Grinsen. Er nimmt noch einen Schluck aus seinem Glas.
»Kann es sein, dass du ein kleines bisschen von dir selbst eingenommen bist? Wohnst du zufällig Upper East? Ich war dort in der Ballettschule, vielleicht bin ich dir auf dem Weg zur Subway begegnet. Ich komme aus Queens.« Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch nie in Queens gewesen ist. An meinem Haus ist er höchstens mal auf dem Weg zum Flughafen vorbeigefahren, um in die Karibik oder sonst wohin zu fliegen. Jungs wie er kommen nicht nach Queens, die verlassen ihr goldenes Viertel nur für die Clubs im Village oder, wenn sie sich nach Abenteuer fühlen, Lower East Side.
Er wirkt beinahe ein wenig verlegen. Er weiß nicht so recht, woran er bei mir ist, und blickt mich fast entschuldigend an.
»Ich bin nicht so oft in Queens«, sagt er. »Wobei man hier wahrscheinlich auch aus New Jersey kommen kann und als New Yorker gilt, und wir wissen beide, dass New Jersey nicht zu New York gehört.«
Ich muss unwillkürlich lächeln. Meine Güte, ich vermisse zwar nicht die Partys, aber bei seinen Worten wird es eng in meiner Brust. Ich vermisse mein Zuhause jetzt schon.
Er kneift noch mal die Augen zusammen. Auf seinen Schläfen glänzen feine Schweißperlen. »Du bist ganz schön breit«, bemerke ich.
Sein Kopf schnellt zu mir herum. »Ist es so auffällig?«
Ich zucke mit den Schultern. Für andere vielleicht nicht, aber ich kenne es von Maxwell. »Ich muss gleich nach Hause«, erkläre ich. Vielleicht will ich klarmachen, dass ich nicht interessiert bin. Nicht, dass er wirklich Interesse gezeigt hat. Aber er weckt keine guten Erinnerungen in mir. Er erinnert mich zu sehr an Maxwell.
»Du meinst, es gibt keine Zigarette danach für uns?«, fragt er mit leidendem Gesichtsausdruck. So richtig enttäuscht wirkt er nicht. Er hat natürlich schon gemerkt, dass ich nicht brauchbar bin, um eine ausgelassene Party mit ihm zu feiern.
»Meine Freundin kommt aus Ohio, da zieht die New-York-Nummer mit Sicherheit mega«, kann ich mir nicht verkneifen hinzuzufügen, um ihn zu trösten.
»Kann es sein, dass du dich über mich lustig machst?«, fragt er. Doof ist er nicht.
»Kann sein, muss aber nicht sein.« Ich zucke mit den Augenbrauen.
Er fährt sich durch die Haare. »Magst du sie mir vorstellen?«
Ich verdrehe die Augen. Er hat es natürlich ernst genommen. Vielleicht keine gute Idee, ihm Hazel vorzustellen. Aber ich weiß, dass Hazel sehr gern ein paar Leute treffen will, deshalb hat sie mich hierhergebracht. Sie wollte nur nicht kommen, ohne jemanden zu kennen. Wenn ich beide vorstelle, sind alle zufrieden, und ich kann ohne schlechtes Gewissen gehen. »Logisch. Sie ist zur Bar gegangen und nie wieder zurückgekommen, möglicherweise ist dir also jemand zuvorgekommen. Aber so weit kann dein Mitbewerber noch nicht sein.«
»Das klingt vielversprechend«, erwidert Nate. Irgendwie ist ein seltsames Einverständnis zwischen uns entstanden, als hätten wir geklärt, dass er der saufende Feiertyp ist und ich die disziplinierte Ballerina bin. Wir werden definitiv nicht kichernd gemeinsam im Bett landen, Friend-Zone. Wobei ich so weit jetzt noch nicht gehen würde, eher Leben-und-leben-lassen-Zone. Trotzdem ist er im Moment der mir vertrauteste Mensch an diesem ganzen College.
Wir drängen uns zwischen den aufgedrehten, sich laut unterhaltenden Studenten Richtung Bar vor. Die Musik hat jetzt einen besseren Rhythmus. Ich mag laute Musik, und ich liebe es, wenn sie den Körper übernimmt, die unterschiedlichen Vibrationen von Klassik und Pop, Hip-Hop. Ich gehöre definitiv nicht zu den Tänzerinnen, die nur Klassik hören.
Studenten stehen in Gruppen zusammen, schwer zu sagen, wer neu angekommen ist und wer schon länger hier ist. Es liegt so viel Energie in der Luft, Gelächter, Flirt, alle möchten sich von ihrer besten Seite zeigen oder von einer brandneu entworfenen, um schnell Freunde für eine großartige gemeinsame Collegezeit zu finden. Meine Agenda ist ein bisschen anders. Vor allem nicht ablenken lassen, volle Konzentration aufs Training, Sichtbarkeit nur im Tanzstudio. Ich werde sowieso nie wirklich dazugehören zu den Studenten, die hier die beste Zeit ihres Lebens haben wollen. Wenn die Krankheit mir nicht dazwischengekommen wäre, wäre ich schon lange in einer Kompanie. Jetzt ist es eben ein Umweg über dieses Tanzcollege, doch das Ziel ist das gleiche. Im Außenseitersein bin ich ziemlich gut. Wenn deine Eltern einen koreanischen Shop in Queens betreiben, deine Großmutter Mexikanerin ist und du an der Waganowa-Ballettakademie in New York mit einem Haufen Upperclass-Ballerinen getanzt hast, beherrscht man das. Der Unterschied ist, dass es diesmal kein Gefühl ist, sondern zu hundert Prozent stimmt. Ich habe nämlich ein paar Dinge in meiner Bewerbung weggelassen. Streng genommen, könnte man es auch als Lüge bezeichnen. Wie zum Beispiel fast ein ganzes Jahr, in dem ich gar nicht getanzt habe. Wenn man schon als schwache Ballerina anfängt, kann man die Karriere gleich vergessen, vor allem, wenn man sowieso schon in so vielerlei Hinsicht aus dem Rahmen fällt wie ich. Ich werde also freundlich und unsichtbar außerhalb des Tanzstudios sein. Früher habe ich mir eingebildet, dass ich irgendwann dazugehöre, wenn ich nett bin. Das bilde ich mir nicht mehr ein. Ich muss auch nicht dazugehören. Ich muss nur die Beste sein, sobald ich im Studio bin. Meine alte Ballettlehrerin Catherine in New York hat gesagt: »Erfolg ist einfach. Mach es ihnen unmöglich, dich zu übersehen.«
Die Lieder wechseln, ich erkenne ein paar echte Tänzer in der Gruppe der Tanzenden, die sich in einer Ecke gebildet hat. Sie können es natürlich nicht lassen, irgendwelche komischen Verrenkungen zu machen, um zu demonstrieren, wie gelenkig sie sind. Aber irgendwie beruhigt es auch. Montana und New York mögen völlig unterschiedlich sein, aber Tänzer sind überall gleich.
Okay, Hazel ist nirgends zu sehen. Ich hoffe, sie sucht mich jetzt nicht an der Stelle, wo wir gerade standen. Zum Glück bin ich groß, was als Ballerina ein Nachteil, als Partybesucherin aber ein Vorteil ist. Mein Blick trifft auf den des Typen hinter der Bar. Eine Lampe über dem Tresen strahlt aus einem komischen Winkel in seine Augen, sodass sie ein wenig überblau wirken, wie die Augen eines Huskys. Unsere Blicke hängen für einen Moment aneinander, über das Meer der Leute um uns herum hinweg. Sein Blick ist klar, ganz anders als bei Nate, der neben mir am Tresen hängt. Dann schaut der Barkeeper wieder weg und erledigt eine andere Bestellung, und ich schaue schnell zur Seite, weil mir plötzlich bewusst wird, dass ich ihn gerade etwas creepy angestarrt habe.
»Ich habe mir einen doppelten Moscow Mule bestellt. Ich würde dir natürlich auch einen bestellen, aber ich habe das dunkle Gefühl, dass du den nicht willst.« Nate schenkt mir ein träges Lächeln. Trotz seines pseudoverwahrlosten Stils ist er attraktiv mit seinem klassischen Profil und den hohen Wangenknochen. Ich kann verstehen, warum Mädchen auf ihn abfahren. Früher hätte ich ihn auch attraktiv gefunden. Die Mädchen aus der Ballettschule standen auf solche Typen, da hing ein ganzer Lebensstil dran: Man tanzt bis Ende dreißig, dann Kinder und Sektfrühstück am Park mit den Freundinnen. Anschließend Kleider mit der Kreditkarte vom Familien-Trustfund für den nächsten Charity-Ball shoppen. Ab vierzig dann Pilates mit Personaltrainer statt Ballett. Ich blicke von Nate zurück zum Barkeeper, der mich abwartend und etwas genervt anschaut. Ich bemühe mich, diesmal nicht in seine Augen zu starren, die ohne das Licht wieder etwas normaler aussehen. Wie er sich wohl vorstellen würde? Schauspielprogramm? Design? Oder ist er einer der Studenten, die hier einen Abschluss in Englisch, Geschichte oder sogar Business machen? Er wirkt jedoch nicht so, als wollte er reden. Er will nur Bestellungen aufnehmen. Ein paar andere fixieren ihn schon demonstrativ mit Blicken und warten, bis sie endlich an der Reihe sind.
»Ich nehme ein Wasser. Mit Kohlensäure«, sage ich zu ihm.
Ich entdecke Hazel ganz in der Nähe. Sie unterhält sich mit einem anderen Mädchen mit feuerroten Haaren und einer auffälligen Blumenranke auf dem Oberarm, die in ihrem ausgeschnittenen Top perfekt zur Geltung kommt.
Hazel sieht sie mit großen Augen und leicht geöffneten Lippen so bewundernd an, als wäre sie das perfekteste Wesen, das sie je gesehen hat.
»Hazel«, rufe ich, allerdings nicht laut genug, um die Musik zu übertönen. In dem Moment schaut sie zu mir rüber, und ich gebe ihr ein Zeichen, dass sie zu mir kommen soll und ich mit ihr sprechen will. Sie blickt zur Rothaarigen zurück, die aber schon wieder mit jemand anderem spricht und Hazels bewundernde Blicke wohl nicht vermisst. Hazel kommt also herüber, und weil Nate in seinem teuren, lässig verknitterten Hemd neben mir sie anlächelt und dabei vollständig abcheckt, springt ihr Blick hektisch zwischen ihm und mir hin und her.
Ich schaue wieder zum Barkeeper. Er lächelt nicht, aber er sieht auch nicht unfreundlich aus. Er wirkt, als hätte er die Situation mit Hazel und Nate richtig erfasst. Quatsch. Diese Augen irritieren mich, wahrscheinlich denkt er gerade an etwas völlig Unspektakuläres wie die nächste Bestellung. Er füllt ein Glas mit Wasser und schiebt es vor mich.
»Mit besonders großen Eiswürfeln. Und extrastarker Kohlensäure. Partywasser.«
Sein linker Mundwinkel verzieht sich zu einem angedeuteten Lächeln und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine geschwungenen Lippen. Seine Augen sind auch ohne das Licht ziemlich durchdringend. Er ist blond und hat im Gegensatz zu Nate gar nichts vom Upper-Class-Boy. Er trägt ein T-Shirt und darüber ein nicht zugeknöpftes, kariertes Hemd. Er sieht aus wie jemand aus der Gegend. Oder so, wie ich mir die Leute aus der Gegend so vorstelle. Aber ich höre jetzt auf, ihn anzustarren wie ein Groupie, nur weil er mir das Wasser mit einem kleinen Witz überreicht hat.
»Danke«, sage ich betont knapp, doch er hat sich schon dem nächsten Studenten zugewandt, um eine Bestellung aufzunehmen. Ein süßlicher Alkoholgeruch holt mich in die Wirklichkeit zurück. Er kommt von Hazel, die einen Becher mit der gefährlichen Bowle in der Hand hat. Ich hoffe, ich bilde mir nur ein, dass ihr Blick noch glasiger wirkt. Immerhin scheint ihre Unsicherheit ebenfalls weniger geworden zu sein.
»Ich wollte dich jemandem vorstellen«, erkläre ich ihr und wende mich zu Nate, der lässig am Tresen lehnt. Ich vermute allerdings, er nutzt diesen auch zur Stabilisierung seines Gleichgewichts.
»Das ist Hazel, Schauspielprogramm. Das ist Nate, Filmprogramm.« Ich bin wie meine Mutter, wenn sie mir die netten koreanischen Söhne ihrer Freundinnen vorstellt. »Hey, vielleicht werdet ihr so ein Producer-Schauspieler-Team wie Ridley Scott und Russel Crowe. Oder Woody Allen und Diane Keaton. Dann möchte ich bitte, dass später im Abspann erwähnt wird, dass ich euch einander vorgestellt habe.«
Wenn ich mich nicht täusche, sind Hazels Wangen noch erhitzter als vorhin. Nate checkt sie weiter ab, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das nicht entweder macht, um Hazel zu verunsichern, oder aus reiner Höflichkeit.
Hazel ist jedenfalls sofort interessiert, vor allem, als sie hört, dass er aus New York kommt. Nate ist charmant, auch wenn er betrunken ist, hat er das noch voll drauf.
»Ich hab’s dir doch gesagt«, raune ich Nate zu, als Hazel kurz abgelenkt ist, weil sie glaubt, jemanden aus ihrer Heimatstadt zu sehen.
Nate grinst und hebt seine Hand zum High Five.
»Der Typ war natürlich nicht der, der ich dachte«, erklärt Hazel, als sie zurückkommt. »Was ist los?«, fragt sie ein wenig nervös, so als ob sie Angst hat, etwas verpasst zu haben.
»Nichts«, beruhige ich sie. »Ich habe ihm ehrlicherweise vorher gesagt, dass du New York cool findest und wahrscheinlich mehr mit ihm flirten würdest als ich.« Ich sage das so leise, dass Nate es nicht hören kann, auch wenn es ihn kaum stören würde. Ich stupse sie an, aber sie lacht zum Glück darüber. Wir sind vielleicht doch mehr auf einer Ebene, als ich anfangs dachte.
»Okay. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich jetzt nach Hause gehen. Ich habe morgen früh Training.« Das stimmt so halb. Es gibt kein offizielles Training, es ist mein eigener Plan.
»Am Wochenende?«, fragt Hazel.
Ich beuge mich noch weiter zu ihr und betrachte sie genau. Trotz des Bechers Bowle ist sie noch wesentlich nüchterner als Nate. »Der Typ flirtet jetzt mit dir, und wenn du ihm die Chance gibst, geht er mit dir ins Bett. Ich kenne solche Typen aus New York, nett, aber nichts für große Gefühle. Willst du mit mir nach Hause?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Kann ich dich mit gutem Gewissen hierlassen, und es passiert nichts, was du nicht willst?«
»Glaub mir, ich bin froh, wenn überhaupt mal was passiert. Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich mache nichts, was ich nicht will. Danke, dass du dich um mich gekümmert hast.« Sie drückt kurz meinen Arm. Ein warmes Gefühl durchströmt mich. Hazel ist vielleicht unerfahren und überbehütet aufgewachsen, aber sie ist nicht so naiv, dass sie nicht weiß, dass sie naiv ist. Sie ist in Ordnung.
Nate hängt immer noch am Tresen, scannt geduldig die Menge. In seinem Zustand läuft die Zeit etwas langsamer.
»Okay, ich lass euch jetzt allein«, erkläre ich. »Ich wünsche euch einen schönen Abend.« Nate hebt lässig eine Hand. Bei allem demonstrativen Abchecken von Hazel habe ich den Eindruck, dass sie ihn nicht ernsthaft interessiert. Vielleicht, weil er denkt, dass Hazel leichte Beute sein würde? Letztlich steht er wahrscheinlich eher auf die Hard-to-get-Mädchen. Die Ballerinen, mit denen ich in New York getanzt habe, beherrschen dieses Spiel perfekt. Und es ist nicht so, dass ich mir das nicht abschauen konnte in den letzten Jahren. Nur ist das eine Mal, als ich versucht habe, genauso zu sein, so schiefgegangen, dass ich zumindest aus dem Grund froh bin, New York hinter mir gelassen zu haben. Leute wie dieser Nate enden mit arroganten Bitches, die dann zu anstrengenden Upper-East-Side-Diven werden – nicht mit unschuldigen Kleinstadtmädchen wie Hazel.
Okay, wahrscheinlich bilde ich mir etwas zu sehr ein, alles durchschaut zu haben. Wäre meine Menschenkenntnis wirklich so gut, wäre ich schließlich nicht selbst gegen die Wand gefahren. Nach meiner Verabschiedung drehe ich mich ein letztes Mal um. Der Student im karierten Hemd hinter dem Tresen ist mir mit Blicken gefolgt. Vielleicht auch nicht. Er tut es auf jeden Fall nicht demonstrativ. Im Gegenteil, jetzt schaut er wieder weg. Irgendwie spüre ich jedoch diesen Blick in meinem Bauch. Mein Kopf brummt von der Musik, den vielen Leuten. Draußen schlägt mir die kühle Abendluft entgegen, und gierig sauge ich sie ein. Nachdem die Tür hinter mir zugefallen ist und die Musik abrupt abgeschnitten, herrscht totale Stille. So eine tiefe Stille, die sich bis in die Ferne zieht, gibt es in New York gar nicht. Wenn New York zu Ende ist, kommen die Vororte. Hier in Montana werden Stimmen meilenweit getragen, weil keine Hindernisse im Weg liegen. So eine Stille habe ich noch nie erlebt, und sie macht mich nervös. Ich bin froh, dass ich auch nach ein paar Hundert Metern noch die Musik der Party höre, wenn die Tür kurz aufgeht. Ich hole schnell mein Handy raus und notiere, was ich heute getrunken und gegessen habe. Als ich fertig bin, ist es immer noch still. Dieser Nate kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ich liebe Queens viel mehr als die Upper East Side. Es ist nicht chic, aber ich mag die Ecke, wo wir wohnen, und wenn das Rauschen der Autos im Sommer durch die Fenster schallt, fühlt man sich auf jeden Fall nicht allein. Ich mag die vielen Hispanics, die Menschen, die ihre kleinen Läden und Imbisse betreiben, die kargen Sportplätze, wo man trotzdem so viel Spaß haben kann, und den koreanischen Deli-Shop meiner Eltern mit den Stammgästen. Mein Herz zieht sich zusammen bei dem Gedanken an zu Hause. Nein, natürlich, ich weiß, dass ich froh sein sollte, dass ich nicht in New York bin, sondern in Appleby, Montana. Genau auf der Grenze zu Idaho. No Man’s Land. Big Sky Country. The Gem State. Montana College of Performing Arts.
Zwei
Miles
Geradezu niedlich, dass diese reichen Studenten sich die Party mit ein paar Getto-Beats untermalen lassen, um sich verruchter zu fühlen. Ich habe sie noch nie auf einer Party erlebt. Sie sind aufgeregt wie junge Welpen in der Hoffnung auf Futter. Sie bezahlen Tausende und Abertausende von Dollar, um hier studieren zu dürfen. Tanz, Schauspiel, diese Dinge, aus denen Träume sind. Sie wollen auf die Bühne. Ich will alles, nur nicht auf eine Bühne. »Fuck the dirty bitches«, singt Rapper Q. Und die Studis drehen auf, weil sie Dinge mitsingen, die sonst nie über ihre Lippen kommen würden. Es ist kochend heiß hier drin, weil die Klimaanlage irgendein Problem hat, aber ich glaube, die merken das alle nicht mal, so vollgepumpt mit Flirt-Hormonen, wie sie gerade sind.
Die Mädchen spielen ihr Spiel mit unglaublich viel Inbrunst und Überzeugung. Hey, ihr müsst euch gar nicht so anstrengen. Ich garantiere euch, dass die Jungs hier das Gleiche wollen. Ihr könnt einfach Klartext reden und dann gemeinsam nach Hause gehen! Dann kann ich nämlich auch nach Hause, mich juckt es in den Fingern, zurückzufahren. Oder in den Füßen. Die kleben allerdings am Boden, weil ein paar Besoffene Bier oder Bowle verschüttet haben. Ich weiß, dass hier die meisten ihre Armbänder, die ihnen das Trinken von Alkohol erlauben, nicht auf ehrliche Weise bekommen haben. Aber ich bin nicht der Babysitter, und wenn man in diesem Staat mit vierzehn Jahren eine Waffe besitzen und mit sechzehn heiraten darf, kann man wohl auch mit achtzehn Alkohol trinken.
Dieser Typ mit seinen Moscow Mule und dem weißen Leinenhemd nervt. Vorurteile sind da, um sich an ihnen zu orientieren, oder nicht? Der Typ findet sich geil, und wenn man sich selbst geil findet, stehen die Chancen gut, dass andere das auch tun. Oft genug erlebt. Ich will’s dem Mädchen neben ihm zuflüstern. Ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, ob sie indianische oder asiatische Wurzeln hat. Eigentlich bin ich ganz gut in so was, weil ich zeitweise in Stadtgebieten gewohnt habe, wo jede nur erdenkliche Hautfarbe und ethnische Mischung zu finden war. Ich könnte sie stundenlang anschauen, aber dass sie sich mit diesem Hochstapler abgibt, ist deprimierend. Zum Glück habe ich keine Zeit, ständig hinzuschauen, weil die Studenten trinken, als wäre es das letzte und nicht das erste Mal für die Studienanfänger. Käme auch etwas komisch rüber. Aber wenn ich richtig einschätze, wie sie dasteht, legt sie nicht ihre ganze Energie in den Flirt, was für sie spricht. Sie ist selbst mehr wie ein Zuschauer. Hoffe ich zumindest. Ich gebe Sunnyboy einen weiteren Moscow Mule mit besonders viel Alkohol. Viel Spaß damit. Wenn er sich das weiter in dem Tempo reinkippt, bekommt er sowieso nichts mehr auf die Reihe, und mit einem total Weggetretenen haben dann auch die Mädchen keine Lust mehr. Das dürfte sogar noch stärker sein als diese widerliche Bowle, die sich die Studenten reinziehen wie Biolimonade. Keine Ahnung, ich fühle mich mindestens zwanzig Jahre älter als alle anderen, auch wenn hier wahrscheinlich sogar einige sind, die älter sind als ich. Das passiert mir häufiger, seit ich in Appleby lebe.
»Kannst du noch mal ein neues Fass von hinten holen?«, brüllt Matt mir ins Ohr, weil die Musik gerade so laut ist, als wären das keine Zwanzigjährigen, sondern Senioren mit Hörschaden. »It’s time for the nigga roll call. Show your middle finga, bitch«, singt eine Rapperin mit verärgerter Stimme. Leute, kriegt euch mal wieder ein.
Ich nicke ihm zu. Er ist in Ordnung. Matt hatte vorhin Rückenschmerzen, und mir macht es nichts aus, die schweren Dinger zu schleppen. Ich verlasse meinen Posten hinter dem Tresen, den wir vorhin erst provisorisch aufgebaut haben. Ich freue mich schon auf eine Dusche später, der Tag war lang. Und die Temperatur ist in der letzten Stunde um fünf Grad gestiegen.
Matt ist mein Boss im Books & Beans, dem Campuscafé, wo ich normalerweise jobbe. Und ich weiß jetzt wieder, warum ich die Studenten nicht dabei sehen will, wie sie Party machen. Es hinterlässt kein gutes Gefühl. Ich dränge mich an den verschwitzten Körpern vorbei und spüre dabei einige Blicke auf mir. Jeder schaut hier heute jeden an. Die Studenten zum Herbstsemester sind frisch angekommen, und alle sind im Check-up-Mode. Die älteren Semester sind da, angeblich, um die Neuen willkommen zu heißen, aber ganz ehrlich, die begutachten das Frischfleisch, »darstellende Künste« hin oder her, da interessiert sich gerade niemand wirklich für. Der vertraute Geruch von Gras steigt mir in die Nase. Klar, dass sich einige erst mal zudröhnen, Papa hat ja das Studium schon bezahlt, da kann man sein Gehirn auch ausschalten. Okay, das ist unfair, vielleicht bin ich einfach neidisch.
Der Beat wird tiefer. Das Lied kenne ich, und es erinnert mich leider sofort an den Club in Chicago, wo ich mit Olivia war. Olivia. Der verbotene Gedanke. In mir breitet sich sofort dieses durchdringende Ziehen aus, ein merkwürdiger Schmerz, der definitiv nicht eingebildet ist. Diese Sehnsucht ist unerträglich, und doch hat sie sich wieder eingeschlichen. Ich möchte mich am liebsten schlagen für diesen Gedanken, obwohl das genauso wenig hilft, alles schon probiert. Inzwischen ist die Musik nur noch dumpf im Hintergrund, weil ich in den Flur gegangen bin, wo wir die Bierfässer gestapelt haben. Ich umfasse ein silbernes Fass, gehe in die Knie und hebe es hoch. Es liegt angenehm kalt in meinen Armen, dann hebe ich es mit Schwung auf die Schulter. Jetzt bemerke ich erst das Pärchen, das ein paar Meter weiter entfernt steht und anscheinend versucht, sich gegenseitig zu verschlingen. Sie bemerken mich garantiert nicht. Hektisch werfen die beiden ihre Münder hin und her, um herauszufinden, wer die Oberhand hat – wie in einem Kampf. Ich verdränge die Gedanken, die in mir hochsteigen, die Sehnsucht, die Bilder, die vor meinen Augen flackern, Olivia mit nach oben gestreckten Armen auf meinem Bett, ihre zu einem Strahl gebündelten Haare auf meinem Kissen. Bilder, die eine Welt zeigen, die so weit weg ist, die ich so vermisse.
Mit der Schulter stoße ich die Tür auf, sofort wird die Musik wieder laut.
»Ohh, du bist sooo stark«, ruft ein Mädchen mit feuerroten Haaren und einem knallrot geschminkten Mund laut genug, dass ich es noch über die Musik hinweg verstehe. Sie denkt, ich bin einer von ihnen. Für einen Moment bin ich perplex und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie klimpert demonstrativ mit ihren Wimpern.
»Ich hatte gehofft, dass es jemand merkt«, erwidere ich dann.
Sie lacht, wirft dabei den Kopf nach hinten und zeigt ihre hyperweißen Zähne. Ich gehe schnell weiter. Es kommt mir falsch vor. Als würde ich mich hier einschleichen und vorgeben, etwas zu sein, was ich nicht bin. Am liebsten würde ich ihr sagen: Hey, ich bin kein Student. Du willst mich nicht kennenlernen. Ich bin nicht da, um jemanden kennenzulernen. Ich bin nur zu jung dafür, dass sich mein Leben in meinem Gesicht abgezeichnet haben könnte, aber alle Jugend an mir ist fake.
Das Fass ist scheißschwer. Das schöne Mädchen mit den auffallenden Augen steht immer noch in der Nähe des Tresens. Sie steht besonders aufrecht, als würde sie sich nach oben strecken, was ihr einen eleganten, stolzen Ausdruck verleiht. Sie ist groß und trägt ein schwarzes, eng anliegendes Shirt, ihre glatten dunklen Haare fallen nach vorn. Ich weiß nicht, warum, aber sie strahlt Kraft aus, Power.
Sie dreht sich in meine Richtung, als ich mich mit dem Fass an ihr vorbeischieben muss, und ich bemerke ihre Gegenwart viel zu genau, als würde eine Lupe auf sie gerichtet sein. Whatever. Andere Frauen sollten mich nicht interessieren. Ich bin vergeben.
Plötzlich sehne ich mich weg von dieser Party und bereue noch mal, dass ich angenommen habe, als Matt mich um Hilfe gebeten hat. Ich hätte auch sagen können, dass ich auf der Ranch gebraucht werde. Dass ich die Arbeitsaufträge der Murphys nicht ablehnen kann, weil sie mir Kost und Logis gewähren. Er hätte das geglaubt, auch wenn die Murphys mich immer ermutigen auszugehen. Ich sage gelegentlich, dass ich weggehe. Dann setze ich mich in den Pick-up und fahre eine Weile herum und höre Musik. Wenn ich zurückkomme, sind sie zufrieden, und ich bin es auch.
Drei Stunden später lässt Matt mich gehen, weil er den Rest allein schafft. Ich verspreche ihm, dafür morgen die Frühschicht im Books & Beans zu übernehmen, damit er ein bisschen länger schlafen kann. Er ist nicht jemand, der mich die lästigen Arbeiten machen lässt, er ist in Ordnung. Ich mag es, ihm zu helfen, er kommt aus der Gegend und ist selbst erst fünfundzwanzig, hat aber schon zwei Kinder und eine tolle Frau. Alles ist bei ihnen so harmonisch, kaum vorstellbar, dass man ein Leben führen kann, das so unkompliziert ist und wie aus einem Bilderbuch.
Draußen auf dem Parkplatz hinter dem Eclectic House, wo die Party stattgefunden hat, steht mein Pick-up. Nie werde ich den Moment vergessen, als Ellen Murphy mir das Auto gezeigt hat. Sie hat sich für die Roststellen entschuldigt und die vielen Beulen. »Aber es fährt, und du kannst es benutzen, so viel du willst. Es ist von Rich, und er braucht es nicht mehr, will es aber auch nicht verkaufen. Betrachte es wie dein eigenes.« Ich hätte fast losgeheult. Auf dem Beifahrersitz liegt Spike und wartet auf mich. Er ist eine ziemlich wilde Hundemischung. Da ist alles drin, was die Straßen Chicagos zu bieten hatten. Seine Schäferhundohren sind gespitzt, sein Fell ist braun mit schwarzen Flecken, und nur am Bauch ist es weich. Auf dem Rücken ist es rauer, Regen perlt problemlos ab. Er blickt mich aus seinen wachen Augen an, als ich die Tür öffne. Sein linkes Auge wirkt größer, weil sich direkt darum ein schwarzer Sprenkel schließt. Er ist mir an einem Abend in Chicago einfach gefolgt. Er war voller Ungeziefer, ich wusste, dass sie ihn einschläfern würden, wenn er einmal im Hundeauffanglager landen würde. Wenn man so wenig nach Golden Retriever aussieht wie er, kann einem das passieren. Keine Ahnung, Tiere mögen mich schon immer, aber er hatte wirklich einen Narren an mir gefressen, nachdem ich nur einen Tag lang nett zu ihm war. So ausgehungert war er nach jemandem, der ihn weder gehauen noch ihm Befehle gegeben hat, einfach, um jemand anderen noch unter sich zu haben. Und irgendwie wollte ich ihn dann nicht enttäuschen. Nicht einen Tag nett sein und ihn anschließend fallen lassen. Jetzt blinzelt er mich an, und sein Schwanz schlägt auf den Beifahrersitz. Er hat geschlafen. Ich kraule ihn hinter den Ohren, und er lehnt seinen Kopf gegen meine Hand. Ich mag nicht zugeben, wie sehr ich den Hund liebe. Sonst bekommt er vielleicht Angst und haut ab. Ich habe keinen Schimmer, woher er kommt, wer seine Eltern sind. Vielleicht denkt er, dass wir etwas gemeinsam haben.
Vielleicht gibt es irgendeinen großen Plan, und Spike und ich sollten uns treffen. Ja, vielleicht werde ich spirituell und führe bald eine dieser fucking Dankbarkeitslisten in einem rosa Tagebuch. Ich mag mein Leben gerade. Es passiert nichts. Wenn Olivia kommt, wird sie überrascht sein. Ich kann es nicht erwarten. Genauso wenig kann ich erwarten zu schauen, was sie macht, wenn ich nach Hause komme. Früher fand ich Social Media bescheuert, jetzt bin ich froh über die Tanzvideos auf TikTok mit ihren Freundinnen.
»Alles klar? Party zu Hause?«, sage ich zu Spike, während ich den Motor aufheulen lasse und den Gang einlege. Spike wedelt mit dem Schwanz und sieht mich an. Er denkt, dass ich ihn gerettet habe, dabei ist es umgekehrt. Vielleicht wäre ich sonst das geworden, was alle anderen von mir erwartet haben.
Drei
Yuna
Könnt ihr bitte etwas leiser zwitschern? Die Vögel wecken mich, und sie produzieren mit Sicherheit eine höhere Dezibelzahl als die Autos, die an unserer Wohnung in Queens vorbeifahren. Eine Woche bin ich schon hier, aber jeden Tag wache ich von den Vögeln auf. Die Autos in Queens waren für mich so beruhigend wie für andere Leute das Rauschen des Meeres. Die Vögel trällern hingegen so inbrünstig, dass es locker als Lärmbelästigung durchgeht. Meine Beine fühlen sich schwer an, weil ich gestern viel trainiert habe und abends noch zu lange in der Bibliothek war.
Mir geht es aber mit Sicherheit besser als Hazel, die mir noch eine Sprachnachricht geschickt hat, um mir zu bestätigen, dass sie auch gestern Nacht wieder sicher nach Hause gekommen ist. Es hörte sich im Hintergrund allerdings so an, als hätte sie einen Tisch umgeworfen, während sie nach eigener Aussage »ins Zimmer geschlichen« ist. Hazel war bisher jeden Tag auf irgendeiner Party, sie hat definitiv Angst, etwas vom Studentenleben zu verpassen.
Ich schaue zu Julie rüber, meiner Mitbewohnerin. Sie schläft noch fest, ihre dicken, rotblonden Haare verdecken ihre Augen, und ihr Mund steht ein wenig offen. Unten auf ihrer Bettdecke, auf der verblasste Rosen zu sehen sind, liegt ein Buch, das sie gestern gelesen hat, ein Kinderbuch von Dr. Seuss, dem vielleicht berühmtesten Kinderbuchautor in ganz Amerika. Sie hat sich einen ganzen Stapel Kinderbücher aus der Bibliothek ausgeliehen. Sie besitzt sehr wenige Dinge, vielleicht drei T-Shirts, die abgetragen aussehen, und zwei Sweatshirts. Ihr gesamtes Gepäck bestand aus einer kleinen Segeltuchtasche, in die alle ihre Sachen hineinpassten. So wenig Kleidung, als würde sie gerade ein Minimalismus-Experiment durchführen. Dafür besitzt sie umso mehr dieser Kristalle, die auf dem Fensterbrett liegen, und kleine Fläschchen mit Ölen. Sie hat mich am ersten Tag freundlich begrüßt, aber dann ziemlich viel geschwiegen und mich nur gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn sie das Zimmer reinigt. Als ich zugestimmt habe, hat sie ein Bündel Salbei verbrannt, sodass unser Zimmer kurzzeitig gerochen hat wie ein Kiefernwald mit einer bitteren Note. Der Geruch ist glücklicherweise inzwischen verflogen. Ich habe noch nie eine Zimmergenossin gehabt, außer auf den Wettbewerben für ein oder zwei Tage, doch es wird schon irgendwie funktionieren, und vielleicht freunden wir uns ja noch an. Ich habe schon gehört, wie Iris über sie gelästert hat. Aber ich habe nichts gegen Julie, sie lebt irgendwie in ihrer eigenen Dimension und erzählt bisher nicht viel von sich. Für mich ist das okay. Mir ist jemand, der eher ruhiger ist, ganz recht. Und unser Zimmer gefällt mir. Unsere Betten stehen an den gegenüberliegenden Wänden, jeder hat den gleichen Schrank, ein Regal, einen Schreibtisch mit Stuhl. Es ist spannend, in die Zimmer der anderen zu schauen und zu sehen, wie unterschiedlich sie dekoriert sind, obwohl alle mit den gleichen Möbeln angefangen haben. Ich habe eine Fotowand mit Bildern vom Tanzen, meiner Familie und Paris aufgehängt, vielleicht besorge ich noch eine Lichterkette. Es ist eigentlich ganz hübsch, auch wenn mein Heimweh nach New York dadurch bisher nicht besser wird.
Iris, eine andere Tänzerin, wohnt im Zimmer gegenüber in meinem Haus, das die Anschrift »344 Washington« hat. Hier wohnen zwölf Studenten, sechs männliche und sechs weibliche aus allen möglichen Studienrichtungen, die meisten natürlich künstlerisch, weil die Mehrzahl der Studiengänge am MCPA zum Bereich Darstellende Künste gehört. 344 Washington ist ein ganz normales Wohnhaus, das auch einer großen Familie gehören könnte, aus weißem Holz gebaut mit vielen Zimmern, davon einige sogar mit eigenem Bad. Es gefällt mir. Man könnte denken, dass es schön ist, nicht die einzige Tänzerin im Haus zu sein, aber das glauben nur Leute, die nicht selbst tanzen. Wenn ich Iris sehe, weiß ich wieder genau, was ich an meiner Ballettschule in New York nicht vermisse: Kolleginnen, die für den Erfolg alle Freundschaften auf der Stelle verraten würden. Seufzend schiebe ich die warme Decke zur Seite. Dann drücke ich mich in die Waagerechte und stehe auf. Ich nehme das Signal »todmüde« meines Körpers als Art neutralen Hinweis war. Jeder Tänzer kann das. Darauf basiert das Training. Man ignoriert solche Hinweise. Ich kann ziemlich viel ignorieren, ich war auf der Waganowa-Ballettakademie in New York, genau, benannt nach der großen Agrippina Waganowa, wie die Akademie des Kirow-Balletts. Wer sich da über Verletzungen beklagt, gilt als schwach und weinerlich. Ich habe seit Jahren nicht mehr geweint. Außer dem einen Mal vor anderthalb Jahren. Und sogar da nur kurz. Bringt ja nichts.
Kurze Zeit später öffne ich die schwere Kühlschranktür für mein erstes Frühstück, Overnight Oats, und ein paar meiner Medikamente, die im Kühlschrank lagern. Dort sind die einzelnen Fächer und Regale schon aufgeteilt und Lebensmittel mit Zetteln markiert, auf denen Namen stehen: Eduardo oder Wei oder Phoebe. Von Eduardo behaupten einige, dass er Teil der spanischen Königsfamilie ist und nur inkognito unterwegs ist. Eine Totenkopfzeichnung neben seinem Namen soll einen Vorgeschmack darauf geben, was einem droht, wenn man die Nussjoghurts isst. Nate lässt sich davon meistens nicht abhalten. Wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, werde ich mir für mehr Privatsphäre einen Mini-Kühlschrank bestellen, den ich in mein Zimmer stellen kann. Ich leiste mir nicht viel, aber den brauche ich. Momentan habe ich die Tütchen mit den Tagesrationen an Tabletten in Schachteln für Vitamintabletten gepackt. Ich schütte mir den Inhalt einer Tüte in die Hand, werfe die Tabletten mit Schwung in den Mund und spüle sie mit einem Glas Wasser herunter. Es gibt Frat-Boys, die können riesige Mengen Bier trinken, indem sie ihr Zäpfchen umlegen und das Bier ungehindert in den Rachen laufen lassen. Ich kann das mit Tabletten. Ich könnte wahrscheinlich auch problemlos alte römische Geldmünzen herunterschlucken. Vielleicht sollte ich mich beim Guinness Buch der Rekorde bewerben.
»Guten Morgen«, erklingt eine Stimme aus Richtung Küchentür. Jetzt verschlucke ich mich doch und muss husten. Mit wenigen Schritten ist die Person neben mir und klopft mir fest auf den Rücken. Ein leichter Lavendelduft steigt mir in die Nase, der von ihren frisch gewaschenen Sachen stammt.
»Alles okay?« Der blumige Duft passt nicht zu den harten Schlägen auf meinen Rücken, die besser zu einem Bauarbeiter passen als zu einer zarten Ballerina. Es ist Iris, die mich besorgt aus ihren weit auseinanderstehenden blauen Augen anblickt. Ihre blonden Haare sind zu einem Knoten eingedreht. Das ist das Ding mit Ballerinen: Sie sehen zart aus, aber eigentlich bestehen sie aus Drahtseilen. Es ist eine Mogelpackung, wir wirken auf der Bühne leicht und zerbrechlich genau dadurch, dass wir es nicht sind.
»Willst du mich unschädlich machen?«, krächze ich und schlucke noch mal, um die Tabletten, die gegen den Eingang meiner Speiseröhre drücken, herunterzuwürgen. Tränen schießen mir in die Augen, doch es gelingt. Ich atme aus.
»Geht’s wieder?«, fragt Iris, ohne die Frage zu beantworten. Ihr Blick ruht auf den Schachteln im Kühlschrank.
»Du nimmst krass viel von dem Zeug«, bemerkt sie. Ich weiß schon, warum ich jeden Kontakt mit ihr außerhalb des Trainings vermeide. Wie mit den anderen auch. Jeder überprüft den anderen. Ich war auch nicht bei der New-Dancer-Fresher-Party der Tanzabteilung. Eine Willkommensparty hat mir gereicht. Iris dreht mir den Rücken zu und holt sich ein Glas aus dem Geschirrschrank über der Spüle. Das Holz des Schranks ist weiß angestrichen und schon häufiger ausgebessert worden. Die Küche ist insgesamt etwas altmodisch und mit einem großen Gasherd ausgestattet.
Iris hat Fingernägel, die in zartem Pink angemalt und stumpf abgefeilt sind: Ballerina-Nägel. Die Finger sehen selbst aus wie Spitzenschuhe. Dann nimmt sie eine Karaffe mit gefiltertem Wasser aus dem Kühlschrank und füllt das Glas auf. Über ihrem Hintern, der in einer rosafarbenen, etwas zu großen Jogginghose steckt, prangt der Schriftzug »Pink«. Sie hat ein perfektes Profil mit einem perfekt ebenmäßigen Haaransatz. Ihr Top ist am Rücken weit ausgeschnitten und legt ihre makellose weiße Haut frei, die wahrscheinlich noch nie einen Sonnenstrahl gesehen hat.
»Soll gesund sein«, sage ich betont gleichgültig. Ich gieße das Wasser, das ich vorher aufgekocht habe, in meine Flasche und bereite meine übliche große Portion grünen Tee vor. Ich bemerke allerdings ihren prüfenden Blick. Ballerina zu Ballerina. Wir wissen, dass es nicht wirklich um die Gesundheit geht beim Tanzen, sondern darum, perfekt zu sein. Mädchen machen alle möglichen Sachen, um das richtige Gewicht zu halten und die besten Füße zu bekommen, einige Fußstrecker sehen aus wie mittelalterliche Foltermaschinen.
»Sollen wir los?«, fragt sie, als wäre es total normal, dass wir beide gemeinsam zum Training gehen. Dabei klopft sie mit ihren Nägeln auf die Arbeitsfläche. Bisher sind wir noch nie gemeinsam gegangen. Und ich will auch nicht, dass es Gewohnheit wird. Dann greift sie nach ihrer Umhängetasche, die sie am Eingang zur Küche abgestellt hat. Ebenfalls pink mit kleinen Hundesilhouetten. Dabei ist das Training heute absolut freiwillig, wie Lidia gesagt hat. Und das will was heißen. Bis gestern war mir gar nicht klar, dass sich das Wort »freiwillig« überhaupt in Lidias Wortschatz befindet.
Ich nicke, was soll ich sonst tun? Ich schnappe mir meine blaue Umhängetasche, und mir fällt auf, wie abgenutzt sie neben der von Iris aussieht. Dann stecke ich meine Flasche mit dem grünen Tee in die Seitenklappe und folge ihr nach draußen. Es ist kühl. Obwohl es tagsüber noch ziemlich warm ist, sinkt die Temperatur nachts stark. In New York steht Anfang September noch die Hitze in der Stadt, eine derartige Kühle ist zu keiner Tageszeit denkbar. Es ist aber auch erst kurz vor sechs.
»Wieso warst du gestern nicht auf der Party für die Tänzer?«, fragt Iris und sieht mich freundlich an, ihr Lächeln ist professionell wie beim Vorstellungsgespräch. Dabei geht sie zügig weiter.
Ich schüttele den Kopf. »Ich bin nicht so der Partytyp«, entgegne ich.
»Ist mir auch schon aufgefallen«, murmelt Iris mit dem gleichen, irgendwie undurchschaubaren Lächeln.
Vor einem alten Baum auf dem Campus hält sie kurz an und macht ein Foto von sich. »Sorry, ich will nur einmal die Morgenstimmung posten«, sagt sie und tippt im Gehen auf ihrem Handy herum. Wen auch immer das interessiert.
Schweigend gehen wir eine Weile nebeneinander über den verschlafenen Campus. Vereinzelt sind ein paar Jogger unterwegs, einige schleppen sich aus fremden Wohnheimbetten nach Hause und tragen verknitterte Klamotten oder verschmierten Lidstrich vom letzten Abend.
»Man muss es ja nicht übertreiben, aber ich glaube, es ist den anderen auch schon aufgefallen, dass du kein Interesse an ihnen hast. Du warst bei keinem Tänzer-Event, das nicht Pflicht war«, bemerkt Iris. Sie überprüft mich die ganze Zeit auf Fehltritte. Egal, darüber werde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Sie läuft so selbstverständlich über den Campus, als wäre sie schon Wochen hier. Mir kommt immer noch alles ziemlich surreal vor. Als wäre ich in einem Videospiel gelandet und würde vor einem künstlich hineinprojizierten Hintergrund laufen. Die üppige Natur, die Häuser, die brav um den Quad herum aufgereiht sind, eine rechteckige Wiese im Zentrum des Campus, auf der sich die Gehwege aus allen Richtungen kreuzen. Die Studenten nennen die Wege Highway oder Laufsteg. Nirgendwo Obdachlose in Sicht, keine Drogenabhängigen, nur der Campus, die Bäume, Sträucher, dahinter die Felder, der Nebel, der sich langsam von den Wiesen hebt.
»Es war gut«, erklärt Iris mit dem gleichen Lächeln. »Man muss sich ja auf die Gruppe einlassen. Wir müssen schließlich zusammen tanzen«, erklärt sie und meint ganz klar, dass sie glaubt, ich halte mich für was Besseres.
»Ich hole mir noch schnell einen Kaffee«, erklärt sie, als wir am Eingang des Books & Beans vorbeikommen. Das Café ist in einem altmodischen Haus mit weiß unterteilten Fenstern untergebracht und sieht wie eins der Häuser im West Village aus. Es macht um sechs Uhr auf, aber die Tür steht schon offen, und ich folge ihr ins Innere, das ähnlich einladend aussieht wie das Äußere. Ich habe meinen Tee schon. Vor dem Training könnte ich keinen Kaffee trinken.
»Entschuldigung, könnte ich schon einen Espresso haben?«, fragt Iris. Der Barista trägt ein grün kariertes Flanellhemd und steht mit dem Rücken zu uns. Er füllt gerade Bohnen in die Maschine. Es duftet nach Kaffee und frischem Gebäck, das in Kartons auf dem Tresen steht und noch in den Vitrinen verteilt werden muss. Die Tische sind noch leer, auf einigen stehen Vasen mit Blumen. Der Ort versprüht eine unglaublich warme Atmosphäre. Ich habe schon gesehen, dass viele Studenten hierherkommen, um zu lernen, wenn sie nicht in die Bibliothek möchten. Ich werde nachher noch mal kommen. Das sieht nach einem wunderbaren Ort aus.
Der Barista dreht sich flüchtig um. »Guten Morgen, klar«, sagt er und lächelt uns freundlich zu, aber nicht so, als würde er uns richtig wahrnehmen. Er holt zwei Tassen. »Du auch?«, fragt Iris mich.
Ich schüttele den Kopf.
»Nur einen, danke«, fügt sie an den Barista gewandt hinzu.
Jetzt dreht er sich richtig um, und ich erkenne ihn wieder. Er ist der Barkeeper von der Begrüßungsparty, der mir das »Partywasser« gegeben hat. Er hat feuchte Haare, die er auf dem Kopf zurückgestrichen hat, aber er ist es. Garantiert. Die blonden Haare und die durchdringenden Augen, die mich sofort wieder seltsam nervös machen. Er hat mich auch erkannt, denke ich. Er stockt jedenfalls kurz, als sein Blick auf mir landet. »Guten Morgen«, sagt er. Und nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: »Du möchtest nichts?«