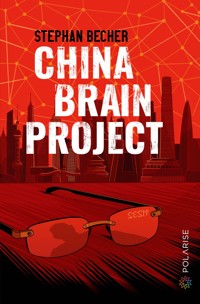
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Polarise
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hast du zu viele Punkte verloren, wird deine Freiheit eingeschränkt. Allein China beherrscht die Technologie der Quantencomputer. Doch das Land benötigt ausländisches Know-how, um die Simulation eines menschlichen Gehirns zu verwirklichen. Eine Wissenschaftlerin und drei Wissenschaftler ergreifen die Chance, im Reich der Mitte mit unbegrenzten Mitteln zu forschen. Die allgegenwärtige Überwachung durch Augmented-Reality-Brillen und ein kompromissloses Sozialkreditsystem stellen die vier jedoch schnell vor ungeahnte Herausforderungen. Bald sind nicht nur ihre Karrieren bedroht, mit jedem Tag steigt auch die Gefahr, dass einer von ihnen als Spion entlarvt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Becher
CHINA BRAIN PROJECT
© 2022 Polarise
Ein Imprint der dpunkt.verlag GmbH
Wieblinger Weg 17
69123 Heidelberg
www.polarise.de
1. Auflage 2022
Autor: Stephan Becher
Lektorat: Dr. Benjamin Ziech
Copy-Editing: Irina Sehling
Satz: Veronika Schnabel
Herstellung: Stefanie Weidner, Frank Heidt
Illustration Cover: Weberson Santiago
ISBN:
978-3-947619-65-8
978-3-947619-66-5
ePub
978-3-947619-67-2
mobi
978-3-947619-68-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über www.dnb.de abrufbar.
Stephan Becher ist Elektroingenieur und promovierter Volkswirt. Nach einigen Beiträgen für Fachzeitschriften über Mikrocomputertechnik erschienen in den 1990er Jahren der dBASE-Schnellkurs und der Ratgeber Schnell und erfolgreich studieren. Vor wenigen Jahren traf er den Entschluss, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Elf seiner Science-Fiction-Kurzgeschichten wurden seither in der Zeitschrift c’t Magazin für Computertechnik veröffentlicht. Die Kurzgeschichte Stromsperre aus der Anthologie Rebellion in Sirius City wurde für den Deutschen Science-Fiction-Preis des Jahres 2021 nominiert.
Inhalt
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
TEIL 1 XIÈ SHÚFĀN
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
TEIL 2 XÚ BĂILÓNG
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
EPILOG
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
DANKSAGUNG
PROLOG
1
»Wegen der Höhe Ihres Gehalts brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich verspreche Ihnen, Sie werden vollauf zufrieden sein.«
Die junge Frau im Bildschirmfenster zauberte mit einem Lächeln Grübchen in ihr Gesicht. Das locker herabfallende schwarze Haar bildete zusammen mit den dunklen Augen und den grellrot geschminkten Lippen einen starken Kontrast zu ihrem blassen, schmalen Gesicht. Sie sah vollkommen anders aus als die chinesischen Nachrichtensprecherinnen, wenn sie ihre Propagandabotschaften über der Menschheit ausschütteten. Sū Yànméi hieß sie, wie Jesper von der neben dem Kamerabild eingeblendeten elektronischen Visitenkarte ablas. Ihr Englisch war nahezu akzentfrei, soweit er das beurteilen konnte.
»Außerdem gibt es in China seit achtzehn Jahren keine Einkommensteuer und keine Sozialabgaben mehr, wie Ihnen möglicherweise bekannt ist.«
Sie schien ihm direkt in die Augen zu sehen. Entweder hatte sie sich angewöhnt, stets die Kameralinse zu fixieren, oder sie saß einer 3D-Kamera gegenüber, die ihre Blickrichtung anpasste, damit dieser Eindruck entstand. War sie überhaupt echt? Ihr Bild konnte ebenso gut ein Avatar sein, der Gestik, Mimik, Ausdrucksweise und Betonung von Jespers wahrer Gesprächspartnerin nachahmte. Vielleicht saß am anderen Ende der Leitung auch gar keine junge Frau, sondern ein ergrauter Botschaftsangestellter, dem ein Stück Software ein ansprechenderes Äußeres und eine dazu passende Stimme verlieh. Oder redete er gar seit zehn Minuten mit einer KI, ohne es zu merken? So etwas war den Chinesen zuzutrauen. Doch was spielte das für eine Rolle? Für ihn ging es hauptsächlich darum, nach der Einstellung des Human Brain Projects, dem sich Norwegen erst vor wenigen Jahren angeschlossen hatte, eine neue Herausforderung zu finden.
»Herr Sandvik?«
»Soweit ich weiß, ist die Leitung verschlüsselt.«
»Wir möchten sichergehen, dass Sie an unserem Angebot interessiert sind, ehe wir Ihnen die genauen Konditionen nennen. Es soll nicht bekannt werden, wie viel uns Ihre Mitarbeit wert ist.«
Seit das Aus für das HBP feststand, hatte Jesper Dutzende von Bewerbungen an Forschungsinstitute und IT-Unternehmen zwischen Fredrikstad und Tromsø geschickt. Einige hatten es nicht für nötig erachtet, ihm eine Absage zu erteilen. Niemand hatte ihn zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Es schmeichelte ihm, auf einmal derart umworben zu werden, wenn auch von unerwarteter Seite.
»Ehrlich gesagt, ich bin von Ihrem Angebot überrascht.«
»Sie brauchen sich nicht sofort zu entscheiden. Es ist verständlich, dass Sie zunächst darüber nachdenken wollen.«
Wieder dieses zauberhafte Lächeln. Es stimmte, dass das HBP in eine Sackgasse geraten war. Die zum Simulieren eines menschlichen Gehirns erforderliche Rechenleistung war um Größenordnungen höher als diejenige, die gegenwärtig zur Verfügung stand. Ein Ausbau des Superrechners hier an der Technischen Universität Trondheim, der mit billigem Strom aus Wasserkraft betrieben und vom Europäischen Nordmeer gekühlt wurde, wäre kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein die Quantencomputer-Technologie hätte einen Ausweg geboten. Doch als sich abzeichnete, dass weder Europa noch die USA in absehbarer Zeit brauchbare Quantencomputer bauen würden, hatte die EU die Reißleine gezogen – fünf Jahre nachdem die Amerikaner ihrer BRAIN Initiative den Todesstoß versetzt und die im Projekt gebundene Rechenleistung anderen Zwecken zugeführt hatten.
Und nun kamen ausgerechnet die Chinesen auf ihn zu. Ihre Quantencomputer, so hieß es, würden klassische Superrechner auf einer wachsenden Zahl von Anwendungsgebieten verdrängen. Ärgerlicherweise behielten sie diese Schlüsseltechnologie für sich. Kein chinesischer Quantencomputer war jemals über die Landesgrenzen gebracht worden. Sie waren auch nicht bereit, die gewaltige Rechenleistung der Quantencomputer für wissenschaftliche Zwecke wie die des HBP zu vermieten. Von Patenten hielten sie traditionell nichts. Statt Lizenzgebühren einzustreichen, erklärten sie ihre Forschungsergebnisse zu Staatsgeheimnissen und verhängten Exportverbote.
Aufgrund ihres technologischen Vorsprungs besaßen chinesische Unternehmen uneinholbare Wettbewerbsvorteile. Mithilfe von Quantencomputern trieben sie die Leistung künstlicher Intelligenzen in bislang unerreichte Dimensionen. Dabei ging es nicht bloß um Klima- und Wettersimulationen, um Dolmetscher- und Übersetzerdienste oder um Überwachungsmaßnahmen. Sobald die Chinesen begannen, ihren KIs Kreativität zu verleihen und sie für Forschungsvorhaben einzusetzen, konnten die Wissenschaftler im Rest der Welt einpacken. Die Situation war so, als ob ein Marathonläufer unterwegs in einen Rennwagen umsteigen und den anderen Läufern davonbrausen würde, ohne disqualifiziert zu werden.
Die westliche KI-Forschung hinkte der chinesischen gleichfalls um Jahre hinterher. Lediglich auf dem Gebiet der Gehirnforschung waren Europa und die USA dank des HBP und der BRAIN Initiative führend. Aber das nur, weil die Chinesen daran kein Interesse zu haben schienen. Zumindest war Jesper davon nichts bekannt.
»Wie sind Sie auf mich gekommen?«, wollte er wissen.
»Selbstverständlich haben wir andere Kandidaten ebenso ins Auge gefasst. Aber wir sind überzeugt, dass gerade Sie die Simulation eines menschlichen Gehirns auf einem unserer Quantencomputer entscheidend voranbringen können.«
Offenbar hatten die Chinesen erfahren, dass er derjenige war, von dem die Quantenalgorithmen für die Simulation neuronaler Netzwerke stammten. In den Veröffentlichungen von Professor Ødegård hatte sein Name nie an erster Stelle gestanden. Nun gut, er hatte die Artikel ja auch nicht verfasst. Er hasste es, seine Algorithmen haarklein dokumentieren zu müssen. Was konnte er schon dafür, dass niemand seinen Erklärungen folgen konnte? Ødegård hatte sich immerhin bemüht, seine Gedankengänge nachzuvollziehen.
Der leistungsfähigste Quantencomputer, mit dem er bisher hatte arbeiten dürfen, hatte gut zwei Millionen Qubits gehabt. Das hatte ausgereicht, um dreiunddreißigtausend kortikale Säulen parallel in Echtzeit zu simulieren. Sinnvolle Tests waren allerdings nicht möglich gewesen, weil die Kohärenz trotz Fehlerkorrektur spätestens nach sechzig Millisekunden zusammengebrochen war. Es war eben bloß ein Prototyp gewesen. Der klassische Superrechner in Trondheim schaffte in Echtzeit zweitausendfünfhundert kortikale Säulen. Um vollständige Gehirnareale auf ihm zu simulieren, musste man die Echtzeit-Forderung fallenlassen.
»Wie viele Qubits haben aktuelle chinesische Quantencomputer?«
Sū Yànméis Augenlider flatterten. »Qubits? Das sind diese Einheiten, mit denen die Leistung von Quantencomputern gemessen wird, nicht wahr?«
»Ja.« Ganz richtig war das nicht, aber wenigstens kannte sie den Begriff.
»Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich auf solche Informationen zugreifen darf. Ich weiß nur, dass ein moderner Quantencomputer genug Rechenleistung für die Simulation eines menschlichen Gehirns bereitstellt.«
Eine interessante Aussage. Ließ sich die benötigte Rechenleistung tatsächlich abschätzen? Oder waren die chinesischen Quantencomputer so leistungsstark, dass sich die Frage gar nicht stellte? Nach der Kohärenzzeit brauchte er seine Gesprächspartnerin nicht zu fragen. Von Konstruktionsdetails und Algorithmen dürfte sie erst recht nichts verstehen.
In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder versucht, mehr über die chinesischen Quantencomputer herauszubekommen. Doch die Chinesen hielten alles unter Verschluss. Sich an den Firewalls vorbei ins Zhōngguówăng – die chinesische Variante des Internets – und weiter zu den interessanten Informationsquellen zu hacken, hatte er irgendwann aufgegeben. Er wusste ohnehin wenig darüber, was in China vor sich ging.
»China möchte also in die Gehirnforschung einsteigen«, fasste er zusammen. »Und die Erkenntnisse des Human Brain Projects sollen dafür die Grundlage bilden.«
»Fänden Sie es nicht auch bedauerlich, wenn diese Erkenntnisse ungenutzt blieben?« Sie neigte den Kopf zur Seite und deutete ein Lächeln an. »Bei uns könnten Sie sich gänzlich auf die Forschung konzentrieren. Sie brauchten nicht wochenlang auf die Genehmigung eines Antrags auf Überlassung eines Quantencomputer-Prototyps oder auf eine neue Tastatur zu warten. Alles, was Sie brauchen, wird unverzüglich beschafft.«
Woher wusste sie von der Tastatur-Geschichte? Jesper hatte volle zwei Wochen mit einer Tastatur arbeiten müssen, bei der die Kappe der Escape-Taste abgebrochen war. Das sei nicht weiter schlimm, hatte Professor Ødegård behauptet und ihm gezeigt, wie er die Taste mit einer Büroklammer betätigen konnte. Für die Textverarbeitung brauchte man die Escape-Taste selten oder gar nicht. Doch im Programm-Editor und beim Debuggen war sie unverzichtbar. Hätte der IT-Fuzzi nicht sein Veto eingelegt, hätte Jesper eine neue Tastatur auf eigene Rechnung gekauft. Damals hatte er kurz davor gestanden, seinen Job hinzuschmeißen.
Der Einstieg der Chinesen in die Gehirnforschung ergab durchaus einen Sinn. Dank der Quantencomputer würde dieses Forschungsgebiet in einigen Jahren verwertbare Ergebnisse liefern. Jetzt, da die Vorarbeit geleistet war und zahlreiche hochkarätige Wissenschaftler auf der Straße standen, bot sich eine einzigartige Gelegenheit. Die Chinesen brauchten lediglich dort weiterzumachen, wo die Europäer und vor ihnen die Amerikaner aufgegeben hatten. Es würde ein Wissenstransfer gigantischen Ausmaßes erfolgen. So wie vor zwölf Jahren, als es China gelungen war, westliche Wissenschaftler auf dem Gebiet der Quantencomputer-Forschung anzuwerben. Zumindest wurde das von den Managern der betroffenen Technologieunternehmen und den ihnen hörigen Politikern stets so dargestellt.
»Werde ich über einen Quantencomputer verfügen können?«
»Für Ihre Arbeit erhalten Sie Zugriff auf einen unserer modernsten Quantencomputer. Sie teilen ihn mit den Mitgliedern des Teams, das Sie leiten werden. Allein die Tatsache, dass die Partei der Gehirnforschung Priorität einräumt, bedeutet, dass es weder an Personal noch an finanziellen Mitteln fehlen wird.«
Es klang zu schön, um wahr zu sein. Ein eigenes Team, ein chinesischer Quantencomputer mit wer weiß wie vielen Millionen Qubits, Forschungsgeld ohne Ende. Dafür wäre er sogar bereit, nach Sibirien oder in die Antarktis auszuwandern.
»Darf ich als Norweger überhaupt in China arbeiten?«
»Sie erhalten ein unbeschränktes Visum samt Arbeitserlaubnis. Wir besorgen Ihnen das Flugticket und organisieren den Transport Ihres Hausrats an den Arbeitsort. Sofern Sie es wünschen, erledigen wir auch die Formalitäten mit den norwegischen Behörden.«
Es war erst drei Jahre her, dass er auf Mettes Drängen hin aus seiner Studentenbude ausgezogen war. Richtig heimisch hatte er sich in der neuen Wohnung nie gefühlt. Er blickte sich um. Wozu brauchte er drei Zimmer, wo er sich zu jedem Zeitpunkt nur in einem davon aufhalten konnte? Wenigstens musste er die Hantelbank nach dem Training nicht mehr hochkant stellen, und die Rudermaschine konnte ständig an ihrem Platz bleiben. Seit seinem Einzug standen halb ausgepackte Kartons herum. Mette hatte ihm mehrmals angeboten, aufzuräumen und sich um die Einrichtung zu kümmern, zusammen mit ihm Möbel auszusuchen und aufzustellen. Doch das wollte er nicht. Es war seine Wohnung.
»Was ist mit meiner Freundin?«
Sū Yànméi zögerte einen Augenblick. Wusste sie nicht, dass er eine Freundin hatte?
»Sie wird ebenfalls ein Visum erhalten«, sagte sie schließlich.
Mette würde ihn bestimmt nicht nach China begleiten. Wann immer etwas über das Land in den Nachrichten kam, ließ sie kein gutes Haar an den Chinesen. Sie warf ihnen Streben nach der Weltherrschaft vor und teilte die üblichen Neidkomplexe wegen ihrer wirtschaftlichen und politischen Erfolge.
Er würde Mette nicht vermissen. Im Gegenteil, er war die ständigen Diskussionen leid. Jeden Abend wollte sie ausgehen, verlangte nach Ablenkung und Unterhaltung, statt sich einfach mit dem Pad aufs Sofa zurückzuziehen. Ein Umzug ins ferne Ausland böte ihm die Gelegenheit, sie loszuwerden. Anderswo gab es auch schöne Frauen. Auf dem Bildschirm konnte er sehen, was er bisher verpasst hatte.
»Steht bereits fest, wo ich arbeiten werde?«
»Das Institut befindet sich an der Tsinghua-Universität in Peking. Eine großzügig geschnittene und komplett eingerichtete Wohnung steht Ihnen auf dem Campus unentgeltlich zur Verfügung. Die Wohnung wird täglich geputzt und der Kühlschrank nach Ihren Wünschen aufgefüllt. Für die Verpflegung und die Gesundheitsversorgung brauchen Sie ebenfalls nicht aufzukommen.«
Die Tsinghua-Universität galt als eine der angesehensten Universitäten des Landes. Er hatte eher mit Shēnzhèn oder einem anderen Technologiezentrum anstelle von Peking gerechnet, aber es ging ja nicht um Technik, sondern um ein Forschungsprojekt.
Er räusperte sich. »Wohin soll meine Bewerbung gehen? Um es vorwegzunehmen, ich habe seit meinem Abschluss durchgängig beim HBP in Trondheim gearbeitet. Im Wesentlichen habe ich Algorithmen und Programmiertechniken für Quantencomputer entwickelt.«
Dass er öfter mit Simulationen als mit echten Quantencomputern experimentiert hatte, behielt er für sich. Er kannte Gerüchte, dass sich die chinesischen Quantencomputer einfacher und direkter programmieren ließen als die europäischen Prototypen.
»Ihr Werdegang ist uns bekannt.« Wieder zeigte Sū Yànméi ihre Grübchen. »Alles, was wir uns zum jetzigen Zeitpunkt erhoffen, ist Ihr grundsätzliches Interesse. Ich würde Ihnen dann umgehend einen Vertrag zukommen lassen, aus dem sämtliche Details hervorgehen. Und ein NDA, versteht sich.«
»Ein NDA?«
»Heißt das nicht so bei Ihnen? Ein Non-Disclosure Agreement. Darin verpflichten Sie sich, alles für sich zu behalten, was Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit erfahren. Vor allem die Forschungsergebnisse, aber auch so banale Dinge wie die Namen Ihrer Mitarbeiter und Kollegen. Geheimhaltung wird bei uns großgeschrieben.«
Jesper war wenig begeistert, sich durch Dutzende Seiten juristischen Kauderwelschs hindurchbeißen zu müssen. Sollte er einen Anwalt bitten, den Vertrag zu prüfen?
Sū Yànméi musste seine Gedanken erraten haben. »Es sind zusammen bloß rund zweitausend Wörter. Sie erhalten eine englischsprachige Fassung und, falls Sie es wünschen, zusätzlich eine auf Norwegisch.«
»Englisch ist in Ordnung.«
Im Institut wurden alle Dokumente auf Englisch verfasst. An Besprechungen nahm fast immer jemand teil, der kein Norwegisch beherrschte. In Fachgesprächen unter ausschließlich norwegischen Kollegen blieb man aus Gewohnheit bei Englisch. Jesper hatte des Öfteren festgestellt, dass es zu manchen Fachausdrücken überhaupt keine norwegischen Wörter gab.
»Kann ich Ihnen weitere Fragen beantworten?«
Jesper tat so, als müsse er überlegen. Eigentlich hatte er sich längst entschieden.
2
»Ich hatte gehofft, es mir zwei Wochen lang gut gehen lassen zu können, bevor ich abfliege. In China werde ich nur zehn Tage Urlaub im ganzen Jahr bekommen.«
Spät aufstehen, am Strand liegen und sich im Rhythmus der Brandung verlieren. Nach einem Imbiss und einem Mittagsschlaf ein paar Stunden auf dem hoteleigenen Golfplatz, schließlich ein ausgedehntes Abendessen und zum Abschluss des Tages zwei oder drei Gläser Wein in einer kleinen Bar. So hatte Craig sich seinen Urlaub vorgestellt.
»Ich bin überzeugt, dass Sie sich das verdient haben. An Ihrer Stelle würde ich es genauso machen.«
Der etwa fünfzigjährige Mann mit den kantigen Zügen und den intensiven, dunkelblauen Augen beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf den Oberschenkeln ab. Craig hatte ihm den Sessel überlassen, während er selbst auf dem Hotelbett Platz genommen hatte. In zwei Gläsern auf dem Schreibtisch neben dem Sessel und auf dem Nachttisch sprudelte Mineralwasser aus der Minibar. Keiner von ihnen hatte bisher einen Schluck getrunken.
»Sie haben nun einmal ein ungewöhnliches Angebot angenommen«, fuhr Neil Dromsky fort. Mit diesem Namen hatte sich der Mann zumindest vorgestellt.
»Was geschieht, wenn die Chinesen herausbekommen, dass die NSA Kontakt mit mir aufgenommen hat?«
»Das ist eine berechtigte Frage. Aber glauben Sie mir, wir verstehen etwas von unserer Arbeit. Die Chinesen werden von diesem Gespräch nichts erfahren.«
Craig erwartete, dass sein Besucher ihm mehr darüber erzählen würde. Wie seine Kollegen das Hotelzimmer vor Craigs Ankunft tagelang nach Abhörvorrichtungen durchsucht hatten, dass sie die benachbarten Zimmer reserviert hatten und wie sie seine Beschatter ausgetrickst hatten. Doch Dromsky schwieg.
»Also gut«, sagte Craig. »Was wollen Sie wissen?«
»Wir wissen bereits alles. Wir kennen Details aus Ihrem Lebenslauf, die Sie längst vergessen haben. Wir verfügen über die Konstruktionspläne der Hardware und den Quellcode der Steuerungssoftware der drei Gehirnscanner, die Sie in Stanford und später für EternalLife.com gebaut haben. Wir wissen, an welchem Tag Ihre Frau die Scheidung eingereicht hat, wie viele Quadratmeter Ihr Schlafzimmer misst und wann Ihre Schwester Ihre Eltern zuletzt in der Seniorenresidenz besucht hat.« Dromsky lehnte sich wieder zurück. »Sie waren in diesem Jahr insgesamt achtzehn Mal auf dem Golfplatz und haben dreihundertsiebzehn QSOs geführt, davon fünfundzwanzig mit ausländischen Funkamateuren. Rechnen Sie damit, dass die Chinesen das auch alles wissen.«
Craig versuchte, seine Hände unauffällig an der Tagesdecke abzuwischen. »Wollen Sie mich davon abhalten, in Peking ebenfalls einen Gehirnscanner zu bauen?«
Seit der Einstellung der BRAIN Initiative interessierte sich kaum jemand in den USA für diese Maschine, die ein Abbild sämtlicher Neuronen und ihrer Verbindungen erstellen konnte, ohne das Gehirn des Probanden in hauchdünne Scheiben hobeln zu müssen.
Dromsky winkte ab. »Wir können nicht verhindern, dass die Chinesen früher oder später einen Gehirnscanner bauen werden. Sie verfügen über die Technologie, und die Konstruktionspläne haben sie sich längst beschafft. Mit Ihrer Unterstützung dürften sie allerdings schneller vorankommen.«
»Worum geht es dann?«
»Um die chinesischen Quantencomputer.«
»Sie glauben, deren Quantencomputer könnten ein menschliches Gehirn in Echtzeit simulieren?«
»Wir glauben es nicht. Wir wissen es.« Auf Dromskys Stirn bildeten sich feine horizontale Linien. »Wenn Sie für die Chinesen einen Gehirnscanner bauen, werden Sie zwangsläufig mit Quantencomputern in Berührung kommen.«
Craig musste schlucken. Er hätte sich denken können, dass die NSA ihn als Spion rekrutieren wollte. »Sie haben also vor, China das Monopol auf die Quantencomputer-Technologie zu entreißen.«
»Quantencomputer sind die alles entscheidende Schlüsseltechnologie. Schaffen wir es nicht, aufzuholen, wird die Welt eines Tages den Chinesen gehören. Es wird das Gleiche geschehen wie vor zigtausend Jahren, als Homo sapiens im Zuge seiner Verbreitung von Afrika aus alle anderen Angehörigen seiner Gattung verdrängt hat.«
Craig hielt das für übertrieben. Aber er sagte nichts.
»In den letzten beiden Jahrzehnten haben sie kaum noch Ausländer in ihr Kernland gelassen. Nicht einmal Touristen erhalten ein Visum. Und nun holen sie unverhofft mehrere westliche Wissenschaftler ins Land.« Dromsky hob den Zeigefinger. »Wissenschaftler!«, wiederholte er. »Das sind Menschen mit besonderen intellektuellen Fähigkeiten, die es gewohnt sind, Fragen zu stellen, die Augen aufzusperren und die Ohren zu spitzen. Wir können gar nicht anders, als diese Gelegenheit zu nutzen.«
»Soll ich mir etwa eine Mikrokamera implantieren lassen, um damit bei Nacht und Nebel Blaupausen der Konstruktionszeichnungen eines chinesischen Quantencomputers abzufotografieren?«
Dromsky schmunzelte. »So hätte James Bond das gemacht. Jedwede Spionageausrüstung, mit der Sie in die eine oder die andere Richtung die Grenze zu überqueren versuchten, würden die Chinesen aufspüren.« Er schüttelte den Kopf. »Sie müssen ohne technische Hilfsmittel auskommen. Ihre Aufgabe besteht aus zwei Teilen. Erstens sollen Sie Forschungsberichte zur chinesischen Quantencomputer-Technologie auftreiben und zweitens sollen Sie diese Informationen aus China herausbringen.«
In Craigs Vorstellung entstand ein Bild, wie er sich mit hochgeschlagenem Kragen, Sonnenbrille und einem ans Handgelenk geketteten Aktenkoffer durch dichtes Unterholz kämpfte, um über die Grenze nach Vietnam zu gelangen.
Dromsky räusperte sich. »Postsendungen scheiden aus, denn die werden grundsätzlich geöffnet. Internetzugänge gibt es in China nicht. Die Chinesen betreiben ihr eigenes Netz. Die Kabelstränge, die die Grenze überqueren, kann man an einer Hand abzählen. Der gesamte Datenverkehr wird von KIs überwacht. Sobald etwas Verschlüsseltes durch die Leitungen geht, schrillen in Peking die Alarmglocken. Selbst Telefongespräche müssen Sie sich vorab genehmigen lassen.«
»Soll ich mir den Inhalt der Geheimdokumente etwa einprägen und nach meiner Rückkehr alles aufschreiben? Leider habe ich kein fotografisches Gedächtnis.«
»Ich fürchte, Sie werden die Dokumente nicht lesen können. Um nebenbei Chinesisch zu lernen, wird Ihnen die Zeit fehlen. Es würde Jahre dauern, bis Sie in der Lage wären, einfachste Texte ohne Hilfsmittel zu verstehen. Die Übersetzungsprogramme sind wie alle Computer-Anwendungen in das chinesische Überwachungssystem eingebunden.«
»Das hört sich an, als ob Sie von mir erwarten würden, Wunder zu vollbringen.«
»Zumindest werden Sie kreativ sein müssen. Ist das nicht eine Ihrer Stärken?«
Na prima, dachte Craig. Die NSA hatte überhaupt keinen Plan, wie er vorgehen sollte. »Ich bin kein Agent. Ich habe keine Ahnung von Geheimschriften, von Verschlüsselungstechniken und von all den anderen Dingen, die man Ihnen und Ihren Kollegen beibringt. Wie soll ich das hinbekommen?«
»Ihre Unkenntnis muss kein Nachteil sein. Wir haben in Erwägung gezogen, die wenigen Tage bis zu Ihrer Abreise zu nutzen, um Sie in elementaren Techniken zu schulen. Das Risiko, dass die Chinesen Wind davon bekämen, wäre allerdings hoch, ganz abgesehen davon, dass Sie nach einem Crashkurs noch lange kein Meisterspion wären.«
»Bleibt das Problem, die Informationen außer Landes zu schaffen.«
Dromskys Züge entspannten sich. »Sie sind Funkamateur. Für den Bau eines Gehirnscanners brauchen Sie die verschiedensten elektronischen Bauteile. Zweigen Sie einige davon ab und bauen Sie daraus einen Kurzwellensender.«
»Einen Kurzwellensender? Das klingt nun wieder ganz nach James Bond.«
»Umso weniger werden die Chinesen damit rechnen. Nur auf Kurzwelle ist die erforderliche Reichweite zu erzielen. Satellitenfunk kommt nicht in Betracht, weil der Sender zu kompliziert wäre.«
Einen Kurzwellensender zu bauen, war eine Kleinigkeit. Craig erstellte in Gedanken eine Bauteileliste. Darin gab es nichts, was er den drei Gehirnscannern, die er bisher konstruiert hatte, nicht hätte entnehmen können. Als Antenne würde er ein paar Meter Kupferdraht auf einem Gebäudedach aufspannen müssen. Doch dann besann er sich.
»Nein, das geht nicht. Ich bin sicher, die Chinesen scannen den Funkverkehr auf allen Bändern. Sie würden meinen Sender binnen Minuten orten.«
»Nicht auf 9.860 Kilohertz. Diese Frequenz benutzt eine Station von Radio Free Asia, deren Raumwelle in Peking und Umgebung gut zu empfangen ist. Wenn Sie Ihre Antenne so zwischen Gebäuden aufspannen, dass die Bodenwelle in allen Richtungen genügend stark gedämpft wird, kann selbst die empfindlichste Empfangsanlage sie nicht aufnehmen. Und das an der Ionosphäre reflektierte Signal lässt sich nicht orten.«
Craig überlegte. »Ich vermute, die NSA verfügt über eine Empfangsanlage, die in der toten Zone des Senders von Radio Free Asia liegt.« Die tote Zone umfasste den Entfernungsbereich um einen Sender, in dem die Bodenwelle nicht mehr, die Raumwelle wegen des zu steilen Einfallswinkels in Bezug auf die Ionosphäre aber noch nicht zu empfangen war. In dieser Zone ließ sich die Raumwelle einer relativ schwachen Station, die auf der gleichen Frequenz von einem weiter entfernten Standort sendete, normalerweise gut empfangen.
Dromsky grinste. »Zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens werden die Ausbreitungsbedingungen in den kommenden Monaten stabil sein. Ich habe mir sagen lassen, das liege an der Jahreszeit und an den Sonnenflecken.«
»Wo befindet sich Ihre Empfangsanlage?«
»Richten Sie die Antenne nach Südosten aus und gehen Sie davon aus, dass wir Ihr Signal empfangen können. Zwei Watt Sendeleistung genügen, um Morsezeichen zu übermitteln.«
»Sie wollen, dass ich in CW sende?« Craig stellte sich vor, wie er in der Besenkammer eines Penthauses auf dem Boden hockte und im Schein einer Taschenlampe den Text eines Geheimdokuments telegrafierte.
»Die Dokumente dürften in Chinesisch verfasst sein. Man kann chinesische Zeichen aber in lateinische Buchstaben transkribieren. Morsezeichen sind überdies besser aufzunehmen als Sprache. Außerdem umgehen Sie das Risiko, dass die Chinesen Ihre Stimme identifizieren, falls sie das Signal wider Erwarten doch auffangen.«
Daran wollte Craig lieber nicht denken. »Könnte man die Texte nicht auf digitalem Weg senden, unter Benutzung einer einfachen Modulation? Ich würde Stunden brauchen, um einen längeren Forschungsbericht zu morsen.«
»Unsere Physiker haben mir versichert, dass ihnen Übersichtsartikel genügen, um die Grundlagen der chinesischen Quantencomputer-Technologie zu verstehen. Außerdem müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen die Texte gar nicht in digitaler Form vorliegen. Und selbst wenn, könnte die Schnittstelle zu einem einfachen Kurzwellensender ziemlich kompliziert werden.«
Craig war erleichtert. Übersichtsartikel enthielten zudem selten mathematische Formeln, die schwer in Morsecode zu übertragen waren.
»Sie wissen bestimmt, dass Amateurfunk in China verboten ist«, fuhr Dromsky fort. »Deshalb dürfen Sie sich beim Bau des Senders keinesfalls erwischen lassen. Sie als Amerikaner dürften unter besonders intensiver Überwachung stehen. Notfalls müssen Sie Kameras abkleben oder zuhängen, um eine Zeitlang unbeobachtet zu sein. Die genauen Bedingungen vor Ort kennen wir zwar nicht, aber wir sind überzeugt, dass Sie nach ein paar Wochen Aufenthalt wissen, wo sich Kameras befinden und welche Bereiche sie abdecken.«
Hoffentlich, dachte Craig.
»Natürlich dürfen Ihre Überwacher, gleich ob es sich um Menschen oder um KIs handelt, nicht misstrauisch werden.
In jedem Fall sollten Sie sich gute Ausreden zurechtlegen. Halten Sie sich an alle Regeln, äußern Sie niemals Kritik am System und geben Sie vor, sich mit der Verletzung Ihrer Privatsphäre abzufinden.«
»Ich habe gehört, in China müsse man ständig eine Art Google-Brille tragen.«
Dromsky nickte. »Diese Brille heißt Zhìnéngyănjìng oder kurz Yănjìng. Es handelt sich um ein äußerst praktisches Kommunikationsgerät. Sie haben gewissermaßen ständig einen Bildschirm vor Augen, der Informationen aller Art in Ihr Blickfeld einblendet. Allerdings dürfen Sie die eingebauten Kameras und Mikrofone nie vergessen.«
»Bei der Suche nach Geheimdokumenten und beim Bau eines Kurzwellensenders muss ich die Yănjìng also absetzen.« In der Nähe konnte Craig auch ohne Brille gut genug sehen.
»Genau. Damit es in kritischen Momenten nicht auffällt, gewöhnen Sie sich am besten an, die Yănjìng nicht nur im Bett und unter der Dusche abzusetzen. Falls Sie nach dem Grund gefragt werden, können Sie behaupten, die ständigen Einblendungen irritierten Sie oder die Yănjìng drücke auf der Nase.«
Detaillierte Pläne würde er ohnehin erst in Peking schmieden können. Und sofern er nicht genügend Freiräume bekam, konnte er seinen Spionageauftrag eben nicht erfüllen.
Craig langte nach dem Wasserglas auf dem Nachttisch und nahm einen kräftigen Schluck. »Wer sind eigentlich die anderen Wissenschaftler, von denen Sie gesprochen haben? Ich kenne keinen meiner Kollegen, der ein ähnliches Angebot erhalten hätte.«
»Die Chinesen haben ausgewählte Spezialisten aus der zweiten Reihe des Wissenschaftsbetriebes angeheuert, die in der Fachwelt eher unbekannt sind. Vorwiegend Einzelgänger, die wenig Drang verspüren, den Kontakt zur Heimat aufrechtzuerhalten.«
»Ich bin kein Einzelgänger«, protestierte Craig.
»Sie sind geschieden. Sie haben keine Kinder, und Ihre Eltern sind versorgt. Sie haben sie und Ihre Schwester in den letzten drei Jahren ein einziges Mal besucht. Ihr Bekanntenkreis besteht aus einigen Kollegen und vier Golfern.«
»Und meine Funkfreunde?«
»Es gibt bloß einen, mit dem Sie sich bis zu seinem Fortzug nach Kentucky zweimal getroffen haben. Das letzte Treffen fand vor anderthalb Jahren statt.« Dromsky blickte ihm tief in die Augen. »Nennen Sie mir die Vornamen von dreien Ihrer Nachbarn.«
Dieser Bursche wusste wirklich alles über ihn.
Craig winkte ab. »Sie haben gewonnen. Ich bin wohl doch ein Einzelgänger.«
In Dromskys Miene war keine Spur eines Triumphs zu erkennen. »Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Mitarbeiter und Kollegen – Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und so weiter – fast ausnahmslos Chinesen sein werden. Nur die Älteren unter ihnen werden ein paar Brocken Englisch verstehen.«
Tatsächlich hatte man ihm einen umfangreichen Mitarbeiterstab versprochen. »Um mich mit ihnen zu verständigen, brauche ich also diese Yănjìng«, stellte Craig fest.
»Die Dolmetscher-Funktion der Yănjìng ist ausgezeichnet.«
»Ich dachte, gebildete Chinesen beherrschen in der Regel Englisch.«
Dromsky schüttelte den Kopf. »Sie begegnen kaum noch Ausländern. Früher war Englisch die Sprache der Wissenschaft. Aber seit China auf nahezu allen Gebieten die Technologieführerschaft übernommen hat, gibt es für chinesische Wissenschaftler keinen Grund mehr, westliche Fachpublikationen zu studieren.«
»Davon habe ich gehört.«
»Die chinesische Führung instrumentalisiert die Sprache nicht allein, um ethnische Minderheiten zu assimilieren, sondern vor allem, um sich vom Ausland abzuschotten. Je weniger Chinesen Fremdsprachen beherrschen und je weniger Ausländer Chinesisch sprechen, desto weniger fremdes Gedankengut kann die Bevölkerung aufnehmen. Inzwischen ist sie immun gegen ausländische Einflüsse.«
»Sie können sich somit erlauben, mich und andere Wissenschaftler ins Land zu holen«, sagte Craig.
»Richtig. Seien Sie im Übrigen darauf vorbereitet, dass Ihre Grundrechte in China eingeschränkt sind. Sie können sich auf nichts von dem berufen, was Sie als amerikanischer Staatsbürger gewohnt sind. Falls nötig, werden wir Sie nach Ihrer Rückkehr in ein Schutzprogramm aufnehmen. Damit brauchen Sie …«
Dromskys Smartwatch summte. Er warf einen Blick darauf und erhob sich im selben Augenblick. »Ich muss gehen.« Er nahm sein Glas und trank es in einem Zug leer. Aus seiner Hosentasche fischte er ein Mikrofasertuch und putzte das Glas damit von innen und von außen ab. Ohne es mit den Fingern zu berühren, stellte er das Glas kopfüber auf das kleine Tablett zurück, exakt so, wie es zuvor dort gestanden hatte. Craig bewunderte die geschmeidigen und routinierten Bewegungen des NSA-Agenten.
»Wir haben alles besprochen. Ich gehe davon aus, dass wir auf Sie zählen können. Möglicherweise kann ich nicht riskieren, Sie vor Ihrer Abreise noch einmal zu kontaktieren.«
Dromsky öffnete die Tür einen Spalt breit und lugte in den Flur, wobei er wie beiläufig den Türgriff mit seinem Tuch abwischte. Craig konnte sich nicht entsinnen, dass er irgendetwas anderes berührt hätte.
»Stellen Sie bitte die Lüftung zehn Minuten lang auf volle Leistung. Viel Glück.« Dromsky glitt nach draußen und schloss lautlos die Tür hinter sich.
Craig ging zur Klimaanlage hinüber und kam Dromskys Wunsch nach. Niemand sollte erschnuppern können, dass er Besuch gehabt hatte. Er erinnerte sich an den Jungen vom Zimmerservice, der ihm gestern Abend ein letztes Glas Rotwein gebracht hatte: kurze, schwarze Haare, hohe Wangenknochen und eine breite Nase. Könnte er vom chinesischen Geheimdienst …? Craig verwarf den Gedanken. Paranoia nannte man so etwas.
Es wäre bestimmt eine gute Idee, sich in den verbleibenden zwei Wochen ein wenig über Quantencomputer zu informieren. Er wusste ja nicht, wie viel Zeit ihm in China dafür bleiben würde. Dass sich ein Ingenieur für aktuelle Technik interessierte, würde sein neuer Arbeitgeber kaum verdächtig finden.
3
»Es ist bloß für ein paar Jahre. Danach entscheide ich mich, ob ich nach Sankt Petersburg zurückkehre oder irgendwo anders hingehe. Ich habe jedenfalls nicht vor, den Rest meines Lebens in China zu verbringen.« Valentina spürte, wie ihr Jelena auf die Nerven ging. Wenigstens ihre einzige Freundin könnte sie doch zu diesem Schritt ermuntern. Es dürfte für lange Zeit das letzte Mal sein, dass sie in ihrem Stammcafé beisammensaßen.
»Du weißt nicht, wie lange du bleiben wirst?« Jelena flatterte mit den Händen. »In drei Jahren bist du vierzig. Deine biologische Uhr läuft allmählich ab.«
»Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine Kinder bekommen will! Ich bin Wissenschaftlerin. Ich will Krankheiten heilen, auch wenn sie selten sind. Kannst du dir etwa vorstellen, wie ich in der Küche stehe, um einen Mann und eine Schar Kinder zu bekochen? Wie ich ihre Wäsche wasche und bügele und den Kindern bei den Hausaufgaben helfe?«
Jelena antwortete nicht. Versuchte sie allen Ernstes, sich eine Valentina als Ehefrau und Mutter vorzustellen?
»Wer weiß, ob ich jemals wieder einen wie Urmas finden werde.« Valentina schluckte den Kloß in ihrem Hals herunter. Urmas hatte sich sogar erdreistet, ihr aus Tallinn ein Foto dieses Zuckerpüppchens zu schicken, das er vor drei Wochen geheiratet hatte. Sie hatte das Foto ausgedruckt und auf die Oberseite ihres Messerblocks geklebt.
»Du findest schon einen anderen. Wie ich deinen Geschmack kenne, stehen die Aussichten dafür in China allerdings schlecht.«
Damit hatte Jelena ausnahmsweise Recht. Urmas war ein Bär von einem Mann und überdies blond und blauäugig. Andererseits hatte sie fürs Erste genug von Männern. Nicht nur von Urmas, sondern ebenso von ihren Kollegen. Vor allem von Dmitriy, der sich nach Igors Pensionierung auf den Posten des Abteilungsleiters geschleimt hatte. Den Posten, der eigentlich ihr zugestanden hätte, wäre es nach Fachkompetenz statt nach Beliebtheit gegangen.
Weil Urmas immer so gern mit ihren Haaren gespielt hatte, war sie nach der Trennung sofort zu Katinka gerannt und hatte sie abschneiden lassen. Sie strich über die Stoppeln auf ihrem Schädel. Die neue Frisur war gewöhnungsbedürftig, aber sie passte zu ihrer Stimmung. Wehe, Jelena ließ sich zu einer weiteren Bemerkung darüber hinreißen. Alle Arten von Tipps, wie sie ihr Äußeres für Männer anziehender gestalten konnte, durfte sich die Freundin sparen.
»Was meinen denn deine Eltern zu diesen Plänen?«, erkundigte sich Jelena.
Valentina zuckte mit den Schultern. »Die wissen nichts davon.«
Sie hatte sie seit Ewigkeiten nicht besucht. Warum auch? Etwa um sich wieder einmal die Frage anzuhören, wann sie denn nun mit Enkeln rechnen dürften? Für das, was ihre Tochter beruflich machte, hatten sie sich nie interessiert. Als ob im Leben einer Frau heutzutage keine anderen Aufgaben zu erfüllen wären.
»Und überhaupt, die Chinesen bieten erstklassige Forschungsbedingungen. Ich werde ein eigenes Team mit zwei Dutzend Laborantinnen bekommen. Zum Gerätepark gehören drei der modernsten Sequenzierer, die …«
»Aus chinesischer Produktion, versteht sich«, unterbrach sie Jelena.
»Du hast keine Ahnung, was die chinesischen Geräte leisten. Kein Vergleich mit diesem amerikanischen Schrott, der bei uns im Labor herumsteht. Ständig müssen die Dinger nachkalibriert werden. Eins davon verstaubt ungenutzt im Regal, weil die Amerikaner seit dem Beginn des Technologie-Boykotts keine Ersatzteile mehr liefern.«
»Warum habt ihr keine russischen Geräte angeschafft?«
Valentina lachte auf. »Ich habe noch keinen russischen Sequenzierer gesehen, der nicht in den ersten zwei Wochen nach der Inbetriebnahme abgeraucht wäre. Außerdem sind unsere Mittel erst vor Kurzem erneut zusammengestrichen worden. Es reicht gerade für unsere mageren Gehälter. Das Ministerium sieht anscheinend keine Notwendigkeit, weiter an seltenen Krankheiten zu forschen.«
»Und das tun die Chinesen? Soweit ich weiß, sind die in der Forschung auf Effizienz bedacht. Wenn man für eine Billion Rubel ein Medikament gegen eine Krankheit entwickeln kann, an der hunderttausend Menschen leiden, ist das effizienter, als den gleichen Betrag in die Forschung an einer seltenen Krankheit zu investieren.«
»Juvenile ALS gilt auch als seltene Krankheit. Hätte es dagegen vor dreißig Jahren eine Therapie gegeben, wäre zum Beispiel dieser englische Astrophysiker …«
»Stephen Hawking.«
»Richtig. Der hätte geheilt werden können. Und ein paar andere dazu. Diese Krankheit ist äußerst tückisch.«
Jelena winkte ab. »Ich weiß. Du hast mir oft genug davon erzählt. Niemand stellt die Bedeutung der Gentherapie in Frage, die du entwickelt hast.«
Valentinas eigentliches Verdienst bestand nicht darin, eine Genschere konstruiert zu haben, so wie Jelena und viele ihrer anderen Bekannten glaubten. Dafür gab es mittlerweile Standardverfahren. Die Aufgabe, die nach einer Infusion im Blutkreislauf zirkulierende Genschere in die Motoneuronen einzuschleusen, war um Größenordnungen anspruchsvoller gewesen.
»Und diese Billion Rubel. Was, glaubst du, würde unsere Regierung anstellen, wenn ihr unerwartet ein solcher Betrag zusätzlich in die Hände fiele?«
Jelena schwieg.
»Die Chinesen haben Geld ohne Ende. Außerdem haben sie keine Bedenken, sich der Gentechnik zu bedienen, sofern sie einen Nutzen verspricht.«
»Die Gefahren sind nicht zu unterschätzen.«
»Das behaupten alle, die nichts davon verstehen. Findest du es ethisch, jemanden ein Leben lang an einer Erbkrankheit leiden zu lassen, von der du ihn noch vor der Geburt hättest befreien können?«
»Lassen wir das. Du kennst meinen Standpunkt, und ich kenne deinen.« Jelena führte ihre Tasse mit spitzen Fingern zum Mund und trank einen Schluck Kaffee.
Valentina war das recht. Mit Laien ethische Aspekte des eigenen wissenschaftlichen Fachgebiets zu diskutieren, war ihrer Erfahrung nach wenig ergiebig. Sie langte ebenfalls nach ihrer Tasse.
»Wie wirst du dich mit deinen Laborantinnen verständigen?«, wollte Jelena wissen. »Chinesen lernen in der Schule seit Jahrzehnten kein Englisch mehr. Von Russisch ganz zu schweigen.«
»Ich werde jedenfalls kein Chinesisch lernen.«
»Davon würde ich dir ohnehin abraten.«
»Du hast ja mal einen Anfängerkurs besucht.«
»Das ist schon …« Jelena sah zur Decke. »… schon fünfzehn Jahre her. Ich habe die Melodie der Aussprache nie richtig hinbekommen. Dazu diese Schriftzeichen, die sich kaum auseinanderhalten lassen. Und seit China die Grenzen für den Tourismus geschlossen hat, gibt es für mich keinen Grund, weiter Chinesisch zu lernen.«
Valentina blickte aus dem Fenster des Cafés. Menschen mit verkniffenen Gesichtern hasteten durch den Sankt Petersburger Nieselregen, beeilten sich, zurück ins Trockene zu gelangen.
»Alle Chinesen tragen Google-Brillen, in denen Dolmetscher-Applikationen integriert sind«, sagte sie schließlich. »So eine Brille bekomme ich auch.«
»Du weißt, dass China ein Überwachungsstaat ist? Die Brillen haben Kameras und Mikrofone. Beim geringsten Fehlverhalten zieht dir das Sozialkreditsystem Punkte ab. Hast du zu viele Punkte verloren, wird deine persönliche Freiheit eingeschränkt.«
»Ich habe nicht vor, die chinesische Führung zu kritisieren oder rote Ampeln zu missachten. Ich gehe nach China, um dort zu arbeiten. Und zum Thema Überwachungsstaat – wirf mal einen Blick nach draußen. Wie viele Kameras siehst du?«
Jelena sparte sich die Mühe. »In jedem Fall wirst du dich zurückhalten müssen. Ich kenne dich nicht als eine, die Regeln befolgt und ihre Meinung für sich behält.«
»Sofern sie an meiner Arbeit interessiert sind, werden sie mich nicht wegen ein paar Regelverstößen aus dem Land jagen.«
Jelena begann, an dem Keks herumzuknabbern, den sie zusammen mit ihrem Kaffee bekommen hatte. Valentina hatte ihren bereits gegessen. »Was ist das eigentlich für eine seltene Krankheit, an der du forschen sollst?«
»Bronsteen-Parese. Das ist eine Variante von ALS. Bis vor wenigen Jahren galt Bronsteen-Parese noch nicht als eigenständige Krankheit, weil sich die Symptome kaum von denen anderer ALS-Varianten unterscheiden lassen. Die Erkrankten landen zuerst im Rollstuhl, später können sie nicht mehr sprechen und nicht mehr schlucken und das Atmen fällt ihnen schwer.«
»Ich glaube, ich habe davon gehört. Ist das nicht die Krankheit, an der Ludmilla Romanova gestorben ist? Die Titeldarstellerin in Die Totengräberin?«
Valentina nickte. »Und Maksim Wladimirowitsch Gassanenko, ein Grundlagenforscher auf dem Gebiet der DNA-Synthese. Ich bin sicher, er hätte irgendwann den Nobelpreis erhalten.«
»Und gegen diese Krankheit sollst du eine Gentherapie finden?«
»Es geht zunächst darum, die Auslöser zu bestimmen. Dann erst kann entschieden werden, ob eine Gentherapie in Betracht kommt. Parallel dazu forschen die Chinesen an anderen Therapiemöglichkeiten.«
Jelena legte ihre Stirn in Falten. »Da stimmt doch etwas nicht. Die Chinesen würden niemals ausländische Wissenschaftler anheuern, um eine Krankheit zu heilen, von der bloß eine Handvoll Menschen betroffen sind.«
»Willst du damit sagen, der Aufwand lohne sich nicht?«
Jelena verdrehte die Augen, sagte aber nichts.
»Möglicherweise gibt es in China Tausende von Erkrankten. Ich weiß nur, dass viele Kleinkinder betroffen sind. Das ist untypisch für Bronsteen-Parese.« Der Botschaftsvertreter hatte sich Valentina gegenüber am Telefon ziemlich vage geäußert. »Es könnte sein, dass in China Umweltbedingungen herrschen, die den Ausbruch der Krankheit bei Menschen mit einer genetischen Prädisposition begünstigen. Oder die entsprechenden Gendefekte sind unter Chinesen besonders stark verbreitet.«
»Du rechnest also damit, dass die Krankheit in China gar nicht mehr so selten ist.« Jelena strich über ihre Bluse, um die Kekskrümel abzustreifen.
»Wäre in China eine Epidemie ausgebrochen, hätte die Welt das jedenfalls nicht unbedingt erfahren.«
»Trotzdem will mir nicht in den Kopf, warum die Chinesen es nötig haben, eine Ausländerin ins Land zu holen. Sind sie nicht auch in der Medizin führend?«
Valentina schüttelte den Kopf. »Seit sich die Chinesen aus allen internationalen Gremien zurückgezogen haben, liegt der Stand ihrer medizinischen Forschung für uns im Dunkeln. Vielleicht bauen sie ihre Forschungskapazitäten aus, um sich seltenen Krankheiten zuwenden zu können.«
»Westliche Pharmaunternehmen befassen sich jedenfalls nur mit seltenen Krankheiten, wenn sie die Medikamente zu astronomischen Preisen verkaufen können.«
»Pharmaunternehmen müssen Geld verdienen. Viel Geld, denn die Entwicklung eines Medikaments bis zur Zulassung ist irrsinnig aufwändig.«
Valentina sah Jelenas Gesichtsausdruck an, dass sie dagegenhalten wollte. Jelena vertrat die verbreitete Meinung, Pharmaunternehmen plünderten das Gesundheitssystem aus. Das Patentrecht ermögliche es den Unternehmen, Monopolpreise für billig herzustellende, aber unverzichtbare Medikamente zu verlangen.
Doch Jelena schien kein Interesse an einem erneuten Schlagabtausch über dieses Thema zu haben. »Früher hieß es immer, die Chinesen beschäftigten sich nicht mit Alterskrankheiten, weil die Bevölkerung nicht im gleichen Maße überaltert sei wie die anderer Industrieländer. Sie konzentrierten sich stattdessen auf die Erhaltung ihres Arbeitskräftepotenzials.«
»Das dürfte sich geändert haben. Denk an die Mitglieder des Politbüros. Von denen ist keiner unter achtzig.«
»Mithilfe westlicher Experten geht der Aufbau zusätzlicher Forschungskapazitäten schneller, als wenn sie eigene Nachwuchs-Wissenschaftler ausbilden müssten.«
»Ich werde rasch herausfinden, was dahintersteckt. Unsere Regierung hat jedenfalls entschieden, die Mittel drastisch zusammenzustreichen. In der EU und in den USA ist das Gesundheitswesen ohnehin zusammengebrochen.« Die Hälfte von Valentinas Kollegen war entlassen worden. Es war eine Frage der Zeit, bis es auch sie treffen würde. Seit zwei Monaten hatte sie nicht mehr geforscht, sondern lediglich die jüngsten Ergebnisse zusammengetragen und veröffentlicht. Abgesehen von chinesischen Wissenschaftlern hatte vermutlich niemand ihre Forschungsberichte gelesen.
»Ich weiß, es gilt als politisch inkorrekt, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen.« Jelena senkte ihre Stimme. »Aber man kann nicht ständig neue Therapien entwickeln und zugleich allen Bürgern medizinische Versorgung nach dem neuesten Stand versprechen. Die Chinesen haben schon immer ihre Köpfe geschüttelt über das ausufernde westliche Gesundheitswesen.«
»Sofern man keine Zweiklassenmedizin einführen will, bleibt nichts anderes übrig, als die Forschungsanstrengungen herunterzufahren. Genau das geschieht zurzeit bei uns. Das Angebot der Chinesen kommt für mich zum rechten Zeitpunkt.«
Jelena hob erneut ihre Tasse, doch nur um festzustellen, dass sie bereits ausgetrunken hatte. »Bist du übrigens die einzige Wissenschaftlerin, die sie anheuern wollen?«
»Ich kenne keinen meiner Kollegen, auch nicht der ehemaligen, dem Ähnliches angeboten worden wäre. Das schließt nicht aus, dass Wissenschaftler aus anderen Instituten angeworben werden. Es ist unüblich, darüber zu sprechen, ehe die Verhandlungen abgeschlossen sind.«
»In der EU und in den USA dürften zahlreiche Wissenschaftler auf der Straße stehen, die unverzüglich nach China gehen würden, um dort weiterzuforschen.«
»Die wenigsten befassen sich mit Motoneuron-Erkrankungen wie ALS. Auf diesem Gebiet ist unser Institut führend.«
Sie schwiegen eine Weile.
Schließlich fragte Jelena: »Wann geht es eigentlich los? Hast du Zeit, deine Wohnung zu verkaufen?«
»Ich fliege Ende nächster Woche. Die Wohnung behalte ich erst einmal. Ich möchte mir die Möglichkeit der Rückkehr offenhalten.«
»Und wo geht es hin? In China unterscheidet man zwanzig verschiedene Klimazonen, seit Taiwan und die Äußere Mongolei hinzugerechnet werden.«
»Nach Peking. Die medizinischen Institute der Peking-Universität sind landesweit führend, hat man mir gesagt.«
»Wie sieht’s mit dem Gehalt aus?«
Valentina konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Die Chinesen sind äußerst großzügig. Dazu kommt, dass ich nicht für Unterkunft und Verpflegung aufkommen muss. Außerdem gibt es in China keine Einkommensteuer.«
»Keine Einkommensteuer? Irgendwie muss sich der Staat doch finanzieren.«
»Dass die Einkommensteuer in fast allen anderen Ländern der Welt den größten Anteil an den Staatseinnahmen hat, bedeutet nicht, dass es keine Alternativen gibt. Die Chinesen finanzieren ihre Ausgaben inzwischen überwiegend aus Verbrauchsteuern und den Einnahmen der Staatsbetriebe.«
Jelena verzog das Gesicht.
»Dieses Steuersystem scheint der chinesischen Wirtschaft ausgezeichnet zu bekommen«, legte Valentina nach.
Jelenas Skepsis war verständlich. Valentina war selbst tagelang unschlüssig gewesen, ob sie das Angebot annehmen sollte. Manchmal musste man mutige Entscheidungen treffen. Im schlimmsten Fall würde sie in ein oder zwei Jahren mit einem Schatz an Erfahrungen und einem gut gefüllten Bankkonto nach Sankt Petersburg zurückkehren.
4
Torsten hievte seine Reisetasche aus dem Kofferraum. Rail-Cab nannte sich das autonome Schienentaxi, mit dem sie vom Flughafen zum Campus der Tsinghua-Universität gefahren waren. Im Verlauf der knapp einstündigen Fahrt hatte er sich keine Minute gelangweilt. Peking war gigantisch, fremdartig, überwältigend. Städte wie Frankfurt und Berlin waren mit dieser Dreißig-Millionen-Metropole nicht zu vergleichen.
Der Schienenstrang des Rail-Cabs verlief auf Pfeilern über Plätze und Grünanlagen hinweg, überbrückte gelegentlich schmale Gewässer. Die wenigen Stellen, an denen das Rail-Cab ebenerdig fuhr, waren durch transparente Wände abgeschirmt. Ein paar Mal waren sie mitten durch Hochhäuser hindurchgefahren. Je näher sie der Innenstadt gekommen waren, desto öfter kreuzten sich die Schienen, verzweigten sich, boten Überholspuren. Nur eines hatte Torsten nirgends gesehen: Anders als in allen deutschen Städten gab es in Peking keine Autos. Sogar auf den breitesten Straßen fuhren lediglich Fahrräder und Scooter auf von den Fußgängern getrennten Spuren.
In den letzten zehn Minuten hatte Torsten den Eindruck gehabt, durch eine Ausstellung moderner Architektur zu fahren. Manche Gebäude schienen zu schweben oder sich auf andere Weise den Gesetzen der Statik zu widersetzen. Von simplen Quadern hatten sich die chinesischen Architekten offenbar verabschiedet.
Vor allem aber herrschte überall die Ordnung und Sauberkeit einer Hotellobby. Keine einzige Fassade, an der Farbe abblätterte, an der Putz bröckelte oder sich gar ein Riss durch eine Glasscheibe zog. Nirgends klebten Kaugummis auf dem Pflaster, keine Flaschen oder Pappbecher standen herum und kein Abfallbehälter quoll über. Torsten war nicht einmal eine von einer Windböe aufgewirbelte Papiertüte aufgefallen.
Bereits das Gedränge am Flughafen hatte ihn eingeschüchtert. Er war sich vollkommen verloren vorgekommen, als er mit seiner Reisetasche in der Ankunftshalle herumgestanden hatte. Links und rechts, vor und hinter ihm waren Menschen vorbeigelaufen, die allesamt einem Ziel entgegenzustreben schienen. Einige hatten ihn, den Fremdling, verstohlen gemustert. Bis auf Babys und Kleinkinder trug jede und jeder eine Yănjìng. Auf deutschen Straßen war das Tragen solcher Brillen noch immer verpönt. Die Chinesen schienen hingegen keine Probleme damit zu haben, unentwegt im Fokus Dutzender Kameras zu stehen.
Und plötzlich hatte sich diese Märchenprinzessin aus der Menge geschält. Zielstrebig und geschmeidig war sie auf ihn zugesteuert und hatte seinen Blick mit ihrem Lächeln gefesselt. Ihm war unklar, wie sie ihn mit seinen hundertsiebzig Zentimetern in dieser Menschenmasse entdeckt hatte.
»Herr Dr. Pohl, willkommen in Peking!«, hatte sie ihn in sorgfältig artikuliertem Englisch begrüßt. Ihre Hand war warm und so zierlich, dass sie fast gänzlich in seiner eigenen verschwunden war. Stotternd hatte er die Begrüßung erwidert. Sie hatte sich nach dem Flug erkundigt und ihm weitere Fragen gestellt, an die er sich nicht erinnern konnte. Er musste mehr oder weniger einsilbig geantwortet haben. Immerhin hatte er ihren Namen behalten. Sie hatte ihm ausführlich erklärt, warum bei chinesischen Namen der Nachname immer vor dem Vorname stand.
Xiè Shúfān war höchstens Anfang dreißig und nur wenig kleiner als er selbst. Ihre Haut war hell und makellos glatt wie die eines Avatars. Sofern sie sich geschminkt hatte, war nichts davon zu erkennen. Eine beigefarbene Stoffhose und eine schlichte hellblaue Bluse mit mäßigem Ausschnitt betonten ihre Figur, ohne aufreizend zu wirken.
Sie hatte ihn zu einem Ausgang gelotst, an dem Rail-Cabs in einer endlosen Reihe auf Fahrgäste warteten. Alle paar Sekunden fuhr eines der Fahrzeuge ab.
Keine der Erklärungen zu den Gebäuden, Plätzen und Parkanlagen, die Xiè Shúfān unterwegs wie eine Reiseleiterin abgespult hatte, war in seinem Gedächtnis haften geblieben. Er war aus dem Staunen nicht herausgekommen, hatte gemeint zu träumen. Drei- oder viermal war er versucht gewesen, sich ihr zuzuwenden. Doch er hatte es nicht gewagt, weil er fürchtete, von so viel Schönheit und Anmut in seiner unmittelbaren Nähe erschlagen zu werden. Ihrer Stimme zu lauschen, forderte genug Selbstbeherrschung.
Er war geradezu erleichtert, dass sie endlich angekommen waren. Mit einem kaum wahrnehmbaren Summen entfernte sich das Rail-Cab.
»Die Tsinghua-Universität wurde Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet. Von den damaligen Gebäuden steht allerdings keines mehr.« Xiè Shúfān wies auf den von Stahlträgern gestützten Ikosaeder mit verspiegelten dreieckigen Fassadenabschnitten, vor dem sie standen. »Darin befinden sich die Unterkünfte der ausländischen Wissenschaftler. Es sind bloß zwei Minuten zu Fuß bis zum Institut für Gehirnforschung, in dem Sie arbeiten werden. Das Gebäude befindet sich hinter dem Rechenzentrum.« Sie deutete auf einen aus trapezförmigen Blöcken zusammengesetzten Bau mit matt schimmernden Oberflächen in verschiedenen Grautönen.
Der Campus glich einem Park, in den man Gebäude wie Kunstwerke in einem Open-Air-Museum gestellt hatte. Zwischen Rasenflächen, Blumenbeeten, Stauden und einzeln stehenden Bäumen verliefen gepflasterte Fußwege. Vier Frauen in knallbunten Outfits joggten an ihnen vorbei. Rail-Cabs fuhren in beiden Richtungen auf dem den Campus in einem weiten Bogen durchschneidenden Schienenstrang. Zwei Männer in anthrazitfarbenen Uniformen betraten gerade das Rechenzentrum.
»Wo sind die Studenten?« Es war die erste Frage, die Torsten seiner Begleiterin stellte. Heute war zwar Sonntag, aber bei diesem Kaiserwetter hätte er erwartet, dass junge Menschen die Grünflächen belagerten, um dort zu reden, zu lesen oder Musik zu hören.
»Studenten gibt es hier nicht mehr. Die Tsinghua-Universität ist ein Zusammenschluss von fünfunddreißig Forschungsinstituten. Es hat sich herausgestellt, dass sich die besondere Atmosphäre eines Universitätscampus förderlich auf die Arbeit der Wissenschaftler auswirkt.«
Offenbar benutzten die Chinesen den Begriff Universität in einer anderen Weise. Oder sie hatten ihn nach der Umwidmung des Campus lediglich beibehalten.
»Ist das da drüben eine Mensa?« Das Gebäude erinnerte an aufeinandergestapelte, unregelmäßig geformte Platten, die jeweils eine Geschosshöhe dick waren. Auf einigen standen Sonnenschirme und Tische mit Stühlen.
Xiè Shúfān nickte. »Eine Kantine für die Wissenschaftler der umliegenden Institute. Es gibt mehrere große und kleine Kantinen auf dem Campus, die jeweils die Küche einer bestimmten Region anbieten.«
»Ich habe also eine große Auswahl«, stellte Torsten fest. Er freute sich darauf, die echte chinesische Küche kennenzulernen. Die Gerichte des Asia-Imbisses in Jülich, bei dem er eine Zeitlang regelmäßig gegessen hatte, hatten ihm irgendwann zum Hals herausgehangen.
»Sie dürfen selbstverständlich jede Kantine nutzen. Zusätzlich steht Ihnen und Ihren Kollegen eine besondere Kantine im Erdgeschoss Ihrer Unterkunft zur Verfügung. Der Koch erfüllt alle Ihre kulinarischen Wünsche. Sie brauchten nicht einmal auf Pizza zu verzichten, sollten Sie einmal Appetit darauf haben.«
In Jülich hatte er zwei- oder dreimal pro Woche Pizza gegessen. Aber das konnte sie nicht wissen.
»Gibt es einen Arzt auf dem Campus?« Vielleicht kannte man in China ein Mittel gegen seine Akne, das im Gegensatz zu all den Salben und Wässerchen, die er in Deutschland ausprobiert hatte, eine Wirkung zeigte.
»Es gibt alles, was Sie zum Leben brauchen. Neben Ärzten und Apotheken haben wir Sportplätze und -hallen, Schwimmbäder und Wellness-Einrichtungen. Der Campus ist wie eine kleine Stadt.«
»Ich habe keine Geschäfte gesehen.«
Sie blickte ihn ein wenig irritiert an. »Essen und Getränke bekommen Sie in der Kantine oder in kassenlosen Läden. Alles andere bestellen Sie im Zhōngguówăng. Es wird normalerweise binnen weniger Stunden geliefert. Außerhalb des Campus gibt es allenfalls Showrooms, in denen Sie Produkte ansehen und ausprobieren dürfen, bevor Sie sie bestellen. Die Lieferungen erfolgen in der Regel innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch am Folgetag.«
Auch in Jülich verdrängte der Online-Handel die Einzelhändler. In Peking war diese Entwicklung offenbar abgeschlossen.
»Am nächsten Sonntag werde ich Sie und Ihre Kollegen über den Campus führen. Die Woche darauf habe ich einen Ausflug durch Peking geplant. Ich bin überzeugt, Sie wollen Ihre Zeit in China dazu nutzen, etwas von unserem wunderschönen Land zu sehen.«
Torsten wollte seine Zustimmung signalisieren, doch angesichts ihres im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Lächelns brachte er kein Wort heraus. Organisierte Ausflüge mit den neuen Kollegen waren eine gute Idee. In Jülich hatte er mitunter ganze Wochenenden durchgearbeitet, damit ihm in seiner Zweizimmerwohnung nicht die Decke auf den Kopf fiel. Die Wochenenden bei Pizza und Cola durchzuzocken, so wie er es als Student gemacht hatte, reizte ihn seit langem nicht mehr.
»Ich zeige Ihnen jetzt Ihre Unterkunft. Sie möchten gewiss duschen und sich ausruhen.« Sie machte eine einladende Armbewegung in Richtung der Eingangstüren des gläsernen Ikosaeders.
Torsten wusste, dass Wohnraum in chinesischen Metropolen mindestens ebenso knapp war wie in deutschen Großstädten. Die Bilder von Behausungen chinesischer Wanderarbeiter – sechs Mann in mehrstöckigen Betten auf acht Quadratmetern oder so ähnlich – stammten indes aus der Vergangenheit. Er hatte ein Appartement mit Nasszelle und einer Kochnische erwartet. Auf keinen Fall jedoch das, was Xiè Shúfān ihm hier präsentierte.
Das war kein Appartement. Das war eine voll ausgestattete Suite mit separatem Schlafzimmer und einem Wohnraum, dessen Größe die seiner gesamten Wohnung in Jülich übertraf. Das Bad maß mindestens fünfzehn Quadratmeter. Neben einem üppig dimensionierten, ebenerdigen Duschbereich gab es eine freistehende Wanne, in der sich ein Dreizentnermann wohl gefühlt hätte. Föhn, Rasierapparat, elektrische Zahnbürste sowie Dutzende von Seifen, Cremes und Lotionen standen bereit. Das abgetrennte WC war ein mit allen Schikanen moderner Hygiene ausgestattetes Modell. Man wollte ihm den Aufenthalt anscheinend so angenehm wie möglich gestalten.
Die Fensterfront im Wohnzimmer, durch die sich eine schräg verlaufende Kante des Ikosaeders zog, ging auf eine weitläufige Grünanlage hinaus. Die Suite musste sich somit an der dem Eingang entgegengesetzten Seite des Gebäudes befinden.
»Lassen Sie sich bitte nicht von der Aussicht täuschen. Es handelt sich bloß um eine dreidimensionale Projektion. In Wahrheit sieht es draußen so aus.« Xiè Shúfān tippte auf einen in die Wand eingelassenen Bildschirm. Die Aussicht verblasste und verwandelte sich in einen Blick auf den Campus. Torsten wurde schwindlig. Keine zwanzig Meter vom Fenster entfernt ragte ein aus zwei etwa zehngeschossigen Zylindern bestehendes Gebäude auf, hinter dessen Fenstern sich Büroräume und chemische Labore abzeichneten. Unten an der Haltestelle des Rail-Cabs und vor dem Eingang des Ikosaeders hatte er diese Zylinder überhaupt nicht wahrgenommen.
»Sie können sich aus Hunderten verschiedener Panoramen eines aussuchen oder jeden Tag ein anderes wählen. Vom Regenwald über Hochgebirge, Taiga und Flussdelta bis hin zum Ozean ist alles verfügbar.«
»Wie funktioniert das?«
»Auf dem Fenster ist eine Displayfolie aufgebracht, die auch transparent gestellt werden kann. Fragen Sie mich bitte nicht nach technischen Details.« Sie lächelte ihn an, bis Torsten nichts anderes übrig blieb, als wegzusehen.
Er hätte zu gern gewusst, wie der 3D-Effekt zustande kam. Vielleicht begegnete er in Verbindung mit seiner Arbeit einem chinesischen Techniker oder Ingenieur, der es ihm erklären konnte.
»Eigentlich sind Displayfolien überholt«, fuhr Xiè Shúfān fort. »Wer wie die meisten meiner Landsleute seine Yănjìng niemals abnimmt, kann auf Bildschirme aller Art verzichten. Die Bilder werden an der richtigen Stelle und in der passenden Perspektive ins Blickfeld eingeblendet. Nur bei Yănjìngs der ersten Generation kann es passieren, dass das Bild ruckelt.«
Torsten nutzte das Stichwort, um Xiè Shúfāns Yănjìng genauer in Augenschein zu nehmen. Sie sah aus wie eine gewöhnliche randlose Brille, wenn man von den stärkeren Bügeln absah. Wo die Kameras und die Mikrofone saßen, war nicht zu erkennen. Dass seine Begleiterin eine Yănjìng trug, war ihm anfangs nicht einmal aufgefallen. Hätte man ihn gebeten, aus dem Gedächtnis eine Chinesin zu zeichnen, hätte er ihr, ohne nachzudenken, eine Yănjìng verpasst.
»Die Yănjìng ist im Alltag unverzichtbar«, sagte Xiè Shúfān. »Manche tragen sie sogar unter der Dusche.«
»So wie die Smartwatch bei uns.« Er streckte die Linke vor, um ihr seine teure Smartwatch zu zeigen. Sie war ihm beinahe ans Handgelenk gewachsen. Doch verschämt zog er die Hand sofort wieder zurück. Im Vergleich zu einer Yănjìng basierte dieses vermeintliche Wunderwerk japanischer Ingenieurskunst auf Technologie von vorgestern. In China würde er die Smartwatch allenfalls offline benutzen können.
Xiè Shúfān nahm einen weißen, mit chinesischen Schriftzeichen und Piktogrammen verschiedener Größe versehenen Karton vom Sideboard neben der Wohnungstür und öffnete ihn. Fasziniert beobachtete er die geschickten Bewegungen ihrer zerbrechlich wirkenden Finger. In dem Karton befand sich ein mit einer Schnur zusammengehaltener hellgrauer Stoffbeutel. Sie fischte eine Yănjìng daraus hervor, die bis auf die Farbe der Bügel ihrer eigenen glich.
»Das ist Ihre Zhìnéngyănjìng. Weil sie ihren Besitzer anhand der Iris erkennt, kann kein anderer sie benutzen. Sofern sich Ihre Kopfform und Ihre Sehstärke in den letzten Monaten nicht geändert haben, müsste sie passen.«
An hochaufgelöste Aufnahmen seiner Augen zu kommen, dürfte kein Problem gewesen sein. Doch woher kannten sie seine Kopfform? Hatten sie etwa sämtliche Bilder von ihm im Netz zusammengeklaubt und daraus ein dreidimensionales Modell errechnet? Seine Brillenstärke kannten außer ihm nur der Augenarzt und der Optiker, eventuell noch die Krankenkasse und der Hersteller der Brille. Oder konnte man den Schliff der Brillengläser anhand von Fotografien rekonstruieren?
Torsten setzte seine Brille ab und legte sie auf das Sideboard. Xiè Shúfān reichte ihm die Zhìnéngyănjìng.
Mit der Hightech-Brille auf der Nase blickte er sich im Wohnzimmer um, sah nach draußen und schließlich in Xiè Shúfāns Gesicht. Er konnte keinen Unterschied feststellen, außer dass alles ein wenig klarer wirkte. Aber das konnte daran liegen, dass er seine Brille seit dem Abflug in Düsseldorf nicht mehr geputzt hatte.
»Der Bügel drückt auf der rechten Seite.«
»Das haben wir gleich. Wenn Sie erlauben …?« Sie kam einen Schritt auf ihn zu. Intuitiv drehte er den Kopf zur Seite, damit sie den Sitz des Bügels begutachten konnte.
Unter einem dezenten Lavendelaroma kroch ein zart femininer Duft in seine Nase. Seine Arme zuckten, als wollten sie den Körper dieser Frau von allein umschließen.
Nein, das war ausgeschlossen. Er wusste, dass er bei Frauen nicht die Spur einer Chance hatte. Das war immer so gewesen und würde sich niemals ändern.
»Da ist eine gerötete Stelle.« Er spürte ihren Atem an seinem Ohrläppchen.
Na klar. An dieser Stelle wuchs gerade ein Pickel heran, der ihn die nächsten Wochen plagen würde.
Sie murmelte ein paar chinesische Worte. Der Druck hinter seinem Ohr ließ nach.
»Was haben Sie gemacht? War das ein Zauberspruch?«
Xiè Shúfān kicherte. »Meine Yănjìng hat die Stelle vermessen und Ihrer vorgeschlagen, den Bügel zu verstellen. Merken Sie einen Unterschied?«
»Aber ja.« Diese Technik war faszinierend. Wer kam bloß auf solche Ideen? »Was kann die Yănjìng sonst noch?«
»Sie müssen zweimal kurz hintereinander an den linken Bügel klopfen, um die Anzeige einzuschalten«, erklärte sie.
Er folgte ihrer Aufforderung. Einen halben Meter vor ihm erschienen drei gestochen scharfe Textzeilen, so als ob er eine beschriftete Glasplatte vor sich hielte. Die ersten beiden Zeilen zeigten seinen Namen und sein Geburtsdatum. Dunkelgrüne Buchstaben und Ziffern mit einem haarfeinen weißen Rand, die in jeder Umgebung gut zu lesen waren. Darunter stand eine leuchtend rote Zahl in größerer Schrift, die er nicht zuordnen konnte: 11800.
»Sobald Sie blinzeln, wird die Anzeige ausgeblendet. Etwas länger blinzeln bringt die letzte Anzeige zurück. Wenn Sie wissen wollen, wie spät es ist, fragen Sie danach.«
»Wie spät?«, nuschelte Torsten auf Deutsch.
Die eingeblendete Uhr zeigte 11:37 an. Er blinzelte, und die Uhr verschwand, ebenso wie sein Name und sein Geburtsdatum. Lediglich die Zahl 11800 blieb am Rand seines Blickfeldes stehen. Seine Smartwatch bestätigte, dass die angezeigte Uhrzeit stimmte.
»Die Yănjìng stellt Ihnen eine ständige Verbindung ins Zhōngguówăng zur Verfügung. Sie können sich damit identifizieren, Waren und Dienstleistungen bezahlen und sich an jedem Ort in China orientieren, auch innerhalb von Gebäuden. Spielen Sie am besten damit herum. Sie können sich jederzeit die Bedienungsanleitung anzeigen lassen.«
»Auf Chinesisch?«
»Die Yănjìng übersetzt die Schriftzeichen automatisch in Ihre Muttersprache, sobald Sie sie fixieren.«
Torsten blickte auf den Karton, in dem die Yănjìng verpackt gewesen war. Darauf standen nun seine persönlichen Daten in lateinischen Buchstaben, deutsche Hinweise zum Öffnen der Verpackung, die üblichen Warnungen und der Name des Herstellers. Es war verblüffend.
Xiè Shúfān sagte ein paar Worte, die eindeutig chinesisch klangen. Noch ehe sie fertig war, übertönte sie die Stimme einer virtuellen Zwillingsschwester in akzentfreiem Deutsch: »Die Yănjìng ist zugleich Ihr persönlicher Dolmetscher. Wenn Sie Deutsch oder Englisch sprechen, wird dies umgekehrt in Mandarin übertragen. Es wird also keine Verständigungsprobleme mit Ihren Mitarbeitern geben.«
Torsten wusste, dass Mandarin die mit Abstand verbreitetste der in China gesprochenen Sprachen war. Die Schriftzeichen der anderen Sprachen – darunter etwa Kantonesisch – hatten den gleichen Ursprung. Das hatte zur Folge, dass sich Bewohner unterschiedlicher Regionen mitunter schriftlich, nicht aber mündlich verständigen konnten.
»Was ist mit dem Internet?«, fragte er auf Deutsch.
»Das Internet ist in China nicht verfügbar. Sie können mit Freunden und Bekannten in Ihrem Heimatland nur über spezielle Kanäle kommunizieren. Doch dem haben Sie in Ihrem Vertrag ja zugestimmt.« Sie hatte auf Englisch zurückgewechselt, vermutlich weil es praktischer war, nicht nach jedem Satz die Übersetzung abwarten zu müssen.
Torsten hatte keine Freunde, abgesehen von seinen Online-Spielkameraden. Von denen kannte er lediglich die Avatare. Zu seinen Kollegen hatte er nie ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Und mit seinen Eltern hatte er sich nach der Auseinandersetzung auf der Feier zum fünfunddreißigsten Geburtstag seiner Schwester überworfen. Er hatte ihre jahrzehntelange Bevorzugung Selinas gegenüber ihm, dem hässlichen Enterich, nicht länger ertragen können. Von seinem letzten Umzug wussten sie noch nichts.
Er verscheuchte die Gedanken. Nein, es gab keinen Grund, die Verbindungen zu Verwandten oder Bekannten in Deutschland aufrechtzuerhalten. Für Online-Spiele würde ihm die Zeit fehlen. Aber er brauchte Kontakte zu Neurowissenschaftlern aus der ganzen Welt. Es waren Dutzende, mit denen er regelmäßig Nachrichten austauschte. Das Internet war der Schlüssel zu Informationen aller Art, bot Zugang zu Wissenschaftsnachrichten, Forschungsberichten, Blogs und Fachliteratur. Es würde dauern, sich in diesem Zhōngguówăng zurechtzufinden und darin ein neues Netzwerk aufzubauen. Konnte das vergleichsweise junge chinesische Netz mit dem Internet mithalten? Gewiss, die chinesische Wissenschaft insgesamt war der des Westens um Jahre voraus. Doch hätten ihn die Chinesen angeworben, wenn das auch für die Gehirnforschung zuträfe? Würden sie ihn unterbringen wie einen Staatsmann oder einen Wirtschaftsboss?
»Ich bin überzeugt, Sie werden die Vorzüge des Zhōngguówăng gegenüber dem Internet bald zu würdigen wissen. Es hat eine geordnetere Struktur und ist deutlich schneller. Außerdem haben Sie es buchstäblich jederzeit vor Augen.« Xiè Shúfān schmunzelte. »Ich empfehle Ihnen, die Yănjìng nur zum Aufladen abzusetzen. In Ihrem Nachttisch und auf der Konsole im Badezimmer befinden sich Induktionsspulen.
So sind Sie zu jeder Zeit erreichbar und verstehen alles, was Ihre Mitarbeiter sagen. Die meisten von ihnen sprechen allenfalls gebrochen Englisch.«
»Sie sprechen allerdings ausgezeichnet Englisch.«
»Danke.« Sie schien sich über sein Lob ehrlich zu freuen. »Es gehört zu den Anforderungen, die ich als Ihre Betreuerin erfüllen muss. Ich habe drei Jahre in Los Angeles studiert.«
Torsten hob die Augenbrauen. »Welches Fachgebiet?«
»Anglistik und Psychologie.« Sie strahlte ihn an.





























