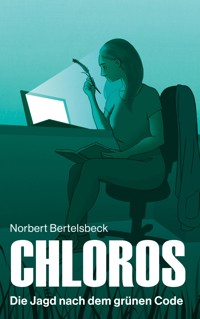
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer fesselnden Erzählung über Wissenschaft, Geheimnisse und Überlebenskampf folgen wir Johanna Reubling, einer ambitionierten Doktorandin, die an der Schwelle einer bahnbrechenden Entdeckung über die elektrische Kommunikation zwischen Queckenpflanzen steht. Ihr Forschungsprojekt auf dem malerischen Plateau des mittleren Eichkopfs wird jedoch jäh durch eine mysteriöse Explosion unterbrochen, die sie ins Koma reißt. Parallel dazu begibt sich Teddy Joulson auf eine wissenschaftliche Mission nach Indien, um den Salzstress bei Weizenpflanzen zu untersuchen. Die Nachricht von Johannas tragischem Unfall und ihrer darauffolgenden Fuß-Amputation erreicht ihn während eines Zwischenstopps in Dubai, und wirft ihn in ein Netz aus Intrigen und Ermittlungen, die weit über das Labor hinausgehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 786
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wichtige Mitwirkende
In Mittelhessen, in der Wetterau und im Taunus
Quecken: Tapfere, neugierige Wildkräuter, in der Landwirtschaft wenig beliebt.
Johanna Reubling: Bei ihrer Forschungsarbeit belauscht sie mit modernsten Methoden die Gespräche zwischen Pflanzen.
Teddy Joulson: Seine Untersuchungen sollen dabei helfen, das Wachstum von Weizenpflanzen umweltschonend zu steuern.
Alexandra „Alex“ Taschenhuber: Die Leiterin des Instituts für Elektrophysiologie der Pflanzen träumt von einer ganz großen Karriere.
Manfred Müller: Hauptkommissar, stationiert in Friedberg.
Jasmin Meier: Kommissarin im Team von Manfred Müller.
Frederic Hinkel: Der Wirbelwind in der Polizeistation. Engagiert und immer wieder mit überraschenden Schlussfolgerungen.
Peter: Sein wirklicher Name wird nicht bekannt. Abteilungsleiter im Landeskriminalamt.
Daniel Sander: Seit einigen Jahren nicht mehr in Gießen, aber seine Vergangenheit holt ihn ein.
In Indien
Amisutra „Amy“ Bhindrawale: Sie untersucht den Wasserhaushalt bei Reis- und Weizenpflanzen. Ihr Ehemann ist
Sanjit Bhindrawale: Geschäftsführer eines Genossenschaftsprojekts in Rajasthan, hervorragend vernetzt mit staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen.
Tom Krishna Bhindrawale: 12-jähriger Sohn von Amisutra und Sanjit Bhindrawale.
Sally: Ein eigenwilliges kleines Raubtier, im richtigen Moment hellwach.
Weizenpflanzen: In manchen Verhaltensweisen den Menschen überraschend ähnlich.
Vikander „Viko“ Singh: Abteilungsleiter an der landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Amritsar.
Wang He: Leiter einer Regierungsdelegation aus dem chinesischen Tourismusministerium.
Zhao Gu: Studentin der Betriebswirtschaft, Tochter eines hohen Parteikaders und wohl nur deshalb Wang Hes Stellvertreterin.
Auf Long Island / Vereinigte Staaten von Amerika
John Prescott: Vizepräsident der 2014 gegründeten Plantareg Corporation, Arbeitsbereiche Sicherheit und Informationstechnologie.
Claudio Monizetti: Mitarbeiter von John Prescott, zuständig in Sicherheitsfragen.
Stephen Randolph: Mitarbeiter von John Prescott, zuständig für Informationstechnologie.
Mary Jean Crayford: Vizepräsidentin der Plantareg Corporation, wissenschaftliche Leiterin im Bereich Landwirtschaft.
Der Eigentümer: Sein Name und sein Aufenthaltsort sind genauso geheim wie seine Ziele.
In Göttingen und im Harz
Richard Meier: Forstwissenschaftler, Bruder von Jasmin Meier.
In Frankreich
Jean-Michel Serrault: Förster im Nationalpark am Mont Blanc.
Inhaltsverzeichnis
Wichtige Mitwirkende
Prolog
Kapitel 01
Kapitel 02
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
Kapitel 09
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Anmerkungen und Dank
Weiterführende Literatur (Auswahl)
Prolog
Donnerstag, 30. Oktober, 22.47 Uhr
Truth Hunters auch in Deutschland?
Auf Forschungseinrichtungen von zwei Universitäten wurden wahrscheinlich nahezu zeitgleich zwei schwere Anschläge verübt. Wie sich erst jetzt herausstellte, wurde ein Gewächshaus in Weihenstephan in der Nacht zum Dienstag nach einem Einbruch mutwillig mit Salzwasser überflutet. Die Getreidepflanzen auf zwei ebenerdig angelegten Versuchsflächen sind vollständig abgestorben, des Weiteren wurden technische Anlagen und Messgeräte so stark beschädigt, dass der Gesamtschaden eine hohe fünfstellige Summe erreichen dürfte. Menschen kamen bei diesem Vorfall nicht zu Schaden.
Weniger glimpflich verlief ein Vorfall auf dem Versuchsgelände einer mittelhessischen Universität im Taunus. Durch zwei schwere Explosionen wurde eine junge Biologin so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber zu einer Notoperation geflogen werden musste. Dem Vernehmen nach schwebt sie aber nicht in Lebensgefahr.
Auffällig ist, dass beide Anschläge Einrichtungen betrafen, in denen landwirtschaftliche Forschung in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Plantareg-Konzern betrieben wurde. Dessen Einrichtungen in den USA waren im letzten Jahr mehrfach Ziele für Sabotageakte der sogenannten Truth Hunters.
Offizielle Stellungnahmen liegen bisher nicht vor. Aus gut informierten Kreisen sickerte aber durch, dass in beiden Fällen die Landeskriminalämter die Ermittlungen übernommen haben. Ein terroristischer Hintergrund scheint also nicht ausgeschlossen.
01
Montag, 27. Oktober, 09.30 Uhr
„Vier und fünf senden nichts mehr.“
„Seit wann?“, fragte Alex.
Johanna verschob die Zeitskala an den Diagrammen in Richtung Vergangenheit.
„Vorgestern kam abends gegen sechs noch ein einzelnes Signal.
Der andere Sensor hat schon vier Stunden vorher aufgehört.“
„Und die benachbarten Messpunkte?“
„Mit gewohnter Unregelmäßigkeit dabei. Aber mindestens dreißig bis vierzig Impulse pro Tag.“
„Und die Umweltbedingungen?“, fragte Alex.
„Konstant seit zehn Tagen, bis auf die Temperatur. Eigentlich wollten wir mindestens zwei Wochen durchgehend aufzeichnen.“
„Was also bedeutet,….“, setzte Alex an,
„ …, dass etwas anderes passiert sein muss. Vielleicht ein technischer Defekt,“ antwortete Johanna, obwohl sie dachte, dass wahrscheinlich nur die Elektroden wieder nass geworden waren.
„Also muss jemand rausfahren und nach dem Rechten sehen.“
„Vor morgen früh wird das nichts. Der Techniker aus der Zentrale will noch einige Parameter an den Muster-Analysen ändern und heute Nachmittag soll eine neue Software aufgespielt werden.“
„Dann erwarte ich deinen Bericht morgen gegen elf in meinem Büro.“
Dienstag, 28. Oktober, 07.45 Uhr
Weil sie vergessen hatte, den Wecker zu stellen, geriet Johanna prompt in den Stau, der sich jeden Morgen auf dem Weg zum Industriezentrum bildete. Als die Fahrzeugschlange endgültig zum Stehen kam, fluchte sie laut. Später am Nachmittag wäre die Besprechung sicher genauso gut möglich gewesen. Aber natürlich musste Alex immer alles bis zum Mittag fertig haben. Jeweils nach zehn Metern, wenn die Autos nach einer kurzen Rollphase wieder stoppten, nippte sie an ihrer Thermosflasche mit dem stark gesüßten Kaffee. Etwa zweihundert Meter vor der Ausfahrt scherte sie nach rechts aus und quetschte sich an den wartenden Lastwagen vorbei auf dem Standstreifen nach vorn. Die Sonne stand jetzt schon über den Wolken im Osten und schickte ihr rotgoldenes Licht über die abgeernteten Felder.
Einige Kilometer weiter westlich lag der Nebel noch über dem Wald und in dichten Schwaden über den Baumkronen. Als sie in dem schmalen Seitental aus dem Auto stieg, knirschte das dick mit Raureif überzogene, gefrorene Laub unter ihren Schuhen.
Sie folgte dem Wanderweg, der bergauf nach Süden führte. Eine halbe Stunde später und hundert Meter höher löste sich der Nebel auf. Nachdem sie eine kleine Anhöhe überquert hatte, lag der ehemalige Truppenübungsplatz im vollen Sonnenlicht. Schlagartig war die Temperatur auf angenehme Werte gestiegen. Hier oben war der Boden nicht mehr gefroren. Die Open-Top-Anlagen mit ihren etwa zwei Meter hohen Umrandungen aus weißem, luftdurchlässigem Kunststoff-Vlies wirkten wie die Miniatur einer Zeltstadt in der Mitte der Wiese.
Ein wenig benutzter Fußpfad, schmal wie ein Wildwechsel, bog nach links vom Wanderweg ab und verschwand zwischen den Schlehensträuchern auf der anderen Seite des Grabens. Johanna zwängte sich durch die Hecke und ignorierte die langen Dornen, die ihr die Hände zerkratzten. Sie achtete nur darauf, dass ihr keine Zweige ins Gesicht schlugen.
Während sie die anschließende Wiese überquerte, kramte sie in ihrer Jackentasche nach dem Schlüsselbund.
Zwanzig Jahre, nachdem die Anlage aufgebaut und in Betrieb genommen worden war, hätte der Begrenzungszaun eigentlich eine Erneuerung verdient gehabt. An verschiedenen Stellen zeugten schräg nach innen verbogene Metallpfosten von den Versuchen von Hirschen und Wildschweinen, an das immer noch frische grüne Gras auf der anderen Seite zu gelangen.
Ärgerlich krächzend flogen zwei Krähen auf der gegenüber liegenden Seite auf, als der Schlüssel sich mit lautem Quietschen im Schloss drehte.
Letzten Endes, dachte Johanna, während sie die Tür hinter sich mit einem Fuß zurück ins Schloss drückte, haben wir noch Glück gehabt. Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Wachstum von Wild- und Kulturpflanzen waren schließlich spätestens im Jahr 2010 weitgehend bekannt und beschrieben. Höhere Kohlendioxid-Konzentrationen steigerten die Produktion an Pflanzenmasse bei Reis und Weizen um 5 bis 8%. Noch größere Zunahmen der Wachstumsrate wurden durch das Zusammenwirken mit anderen Umweltfaktoren erklärt. Immerhin war die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion eine eher erwünschte Nebenwirkung des Treibhauseffekts.
Kurz vor dem Ende ihres Masterstudiums war sie noch nicht sicher gewesen, mit welchen Themen aus der Pflanzenphysiologie am ehesten eine gute Grundlage für ihre spätere Karriere zu erreichen war. Als sie relativ spät mit der Suche nach einer Stelle begonnen hatte, waren viele Erfolg versprechende Forschungsaufträge bereits vergeben gewesen. Mehr zufällig hatte sie den Aushang im Institut für Elektrophysiologie der Pflanzen entdeckt und sich mit ihren Bekannten noch darüber amüsiert, dass im digitalen Zeitalter die Ausschreibung nicht auf der Homepage der Universität erschien.
Nur sicherheitshalber hatte sie ihre Bewerbung eingereicht und wurde zwei Tage vor ihrer Urlaubsreise durch die Einladung zum Vorstellungsgespräch überrascht. Ihre Bitte um eine Verlegung des Termins war umgehend erfüllt worden.
Drei Monate später wurde sie offiziell in die Arbeitsgruppe von Frau Professor Taschenhuber eingeführt, ausgestattet mit einem mehr als großzügig bezahlten Arbeitsvertrag über drei Jahre.
Trotz allem sind wir ein Auslaufmodell, dachte Johanna, und das erklärt auch, warum mir vor zwei Jahren niemand etwas über das Arbeitsklima und die Forschungsaufträge des Instituts erzählen konnte. Teddy ist schließlich fast immer unterwegs und mit den Leuten aus dem Rechenzentrum haben wir kaum Kontakt. Die beiden regelmäßig angebotenen Lehrveranstaltungen über elektrische Antworten der Pflanzen auf Stresssituationen und die kybernetischen Grundlagen mathematischer Musteranalyse wurden von höchstens drei Studierenden besucht. In der Regel tauchten auch diese nach den ersten zwei, drei Seminarterminen nicht wieder auf. Erstaunlich blieb die relativ gute Bezahlung und die, abgesehen von den antiquiert wirkenden Open-Top-Kammern, hoch modernen Mess- und Sendegeräte für ihre eigentlichen Untersuchungen.
Jede der 64 in acht Reihen in einem Abstand von vier Metern aufgestellten Klimakammern wies einen Durchmesser von etwas mehr als einem Meter auf. Bis in eine Höhe von zwei Metern waren sie von einem hauchdünnen Vlies aus PVC-Folie umgeben. Das Vlies war fast vollständig durchlässig für Licht und Wärme, behinderte aber die Luftbewegung so, dass die Zusammensetzung der Atmosphäre im Inneren fest beliebig verändert werden konnte. Neben den Kammern befanden sich in ungefähr einem Meter Abstand die würfelförmigen Pumpen, mit denen entsprechend der Versuchsplanung die gewünschten Mengen schädlicher Gase in die Luftschicht über der Vegetation eingebracht werden konnten. Einzig die in etwa vier Metern Höhe über den Kammern angebrachten großflächigen Sonnensegel stellten eine Weiterentwicklung im Vergleich zu den Modellen der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts dar. Sie sollten eine gleichmäßigere Verteilung von Licht und Wärme bewirken.
In der Mitte jeder Kammer befand sich, perfekt vor neugierigen Blicken verborgen, die entscheidende technische Installation.
Erst nachdem sie die in Richtung Norden liegenden vier Reihen der Kammern passiert hatte, fiel ihr die Veränderung auf. Der südliche Begrenzungszaun war auf einer Breite von fast zehn Metern aus dem Boden gerissen und zur Innenseite des Geländes hin nach oben gebogen worden.
Irgendwann musste das ja passieren, dachte Johanna, während sie die tiefen Furchen im Boden betrachtete, die fast bis an die südlichste Reihe der Klimakammern heranreichten. Auf der Suche nach Wurzeln, Engerlingen und Mäusenestern hatten die Wildschweine ganze Arbeit geleistet. Am Boden der Rinnen stand das Wasser, das während des Dauerregens der vergangenen Woche von den umliegenden Hängen abgeflossen war, überraschenderweise fast zehn Zentimeter hoch.
Wahrscheinlich sind doch die Akkus nass geworden, überlegte sie, während sie sich umdrehte und die Klimakammern mit den Nummern Vier und Fünf ansteuerte. Hoffentlich stehen wenigstens die Elektroden nicht vollkommen unter Wasser.
Johanna zog den Reißverschluss an der äußeren Hülle der Kammer nach oben und betrat den Innenraum.
Ein Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von etwa zwanzig Zentimetern ragte ein Stück weit über die Erdoberfläche. Auf dessen Verschluss war in der Mitte eine dünne Antenne aus Edelstahl angebracht. Johanna ging in die Hocke, löste vorsichtig die Spangen am Rand und hob den Deckel langsam nach oben.
Abgesehen von einigen wenigen Tropfen kondensierter Luftfeuchtigkeit an der Schutzhülle des Akkus und an den Innenwänden der Röhre war kein Wasser zu sehen.
Sie beugte sich ein wenig nach vorn. Sofort zog ihr ein stechender Geruch in die Nase und sie musste sofort niesen.
Wir hatten doch gar kein Ozon eingesetzt, dachte sie, während sie versuchte, im schwachen Licht der Taschenlampe die Befestigung des Sensors im Boden zu erkennen. Tatsächlich erschien der Mantel aus feinem Tonmehl, der die Lage der Elektroden an den Queckenwurzeln stabilisieren sollte, poröser als zwei Wochen zuvor. Als sie ihren Oberkörper weiter nach vorn schob und mit einem kleinen Schieber an einem langen Drahtstab das lose Füllmaterial um die Zuleitung andrücken wollte, wurde der Geruch stärker.
Die Druckwelle der ersten Explosion schleuderte Johanna mit großer Wucht gegen die scharfkantigen Stützen der Klimakammer. Für einen kurzen Moment brandete heftiger Schmerz in Wellen aus ihrem Fußgelenk in Richtung Oberschenkel und dann in ihre Hüfte. Als die zweite Detonation die Luft zerriss, hatte sie ihr Bewusstsein bereits verloren.
02
Samstag, 1. November, 22.30 Uhr
Teddy schreckte auf, als ein lautes Knirschen aus dem Kabinenlautsprecher die Ansage des Piloten ankündigte. Sein Kopf war im Schlaf weit nach vorn gesunken, also lehnte er sich zurück und massierte die schmerzenden Nackenmuskeln. Er erinnerte sich, dass er kurz vor dem Einschlafen im hellen Sonnenlicht die wunderbare Aussicht auf den Bosporus und das angrenzende Schwarze Meer genossen hatte. Jetzt war der Himmel schwarz, nur von ganz weit unten leuchteten die Gasfackeln wie winzige Kerzen am Rande der Ölfelder. Das Geräusch der Triebwerke vertiefte sich zu einem lauten Brummen, während der Pilot den Anflug für die Landung in Dubai begann.
Die Wartehalle im Transferbereich erreichte fast die Ausmaße eines Fußballfeldes. Bis in eine Höhe von etwa zehn Metern war die Front verglast und ermöglichte einen ungehinderten Blick über das Rollfeld und die Startbahnen. Auf der riesigen Fläche waren nur drei Passagiermaschinen zu sehen. Weit im Hintergrund schimmerte die Meeresoberfläche silbrig im Schein des fast vollen Mondes.
Auf der gegenüber liegenden Seite der Halle lag eine kleine Ladenzeile. Ein kleines Café war anscheinend geöffnet. Teddy schulterte seinen Rucksack und setzte sich langsam in Bewegung.
Aus den Augenwinkeln registrierte er die neugierigen Blicke der wenigen Gäste an den Tischen vor der Bar. Sicher wirkten seine schulterlangen blonden Haare zwischen den arabischen und indischen Gesichtern um ihn herum eher exotisch. Und, dachte er, auch wenn ich den dunkelblauen Pullover mit den Sternen der Europäischen Union aus Überzeugung trage, werden sie einen Engländer trotzdem sofort erkennen. Dass ich eigentlich überhaupt keinen Tee mag, ist ja von außen nicht zu sehen.
Außer arabischem Mokka wurde auch American Coffee angeboten. Seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht und wenig später saß er mit einer riesigen Tasse des dünnen Gebräus an einem der zierlichen Tische. Außer Müdigkeit verspürte er einen immensen Durst. Während er vorsichtig an der heißen Flüssigkeit schlürfte, klappte er sein Tablet auf und schaltete es ein.
An: Teddy J.
Von: Alex T.
Gesendet: 01.11., 20.15 Uhr
Hallo Teddy,
hoffentlich konntest du dich etwas ausruhen. Leider kaum gute Neuigkeiten.
Im Krankenhaus wollten sie mich immer noch nicht zu Johanna lassen. Auf dem Weg nach draußen habe ich aber ihre Mutter getroffen. Sie wollten nach dem Besuch mit mir sprechen. Also habe ich mich zwei Stunden in die Cafeteria gesetzt und sinnlose E-Mails aussortiert.
Johanna war wohl wach, aber von den vielen Schmerzmitteln ziemlich benommen. Sie hat ihre Eltern nicht erkannt. Ihr Fuß war nicht mehr zu retten, er musste gestern abends abgenommen werden. An der Ferse und unter der Sohle war das Gewebe schon großflächig abgestorben. Keine Ahnung, ob sie es schon weiß. Übrige Verletzungen wohl weniger schlimm, ein Splitter hat den Oberarm durchschlagen, am Knochen vorbei. Ein anderer Splitter hat eine Augenbraue glatt abrasiert, wie durch ein Wunder keine Verletzung der Schädelknochen. Brust und Unterleib mit vielen Prellungen von umherfliegenden Lehmbrocken, keine lebenswichtigen Organe beschädigt.
Die ganze Zeit hat ihre Mutter mich vorwurfsvoll gemustert. Ich habe Johanna doch in keine militärische Auseinandersetzung geschickt. Ich frage mich, was sie von mir erwartet hat. Ich bin auch gleich ins Krankenhaus gefahren.
Von Plantareg kommen in den nächsten Tagen zwei Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Sollen morgen oder übermorgen von Cold Spring aus aufbrechen. Wahrscheinlich sollen sie den Ruf der Firma retten.
Lach jetzt nicht: Die Polizei hat Müller und Meier mit den Ermittlungen beauftragt. Natürlich haben sie mich als erstes befragt.
Sie eine hyperaktive, rappeldürre Blondine, ich vermute, seine Assistentin. Er ein typischer Oberhesse, so träge, dass man ihm wohl die Schuhe beim Gehen besohlen kann.
Natürlich wollten sie wissen, ob wir Feinde oder Konkurrenten haben, ob es in der letzten Zeit Drohungen gab. Ich habe mich zurückgehalten. Natürlich werden sie früher oder später über den letzten Truth Hunters-Shitstorm stolpern, bis dahin wissen wir dann, was wir am besten sagen.
Falls dir noch etwas einfällt: Info immer erst an mich. Wir können dann gemeinsam entscheiden, mit wem wir darüber reden sollten.
Keine Ahnung, wie es jetzt weiter geht, aber Indien ist wahrscheinlich zentral. Also erst mal viel Erfolg im Punjab, Grüße auch an Amy und Viko, Alex.
Teddy blickte auf und rieb sich die Augen. Zwei Tischreihen weiter hatte sich eine pakistanische Großfamilie niedergelassen. Die Kinder zerrissen die Ränder der Papiertischtücher zu kleinen Stücken und bewarfen sich laut schreiend mit den Fetzen. Die Erwachsenen sahen lächelnd zu und schlürften geruhsam ihren Mokka aus zierlichen Tässchen. Keine Chance, einzuschlafen und den Anschluss zu verpassen, dachte er und kehrte in Gedanken nach Deutschland zurück.
Dienstag, 28. Oktober, 13.45 Uhr
In Alex‘ Vorzimmer sprach er gerade mit einem der Informatiker, die ihnen bei der Anpassung der neuen Software helfen sollten, als der Anruf kam.
Zwei Minuten später stürzte Professorin Alexandra Taschenhuber aus ihrem Büro ins Sekretariat, den Kopf heftig schüttelnd, Tränen in den Augen. Sie stützte sich auf dem nächstgelegenen Tisch ab, schluckte, seufzte und schluckte noch einmal.
Keine halbe Minute später hatte sie sich wieder unter Kontrolle und sah sich um. Nur für einen kurzen Moment senkte sie, offensichtlich peinlich berührt, ihren Blick. Als sie erneut den Kopf hob, zeigten ihre Augen wieder den gewöhnlichen kühlen und distanzierten Ausdruck.
„Teddy, “ sagte sie, „du musst sofort zur Anlage. Johanna ist verunglückt. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Wenn du ankommst, schau nach den Geräten. Und mach Fotos von allem. Ich muss jetzt Johannas Verwandte ausfindig machen. Komm sofort zu mir, wenn du zurück bist.“
Das alles, ohne nur einen Moment lang Atem zu holen. Manche bewunderten sie dafür. Energisch richtete sie sich auf und verschwand in ihrem Arbeitszimmer.
Auf dem Wanderparkplatz standen außer Johannas Auto noch ein Streifenwagen und ein olivgrüner Jeep, bei dem sich nur auf Höhe der ersten Sitzreihe Seitenfenster befanden. Niemand war zu sehen. Teddy ging einmal um Johannas Wagen herum und vergewisserte sich, dass er abgeschlossen war. Außer einem Bestimmungsbuch für wildwachsende Gräser auf der Rückbank sah er nichts, was sie zurückgelassen haben konnte. Anschließend schaute er in den Jeep. Eine dunkle Trennwand hinter den beiden Vordersitzen ließ keinen Blick auf die Ladefläche zu. Der Jeep war in Wiesbaden zugelassen, trug zivile Kennzeichen. Teddy schulterte seinen Rucksack und hastete den Wanderweg bergauf in Richtung Süden.
Eine gute Viertelstunde später betrat er den Trampelpfad durch die Hecke. Von Süden her war ein tiefes Brummen zu vernehmen. Als er die offene Fläche betrat, sah er den startenden Hubschrauber mit dem Roten Kreuz. Die Maschine drehte nach Südosten ab.
Schon als er die Tür auf der Nordseite öffnete, sah er das rotweiße Flatterband, das auf Höhe der sechsten Reihe quer über das Versuchsgelände gezogen war. Er blieb direkt davor stehen, sah um sich herum aber nur die im Sonnenlicht schimmernden Folien und hörte das leise Summen der Lüfter an den näher gelegenen Kammern.
Entlang der Absperrung ging er zum westlichen Zaun und fand einen uniformierten Polizisten auf einem Klappstuhl, der angestrengt in Richtung Süden blickte. Erst nachdem sich Teddy zum zweiten Mal geräuspert hatte, drehte er den Kopf und sah ihn an. Noch bevor der Polizist etwas sagen konnte, hatte Teddy seine Ausweise schon gezückt.
„Sie können noch nicht hinein. Die Leute vom LKA sind erst knapp eine Stunde da.“
„Und Johanna, ich meine, meine Kollegin?“
„Der Rettungswagen konnte nicht nahe genug heran. Also haben sie den Hubschrauber gerufen und der Notarzt ist zu Fuß durch den Wald. Die mussten erst von Kassel runterfliegen, deshalb hat das so lange gedauert.“
„Wer hat sie denn überhaupt gefunden?“
„Ich glaube, ein Jäger, aber die Kollegen hinten können Ihnen vielleicht mehr sagen. Laufen Sie am besten auf der Westseite entlang.“
Also stapfte Teddy zurück durch den nördlichen Zugang und erreichte kurz nach drei Uhr die südliche Begrenzung. Für einen Moment lang verschlug es ihm den Atem.
Von Kammer 4 war nichts übrig geblieben als ein wirres Knäuel aus Schutzfolie, Verstrebungen und zertrümmerten Messgeräten. Der Haufen lag schräg auf der Innenseite eines Kraters, dessen Durchmesser fast an Kammer 5 heran reichte. Deren Seitenwand war der Länge nach aufgeschlitzt. Eine Druckwelle hatte offensichtlich den Deckel des Messrohrs abgerissen. Die Antenne samt Kabeln und Bruchstücken der MEA-Elektroden lag auf der anderen Seite am Boden in der Nähe der Gaszufuhr.
Am Boden des Kraters beugte sich ein Spurensicherer im weißen Schutzanzug über die Reste von Johannas Rucksack. Auf Teddys Zuruf hin hob er kurz den Kopf, wedelte mit einer unbestimmten Handbewegung in Richtung Osten und beugte sich wieder nach vorn.
Teddy schaute in die angegebene Richtung und sah eine kleine Gruppe, teils uniformiert, teils zivil gekleidet, am Waldrand.
Teddy stellte sich vor und erkundigte sich nach dem leitenden Beamten.
„Noch nicht hier,“ antwortete einer aus der Gruppe vom Landeskriminalamt, „sie haben eine Geiselnahme, das kann noch dauern.“
„Reines Glück, dass wir schon da sind,“ ergänzte sein Kollege,
„wir waren zufällig in der Nähe unterwegs.“
Wohin der Hubschrauber mit Johanna geflogen war, wusste niemand. Immerhin erzählte der Jäger, der neugierig dem Gespräch gefolgt war, wie er Johanna gefunden hatte.
Am späten Vormittag hatte er auf seinem Rundgang durch das Revier den beschädigten Zaun vor den zerstörten Kammern bemerkt. Als er näher herankam, sah er einen Arm über den Rand des Kraters ragen. Er kletterte über die Trümmer und stellte fest, dass Johanna zwar bewusstlos war, aber stoßweise atmete.
Obwohl er sofort den Rettungsdienst und die Polizei alarmierte, hatte es fast eine Stunde gedauert, bis der Krankenwagen den Versuch aufgab, über den schmalen Wanderweg zum Versuchsgelände zu gelangen.
Die Telefonnummern des Instituts hatten sie erst später auf dem Schild neben der Tür an der gegenüber liegenden Seite bemerkt. Die LKA-Beamten vergewisserten sich noch einmal, dass Alexandra Taschenhuber tatsächlich die verantwortliche Leiterin für das Versuchsgelände war, und ließen sich von Teddy kurz die Funktionsweise der Kammern beschreiben.
„Sieht nicht danach aus, dass davon irgendwas selbst explodieren könnte,“ meinte der älteste der Gruppe, der offensichtlich der Vorgesetzte war.
„Nach der Tiefe des Kraters sind da einige Kilogramm hoch gegangen,“ ergänzte sein Kollege, „mich wundern auch die Unmengen an rostigen Metallsplittern. Sind Sie sicher, dass die nicht aus Ihrer Anlage stammen können?“
„In den Zelten gibt es nur Streben aus Edelstahl und Aluminium. Die Anlage steht erst im zweiten Sommer.“
„Sehr viel Rost kann sich da eigentlich nicht gebildet haben.“
Für einige Minuten herrschte Schweigen. Teddy erkundigte sich nach Johannas Habseligkeiten und erfuhr, dass er sie frühestens im Lauf des nächsten Tages abholen konnte. Wahrscheinlich würden sie im Labor in Wiesbaden untersucht, hauptsächlich, weil niemand wusste, wann das örtliche Ermittlerteam letztendlich eintreffen würde. Bis Sonnenuntergang wollten sie die Spurensuche auf dem Gelände fortsetzen, danach zur Not das Gelände für die Nacht unter Bewachung stellen.
Teddy entschloss sich, noch eine Weile auf das Ermittlerteam zu warten. Er begleitete den jüngeren LKA-Mann ins Tal, damit sie am Imbiss neben der Tankstelle im Dorf Kaffee und belegte Brötchen besorgen konnten. Unterwegs erfuhr er, dass das LKA-Team für den Kampfmittelräumdienst eingesprungen war.
„Eine vertrackte Geschichte,“ erzählte der junge Beamte, „drei von vier Teams von denen sind zur Fortbildung in den USA, weil momentan kaum Baustellen zu untersuchen waren. Heute um sechs Uhr früh sind sie zu der alten Kommandozentrale aus dem zweiten Weltkrieg gerufen worden. Da werden gerade die Wasserleitungen erneuert und plötzlich lagen zwei Zentner TNT in der Baggerschaufel. Sie haben also angefangen, die Fräse um den Zünder herum zu montieren, da kommt der Anruf, dass die Autobahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden gesperrt werden musste. Eine große Luftmine aus einem Seitenhang war beim Planieren freigelegt worden und rutschte langsam, aber stetig Richtung Fahrbahn. Kein Mensch wusste, wie lange sie an der Autobahn brauchen würden, aber das Wasser hier im Dorf war schon seit fünf Uhr abgestellt. Also haben sie uns um Amtshilfe gebeten, auch wenn wir normalerweise modernere Sprengsätze entschärfen.
Wir sind also hierher, haben unseren kleinen Roboter den Zünder abschrauben lassen und wollten gerade einpacken, als sie uns in den Wald geschickt haben. Wenigstens ist im Dorf keiner verdurstet. Also es gibt Tage…“
Auf dem Rückweg versorgte Teddy den Beamten mit Informationen über ihre Arbeit, von denen er glaubte, dass er sie ohne Bedenken weitergeben durfte. Dass ihre Arbeit weder in Wissenschaftskreisen noch in der Öffentlichkeit unumstritten war, erwähnte er nicht.
Nachdem sie zum Versuchsgelände zurückgekehrt und gegessen hatten, war die Sonne schon hinter die Baumkronen über den westlichen Hügelkämmen gesunken. Das Herbstlaub schimmerte allenfalls noch blassgelb und am östlichen Himmel schien bereits der fast volle Mond.
Alex hatte den Nachmittag am Telefon verbracht, aber wenig erreicht. Mehr als eine Stunde hatte sie gebraucht, bis sie eine Studentin fand, die sich vage an Johannas Heimatort erinnerte, ein Dorf im südlichen Münsterland in der Nähe von Soest. Das Telefonbuch wies sechs Nummern zum Namen Reubling aus und in der Gemeindeverwaltung war niemand mehr zu erreichen. Zwischenzeitlich ging es in Cold Spring Harbor auf die Mittagszeit zu und sie benötigte drei Anläufe, bis sich ihr Projektbetreuer in der Plantareg-Konzernzentrale meldete. Natürlich konnte er nicht wirklich helfen, versprach aber, im Lauf der Nacht eine E-Mail zu schicken. Gerade als sie das Telefon auf den Schreibtisch legte, betrat Teddy ihr Büro.
„Hör zu,“ sagte sie, „heute Abend können wir Johannas Eltern nicht mehr ausfindig machen. Du solltest dich morgen ins Auto setzen und ihnen die Nachricht persönlich überbringen. Wenn es sein muss, lass sie mit dir hierher kommen. Die Unterkunft werden wir schon bezahlen können.
Die verdammte Rettungsleitstelle hat sich immer noch nicht gemeldet. Ich kann doch jetzt nicht auf Verdacht alle Krankenhäuser anrufen, in die sie Johanna gebracht haben können.“
Sie ließ sich über die Ereignisse auf dem Versuchsgelände informieren und gab die wenigen sicheren Fakten in ihr Tablet ein, um sie später an Plantareg weiterzuleiten.
„Sobald ich das Krankenhaus weiß, muss jemand hin. Im Rechenzentrum sitzt immer noch der Informatiker und testet die neue Software. Scheinbar liefert sie vollkommen wirre Interpretationen. Ich gehe jetzt rüber. Kann sein, dass du mich später ablösen musst. Zur Not fahre ich auch mitten in der Nacht ins Krankenhaus.“
„Dann hole ich mir mal was zu essen und gehe anschließend ins Labor. Lass länger klingeln, falls ich auf der Liege eingeschlafen bin.“
Mittwoch, 29. Oktober, 00.45 Uhr
„Es versucht immer noch, Muster zu erkennen. Ich weiß nicht, wie oft schon.“
„Können wir die Prozedur nicht abbrechen?“
„Das wäre wenig schlau. Beim Neustart soll das Programm immer erst überprüfen, ob beim Testen der alten Interpretationen Übertragungsfehler aufgetreten sind.“
„Und?“
„Bisher hatten wir über 120.000 Versuche. Am besten warten wir, bis das Programm von selbst aufgibt.“
„Schon mal mit KI probiert?“
„Was glaubst du denn? Selbst bei den einfachsten Morsecodes kamen noch abstrusere Ergebnisse. Also sind wir zur alten Rechenschieber-Methode zurück.“
„Wo liegt denn dann das Problem?“
„Periodizität, Wiederholungen. Erst wenn eine Signalfolge erkennbar ein zweites Mal erscheint, kann man versuchen, mit der Suche nach Mustern zu beginnen.“
„Und unsere Signalfolgen wiederholen sich überhaupt nicht?“
„In den letzten zehn Tagen nein. Es sei denn, du betrachtest Vierergruppen als Wiederholungen. Das wäre dann allerdings viel zu wenig komplex.“
„Was denkst du denn dann?“
„Entweder hat das alles gar nichts zu bedeuten oder aber euer Sender ist intelligenter als alles, was ich bisher gesehen habe.“
Drei Stunden später war es vorbei.
„Muster nicht gefunden,“ lautete die lapidare Meldung, die das Scheitern aller Bemühungen eines halben Tages verkündete. Der Informatiker stützte den Kopf zwischen beiden Händen.
„Ich möchte wissen, woher ihr das habt. Die meisten E-Mail-Verschlüsselungen knacke ich mit dem Programm in höchstens drei Stunden.“
Er richtete sich auf, griff nach dem Becher mit dem letzten Schluck Mate und trank ihn aus.
„Vielleicht fällt mir noch was ein. Kann ich die Signaldaten mitnehmen?“
Einen Moment lang zögerte Teddy, dann fiel ihm ein, dass der Software-Ingenieur von Plantareg geschickt worden war.
„Ich denke mal, das sollte kein Problem sein.“
Später im Labor verkündete sein Mobiltelefon mit dem Keckern einer Elster, dass eine Nachricht von Alex eingetroffen war.
Demnach war Johanna erst nach acht Uhr abends aus dem Operationssaal gekommen und sicherheitshalber für zunächst 24 Stunden in ein künstliches Koma versetzt worden. Sie würde überleben. Mehr wollten die Ärzte Alex nicht mitteilen, wiesen sie aber sehr deutlich darauf hin, dass zügig Johannas Verwandte ausfindig gemacht werden mussten.
Teddy hatte gar nicht wahrgenommen, wie durstig er inzwischen war. Er öffnete einen Schrank an seinem Schreibtisch und stellte einen Sechserpack Energy Drinks auf die Schreibunterlage. Die ersten beiden Dosen leerte er in insgesamt vier Zügen.
Als er alle Informationen über die Schäden auf dem Versuchsgelände in sein Laborbuch eingetragen hatte, ging es auf sechs Uhr zu.
Er packte die verbliebenen vier Getränkedosen in seinen Rucksack und fuhr zur nächstgelegenen Autobahnraststätte, um zu frühstücken.
Kurz vor neun Uhr parkte Teddy seinen Wagen vor dem Klinkerbau, in dem sich die Gemeindeverwaltung befand.
Die Angestellte im Meldebüro vergewisserte sich durch einen Anruf, dass nichts dagegen sprach, ihm die Anschrift von Johannas Eltern mitzuteilen.
Johannas Mutter öffnete die Haustür und blickte ihm etwas verlegen mit ängstlich geweiteten Augen entgegen.
„Die Gemeinde hat angerufen. Ist etwas mit unserer Tochter?“
Teddy entschuldigte sich für sein plötzliches Auftauchen und bat darum, eintreten zu dürfen. Frau Reubling führte ihn in ein Wohnzimmer mit schlichten, aber liebevoll restaurierten Bauernmöbeln und wies auf die Eckbank. Auf dem Esstisch stand ein großer Strauß Rosen.
Einen Moment zögerte sie, dann setzte sie sich auf einen der Stühle und faltete ihre Hände auf dem Schoß.
Obwohl Teddy sich noch Jahre später alle Einzelheiten der Ereignisse dieser Tage ins Gedächtnis rufen konnte, blieb seine Erinnerung an das Gespräch immer unvollständig und verschwommen. Manchmal meinte er, dass seine eigenen starken Gefühle von Angst und Zorn verhindert hatten, die Empfindungen und Gedanken von Johannas Mutter richtig wahrzunehmen. Nur vage bekam er mit, dass sie in der Schule, in der ihr Mann als Konrektor arbeitete, anrief und ihn bat, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.
Nein, sie wollte nicht gleich mit ihm kommen und sich zum Krankenhaus bringen lassen. Abends oder am folgenden Tag wollten sie sich bei ihm melden.
Der Versuch, im Krankenhaus Neues zu erfahren, schlug fehl. Die Telefonistin teilte nur mit, dass Johanna sich noch auf der Intensivstation befand, ließ sich aber anschließend von Johannas Mutter ausführlich alle persönlichen Daten mitteilen. Teddy fiel ein, dass sich Johannas Papiere wohl noch bei der Spurensicherung in Wiesbaden befanden.
Südlich von Kassel war die Wirkung von Cola und Mate verpufft. Teddy fuhr auf einen Parkplatz, brachte die Rückenlehne des Beifahrersitzes in die Schlafposition, schaltete sein Mobiltelefon aus und machte es sich, so gut es eben ging, bequem.
Später am Nachmittag, etwas wacher als zuvor, aber mit schmerzendem Rücken, befand er sich auf dem Weg nach Wiesbaden, um Johannas Sachen abzuholen.
Das sollte ich ihr auf jeden Fall ins Krankenhaus bringen, dachte er, während er ihr Skizzenbuch mit den hauchzart kolorierten Zeichnungen verschiedenster Wildpflanzen durchblätterte. Der Betreuer der Asservatenkammer zeigte ihm, an welcher Stelle des Formulars er den Empfang bestätigen musste.
„Ungewöhnlich, dass Sie die Sachen schon heute abholen sollen.
Vielleicht haben sie im Labor Druck gemacht. Wahrscheinlich hat sich aber keiner viel von der Untersuchung versprochen.“
„Hat Ihnen denn niemand etwas erzählt?“
„Wir verwahren nur Sachen. Keine Ahnung, welche Geschichten dahinterstecken.“
Teddy verpackte die Gegenstände in seinem Rucksack, ohne sie aus den Plastiktüten zu nehmen, und fuhr ins Labor.
Nanu, dachte er, als er den Zettel mit der Nachricht auf seinem Schreibtisch fand.
„Briefing in München bis morgen Mittag. Keine Statements, keine Interviews, kein Handy!! Danke und Gruß, A.“
Selbst beim Schreiben der großen Blockbuchstaben hatte ihre Hand gezittert.
Der Software-Ingenieur hatte eine Nachricht hinterlassen und fragte, ob er später abends vorbeikommen könnte. Teddy verabredete sich mit ihm für die Zeit nach neun Uhr.
„Vielleicht habe ich eine Idee.“
Der Software-Ingenieur wendete den Blick vom Bildschirm ab und drehte sich zu Teddy um.
„Ihr habt uns bisher nur die Signale aus den letzten zehn Tagen für das neue Programm überlassen. Wir könnten es mit einem älteren Datensatz versuchen.“
„Und was soll das bringen?“
„Du hast gesagt, ihr habt neulich mit einer neuen Untersuchung begonnen. Das kann zweierlei bedeuten: Wahrscheinlich andere Informationen, wenn es ganz schlimm kommt, sogar andere Zuordnungen. Am besten klärst du mich erst mal auf, an was für einem System ihr überhaupt arbeitet.“
„Unkraut,“ sagte Teddy, „die gemeine Quecke. Eines der häufigsten Gräser auf unseren Wiesen. Die Bauern fürchten sie.“
„Warum das?“
„Wenn sie sich einmal angesiedelt hat, bildet sie weit verzweigte Wurzelgeflechte bis in fast zwei Meter Tiefe. Danach bekommst du sie aus keinem Acker oder Gartenbeet wieder heraus.“
„Pflanzen also. Ich kann es nicht glauben.“
Teddy war inzwischen vollkommen übermüdet. Trotzdem beschloss er, dem Informatiker wenigstens kurz zu umreißen, welche Ideen zu ihren aktuellen Untersuchungen geführt hatten.
Niemand anders als der große Charles Darwin äußerte zusammen mit seinem Sohn Francis schon 1880 in ihrem Buch „Die Kraft der Bewegung der Pflanzen“ die zweite revolutionäre Hypothese seines langen Forscherlebens:
„Es ist kaum eine Übertreibung, zu sagen, dass die so ausgestattete Wurzelspitze mit der Kraft, die Bewegung benachbarter Teile zu lenken, wie das Gehirn eines niederen Tieres agiert; das Gehirn am vorderen Ende des Körpers positioniert; indem es Eindrücke von verschiedenen Sinnesorganen erhält und die verschiedenen Bewegungen veranlasst.“
Im Gegensatz zur Evolutionstheorie fand die Wurzelhirn-Hypothese weder die Akzeptanz der Fachwissenschaft, noch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
Der Wortführer der Gegenseite, der etablierte Pflanzenphysiologe Julius Sachs bezeichnete die Darwins als Amateure, die unqualifizierte Experimente durchführten, mit Ergebnissen, die in die Irre führten.
Fast 100 Jahre vergingen, bis die Beobachtungen von Vater und Sohn, jetzt mit erheblich verfeinerten Methoden, einer ernsthaften Überprüfung unterzogen wurden.
Das ist umso erstaunlicher, weil die physikalischen Grundlagen für die Informationsverarbeitung in Lebewesen, elektrische Spannungsänderungen an Zellmembranen, bereits vor der Entdeckung der Erregungsleitung in den Nerven der Tiere an Arm-leuchteralgen der Gattung Nitella ausführlich untersucht wurden.
Nach der Entdeckung der elektrischen Erregungsleitung in den Nervenbahnen von Tintenfischen sieben Jahre später konzentrierten sich die Forschungen für etwa 50 Jahre auf die Informationsverarbeitung im Körper von Tieren. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts begannen einige Arbeitsgruppen damit, die alten Ergebnisse mit jetzt sehr viel besseren technischen Voraussetzungen zu überprüfen und weiter gehende Fragen zu formulieren.
„Inzwischen,“ fuhr Teddy fort, „sind wir zu der Ansicht gelangt, dass die Informationsverarbeitung bei Pflanzen weitaus komplizierter organisiert sein könnte als bei Tieren.“
„Meinst du etwa, dass Pflanzen so etwas wie Intelligenz entwickelt haben könnten?“
„Das ist genau die Frage, die uns im Moment sehr stark beschäftigt.“
„Dann schauen wir mal, was ich hier habe.“
Ganz im Gegensatz zu sonstigen Gewohnheiten nahm der Software-Ingenieur einen dicken Aktenordner aus seinem kleinen Koffer.
„Wenn ich diese Überlegungen mit der Firma diskutiere, zweifeln sie an meiner Zurechnungsfähigkeit. Mindestens werden sie ein paar sehr unangenehme Fragen stellen.“
„Etwa, weil deine Idee verrückt ist, aber nicht verrückt genug, um wahr zu sein?“
„So in etwa. Ich habe also eure Aufzeichnungen aus den früheren Versuchen und die Signalfolgen aus den letzten zehn Tagen ausgedruckt und von Hand nach Wiederholungen gesucht.“
„Warum sollte das der Computer nicht besser können?“
„Weil er immer von irgendeiner Art Schrift ausgeht, die nach einem bestimmten Schema in einen Binärcode umgewandelt wird. Das alte Verfahren hat ja vorzugsweise mit Methoden gearbeitet, mit denen der E-Mail-Verkehr ausspioniert werden kann.“
„Und?“
„Das neue Programm ist um einen Algorithmus erweitert worden, der keine bestimmte Zeichenzahl zugrunde legt. Außerdem können auch nichtalphabetische Codes erkannt werden. Wie bei den Symbolen für die chemischen Elemente, die ja auch aus einem oder zwei Buchstaben bestehen können. Natürlich muss dann die Trennung zwischen zwei Zeichen im Prinzip einheitlich codiert sein. In diesem Fall würden wir die Trennstriche durch die häufigen Wiederholungen vermutlich schnell erkennen.
Böse wird es aber dann, wenn die Länge der Trennelemente nach einem anderen Schema variiert wird. Dann hast du vielleicht eine einfache Verknüpfung zwischen Zeichen und Binärcode, aber keine Chance, sie zu erkennen, weil du nicht weißt, wo die Lücke aufhört, und das Zeichen beginnt.“
„Und könnte das hier der Fall sein?“
„Als ich hierher kam, war das nur so eine Idee. Aber mittlerweile rechne ich fast mit so etwas.“
„Warum denn das?“
„Ihr belauscht Pflanzen. Und wenn die wirklich miteinander sprechen, dann wahrscheinlich in einer Sprache, die anders ist als alle, die wir bisher übersetzen können.“
„Und das sind eine ganze Menge. Aber warum die Ausdrucke?“
„Der Computer macht immer einen Schritt nach dem anderen.
Manchmal gewinnt man mit genügend Abstand schneller einen guten Überblick.“
„Wenn wir dafür die Zeit finden…“
„Es weiß ja auch keiner, ob das funktioniert. Auf jeden Fall lasse ich die Sachen erst mal hier.“
„Wir sehen uns dann im Januar.“
„Viel Glück in Indien.“
Donnerstag, 30. Oktober, 00.15 Uhr
Nachdem er noch zwanzig Minuten auf die Signalfolgen der ersten Seite gestarrt hatte, klappte Teddy den Ordner zu und machte sich auf die Suche nach einem Tablet, das er zu Johanna ins Krankenhaus bringen konnte. Die technischen Geräte aus ihrem Rucksack waren irreparabel zerstört.
Zwei Stunden später war er mit der Einrichtung fertig und legte den Computer zusammen mit Johannas Skizzenbuch auf den Ordner mit der Aufzeichnung der Quecken-Signale.
Um acht Uhr morgens sollte er sich mit ihren Eltern treffen und mit ihnen zum Krankenhaus fahren.
Zwischen sechs und sieben Uhr morgens kontrollierte Teddy oberflächlich die Aufzeichnungen der noch funktionierenden Open-Top-Kammern auf dem Versuchsgelände. Auf den ersten Blick erschien alles wie immer, also speicherte er die Daten für eine spätere genauere Auswertung und fuhr anschließend ins Hotel, um Johannas Eltern zum Krankenhaus zu bringen.
Nachdem er sie in den Wartebereich vor der Intensivstation gebracht hatte, kaufte er sich Brötchen und Kaffee und setzte sich in die Cafeteria.
Natürlich hätte er unbedingt Johanna sehen wollen, aber die Sta-tionsschwester hatte kategorisch darauf bestanden, dass nur nächste Verwandte auf die Intensivstation durften. Minutenlang saß er mit einem Kloß im Hals vor seinem mageren Frühstück und versuchte, die aufkommenden Tränen zu unterdrücken.
Schließlich raffte er sich auf, biss lustlos in das weiche Salami-brötchen und nippte am inzwischen lauwarmen Kaffee.
Irgendjemanden lässt man immer im Stich, dachte er bekümmert und zerbröselte das letzte Stück Brötchen gedankenlos zu staub-feinen Krümeln. Ich sollte hierbleiben, bis ich mit Johanna gesprochen habe, aber die Firma wird sich kaum auf eine Verschiebung des Projekts in Indien einlassen. Außerdem haben Amy und Viko bestimmt schon alles vorbereitet. Die Geräte könnten schon in Amritsar sein. Wenn ich doch wenigstens nur ihr Gesicht sehen könnte…
Johanna und Teddy waren kein Paar und es sprach wenig dafür, dass sie es jemals werden könnten. Ihre bedingungslose gegenseitige Zuneigung erschien ihren Bekannten immer weniger erklärbar, je länger sie die Beziehung der beiden beobachteten. Es war nicht einmal sicher, ob sie sich überhaupt brauchten. Und doch gab es immer wieder Situationen, in denen sie wortlos durch einen kurzen Blick oder eine knappe Geste Gespräche zu führen schienen, für die andere Menschen halbe oder ganze Stunden benötigen würden.
Wenn die Bezeichnung beste Freunde überhaupt und irgendwann mit Leben erfüllt werden konnte, dann wahrscheinlich durch die Doktorandin Johanna und ihren Kollegen Teddy.
Eine knappe Stunde später betrat Johannas Mutter die Cafeteria und setzte sich wortlos zu ihm an den Tisch. Erst als Teddy leise fragte, ob er für sie etwas zu essen oder zu trinken holen könne, hob sie den Kopf und bat um Entschuldigung.
„Ein schwarzer Tee wäre schön. Es hat aber wirklich keine Eile.
Sie wollen doch sicher erst wissen, was mit Johanna ist.“
Als Teddy nickte, fuhr sie fort.
„Mein Mann spricht gerade noch mit dem Chirurgen. Sie haben Johanna in ein künstliches Koma versetzt. Aber alle sagen, sie wird es schaffen.“
Sie schluckte, seufzte und wischte sich einige Tränen von den Wangen.
„Wie konnte das nur passieren? Johanna hat doch immer gesagt, da oben sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.“
Teddy versuchte, das Wenige, was er wusste, behutsam zu erzählen. Als er die Explosionen erwähnte, zuckte Johannas Mutter zusammen.
„Das wird doch wohl kein Anschlag gewesen sein. Wer sollte denn mitten im Wald eine Bombe legen?“
Teddy zuckte mit den Schultern und senkte den Blick, weil er selbst schon an diese Möglichkeit gedacht hatte. Aber diesen Punkt musste er unbedingt erst mit Alex besprechen.
Für eine Weile war es still. Johannas Vater kam hinzu und Teddy erhob sich, um die beiden mit warmen Getränken zu versorgen.
Als er zurückkam, stand Herr Reubling auf, drückte ihm beide Hände und dankte leise für das, was Teddy für sie getan hatte.
„Ihr Rucksack ist im Stationszimmer. Sie wollen ihn zu ihr bringen, wenn sie aufwacht. Wahrscheinlich morgen. Was ist denn da so Schweres drin?“
Die Akte, dachte Teddy, aber vorerst kann ich die ohnehin nicht lesen. Wenig überzeugend erklärte er, dass er Johannas Zeichenausrüstung und ihr Skizzenbuch zu dem Tablet gepackt hatte.
Auf die Frage, ob Teddy ab der kommenden Woche etwas häufiger nach Johanna sehen könnte, antwortete er peinlich berührt, dass er zwei Tage später nach Indien fliegen musste.
Eine Weile überlegten sie, was zu tun sei. Am Ende zeichnete sich ab, dass wenigstens in den ersten zwei Wochen Johannas Eltern abwechselnd in der Nähe sein würden.
Teddy erklärte seine Vorinstallationen auf dem Tablet und versprach, so häufig wie möglich zu schreiben oder zu skypen.
Er brachte Johannas Eltern zum Hotel zurück und fuhr ins Institut.
Kurz nach vier Uhr rauschte Alex, noch im Kostüm, das sie auf der Konferenz getragen hatte, ins Labor.
„Können wir jetzt gleich alles besprechen? Ich muss morgen erst mal sehen, was die Polizei herausgefunden hat. Keine Ahnung, wie lange das schon wieder dauern wird.“
Teddy hatte in den vergangenen zwei Stunden das Versuchsprogramm für das Projekt in Indien überprüft und letzte Änderungen vorgenommen. Er klappte den Computer zu und drehte sich um.
„Eigentlich wollte ich gleich zum Arzt und noch eine Impfung auffrischen lassen. Lass mich kurz telefonieren und schauen, ob es auch morgen früh geht.“
„Komm dann in mein Büro.“
„Natürlich wollten sie alles über den Unfall wissen, so sollte es mir wohl auch vorkommen. Komisch war nur, dass sie kaum überrascht waren.“
„Hat das mit deinem Zettel von gestern zu tun?“
„Möglich ist das. Jedenfalls kam gegen zwei ein Anruf, dass wir vorläufig keine E-Mails mehr schicken dürfen und dass ich sofort nach München kommen sollte.“
„Irgendeine Idee, weshalb?“
„Eigentlich sollten wir die Ergebnisse mit den Salzstress-Leuten nächste Woche besprechen und ich sollte dir die Daten nach Indien schicken. Aber in München ist was dazwischen gekommen.
Vor einigen Tagen hat wohl jemand die Schlösser an den Gewächshäusern geknackt und die Versuchsbeete mit Salzwasser überschwemmt. Gemerkt haben sie das erst, als die Pflanzen flächendeckend abgestorben sind. Auf die Aufzeichnungen hat keiner geachtet.“
„Die Firma war sicher begeistert.“
„Das kannst du wohl sagen. Die Daten, die sie dann noch gesichert haben, sind zu nichts zu gebrauchen. Also haben sie kurzerhand euer Programm geändert.“
„Na super. Und was soll es jetzt werden?“
„Wasserhaushalt. Ihr sollt versuchen, die Spaltöffnungen zu steuern.“
„Wenigstens haben Amy und Viko dazu einiges gemacht. Aber haben die gar nichts zu Johanna gesagt?“
„Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie fast mit so etwas gerechnet haben. Natürlich übernimmt die Firma alle Kosten, bestmögliche Behandlung, alles, was du dir wünschen kannst.
Aber sie haben immer wieder nach Leuten gefragt, bei denen es Verbindungen zwischen hier und München geben könnte.“
„Denken die da an irgendeinen Zusammenhang?“
„Ich fürchte, ja.“
„Truth Hunters?“
„Gesagt hat das keiner. Allerdings könnten die wahrscheinlich unsere E-Mails und den Datenverkehr mitlesen.“
„Und was wollen sie nun tun?“
„Sie müssen jemand ins Flugzeug setzen, wissen aber noch nicht, wann das klappt.“
„Und in der Zwischenzeit?“
„Das gute alte Festnetz-Telefon. In der Hoffnung, dass die anderen noch nicht mithören können. Die Zahleneingabe für gesicherte Verbindungen solltest du jetzt gleich anschließend notieren.“
„Vielleicht gibt es ja eine neue Verschlüsselung, bevor die Leute hier sind.“
„Ich denke, das wirst du mitbekommen.“
Teddy wunderte sich nicht, dass ihr Arbeitgeber offensichtlich so wenig Interesse an Johannas Schicksal zeigte. Er ahnte, dass im Hintergrund größere Probleme lauerten als die Frage, ob sie beide im nächsten Jahr noch für Plantareg arbeiten würden.
Missmutig zog er sich ins Labor zurück, betrachtete wehmütig sein Versuchsprogramm zur Elektrophysiologie des Weizens unter Salzstress und begann dann mit der Planung ähnlicher Untersuchungen zur elektrischen Beeinflussung der Bewegung von Spaltöffnungen.
Kurz vor Mitternacht übertrug er seine Daten auf einen USBStick und druckte eine Liste der zusätzlich benötigten Instrumente aus. Auf welchem Weg er sie an die Firma schicken sollte, war ihm noch vollkommen unklar.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte.
„Hier Alex. Wir haben eine neue Verschlüsselung. Musst du aber in den nächsten zwei Stunden anfordern. Ich gebe dir jetzt den Zugangscode…“
Nachdem er sich die Zeichenkombination notiert hatte, fragte er, wie Johannas Zugang organisiert werden sollte.
„Vorläufig wird sie ihn kaum brauchen. Ich kläre das mit der Firma und gebe dir dann Bescheid. Sei übrigens vorsichtig, wenn du morgen zum Institut kommst.“
„Warum das?“
„Schau mal die Nachrichten. Kann sein, dass dich die Meute von den Medien abfangen will.“
„Sollte ich dann nicht besser gleich zum Krankenhaus fahren?“
„Das ist wahrscheinlich besser. Sieh zu, dass du danach alles besorgst, was du selbst noch für Indien brauchst. Wir können dann nachmittags noch mal sprechen.“
Nachdem Teddy Programm und Bestellungen für die neue Untersuchung in die Firmenzentrale geschickt hatte, schloss er ab und fuhr nach Hause.
Freitag, 31. Oktober, 08.15 Uhr
Teddy gab getrocknete Cranberries über sein Knuspermüsli, goss etwas Milch hinzu und rührte vorsichtig um. Neben ihm auf dem Tisch dampfte eine riesige Tasse Kaffee.
Er blickte auf die Schlagzeilen der Nachrichtenseite im Computer, fand aber zunächst keinen Hinweis auf die Explosion auf dem Versuchsgelände. Erst unter den regionalen Meldungen fand sich ein zwei Tage alter, kurzer Artikel, der im Wesentlichen auf den Angaben des Jägers beruhte.
Wirklich nichts Neues, dachte Teddy und folgte gelangweilt dem Hinweis auf einen Text mit Hintergrundinformationen.
Hintergrund: Die Truth Hunters
Bei den Truth Hunters handelt es sich um eine der geheimnisvollsten Untergrundbewegungen, die jemals ins Visier der Nachrichtendienste gerieten. Bis heute ist nicht einmal bekannt, ob es sich überhaupt um eine Organisation handelt, oder, ob die Bezeichnung nur von verschiedenen Einzelpersonen, vielleicht auch kleinen Gruppen zur Rechtfertigung von Sabotageakten genutzt wird. Wiederholt wurde auch spekuliert, dass die Vorfälle durch eine Verschwörung von politischen Kreisen mit Wirtschaftsunternehmen inszeniert wurden, um seriöse Nichtregierungsorganisationen zu diskreditieren.
„Dirty Research – Money for Lies“: Unter diesem Motto fand vor fast zehn Jahren eine Tagung wissenschaftskritischer Globalisierungsgegner in San Francisco statt.
In scharfer Form wurde die Kooperation von öffentlichen Forschungseinrichtungen mit Wirtschaftsunternehmen angegriffen. Nach dem subjektiv empfundenen Scheitern der Bemühungen um eine Demokratisierung der Wissenschaft am Ende des 20. Jahrhunderts gerieten besonders die Naturwissenschaften immer stärker in den Verdacht, allein den Herrschaftsinteressen von Staaten und Konzernen zu dienen. Die immer größere Bedeutung der Forschungsfinanzierung durch Wirtschaftsunternehmen verstärkte das wachsende Misstrauen in die Objektivität der Wissenschaftsgemeinde weiter.
Ab dem Ende des 20. Jahrhunderts wurden Forschungsgruppen, deren Ergebnisse vermeintlich die wirtschaftlichen Interessen der Produzenten beeinträchtigten, in immer kürzeren Zeitabständen durch vorgeblich objektive, im Auftrag der Konzerne erstellte Studien widerlegt.
Veröffentlichungen zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat legten zum Beispiel nahe, dass das Herbizid Krebs auslösen konnte. Der Hersteller konterte unmittelbar mit von ihm beauftragten Studien, die angebliche methodische Mängel in den kritischen Arbeiten unterstellten.
Fast überall auf der Welt schlossen sich die Gesundheits- und Umweltbehörden dieser Beurteilung an. In einem Fall gab es sogar die Empfehlung, keine weiteren Versuche zur Wirkung von Glyphosat auf Säuge- und Wildtiere durchzuführen.
Nur in Kalifornien setzte die zuständige Behörde für Gesundheit und Umwelt den Wirkstoff auf die Liste der krebserregenden Chemikalien. Vorher hatte der Hersteller den Rechtsstreit gegen die Behörde verloren.
Neben den Kontroversen um Glyphosat erschütterten auch Affären um weitere Pestizide, Risikobewertungen für Antibiotika, die Gefahren durch Nanopartikel und immer wieder der Streit um die Folgen radioaktiver Belastungen das Vertrauen der Umwelt-und Verbraucherschutzorganisationen in die Rolle der wissenschaftlichen Forschung so nachhaltig wie nie zuvor.
Schon Anfang des 21. Jahrhunderts wurde eine zunehmende Anzahl von Sabotageakten gegen wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, aber auch gegen Unternehmen der Energieversorgung und Verkehrsbetriebe registriert. Radikale Umwelt- und Tierschutzorganisationen zerstörten Versuchsfelder mit gentechnisch veränderten Pflanzen oder blockierten Walfänger und Fischtrawler in internationalen Gewässern.
Der skrupellose Einsatz von falschen oder tendenziellen Informationen besonders in den sozialen Medien beschleunigte parallel dazu die Erosion des Vertrauens in die Unparteilichkeit der Wissenschaft.
Stil und Wortwahl der Bekennerschreiben nach den Anschlägen wurden immer kompromissloser und militanter. Inzwischen wurde jedes Forschungsergebnis, das auch mit Unterstützung von Wirtschaftsunternehmen erzielt wurde, als Lüge bezeichnet. Wann genau der Ausdruck Truth Hunters zum ersten Mal mit einem Anschlag in Zusammenhang gebracht wurde, ist nicht bekannt. Eine ganze Reihe von Forschungsinstituten weigert sich aus nachvollziehbaren Gründen, zu diesem Thema Stellung zu beziehen.
Gerüchte besagen darüber hinaus, dass manche Aktivitäten dieser Gruppe nicht einmal bei Polizei oder Nachrichtendiensten gemeldet werden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche Konzerne mittlerweile eigene Ermittlungsgruppen beschäftigen und die Probleme teilweise mit durchaus fragwürdigen Methoden selbst bewältigen wollen.
Viel geschrieben, aber wenig gesagt, dachte Teddy und nahm den letzten Schluck Kaffee. Die Spekulationen am Schluss des Artikels lösten nicht einmal Stirnrunzeln bei ihm aus. Er konnte sich leicht vorstellen, wozu die Führung des Plantareg-Konzerns zwei Mitarbeiter aus der Zentrale über den Atlantik schickte.
Mich werden sie jedenfalls nicht mehr antreffen, dachte er und bedauerte zugleich tief, dass er nicht in Johannas Nähe bleiben konnte.
Er räumte den Frühstückstisch ab und fuhr danach ins Krankenhaus.
Als er sich auf dem Weg zur Auskunft kurz umdrehte, erhoben sich zwei junge Männer von den Sitzreihen im Wartebereich, umkurvten die Blumenbank und kamen mit schnellen Schritten auf ihn zu. Einer von ihnen trug eine Videokamera in der linken Hand.
Teddy drehte den Kopf zur Rezeptionistin und sah, dass sie ihn mit hektischen Handbewegungen zur hinteren Tür der Pförtner-kabine winkte. Flüsternd erklärte sie ihm, dass seit dem frühen Morgen durchgehend Reportage-Teams nach Johanna und Mitarbeitern des Instituts gefragt hätten. Er solle hier warten, bis eine Kollegin ihn auf einem Umweg ins Stationszimmer der Intensivabteilung bringen würde. Johannas Mutter sei bereits dort.
„Mein Mann ist schon auf dem Weg nach Hause. Ich werde die nächsten Tage hier bei Johanna bleiben.“
Frau Reubling blickte zu ihm auf, als ob sie sich für irgendetwas entschuldigen wollte. Teddy nickte nur irritiert und erkundigte sich nach Johannas Zustand.
Der Stationsarzt erklärte, dass Johanna sicherheitshalber mindestens noch einen Tag im künstlichen Koma gehalten werden sollte.
„Was den Fuß angeht, kann man noch gar nichts sagen. Er war fast ganz abgerissen, aber wir haben trotzdem versucht, ihn wieder anzunähen. Jetzt kommt es darauf an, ob sich das verletzte Gewebe regenerieren kann oder abstirbt. Bis wir das wissen, kann es noch zwei, drei Tage dauern.“
„Und sonst?“
„Sie war in guter körperlicher Verfassung. Ich denke, sie wird auf jeden Fall wieder gesund und kann wahrscheinlich auch wieder ganz normal arbeiten.“
Ohne Zweifel war Johannas Mutter keineswegs überzeugt, dass alles gut enden würde. Sie ließ sich aber nichts anmerken und fragte stattdessen Teddy nach seinen Plänen für die nächste Zeit.
Er erklärte, dass er nach Indien reisen musste, um Untersuchungen für seine eigene Doktorarbeit voranzutreiben, versprach aber, so bald wie möglich mit Johanna zu telefonieren und sie, so gut er konnte, zu unterstützen.
Er bat darum, an Johannas Laptop noch einige Installationen vornehmen zu können, und richtete nur für sie und ihn eine Internet-Verbindung mit einer eigenen Verschlüsselung ein.
Der Arzt fragte ihn, wie er das Gebäude verlassen wollte. Er hätte für Frau Reubling ein Taxi zum Hinterausgang bestellt. Vielleicht könnte er sie zum Hotel begleiten.
Teddy ging auf den Vorschlag ein und beschloss, sein Auto später am Tag zu holen.
Am Hotel nahm Frau Reubling seine rechte Hand in beide Hände und blickte ihn an.
„Ich glaube, ich weiß, was Sie für Johanna bedeuten. Sie hat so viel von Ihnen erzählt. Ich kann mich im Moment nur bedanken und Ihnen alles Gute für Ihr Projekt wünschen.“
Teddy ließ sich vom Taxi zu seiner Wohnung bringen.
„Kannst du mir vielleicht erklären, was das alles bedeuten soll?“
„Was meinst du genau?“
„Gestern Nacht sollte ich in die Nachrichten schauen und du hast gemeint, es gäbe ein riesiges Medienspektakel. Zugegeben, ich habe nicht mehr nachgesehen. Aber heute früh gab es nur eine Meldung in den regionalen Nachrichten. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Also, woher kam die Anweisung wirklich?“
Alex vermied es, ihn anzusehen, und drehte einen Kugelschreiber in ihren Händen. Sie schien zu überlegen, obwohl Teddy nicht die leiseste Ahnung hatte, warum sie so zögerlich reagierte.
„Also heute früh haben zwei Zweiergruppen vor dem Institut gewartet.“
„Und was hast du gemacht?“
„Ich bin auf den Rasen gegangen, als ob ich nach ein paar Pflanzen sehen wollte. Danach hinter das Gebäude und durch die Gewächshäuser.“
„Konntest du erkennen, für wen sie gearbeitet haben?“
„Später, vom Bürofenster aus. Eine Gruppe vom Hessischen Rundfunk. Bei den beiden anderen waren keine Logos zu sehen.“
„Genau wie bei den beiden im Krankenhaus. Also, was glaubst du, was wird hier eigentlich gespielt?“
„Keine einzige Idee. Woran denkst du denn?“
„Ich denke, man ist sehr interessiert an uns. Ich glaube auch nicht, dass Johannas Unfall der einzige Grund ist. Hat sich die Polizei eigentlich schon gemeldet?“
„Doch, sie wollen morgen am frühen Nachmittag hierher kommen. Du sitzt dann aber schon im Flugzeug.“
„Und wie soll es mit Johanna weitergehen?“
„Ich treffe mich morgen mit ihrer Mutter. Sie will die Ärzte auch mir gegenüber von der Schweigepflicht befreien.“
„Schreib mir bitte abends, was es gegeben hat. Kurz vor elf müsste ich in Dubai sein. Da kann ich mich dann ein paar Stunden langweilen.“
„Ortszeit?“
„Ja sicher. Und jetzt kannst du mir einen großen Gefallen tun.
Fahr mich zum Krankenhaus, damit ich mein Auto holen kann.
Lass uns unterwegs noch einmal die Programmänderungen für den Punjab durchgehen.“
„Gibt es eine Gegenleistung?“
„Das wäre Bestechung. Aber wir können vielleicht zum Italiener.
Indisch gibt’s für mich in den nächsten Wochen genug.“
Alex setzte ihn vielleicht einen halben Kilometer vor dem Krankenhaus an einer Parkanlage ab. Teddy blieb einen Moment lang stehen und vergewisserte sich, dass kein weiteres Auto anhielt oder Alex‘ Wagen folgte.
Auf dem Parkplatz war niemand zu sehen. Er schlenderte gemächlich zu seinem Auto, sah sich noch einmal um und nahm anschließend den direkten Weg zum Restaurant, in das er Alex eingeladen hatte.
Wahrscheinlich bilde ich mir einiges nur ein, dachte er später, als er seinen Koffer zuklappte. Das Abendessen war eher schweigsam verlaufen, wahrscheinlich auch, weil beide sich scheuten, laut über Johannas Schicksal nachzudenken. Weder vorher, noch nachher hatte es irgendwelche Anzeichen dafür gegeben, dass ihnen jemand folgte.
Sonntag, 02. November, 01.15 Uhr
Auf dem Weg von der Sicherheitskontrolle zum Flugzeug vibrierte sein Mobiltelefon. Teddy setzte sich auf eine Bank und rief die Textmitteilung auf.
An: Teddy Joulson
Von: Vikander Singh
Gesendet: 02.11., 02.40 Uhr
Hi Teddy,
komm nicht nach Amritsar. Amy wartet in Delhi am Flughafen.
Alles Weitere mündlich heute Nachmittag im Rambagh. Ich kümmere mich um die Ausrüstung.
Eilige Grüße, Vikander.
Der Versuch, zurückzurufen, blieb ohne Erfolg. Vikander hatte sein Handy ausgeschaltet.
Noch, nachdem er sich im Flugzeug angeschnallt hatte, wirbelten Dutzende Ideen in seinem Kopf herum, eine wirrer als die andere.
Vielleicht kann Amy schon was sagen, dachte er und schloss die Augen.
An Schlaf war nicht zu denken.
03
Sonntag, 02. November, 07.15 Uhr
Das Begrüßungsritual umfasste alle Elemente der freundschaftlichen Beziehung zwischen Amy und Teddy. Zunächst der traditionelle indische Namasté-Gruß, die Handflächen mit nach oben gerichteten Fingern vor der Brust aneinander gelegt. Danach schüttelten sie sich nach europäischer Art die Hände und Amy zog ihn zu sich heran, um ihren Kopf leicht gegen seine Schulter zu drücken. Verglichen mit den meisten indischen Frauen war sie hochgewachsen, so dass ihre Geste nicht im Entferntesten peinlich wirken konnte.
„Du siehst müde aus und ich muss uns erst mal aus Delhi herausbringen. Lass uns beim Frühstück alles in Ruhe besprechen.“
„Aber Vikander….“
„… ist gerade dabei, einen Lieferwagen mit den Geräten nach Jaipur zu fahren. Wir sehen ihn hoffentlich heute Nachmittag.“
„Und im Punjab?“
„Ich weiß nicht viel. Das Versuchsfeld ist in der vorletzten Nacht komplett abgebrannt.“
Eine halbe Stunde später war Teddy auf dem Beifahrersitz eingeschlafen, obwohl Amy fast pausenlos auf die Hupe drückte, um so schnell wie möglich die Schnellstraße nach Süden zu erreichen.
Fast drei Stunden danach erwachte Teddy dadurch, dass Amy das Auto abrupt nach links in eine Ausfahrt lenkte, die zu einer Raststätte auf einem Hügel oberhalb der Autobahn führte.
„Warum hast du mich nicht geweckt? Du musst ja fast verhungert sein.“
„Richtige Feststellung. Aber mit dem Hunger mussten wir hier viel länger leben als ihr. Außerdem hat Viko angerufen. Er wird gegen vier in Jaipur ankommen. Du kannst froh sein, wenn du vorher noch Zeit zum Duschen hast.“
„Warum die Eile?“
„Viko will noch heute Abend weiter nach Ghoram. Wenn er Glück hat, kann er Sanjit noch bei der Versammlung unterstützen. Kann sein, dass das nötig wird. Wahrscheinlich sogar sehr nötig.“
„Dann lass uns zum Essen gehen.“
Sie setzten sich auf die westliche Terrasse. Bis zum Horizont sah man nur Hügel mit sanften Hängen, auf denen das Laub der Gebüsche und das Gras auf den Wiesen trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit in hellem Grün leuchteten.
„Warum ist noch nicht alles gelb?“
„Die letzten Regenfälle kamen dieses Jahr fast vier Wochen später als sonst. Das ist einer der Gründe, warum ihr in Ghoram weiter machen könnt.“
Teddy kaute gedankenverloren auf einem Weizenfladen herum, während Amy ihm Gurkenscheiben und Joghurt auf den Teller häufte und dezent die Platte mit dem Rührei in seine Richtung schob.
„Keine Eier für dich?“
„Eher nein. Im Moment lebe ich mal wieder eher vegan. Na ja, ziemlich weitgehend jedenfalls.“
„Worüber sollen wir als erstes reden?“
„Erzähl von Johanna. Alex hat etwas von einem Unfall geschrieben.“
„Wenn es denn ein Unfall war…“
Als Teddy seinen Bericht beendet hatte, schüttelte Amy den Kopf.
„Ich kann das kaum glauben. Und ich will meine Freundin Johanna wieder haben. So wie wir sie kennen, vor allem mit ihren Witzen. Hoffentlich schafft sie das…“
„Spätestens morgen will ich ihr schreiben. Sag mir irgendwas, womit ich sie aufmuntern kann.“
„Ich glaube, das wird schwierig. Um ehrlich zu sein, so langsam mache ich mir große Sorgen. Pass mal auf: Fast zur gleichen Zeit werden die Versuchsanlagen in München und bei euch zerstört.
Und drei Tage später das Weizenfeld bei Amritsar. Glaubst du da an einen Zufall?“
„Wie ist das bei Amritsar denn passiert?“
„Ein Tanklastzug ist über die Wegböschung ins Feld gestürzt.
Das Benzin ist ausgelaufen und hat dann irgendwie Feuer gefangen.“
„So was kommt vor.“
„Kann schon sein. Aber der Weg führt nur zu einigen Schuppen mit Material für die Versuchsfelder.“
„Hat sich da jemand verfahren?“
„Der Fahrer war nicht auffindbar. Das Führerhaus war leer.“
„Und was sagt die Polizei? Die können doch den Eigentümer ermitteln.“
„Die Nummernschilder sind verschwunden. Und die Spurensicherung am Fahrgestell kann dauern. Sie machen auch keinen großen Druck. Wie du schon sagtest: Solche Unfälle passieren immer mal wieder.“
„Aber du machst dir Sorgen, weil du denkst, es gibt da einen Zusammenhang. Aber woher sollen die Leute hier denn über die Firmenprojekte in Deutschland Bescheid wissen?“
„Das ist genau der Punkt. Wenn es einen Zusammenhang gibt, dann wahrscheinlich über die Truth Hunters. Wenn nicht, gibt es noch so einige andere Möglichkeiten.“
„Woran denkst du da?“
„Kleinbauern, Chinesen, Nationalisten, die Konkurrenz, Pakistani, und bestimmt sind das noch nicht alle. Aber darüber solltest du mit Viko und Sanjit reden. Außerdem wird es Zeit, dass wir weiterkommen.“
Kurz nach drei Uhr betrat Teddy die Terrasse des Rambagh-Palace-Hotels in Jaipur. Unter dem mit Palmstroh gedeckten Vordach hätten zwei Handball-Mannschaften bequem trainieren können und die Qualität der Ausstattung ließ, wenn auch etwas altertümlich wirkend, keinen Zweifel darüber aufkommen, dass man sich auf dem Anwesen eines ehemaligen Palastes des Maharadschas befand. Bis zur Teestunde war noch reichlich Zeit.
Teddy blickte sich auf der leeren Terrasse um und entdeckte erst einen Moment später, dass sich an einem der Tische am Geländer zum parkartigen Garten ein Mann mit Turban erhob. Amy saß in einem Sessel aus gelbem Rattan-Geflecht mit Blick auf den Rasen und drehte lächelnd ihren Kopf in seine Richtung. Am Rand des Gebüsches hinter dem Springbrunnen kreischten zwei Pfauen.
Vikander Singh wurde trotz seines nach indischem Verständnis noch jugendlichen Alters, er hatte seinen fünfzigsten Geburtstag noch nicht gefeiert, zugetraut, die legitime Nachfolge von Sub-rahmanian Nagarajan anzutreten.
Professor Nagarajan hatte zu einer Reihe von Pionieren gehört, die in den sechziger und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die landwirtschaftliche Forschung in Indien so weit vorantrieben, dass Indien zum zweitgrößten Weizenproduzenten der Welt wurde. Die Hungersnöte, die noch bis vor wenigen Jahrzehnten das Land zumindest in einigen Regionen regelmäßig heimsuchten, schienen der Vergangenheit anzugehören.
Rein technisch wurden die Erfolge durch die Züchtung neuer Weizensorten mit kürzerer Wachstumsperiode erreicht. Mit diesen Sorten ließen sich bis zu drei Ernten im Jahr erzielen. Hinzu kam die Optimierung des Bewässerungsmanagements. Mit wenig mehr als der Hälfte der traditionell benötigten Wassermenge konnten gleich hohe Erträge erzielt werden.
Trotz aller sozialen Konflikte zwischen Kleinbauern und Großgrundbesitzern und der wie in vielen Entwicklungsländern gras-sierenden Korruption leistete Indiens Landwirtschaftspolitik einen wesentlichen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte.





























