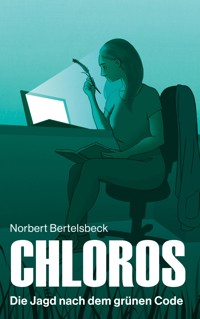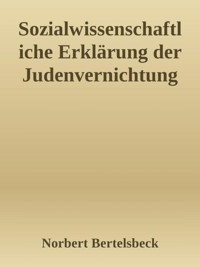Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Konflikte mit anderen werden häufig durch Macht oder Nachgiebigkeit gelöst. Dies bedeutet dann, dass sich entweder die eine oder die andere Seite der am Konflikt beteiligten Personen durchsetzt. Zurück bleiben Ärger, Unzufriedenheit oder sogar Verbitterung, welche die Beziehung beeinträchtigen. Eine Alternative hierzu wird in diesem Buch unterbreitet. Auf der Grundlage von Thomas Gordons "Beziehungskonferenzen" werden partnerschaftliche Konfliktlösungs- und Konfliktvermeidungsmethoden mit vielen Beispielen anschaulich dargestellt. Zugleich werden dem Leser Möglichkeiten geboten, das erworbene Wissen in Übungen anzuwenden. Das Buch wendet sich an Leser, die von Berufs wegen mit Konflikten zu tun haben, aber auch an solche, die ihre Paar- oder Eltern-Kind-Beziehung verbessern wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Bertelsbeck:
Konflikte einvernehmlich lösen
Impressum
Konflikte einvernehmlich lösen und vermeiden
Norbert Bertelsbeck
Copyright: © 2015 Norbert Bertelsbeck
Published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-3102-3
Inhalt
Einführung
1. Konfliktbegriff
2. Bedürfnis- und Wertbeeinträchtigung
3. Wertvorstellungen für das Vermeiden und Lösen von Konflikten
4. Vermeidung von Bedürfniskonflikten
5. Der Umgang mit Bedürniskonflikten
6. Wertkonflikt
7. Konfliktvermittlung
8. Übungen
9. Methoden zur Vermeidung und Lösung von Bedürfniskonflikten (Gesamtdarstellung)
10. Das Vermeiden und Lösen von Konflikten mit kleinen Kindern
Literaturliste
Über den Autor
Einführung
Die große Bedeutung von Kontakten
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Vermeidung und Beseitigung von zwischenmenschlichen Konflikten. Es handelt sich um eine Thematik, die von erheblicher Bedeutung für das alltägliche Leben ist, denn Kontakte zu anderen Personen - und damit auch die Möglichkeit des Vorliegens von Konflikten - sind für die meisten Menschen ein wesentlicher Bestandteil des Lebens.
So wachsen Kinder zunächst in der Familie auf, wo auch heutzutage noch meist die Mütter als primäre Bezugspersonen und andere Familienmitglieder wie Väter und Geschwister von Bedeutung sind. Allmählich vergrößert sich dann die Personenzahl um den weiteren Verwandtenkreis wie Großmütter und Großväter, Tanten und Onkel, Cousinen und Cousins. Später kommen Gleichaltrigengruppen und andere Erwachsene in Gestalt von Erzieherinnen/Erziehern im Kindergarten und Lehrerinnen/ Lehrern in der Schule hinzu. Kinder treffen sich ebenfalls mit ihresgleichen nach der Schule, treten Vereinen oder anderen Freizeitorganisationen bei. Es entwickeln sich länger andauernde Freundschaften zum gleichen, später auch zum anderen Geschlecht. Schließlich sind Kinder Erwachsene, die eine Ausbildung beginnen und so neue Kontaktmöglichkeiten erhalten. Sie ergreifen einen Beruf und arbeiten so mit anderen Menschen zusammen, binden sich langfristig an einen Partner in Form einer Ehe oder Lebenspartnerschaft, bekommen Kinder und darüber vermittelt wieder weitere Kontakte zu anderen Eltern, Erziehern, Lehrern, Freunden ihrer Kinder etc. Später im fortgeschrittenen Alter wird ggf. der vertraute häusliche Bereich mit dem Umzug in ein Alten- oder Pflegeheim verlassen, und es ergibt sich noch einmal ein veränderter Kontaktbereich. Sind bisher unterschiedliche Kontakte in Abhängigkeit vom Lebenslauf erwähnt worden, so lässt sich eine Vielfalt von Beziehungen auch vor Augen führen, wenn man sich an einem Tagesablauf orientiert.
Vielleicht halten Sie einmal für einen Augenblick inne, gönnen sich eine Tasse Tee oder Kaffee und vergegenwärtigen sich die Kontakte, die Sie am gestrigen Tag hatten. Mit welchen Personen standen Sie am frühen Morgen, Vormittag, Nachmittag und am Abend in Kontakt? Sind Sie möglicherweise überrascht über die Kontakthäufigkeit?
So haben Personen an einem Tag, jeweils in Abhängigkeit von besonderen Lebenssituationen, häufig mit bestimmten Menschen zu tun: mit dem Ehepartner oder Lebensgefährten, Kindern, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden, Bekannten, Verwandten oder sonstigen mehr oder minder fremden Personen wie Fahrgästen, Verkäufern, Passanten, Besuchern von Veranstaltungen etc. Die Kontakte werden dabei als mehr oder minder angenehm erlebt.
So kann es sein, wenn Sie berufstätig und zugleich verheiratet sind, dass Ihr ebenfalls berufstätiger Partner sich morgens allzu lange im Badezimmer aufhält, während Sie in Eile sind. Im vollen Bus auf dem Weg zur Arbeit werden Sie, während Sie stehen, von hinten angerempelt. Im Büro raucht neuerdings ein Arbeitskollege, dem Sie gegenüber sitzen; ein anderer ist ungewohnt schweigsam. Ihr Chef hat Ihnen heute schon wieder eine Sonderarbeit verpasst, die es unmöglich macht, eine Terminarbeit zu erledigen. Kommen Sie nach Hause, so sagt Ihre Frau mit stockender Stimme, dass ihre Freundin eine Verabredung nicht eingehalten habe, und möchte mit Ihnen hierüber sprechen, oder die Kinder wollen sofort mit Ihnen spielen, obgleich Sie erschöpft sind. Abends würden Sie gern mit Ihrem Partner einen Film im Kino anschauen, dieser möchte jedoch zu Hause bleiben. Ihre älteren Kinder kommen spätabends nach Hause und machen Lärm, während Sie schon schlafen und dadurch aufgeweckt werden.
Wenngleich Kontakte aufgeführt wurden, die im Allgemeinen als unangenehm angesehen werden, so hat der Alltag jedoch auch eine Vielfalt von angenehmen Begegnungen zu bieten, die das Leben lebenswert machen.
Das Essen steht schon auf dem Tisch, als Sie nach Hause kommen, obwohl Sie damit nicht gerechnet haben. Der Chef teilt Ihnen mit, dass eine Beförderung ansteht. Die Tochter sagt zu Ihnen: „Vati, ich hab’ Dich lieb“. Sie sehen sich mit Ihrem Partner einen schönen Film an. Sie fahren nächste Woche mit ihrer Familie in den Urlaub und freuen sich schon darauf. Ihre Freundin bedankt sich bei Ihnen mit einem kleinen Präsent dafür, dass Sie in ihrem Urlaub für sie die Treppe geputzt haben etc.
Konflikte in verschiedenen Gruppen
Möchte man Konflikte zum Gegenstand von Erörterungen machen, so ist dieses auf verschiedenen Ebenen möglich:
Auf gesellschaftlicher Ebene lassen sich Konflikte in verschiedenen Bereichen benennen, von denen beispielhaft einige genannt werden sollen.
-Im Politikbereich beziehen sich Konflikte darauf, welche Ereignisse zu politischen Themen werden sollen und wie sie zu lösen sind. Hier gibt es Kontroversen innerhalb der Regierungsparteien wie auch zwischen Regierung und Opposition.
-Daneben gibt es Konflikte zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen um das Ausmaß der Mitbestimmung, von Lohn- und Arbeitsbedingungen.
-Auch gibt es Konflikte zwischen den verschiedenen Anbietern im Gesundheitsbereich (Ärzte, Pharmaindustrie, Apotheker und Krankenhäuser) einschließlich der Krankenkassen, welche Leistungen von ihnen zu welchem Preis zu erbringen sind.
Die Öffentlichkeit ist bei diesen Auseinandersetzungen einerseits Zuschauer, andererseits jedoch zugleich auch Betroffene von Konfliktlösungen.
So verfolgen Sie z. B. im Radio, Fernsehen, Internet und in der Zeitung interessiert Berichte von Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen um höhere Tariflöhne, weil Sie Nutznießer von derartigen Vereinbarungen sind. Sie schauen sich des Weiteren Wahlsendungen im Fernsehen an, um bei der Bundestagswahl die für Sie richtige Partei zu wählen etc.
Konflikte sind darüber hinaus auf der Ebene des Alltagslebens angesiedelt. Dieses ist nun Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Es werden hier Konflikte zwischen zwei Personen in verschiedenen Lebensbereichen behandelt, d. h. solche in Gruppen wie z. B. der Ehe, Familie, einer Arbeitsgruppe oder einer Schulklasse. Konfliktträchtige Themen lassen sich dabei für unterschiedliche Bereiche benennen:
-Waren in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts Männer berufstätig und Frauen primär im Haushalt tätig, so hat sich diese Situation grundlegend geändert: Auch Frauen sind heute zum größten Teil berufstätig. Einhergehend mit einer veränderten Frauenrolle, muss auch der Mann sein Rollenverständnis überprüfen. Männer und Frauen müssen heute mehr als früher aushandeln, was eigentlich ihre Aufgaben sind.
So können Eheleute dann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, welchen Part Mann und Frau bei der Kindererziehung übernehmen und mit welchen Inhalten überhaupt erzogen werden soll, wie die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Ehepartnern erfolgt, wer Einkäufe oder Finanzangelegenheiten tätigt, die Gartenarbeit übernimmt und Freunde einlädt. Desgleichen können Meinungsverschiedenheiten bestehen wie die Freizeit und der Urlaub zu gestalten sind, welche Anschaffungen erfolgen sollen und in welcher Qualität, wie häufig Eltern, sonstige Verwandte und Freunde zu besuchen sind etc.
-In der Familie können Eltern und Kinder unterschiedliche Meinungen über die Akzeptanz von Lärm, Ausgeh-, Schlafenszeiten, den Freundeskreis etc. haben. Derartige Konflikte sind von Eltern früher, d. h. noch in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, „autoritär“ entschieden worden, während heute eher ein gesellschaftliches Klima vorherrscht, auch die Kinder in derartige „Konfliktlösungen“ einzubeziehen.
-Wenn auch im Beruf Konflikte vermieden werden durch die Geltung bestimmter arbeitsrechtlicher Normen, können nichtsdestotrotz sowohl zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern als auch zwischen Arbeitskollegen Konflikte unterschiedlichster Art bestehen.
So sind beispielsweise Arbeitskollegen unterschiedlicher Meinung hinsichtlich des zeitlichen Öffnens von Fenstern, des Ausmaßes des privaten Telefonierens, der Pausenzeiten, der Art und Weise der Kooperation etc. Und auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern können Konflikte hinsichtlich der Beförderung, der Urlaubszeit, der Arbeitsqualität, der Mehrarbeit, Arbeitsüberlastung, Weiterbildung, frühzeitigen Unterrichtung bei Krankheit etc. vorliegen.
-In der Schule können Schüler im Unterricht reden, umherlaufen oder sonstigen Lärm machen, andere Schüler beleidigen oder schlagen, Lehrer beleidigen oder ihnen nicht antworten, Gegenstände zerstören, verspätet zum Unterricht erscheinen oder zu früh die Schule verlassen, sich am Unterricht nicht beteiligen, Hausaufgaben nicht erledigen etc. Schüler ihrerseits können sich vom Lehrer bei der Zensurengebung oder der Bewertung sonstigen Schülerverhaltens ungerecht behandelt fühlen, von ihm beleidigt werden, sich im Unterricht langweilen etc.
Das Lösen und Vermeiden von Konflikten
Im Alltagsleben wird das Bestehen von Konflikten zumeist negativ bewertet, als Folge von negativen Erfahrungen mit Konfliktlösungen. Der Versuch, Konflikte zu lösen, endet häufig mit psychischen Verletzungen, Niederlagen und verschlechterten Beziehungen als Folge des destruktiven Umgangs mit Konflikten.
So erleben Kinder häufig zu Hause, dass Konflikte mit den Eltern von diesen durch den Einsatz von Bestrafung gelöst werden. Solche Erfahrungen sind mit negativen Gefühlen (Wut, Ärger, Trauer, Enttäuschung, mangelnder Selbstwert etc.) verbunden. Umgekehrt können jedoch auch Eltern im Konflikt den Kürzeren ziehen und Kinder gewähren lassen, „um des lieben Friedens willen“. Dieses ist dann ebenfalls verbunden mit negativen Gefühlen den Kindern gegenüber.
Wird das Bestehen von Konflikten negativ bewertet, so scheut man sich auch, Konflikte offen auszutragen. Zu beachten ist jedoch, dass das Aussitzen von Konflikten zu einer Eskalation beitragen kann: Irgendwann platzt einem der Kragen, und es erfolgen dann (emotionale) Reaktionen, die dem aktuellen Konfliktanlass nicht angemessen sind. Wenn hingegen eine Auseinandersetzung zwischen Personen erfolgt, dann geschieht dies oft mit dem Ziel, sich im Konflikt durchzusetzen.
Vielleicht halten Sie einmal inne und überlegen sich, welche Erfahrungen Sie selbst mit Konflikten gemacht haben. Decken sich die hier getätigten Aussagen mit Ihren eigenen Erlebnissen?
Theoretische Grundlagen
Das hier dargestellte Modell der Konfliktlösung und -vermeidung wird als partnerschaftlich bezeichnet. Es grenzt sich ab von Versuchen, Konflikte zu lösen oder zu vermeiden durch Einsatz von Macht, indem in einer Zweierbeziehung die andere Person mittels Belohnung oder Bestrafung zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden soll. Hierauf ist weiter oben schon eingegangen worden. Stattdessen sollen Personen freiwillig zu Lösungen gelangen. Personen können darüber hinaus auch mittels eines strategischen Verhaltens, d. h. eines solchen, das die wahren Absichten verdeckt, versuchen, zu einer für sie günstigen Konfliktlösung zu gelangen. Stattdessen sollen Konflikte in einem offenen Gespräch gelöst werden. Wird bei der Lösung von Konflikten und deren Vermeidung auf Freiwilligkeit und Offenheit im Gespräch Bezug genommen, so sind dieses Merkmale, die dem partnerschaftlichen Beziehungsmodell von Thomas Gordon zugrunde liegen.
Thomas Gordon wurde 1918 in einer amerikanischen Kleinstadt mit dem Namen der Weltstadt Paris geboren und verstarb im Jahr 2002. Er studierte zunächst Medizin und anschließend Psychologie, u. a. bei Carl Rogers, dem Vater der Gesprächspsychotherapie, zu dem er auch viele Jahre eine freundschaftliche Beziehung unterhielt. Das Studium wurde zwischenzeitlich unterbrochen durch Gordons Einberufung in die Armee während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Danach wurde er Unternehmensberater, zunächst in abhängiger Stellung, dann als Selbstständiger. Neben dieser Tätigkeit war Gordon später auch als Therapeut tätig. Unzufrieden mit seiner therapeutischen Tätigkeit wandte er sich seit 1962 vornehmlich dem Thema zu, wie sich Beziehungen zwischen Personen verbessern lassen. Gordon hatte sich schon in früheren Jahren mit diesem Thema beschäftigt und zwar in Bezug auf demokratisches Führungsverhalten in Organisationen. Später wurde das Modell partnerschaftlicher Beziehungen auch auf andere Personengruppen übertragen (vgl. Breuer, Karlpeter Hrsg.: Das Gordon-Modell).
Das Gordonsche Beziehungskonzept ist nun Grundlage dieses Buches. Dabei wird auf Veröffentlichungen Bezug genommen, die das partnerschaftliche Beziehungsmodell in allgemeiner Weise zum Gegenstand haben, das heißt sich nicht mit bestimmten Personengruppen befassen.Welche Inhalte sind nun Gegenstand des Gordon-Modells? In allgemeiner Weise lässt sich sagen, dass sich Gordon mit der Lösung verschiedenartiger Probleme beschäftigt:
-Verbringen wir im Alltag viel Zeit mit anderen Personen, so erfahren wir auch häufig von ihren Problemen. Personen offenbaren sich dabei umso mehr, je intimer die Kontakte sind. Wollen wir ihnen nun bei der Lösung ihrer Probleme helfen, so stellt sich die Frage, wie das am besten geschehen soll. (a)
-Es kommt ebenso vor, dass wir beobachten, wie andere Personen miteinander streiten, ohne dass sie zu einer Lösung ihres Konflikts kommen. Möglicherweise handelt es sich um Personen, die uns nahestehen. Wir können uns dann die Frage stellen, wie es unter unserer Mithilfe möglich ist, dass der Streit gut gelöst werden kann. (b)
-Habe ich häufig Kontakte mit anderen Personen, so lässt es sich nicht vermeiden, dass sie mir gegenüber auch Verhaltensweisen zeigen, die für mich unannehmbar sind. Ich kann mich dann fragen, was ich tun kann, damit dieses Verhalten unterlassen wird. (c)
-Personen zeigen augenblicklich kein Verhalten, das für mich unannehmbar ist. Ich kann jedoch annehmen, dass das ggf. in der Zukunft der Fall ist und mir so die Frage stellen, wie ich ein derartiges Verhalten verhindern kann. (d)
- Es gibt nicht wenige Situationen, wo sowohl du ein Problem mit meinem Verhalten als auch ich gleichzeitig ein Problem mit deinem Verhalten habe. Es stellt sich dann für uns die Frage: Wie können wir unser gemeinsames Problem aus der Welt schaffen? (e)
Da sich diese Arbeit mit dem Vermeiden und einvernehmlichen Lösen von Konflikten beschäftigt, wird auf nachfolgende Gordonsche Themen Bezug genommen:
-Vermeiden von Konflikten
Ein Konflikt mit einer anderen Person kann vermieden werden, indem es mir gelingt, ein unannehmbares Verhalten einer anderen Person zu beseitigen (c) oder indem ein unannehmbares Verhalten erst gar nicht auftritt (d).
-Einvernehmliches Lösen von Konflikten
Das einvernehmliche Lösen eines Konflikts kann sich einmal darauf beziehen, dass ich einen Konflikt mit einem anderen habe, ich also in der Auseinandersetzung Partei (Betroffener) bin (e), als auch darauf, dass andere einen Konflikt miteinander haben, ich also nicht Betroffener, sondern Außenstehender bin, der eine Vermittlungsfunktion übernimmt (b).
Nicht Bestandteil dieser Arbeit ist so der Sachverhalt, dass eine andere Person ein Problem hat (a).
Wenn diese Arbeit nun Bezug nimmt auf die Gordonschen Lösungen des Umgangs mit und des Vermeidens von Konflikten, so handelt es sich um Problemlösungsmethoden, die (mittlerweile) auch Bestandteil von anderen Konzepten sind, die sich mit dieser Thematik befassen (vgl. hierzu die Literaturliste). Darüber hinaus lässt sich die Niederlagelose Methode der Konfliktlösung, ein Kernelement des Umgangs mit Konflikten, ableiten aus einem allgemeinen Problemlösungsmodell.
Zielgruppe
Vorgehensweise in der Arbeit
Das Lösen und Vermeiden von Konflikten sind die Themen dieser Arbeit. Daraus ergeben sich verschiedene Einzelthemen:
-Besteht das Ziel darin, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich Konflikte zufriedenstellend lösen oder gar vermeiden lassen, so muss zunächst einmal dargelegt werden, welche Bedeutung der Konfliktbegriff eigentlich hat.
-Es werden in dieser Arbeit mit dem Bedürfnis- und Wertkonflikt zwei Konfliktformen vorgestellt, die nach unterschiedlichen Beeinträchtigungen klassifiziert sind: Liegen Bedürfniskonflikten Bedürfnisbeeinträchtigungen zugrunde, so sind bei Wertkonflikten entsprechend Wertbeeinträchtigungen betroffen. Was nun eine Bedürfnis- von einer Wertbeeinträchtigung unterscheidet, soll zunächst verdeutlicht werden.
-In welcher Weise Konflikte vermieden bzw. gelöst werden sollen, ist mit abhängig davon, welche Wertvorstellungen vertreten werden.
-Es wird sodann die Aufmerksamkeit auf das Thema „Bedürfniskonflikte“ gelenkt. Dabei wird als erstes der Überlegung Rechnung getragen, dass es wünschenswerter ist, Konflikte zu vermeiden, als solche entstehen zu lassen. Als Mittel der Konfliktvermeidung werden dabei primär bestimmte Kommunikationsformen vorgestellt.
Liegen Bedürfniskonflikte vor, so können diese auf unterschiedliche Art und Weise gelöst werden. Mit der Niederlagelosen Methode der Konfliktlösung wird ein Instrument vorgestellt, das Konflikte im Konsens löst.
Die hier vorgestellte partnerschaftliche Form der Konfliktlösung lässt sich nur bei gleichberechtigten (symmetrischen) Beziehungen anwenden und bei hierarchischen (asymmetrischen) Beziehungen, wenn Ranghöhere die Initiative ergreifen. Es wird so zusätzlich dargelegt, welche anderen Formender Konfliktlösung noch in Betracht kommen, wenn in hierarchischen Beziehungen Rangniedere Konflikte lösen wollen.
-Als nächstes wird der Sachverhalt thematisiert, dass Konflikte auch in Form von Wertbeeinträchtigungen vorliegen können.
-Sind das Lösen von Konflikten zwischen zwei Personen sowie deren Vermeidung auch die Hauptthemen, so soll zum Schluss der Arbeit dargestellt werden, wie eine Person bei einem Konflikt zwischen anderen vermitteln kann.
Neben der Wissensvermittlung werden Empfehlungen zur Anwendung von Kenntnissen im Alltag gegeben.
Der Arbeit sind noch Anhänge zugefügt mit unterschiedlichen Inhalten:
-Leser können zu einzelnen Themen Übungen hinzufügen
-Die einzelnen Methoden der Konfliktlösung und -vermeidung werden noch einmal im Gesamtzusammenhang dargestellt.
-Schließlich erfolgen einige Überlegungen zur Anwendung des partnerschaftlichen Konfliktkonzepts auf Kinder.
1. Konfliktbegriff
(1) Einzelne Konfliktmerkmale
Welche Vorstellungen verbinden Sie mit dem Begriff „Konflikt“? Denken Sie dabei an Streit mit einer anderen Person, an Meinungsverschiedenheiten, unterschiedlichen Interessen...
Begriffe haben es oft an sich, dass verschiedene Personen diese unterschiedlich verwenden und es so zu Missverständnissen in der Kommunikation kommt.
Im alltäglichen Sprachgebrauch werden diese Missverständnisse normalerweise in der Unterhaltung erst allmählich sichtbar und äußern sich z. B. in der Aussage: „Das habe ich so nicht gemeint. Ich meine mit ….“
Der Konfliktbegriff ist nun vieldeutig, denn nicht nur im Alltag, sondern auch in der Literatur, die sich mit Konflikten beschäftigt, wird er unterschiedlich verwendet.Sollen Methoden zur Lösung oder Vermeidung von Konflikten dargestellt werden, so ist deshalb zunächst einmal darzulegen, was hier unter „Konflikt“ verstanden wird. Damit wird darauf verwiesen, welche Merkmale der Konfliktbegriff umfassen soll.
Dauerhafte und flüchtige Beziehungen
Wenn Personen einen Konflikt miteinander haben, so beinhaltet das zunächst einmal, dass sie Kontakt haben, d. h. in einer Beziehung zueinander stehen, die eher flüchtiger oder dauerhafter Art sein kann.
Ein Beispiel für eine flüchtige Beziehung ist der Kontakt von Fahrgästen, der ggf. nur Sekunden betragen und einmalig sein kann. Demgegenüber unterhalten Eheleute, Arbeitskollegen, Eltern und Kinder am Tag häufige und länger andauernde Kontakte.
Konflikte können dabei sowohl in eher flüchtigen als auch dauerhaften Beziehungen auftreten.
Ein Beispiel für einen Konflikt in einer flüchtigen Beziehung ist die Situation, dass eine Person, mit Waren in der Hand, an Kunden, die in einer Schlange vor der Kasse stehen, vorbeigeht. Ein Kunde sagt zu der sich vordrängenden Person, dass sie sich gefälligst hinten anzustellen habe. Die Person ignoriert jedoch den Einwand und stellt sich trotzdem vorne an.
Jedoch beeinflusst möglicherweise die Dauer einer Beziehung die Art der Konfliktlösung: Bei Konflikten in dauerhaften Beziehungen sind eher die Konsequenzen des Konfliktverhaltens zu berücksichtigen als in flüchtigen.
Sehe ich eine Person nach der Konfliktaustragung nicht mehr wieder, so muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob diese Person mir eine egoistische Art der Konfliktaustragung bei Gelegenheit heimzahlen wird. Derartige Überlegungen sind jedoch in dauerhaften Beziehungen von Bedeutung.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Aufmerksamkeit auf dauerhafte Beziehungen gelenkt.
Unvereinbarkeiten
Wird von einem Konflikt zwischen Personen in einer Beziehung gesprochen, so beinhaltet das weiterhin, dass Nichtübereinstimmungen/ Unvereinbarkeiten vorliegen:
- Personen können unterschiedliche Ziele verfolgen, Einstellungen (Werte) haben oder aktuelles Verhalten unterschiedlich (d. h. der eine positiv, der andere negativ) bewerten. Im Rahmen dieser Arbeit bezieht sich Verschiedenheit darauf, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten ausführt und dieses Verhalten unterschiedlich bewertet wird: Die ausführende Person findet ihr Verhalten annehmbar, die andere Person hingegen unannehmbar.
So kann die Person, die sich mit ihren Waren nicht in der Schlange anstellt, sondern zielstrebig zur Kasse geht, der Meinung sein, dass das in Ordnung ist, da sie ja nur zwei Lebensmittel in der Hand habe und zudem in Eile sei. Für viele Personen, die in der Schlange stehen, hingegen ist das Verhalten unannehmbar, „weil sich jeder in der Schlange anzustellen habe“ und sie zudem dadurch später mit ihren Einkäufen fertig werden.
-Die Unvereinbarkeit besteht dann darin, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten weiter ausführen möchte, hingegen die andere Person sich wünscht, dass das Verhalten unterlassen wird.
(2) Konfliktbezeichnung
Ausgehend von diesen Überlegungen wird nun der Konfliktbegriff wie folgt verwendet:
a) Eine Person führt ein Verhalten aus, das für eine andere Person unannehmbar ist.
b) Die das Verhalten ausführende Person, weiß, dass das Verhalten für die andere Person unannehmbar ist .
c) Sie führt trotz allem weiterhin das Verhalten aus.
Die Konfliktdefinition orientiert sich an Thomas Gordon und soll im Folgenden mittels jeweils eines Beispiels aus dem Familien-, Ehe- und Arbeitsbereich verdeutlicht werden:
1) Familie
a) Die Mutter stört das laute Fernsehen ihres Sohnes.
b) Die Mutter hat das ihrem Sohn heute Vormittag auch schon gesagt.
c) Der Sohn macht das Fernsehen trotzdem am Nachmittag nicht leiser.
2) Ehe
a) Die Ehefrau findet es nicht gut, dass ihr Mann häufig Gewaltfilme ansieht.
b) Sie hat das ihrem Mann gestern noch gesagt.
c) Der Ehemann schaut jedoch auch heute Gewaltfilme an.
3) Arbeit
a) Wenn Herr S. morgens im Büro erscheint, ist die Heizung noch nicht an und das Fenster auf.
b) Herr S. hatte Herrn H., der morgens 30 Minuten früher da ist, Freitag letzter Woche noch gebeten, die Heizung morgens frühzeitig anzustellen und das Fenster zu schließen.
c) Als Herr S. montags ins Büro kommt, ist die Heizung wieder aus und das Fenster steht offen.
Sind die vorangehenden Beispiele auf aktuell vorliegendes Verhalten abgestellt, so liegt ein Konflikt darüber hinaus auch dann vor,
-wenn eine Person die Absicht hat, ein Verhalten auszuführen, das für eine andere Person unannehmbar ist
-die Person weiß, dass ihr Verhalten für die andere Person unannehmbar ist,
-und sie trotzdem an der Absicht festhält.
(3) Kein Konflikt
Wann liegt ein Konflikt nicht vor? Diese Frage soll beantwortet werden, um so zu einem vertieften Konfliktverständnis zu gelangen:
-Meinungsunterschiede