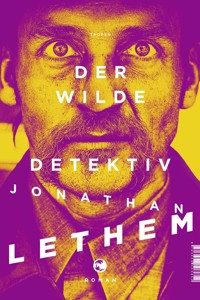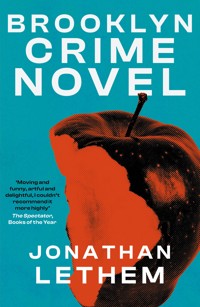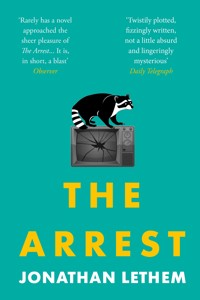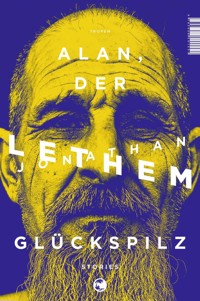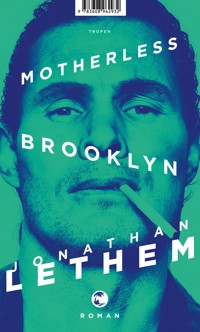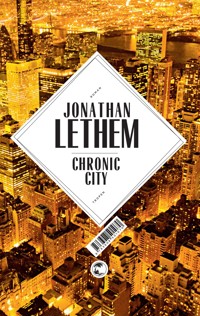
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chase Insteadman, ein ehemaliger Kinderstar, ist fester Bestandteil der New Yorker High Society. Sein soziales Ansehen verdankt er einem Unglück, das in der Klatschpresse für Furore sorgt: Seine Verlobte Janice Trumbull schwebt manövrierunfähig im Weltraum, von wo sie ihm herzzerreißende Liebesbriefe schreibt. Auch Chase treibt haltlos durch seinen Alltag, bis er den schielenden Kulturkritiker Perkus Tooth kennenlernt. Zwischen Migräneanfällen und durchkifften Nächtenscheint er als Einziger durch die glitzernde Oberfläche auf die Realitätzu blicken. Gemeinsam versuchen sie das Rätsel um einen Tiger, die Nebelschwaden über der Wall Street und den Schokoladengeruch in Manhattan zu lösen. Dabei entdecken sie auf der Insel, auf der alles käuflich ist, etwas äußerst Seltenes: die Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Besuchen Sie uns im Internet: www.tropen.de Tropen Die Originalausgabe erschien 2009 im Verlag Doubleday, New York © by Jonathan Lethem Für die deutsche Ausgabe © 2011 by J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Cover: Herburg Weiland Abbildung: Serge Kozak / corbis Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig Printausgabe: ISBN 978-3-608-50107-0 E-Book: ISBN 978-3-608-10175-1
Cover
Haupttitel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Dank
Über den Autor
Für Amy und Everett
Ich begegnete Perkus Tooth zum ersten Mal in einem Büro. Allerdings nicht in einem, in dem er arbeitete, auch wenn ich das damals durcheinandergebracht habe – für mich übrigens nichts Ungewöhnliches.
Es war an einem normalen Spätsommernachmittag in der Geschäftsstelle der Criterion Collection an der Ecke 52nd Street und Third Avenue. Ich war dort, um eine Reihe von Audiokommentaren für die DVD-Neuausgabe des »verschollenen« Film noir Die Stadt als Labyrinth aus den Fünfzigern aufzunehmen. Meine Aufgabe war es, den Text des kürzlich verstorbenen Autorenfilmers Von Tropen Zollner einzusprechen. Ich sollte einige seiner Statements aus Interviews und Artikeln für eine begleitende Dokumentation lesen, die die Programmgenies bei Criterion, von denen ich zwei bei einer Dinnerparty kennengelernt hatte, gerade vorbereiteten. Um mich für das Projekt zu begeistern, hatten sie mir einen Berg von Archivmaterial zur Verfügung gestellt, den ich beiläufig durchgegangen war, sowie eine Vorabversion des rekonstruierten Films. Es war das erste Mal, dass ich den Namen Von Tropen Zollner gehört hatte, also hielt sich meine Begeisterung zunächst in Grenzen. Aber der Enthusiasmus von Cineasten ist ansteckend, und mir gefiel der Film. Mich selbst sah ich eher als Schauspieler im Ruhestand. Solche Sachen waren das Einzige, was ich als Abgesang auf meinen mittlerweile verblassenden Ruhm als ehemaliger Kinderstar noch annahm. Eine wirklich exzentrische Gefälligkeit. Außerdem war ich neugierig darauf, die Räume von Criterion zu sehen. Gerade Anfang September, wenn die Schulferien zu Ende gingen, kribbelte es mich immer, meinem Müßiggang etwas entgegenzusetzen. Janice war weit weg, und ich verlor mich in Oberflächlichkeiten: Partys, Klatsch, Rendezvous, bei denen ich Mittelsmann war oder vertrauensvoller Freund. Arbeitswelten faszinierten mich, Schnittstellen, an denen Manhattans Fassade der praktischen Realität wich.
Ich sprach Zollners Worte in einem Aufnahmestudio inmitten der beengten, baufälligen Räumlichkeiten von Criterion ein. In der Kabine, von der aus der Toningenieur mir über Kopfhörer Anweisungen gab, saß auch ein Restaurator, der auf einem Bildschirm mit der Maus fleißig Kratzer und Flecken von nackt im Matsch herumtollenden Hippies wegretuschierte. Mir war gesagt worden, er restauriere Ich bin neugierig – gelb. Anschließend wurde ich von Susan Eldred, der Produzentin, die mich engagiert hatte, abgeholt. Es waren Susan und eine Kollegin gewesen, die ich auf der Dinnerparty kennengelernt hatte – unvoreingenommene, begeisterungsfähige Menschen mit einer Leidenschaft für den Mikrokosmos filmischen Wissens, die mir sofort sympathisch gewesen waren. Susan führte mich zu ihrem Büro, einer Art Höhle mit einem armseligen Fenster und überbordenden Regalen voller Videobänder, weiteren verschollenen Filmen, die nach Rettung schrien. Anscheinend musste sich Susan das Büro teilen. Nicht mit ihrer Kollegin von der Party, sondern mit jemand anderem. Ein Mann saß unter den durchgebogenen Regalbrettern, ein Notizbuch in der Hand, den Blick in die Ferne gerichtet. Das Büro schien eigentlich zu klein für zwei zu sein. Die Strahlkraft der Marke Criterion passte nicht zu diesem ärmlichen und improvisierten Eindruck, den ich bei meinem Blick hinter die Kulissen gewonnen hatte, aber warum sollte er auch? Erst als Susan zu einer Besprechung gerufen wurde, stellte sie mich Perkus Tooth vor und gab mir ein Formular zum Unterschreiben.
Bei dieser ersten Begegnung war er völlig weggetreten, in einem seiner »ellipsistischen« Zustände, wie ich es bald zu nennen lernte. Perkus Tooth selbst steuerte später die Erklärung bei: ellipsistisch wie in »Ellipse«. Eine Art leeres Intervall, eine Absenz oder psychische Auszeit, in der er weder deprimiert noch euphorisch war, weder einen Gedanken beenden noch einen neuen beginnen wollte. Einfach dazwischen. Pausentaste gedrückt. Ich muss ihn ziemlich angestarrt haben. Mit seiner Schildkrötenhaltung und der völligen Schlaffheit seines Wesens, der hohen Stirn und der altmodischen Kleidung – eng geschnittener Anzug aus zerknittertem, fadenscheinigem Seidenstoff, ausgelatschte Turnschuhe – hätte man ihn für älter halten können. Als er sich wieder rührte, fuhr seine Hand über die offene Seite des Notizbuchs, als nähme sie ein Diktat mit einem unsichtbaren Stift auf, und ich betrachtete sein blasses, jungenhaftes Gesicht. Ich schätzte ihn auf über fünfzig, womit ich immer noch zehn Jahre zu hoch lag. Perkus Tooth war gerade mal Anfang vierzig, kaum älter als ich. Ich hatte ihn für alt gehalten, weil er wichtig gewirkt hatte. Er blickte jetzt auf, und unter seinem Schlupflid sah ich ein braunes Auge unkontrolliert in Richtung Nase wandern. Das Auge wollte querschießen, wollte die ganze besonnene Ausstrahlung mit einem komischen Streich diskreditieren. Sein anderes Auge ignorierte diesen Eröffnungszug und richtete sich auf mich.
»Du bist der Schauspieler.«
»Ja«, sagte ich.
»Also, ich schreib das Begleitheft. Für Die Stadt als Labyrinth.«
»Oh, toll.«
»Ich mach das oft. Ouvertüre um Mitternacht … Widerspenstige Frauen … Die unheilige Stadt … Echolalie …«
»Alles Film noir?«
»Oh, Mann, nein. Hast du noch nie Echolalie von Herzog gesehen?«
»Nein.«
»Tja, ich hab den Text dazu geschrieben, aber er ist noch nicht veröffentlicht. Ich versuch immer noch, Eldred zu überreden …«
Perkus Tooth, so erfuhr ich später, nannte jeden beim Nachnamen. Ob berühmt oder berüchtigt. Seine Geisteswelt war episch, bevölkert von hoch aufragenden Figuren ähnlich den Köpfen der Osterinsel. In dem Moment kam Eldred – Susan – zurück ins Büro.
»Also«, sagte er zu ihr, »hast du hier irgendwo das Video von Echolalie?« Er richtete seine Augen, das gesunde linke und das umherirrende rechte, auf ihre Regale, die Kakophonie bekritzelter Etiketten dort. »Er soll es sich anschauen.«
Susan zog die Augenbrauen hoch, und er schrumpfte zusammen. »Ich weiß nicht, wo es ist«, sagte sie.
»Schon gut.«
»Hast du meinen Gast genervt, Perkus?«
»Wie kommst du drauf?«
Susan Eldred wandte sich mir zu und nahm das unterschriebene Formular an sich, dann verabschiedeten wir uns. Als ich in den Fahrstuhl stieg, zwängte sich Perkus Tooth, den antiquierten Filzhut auf den Kopf gepresst, noch schnell durch die sich schließenden Türen. Der Fahrstuhl war, wie so viele in den Gebäuden von Midtown, eine winzige Mausefalle, kaum größer als ein Speiseaufzug – es gab keinen Spielraum, so zu tun, als wären wir uns nicht gerade erst in dem Büro begegnet. Das schlechte Auge mäanderte leicht, und Perkus Tooth warf mir einen abwesenden Blick zu, weder unfreundlich noch entschuldigend. Trotz der klassischen Kleidung war er kein gediegener Retrofetischist. Sein Hemdkragen sah schmuddelig und verknittert aus. Die grüngrauen Turnschuhe wie versteinerte Schwämme in einem Putzeimer.
»Also«, sagte er wieder. Dieses »Also« von Perkus, seine Angewohnheit, jedes Thema einzuleiten, als führte es ein früheres Gespräch fort, war keineswegs aufdringlich. Es war eher so, als wäre er gerade aus einem Tagtraum erwacht und hielte die aufrüttelnde Stimme in seinem Kopf für die seines Gegenübers. »Also, dann leih ich dir eben meine Kopie von Echolalie, obwohl ich sonst nie was verleihe. Du musst ihn einfach sehen.«
»Gerne.«
»Es ist eine Art filmischer Essay. Herzog hat ihn am Set von Morrison Grooms Bei weitem nicht gedreht. Wie du weißt, ist Grooms Film ja nie fertig geworden. Echolalie dokumentiert Herzogs Versuche, Marlon Brando am Set zu interviewen. Brando will aber nicht, und immer wenn Herzog ihn abfängt, plappert Brando einfach nach, was Herzog sagt … du weißt schon, Echolalie …«
»Ja«, sagte ich, verblüfft, wie ich es später noch so oft sein sollte, über den reißenden Strom an Informationen aus Perkus Tooths Mund.
»Aber ist auch die einzige Möglichkeit, was von Bei weitem nicht zu sehen. Morrison Groom hat das Filmmaterial vernichtet, so dass die Szenen in Echolalie ironischerweise alles sind, was von dem Film übrig ist …«
Wieso »ironischerweise«? Ich traute mich nicht zu fragen. »Einfach unglaublich«, sagte ich stattdessen.
»Du weißt natürlich, dass Morrison Grooms Selbstmord wahrscheinlich nur vorgetäuscht war.«
Mein Nicken war eine Lüge. Die Fahrstuhltüren öffneten sich, und wir stolperten gemeinsam hinaus auf den Gehweg, wobei wir uns vor jeder Türschwelle in die Quere kamen: »Du zuerst …«, »Ups …«, »Nach dir …«, »Tschuldigung.« Wir standen einander gegenüber, die mittwochnachmittäglichen Passantenströme Manhattans flossen um uns herum wie um Inseln. Perkus Tooth war auf einmal sehr kurz angebunden, vielleicht nachträglich darauf bedacht, mir nicht auf die Nerven zu gehen.
»Also, ich bin weg.«
»Es hat mich gefreut, dich zu treffen.« Ich benutzte das Wort »kennenlernen« schon lange nicht mehr, sondern hatte es durch diese schwammige Aussage ersetzt, nachdem mir zum tausendsten Mal jemand erklärt hatte, dass wir uns schon zuvor kennengelernt hätten.
»Also …« Er blieb erwartungsvoll stehen.
»Ja?«
»Wenn du dir das Video abholen willst …«
Das konnte ein Test sein, ich war mir nicht sicher. Perkus Tooth handelte mit okkultem Wissen und maß mit geheimem Zirkel. Ich wusste nie, wann ich eine Linie überschritt, die allein für ihn sichtbar war.
»Hast du eine Karte?«
Er blickte finster drein. »Eldred weiß, wo ich zu finden bin.« Sein Stolz hatte sich gemeldet, und weg war er.
Für einen derart lebensverändernden Anruf hätte ich eigentlich gute Gründe haben sollen. Und doch meldete ich mich später am Nachmittag telefonisch bei der Empfangsdame von Criterion und fragte zuerst nach Perkus Tooth und dann, als sie behauptete, den Namen nicht zu kennen, nach Susan Eldred, angetrieben von nichts weiter als einem Cocktail aus zwei Teilen Übermut und einem Teil Pflichtgefühl. Ich bin Manhattans freiwilliger Helfer, das gebe ich gerne zu. War ich neugierig auf Echolalie oder Morrison Grooms angeblichen Selbstmord oder Perkus Tooths merkwürdige Intensität oder das Verrutschen seines rechten Auges? Auf alles und nichts davon, war die einzige Antwort. Vielleicht bewunderte ich Perkus Tooth da schon und spürte, dass ich seiner Freundschaft bedurfte, um die nächste eigentümliche Phase meines Lebens einzuläuten. Um mich aus dem seltsamen Strudel zu befreien, in den ich geraten war. Die Heftigkeit, mit der ich Perkus nach unserer ersten Begegnung verfiel, macht es schwer zu beurteilen, inwieweit solche Gefühle von Anfang an unterschwellig vorhanden waren.
»Dein Büronachbar«, sagte ich. »Am Empfang kannten sie seinen Namen nicht. Vielleicht habe ich ihn nicht richtig verstanden …«
»Perkus?« Susan lachte. »Der arbeitet nicht hier.«
»Er sagte, er schreibe eure Begleittexte.«
»Er hat ein paar geschrieben, stimmt. Aber er arbeitet nicht hier. Er kommt nur manchmal vorbei und macht sich breit. Ich bin so was wie sein Babysitter. Ich bemerke ihn oft nicht mal mehr – du hast ja gesehen, wie er ist. Ich hoffe, er hat dich nicht belästigt.«
»Nein … überhaupt nicht. Ich wollte ihn eigentlich anrufen.«
Susan Eldred gab mir Perkus Tooths Nummer, dann machte sie eine Pause. »Wahrscheinlich hast du seinen Namen schon mal gehört …«
»Nein.«
»Na ja, er ist schon ein ziemlich toller Kritiker. Als ich auf der NYU war, haben meine Freunde und ich ihn vergöttert. Und als ich ihn dann zum ersten Mal engagieren konnte, lag ich ihm zu Füßen. Es war unglaublich, wie jung er damals war, obwohl ich mit seinen Postern aufgewachsen bin.«
»Postern?«
»Er hat seine Tiraden auf Poster geschrieben und sie überall in Manhattan aufgehängt, brillante Kritiken von allem möglichen: dem aktuellen Tagesgeschehen, Mediengerüchten, Kunst im öffentlichen Raum. Sie waren selbst Kunst im öffentlichen Raum. Alle fanden das sehr geheimnisvoll und wichtig. Dann wurde er vom Rolling Stone angeheuert. Er bekam dort eine große Kolumne, Hunter-S.-Thompson-trifft-Pauline-Kael, so in der Art. Wenn du weißt, was ich meine.«
»Klar.«
»Nun, die Sache ist die, er ist vielen Leuten gehörig auf die Nerven gegangen mit … paranoidem Kram. Ich merkte das erst, als ich anfing mit ihm zusammenzuarbeiten. Versteh mich nicht falsch, ich mag Perkus wirklich sehr. Ich möchte nur nicht, dass du das Gefühl bekommst, ich verschwende deine Zeit oder ziehe dich rein in irgendwelche … Verschwörungen.«
Es ist absurd, wie protektiv Leute sein können, als wäre die Zeit eines abgehalfterten Schauspielers besonders wertvoll. Das war wohl eine Projektion, eine Übertragung von Janice’ außerirdischem Auftrag. Ich hatte eine medienwirksame Liebesbeziehung mit einer Frau, die keine Zeit hatte, nicht einmal einen Atemzug, denn sie befand sich an einem Ort jenseits aller Terminkalender, jeder ihrer Atemzüge war ihr aus Sauerstofftanks zugemessen. Wenn mir also eine Astronautin Zeit einräumte, mussten meine eigenen Prioritäten ähnlich sein. Das Gegenteil war der Fall.
»Danke dir«, sagte ich. »Ich passe auf, dass ich mich nirgendwo reinziehen lasse.«
Wie sich herausstellte, wohnte Perkus Tooth in meiner Nachbarschaft. Sein Apartment befand sich sechs Blocks von meinem entfernt, auf der East 84th Street, in einem dieser anonymen Kaninchenställe, versteckt hinter unscheinbaren Ladenfronten, Gebäude ohne Lobby, geschweige denn einen Doorman. Der Laden darunter, Brandy’s Piano Bar, war ein schmierig wirkendes Nachtlokal, an dem ich vielleicht schon tausendmal vorbeigekommen war, ohne es ein einziges Mal wahrgenommen zu haben. LIEBE BRANDY’S-GÄSTE, NEHMT BITTE RÜCKSICHT AUF DIE NACHBARN!, bat ein kleines Schild am Eingang und weckte damit Assoziationen von unzähligen Beschwerden und Polizeieinsätzen wegen Lärm und Zigarettenqualm. In Manhattan zu leben bedeutet, ständig darüber zu staunen, wie viele Welten hier ineinander verschachtelt sind, mit welch chaotischer Komplexität sie sich verschränken, ähnlich den Fernsehkabeln und den Wasser-, Heizungs- und Abflussrohren, die gemeinsam dieselben Schächte bevölkern, die Straßenarbeiter regelmäßig vor unseren vorbeiziehenden, verwirrten Blicken freilegen. Wir tun nur so, als lebten wir auf etwas so Geordnetem wie einem Raster. Während ich auf das Summen von Perkus Tooths Türöffner wartete, spürte ich, wie sich mein innerer Stadtplan dehnte, um die Wirklichkeit dieses Ortes aufzunehmen: das unregelmäßige Schachbrettmuster des Flurbodens, den widerlichen Zitrusgeruch des Desinfektionsmittels, die Reihe von verbeulten, bronzefarbenen Briefkästen und das Kläffen eines Hundes hinter einer Tür im Obergeschoss, aufgescheucht durch die Klingel und meine schlurfenden Stiefelabsätze. Ich glaube erst an etwas, wenn ich es sinnlich erfahre.
Perkus Tooth wohnte in 1R, einen halben Stock höher, auf der Rückseite des Gebäudes. Er öffnete seine Tür gerade so weit, dass ich hineinschlüpfen konnte, direkt in seine Küche. Obwohl er barfuß war, trug er wieder einen altmodisch anmutenden Anzug, diesmal aus grünem Kord, was aber schon das einzig Förmliche war. Die Wohnung war die reinste Künstlerbude, die Küche nur in dem Sinne eine Küche, als dass ein Spülbecken und ein Herd vorhanden waren und in einer Nische neben der Badezimmertür ein mit Aufklebern übersäter Kühlschrank klemmte. Die offenen Hängeschränke über der Spüle waren vollgestopft mit Büchern. Die Arbeitsplatte war zugestellt mit einem CD-Player und Hunderten von CDs, mit und ohne Schutzhülle, viele davon handbeschriftet mit einem wasserfesten Filzstift. Ein Heizungsrohr pfiff. Dahinter lagen die anderen Räume des Apartments am helllichten Tag mit zugezogenen Vorhängen düster da. Wahrscheinlich gingen sie nur auf den Luftschacht oder eine schmale Gasse hinaus.
Dann gab es noch die Straßenplakate, von denen Susan Eldred gesprochen hatte. Ungerahmt, mit Heftzwecken an jeder freien Stelle befestigt, hingen sie da, Perkus Tooths berühmte Poster. Das Papier vergilbt, die Typo schwankend zwischen einer stilisierten Cartoon- oder Graffitischrift und dem obsessiven Gekritzel eines Autodidakten oder Schizophrenen, wie er im Lehrbuch stand. Ich erkannte sie wieder. Erinnerte mich an sie. Vor zehn Jahren waren sie in Downtown allgegenwärtig gewesen, auf Bauzäunen, quer über U-Bahn-Werbungen, Teil der graphischen Vielstimmigkeit der Stadt, die man wehrlos aus den Augenwinkeln wahrnimmt.
Perkus trat zurück, damit ich die Tür schließen konnte. So unbeholfen, wie er in seinem Anzug in der Mitte des Zimmers dastand, die Handflächen abwehrend erhoben, als könnte etwas Unangenehmes in seine Richtung geflogen kommen, erinnerte er mich an ein Edvard-Munch-Gemälde, ein Selbstporträt, das den Maler mit aufgerissenen Augen und Schnurrbart zeigt, eingesunken in seiner Kleidung. Ich habe Perkus auch danach nicht ein einziges Mal ohne wenigstens ein Anzugteil gesehen, selbst wenn es nur die Hose zusammen mit einem versifften weißen T-Shirt war. Jeans trug er nie.
»Ich hol dir das Video«, sagte er, als hätte ich ihn dazu aufgefordert.
»Prima.«
»Ich muss es suchen. Setz dich doch …« Er zog einen Stuhl unter einem dieser kleinen, linoleumbeschichteten Tische hervor, wie man sie aus Diner-Restaurants kennt. Der Stuhl passte zum Tisch – ein Sammlerstück. Ein großer Sammler war Perkus Tooth jedenfalls schon mal. »Hier.« Er nahm einen perfekt gedrehten Joint vom Rand des Aschenbechers, schob ihn sich zwischen die Lippen und zündete die Spitze an, dann reichte er ihn ungefragt mir. Gleich und gleich gesellt sich gern, nehme ich an. Ich zog daran, während er ins andere Zimmer ging. Als er zurückkam – mit einer VHS-Kassette, seinen Turnschuhen und einem Paar zusammengeknüllter Socken –, nahm er den Joint entgegen und tat selbst einen tiefen Zug.
»Sollen wir was essen gehen? Ich war den ganzen Tag noch nicht draußen.« Er schnürte seine High Tops.
»Klar«, sagte ich.
»Draußen«, so sollte ich nun erfahren, war für Perkus Tooth gewöhnlich nicht besonders weit weg. Er aß gerne in einem hellerleuchteten Fastfood-Laden namens Jackson Hole um die Ecke auf der Second Avenue, einem Schuppen mit viel glänzendem Chrom und einer neueren, nachgeahmten Version des Linoleumtischs in seiner Küche, eingequetscht zwischen voluminösen roten Sitzecken aus Vinyl. Um vier Uhr nachmittags waren wir dort ziemlich allein auf weiter Flur, die Jukebox plärrte irgendwelche Hits, die unser wirres, vernebeltes Gerede übertönten. Es war eine Zeitlang her, seit ich Gras geraucht hatte; alles lag in einem Dämmerzustand, Signale wurden empfangen durch eine Atmosphäre, die sich zusammensetzte aus Verzögerungen, das ganze Universum trieb völlig losgelöst dahin wie Perkus’ vagabundierendes Auge. Die Kellnerin schien ihn zu kennen, doch er grüßte sie nicht und schaute auch nicht auf die Speisekarte. Er bestellte einen Cheeseburger Deluxe und eine Coca-Cola. Überfordert schloss ich mich an. Perkus schien an diesem Ort zu Hause zu sein, genau wie bei Criterion, gleichgültig, selbstvergessen, als wäre er hier geboren worden, ohne je von dem Ort Notiz genommen zu haben.
Beim Essen schwadronierte Perkus über Werner Herzog und Marlon Brando und Morrison Groom, um dann zu verkünden, was er bislang von mir hielt. »Also, bis jetzt bist du damit durchgekommen, einfach nur nett zu sein, nicht wahr, Chase?« Seine spinnenartigen Finger hielten den tropfenden, fettigen Jackson-Hole-Burger dabei vor sein Gesicht, weit genug entfernt von seinem Schoß, um den feinen Zwirn nicht zu gefährden. Ein Auge fixierte mich, während das andere hin und her glitt wie ein Skalpell, das mein Gesicht sezierte. »Du hast dich nicht verändert, du bist wie ein verträumtes Kind, das ist das Geheimnis deiner Ausstrahlung. Aber sie lieben dich dafür. Sie schauen dich an, als wärst du noch im Fernsehen.«
»Wer?«
»Die Reichen. Die Manhattaner Oberschicht – du weißt, wen ich meine.«
»Ja«, sagte ich.
»Du sollst der traurigste Mensch in ganz Manhattan sein«, fuhr er fort. »Wegen der Astronautin, die nicht nach Hause kann.«
Keine große Überraschung, auch Perkus kannte mich als Janice Trumbulls Verlobten. Mein Liebeskummer war tägliches Nachrichtenfutter. Ja, ich liebte Janice Trumbull, die Amerikanerin, die mit den Russen im Orbit gefangen war, die Astronautin, die nicht nach Hause konnte. Abgesehen von meiner Berühmtheit als Fernsehkinderstar war es das, weswegen man mich kannte, auch wenn Leute wie Susan Eldred zu höflich waren, um es zu erwähnen.
»Dafür bewundert dich jeder.«
»Kann schon sein.«
»Aber ich kenn dein Geheimnis.«
Ich war überrascht. Hatte ich ein Geheimnis? Wenn ja, dann gehörte es zu den Dingen, die mir in den letzten Jahren entfallen waren. Ich konnte mich weder daran erinnern, wie ich von dort hierher gekommen war, Entscheidungen getroffen hatte, die mich vom Kinderstar zum harmlos ausschweifenden Manhattaner Prominenten hatten werden lassen, noch wie ich mir die Liebe einer tapferen Astronautin verdient hatte. Ich hatte sogar Schwierigkeiten, mir Janice klar ins Gedächtnis zu rufen. Am Tag, als sie zur Raumstation gestartet war, muss ich aufgehört haben, an sie zu denken, obwohl ich versprochen hatte, auf Erden für sie Wache zu halten. Ich habe das nie jemandem erzählt. Wenn ich also ein Geheimnis hatte, dann jenes, dass ich mein Geheimnis vergessen hatte.
Perkus warf mir einen verschlagenen Blick zu. Vielleicht war es seine Art, jedem neuen Bekannten solche Ansagen zu machen, um zu sehen, was man preisgab. »Halt Augen und Ohren offen«, sagte er mir jetzt. »Du bist in einer Position, in der du viel in Erfahrung bringen kannst.«
Was sollte ich in Erfahrung bringen? Bevor ich fragen konnte, waren wir vom Thema abgekommen. Perkus schwafelte über Monte Hellmann, Semina Culture, Greil Marcus’ Lipstick Traces, die Erpressung von J. Edgar Hoover durch die Mafia mit erotischen Geheimnissen (weshalb die Angst zu Zeiten des Kalten Krieges absichtlich weiter geschürt wurde, was wiederum zu unserer heutigen politischen Landschaft geführt hatte), Wladimir Majakowski und die Futuristen, Chet Baker, Nothingism, die unheilige Säuberung des Times Square während Giulianis Amtszeit, das Geniale an der Gnuppet Show, Frederick Exley, Jacques Rivettes unanschaubaren 13-Stunden-Film Out 1, den generellen Niedergang der Künste durch den Kommerz, Slavoj Žižeks Ausführungen über Hitchcock, Franz Marplots über G. K. Chesterton, Norman Mailers über Muhammad Ali, Norman Mailers über Graffiti und das Weltraumprogramm, Brando als Ikone der Revoluzzer, Brando als Sexgott, Brando als Napoleon im Exil. Namen, die ich zum Teil kannte, zum Teil nicht. Andere, die ich schon mal gehört hatte, ohne über sie nachzudenken. Mailer, wieder und wieder, und Brando, noch viel öfter – diese beiden robusten und unberechenbaren Giganten schienen Perkus Tooths Säulenheilige zu sein, gegen die er, ohne Hintern in seiner bleistiftdünnen Anzughose, nur umso zerbrechlicher und harmloser wirkte. Vielleicht aß er Jackson-Hole-Burger, um sich zu mästen, an Körperumfang zuzulegen, in der Hoffnung, Norman und Marlon, seine Gleichgesinnten, auf sich aufmerksam zu machen.
Er ließ sich von der Kellnerin auch seinen Literbecher Cola nachfüllen und spülte dann, als es Abend wurde, noch einmal mit schwarzem Kaffee nach. Die bekiffte Wirrheit unseres Gesprächs wurde nun abgelöst von Koffeinkicks, die wie dröhnende Fokker-Maschinen unsere Nebelbank durchstießen. Ob ich den New Yorker lesen würde? Diese Frage schien von enormer Wichtigkeit zu sein. Es war nicht ein bestimmter Autor oder Artikel, der ihm Sorge bereitete, sondern die Schrift. Die Botschaft war eingebettet, auf einer unterbewussten Ebene, wenn man sich die Zeitschrift nur anschaute; das Siegel, wie er es nannte, mit der die Typographie und das Layout jeden dialektischen Gedanken versahen. Den New Yorker zu lesen bedeutete laut Perkus, dass man von vornherein zustimmte, nicht dem New Yorker, sondern erschreckenderweise sich selbst. Es fiel mir schwer, das zu verstehen. Offensichtlich kam hier die Paranoia zum Vorschein, vor der mich Susan Eldred gewarnt hatte: Die Schrift des New Yorker kontrollierte oder okkupierte vielleicht sogar Perkus Tooths Denken. Um sich zur Wehr zu setzen, tippte er häufig Artikel ab und druckte sie in einer einfachen Courier aus, ein Versuch, das repressive Bezugssystem der Zeitschrift aufzulösen. Einmal traf ich ihn in seinem Apartment auf dem Teppich kniend mit einer Schere in der Hand an, als er gerade dabei war, wütend eine Ausgabe zu zerschneiden und neu zu arrangieren, um die teuflische Wirkung auf sein Gehirn zu brechen. »Also«, fragte er ein anderes Mal völlig unerwartet, »wie wird ein New Yorker-Autor ein New Yorker-Autor?« Hinter dem scheinbar zwanglosen »Also« verbarg sich die nackte Angst. Auf seine Frage gab es keine Antwort.
Aber ich bringe hier sicher einiges durcheinander. Können wir beim allerersten Mal über so vieles geredet haben? Auf jeden Fall über den New Yorker. Giulianis Verkauf des Times Square an Disney. Mailer über die Nasa als bürokratischen Traumvernichter. J. Edgar Hoover in den Fängen der Mafia, die Kommunistenjagd und das nützliche Einträufeln von Angst in die amerikanische Psyche. Innerhalb dieser Variationen wurde das Thema immer wieder geistreich und neu vorgebracht. Kurz, die menschliche Freiheit war aus dem Blickfeld und auf die Ebene des Unterbewussten verbannt worden, sie war eingeengt, abgetrennt und amnesiert worden. Perkus Tooth benutzte dieses Wort, ohne es zu erklären – er meinte damit etwas, das die Mafia tun würde, wie einen Schlag auf den Kopf oder eine Auslöschung. Alles Überlebenswichtige war dieser Wahrnehmungsverschwörung zum Opfer gefallen. Mehr noch, immer hatte jeder Schuld; wenn man die Verdächtigen aufzählte, begann man am besten mit sich selbst. Komplizenschaft, ihn selbst eingeschlossen, war Perkus Tooths einzige zweifelsfreie Überzeugung. Das Schlimmste war zu glauben, man wüsste etwas, ein Fehler, zu dem die Schrifttype des New Yorker verleitete. Der Horizont des Alltags war ein Tagtraum der Massen – alles, was zählte, lag darunter.
Mittlerweile hatten wir für unser Essen bezahlt und waren in sein Apartment zurückgekehrt. Wir saßen am Esstisch, und er siebte aus einem Häufchen Gras die Samen heraus, dann drehte er einen weiteren Joint. Das Dope kam aus einem kleinen Plastikdöschen mit bedrucktem Etikett, auf dem in Regenbogenfarben eine Art Markenbezeichnung stand: CHRONIC. Wir rauchten den neuen Joint unbarmherzig bis zum Ende und quatschten weiter, Perkus jetzt frei gestikulierend. Bei all seiner Vehemenz bekam er jedoch nie einen roten Kopf, wirklich nie, noch hyperventilierte er. Die fiebrigen Worte wurden mit einer gnadenlosen Coolness dargeboten. Wie der Schnitt seines Anzugs, so verknittert der auch sein mochte. Und wie die peinlich genaue Beschriftung der Videobänder und CDs. Perkus Tooth hatte vielleicht ein wahnsinniges Auge, aber es diente geradezu als Warnung, seine Skrupel nicht zu unterschätzen. Er folgte der Skepsis seines Zuhörers aufmerksam und nahm in seiner Argumentation kleine Anpassungen vor, die Zeichen eines gesunden Verstandes sind: die zwischenmenschliche Realpolitik der Überredung. Das Auge war verrückt, der Rest von ihm aber beinahe stählern.
Perkus durchwühlte seine CDs, um einen Song zu finden, den er mir vorspielen wollte, einen Song, den ich nicht kannte: Peter Blegvads »Something Else (Is Working Harder)«. Für mich hörte sich das Lied wie ein wütender und zusammenhangsloser Blues an, voller Verbitterung über diejenigen, »die mit einem Mord davonkommen«. Als hätte die Musik ihn aufgewühlt, drehte er sich dann um und sagte fast ausfallend: »Also, ich bin kein Rockkritiker, damit das klar ist.«
»Okay.« Es fiel mir nicht schwer, ihm das zuzugestehen.
»Die Leute sagen das zwar, weil ich für den Rolling Stone geschrieben habe – aber ich schreibe so gut wie nie über Musik.« In Wahrheit schienen die Straßenplakate voller Referenzen auf Popsongs zu sein, aber ich zögerte, ihn auf den Widerspruch hinzuweisen.
Er schien meine Gedanken zu erraten. »Selbst wenn ich es tue, benutze ich nicht dieselbe Sprache.«
»Oh.«
»Diese Typen, die Rockkritiker, mein ich – willst du wissen, was sie eigentlich sind?«
»Oh, klar – was sind sie?«
»Superhochleistungsautisten. Die haben Asperger. So wie meinetwegen David Byrne oder Al Gore. Sie sind genial, aber sie sind soziale Außenseiter.«
»Äh, wieso bist du dir da so sicher?« Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich noch nie jemanden mit Asperger-Syndrom kennengelernt, geschweige denn einen Rockkritiker, auch wenn ich David Byrne mal auf einer Party gesehen hatte. Dennoch hatte ich genug gehört, um es skurril zu finden, wie Perkus über soziale Außenseiter sprach.
»Es ist die Art, wie sie reden.« Er lehnte sich zu mir herüber und versuchte es vorzumachen: »Sie aspirieren ihre Vokale weiter vorn im Mund.«
»Wow.«
»Und wenn sie sich zusammenrotten, wird’s umso schlimmer. Das ist selbstverstärkend. Rockkritiker treffen sich, um sich auszuheulen, obwohl sie das niemals zugeben würden. Sie glauben, sie wären Experten.« Bewusst oder unbewusst fuhr Perkus fort, die Vokale im vorderen Mundraum auszuhauchen. »Die sehn den Wald vor lauter Bäumen nicht.«
»Sehlbstverstährkendeh Expehrten«, probierte ich, um ein Gefühl dafür zu bekommen. »Seehn den Wahld vor lauhter Bäuhmen nicht.« Tief im Herzen bin ich ein Imitator. Und zwischen uns auf dem Tisch lag immerhin ein Video mit der Beschriftung ECHOLALIE.
»Absolut richtig«, sagte Perkus ernst. »Einige pfeifen sogar beim Sprechen.«
»Sie pfeifen?«
»Genau.«
»Ein Glück, dass wir keine Rockkritiker sind.«
»Das kannst du laut sagen.« Er leckte die Gummierung eines weiteren Joints an und inspizierte ihn dann auf seine Brauchbarkeit. Sein Schielauge glitt darüber hinweg, als scannte es einen Barcode. Zufrieden steckte er ihn an. »Also, ich hab’s mir selbst verschrieben«, erklärte er. »Ich rauch Gras wegen der Kopfschmerzen.«
»Migräne?«
»Cluster-Kopfschmerz. Eine Form der Migräne. Einseitig.« Mit zwei Fingern tippte er sich an die Schläfe – natürlich war es die rechte Seite, die Kopfschmerzen zogen zum schlechten Auge. »Es heißt Cluster-Kopfschmerz, weil er periodisch auftritt, ein oder zwei Wochen lang jeden Tag um genau dieselbe Uhrzeit. Wie ein Wecker, ein krähender Hahn.«
»Das ist unglaublich.«
»Ich weiß. Dann sind da noch die Sehstörungen … ein blinder Fleck auf der einen Seite …« Wieder hob er die rechte Hand. »Eine Art Loch im Zentrum meines Blickfelds.«
Preisfrage: Was bekommt man, wenn man einen blinden Fleck mit einem Schielauge kreuzt? Aber wir hatten bisher nicht über sein Auge gesprochen, also hielt ich mich zurück. »Das Gras hilft?«, fragte ich stattdessen.
»Migräne zu haben bedeutet nur halb zu leben. Du wankst durch eine Totenwelt, alles ist weit weg und irgendwie stumpf. Das Rauchen zieht mich zurück ans Tageslicht, es regt meinen Appetit an, auf Essen, auf Sex, auf Konversation.«
Nun gut, was Essen und Konversation anging, hatte ich es selbst erlebt – Perkus Tooths Appetit auf Sex sollte für mich zunächst einmal im Dunkeln bleiben. Das war schließlich immer noch der erste von unzähligen Nachmittagen und Abenden, an denen ich mich Perkus’ Küchentisch hingab, seinem qualmenden Aschenbecher und seiner angebrannten Kaffeekanne, seinem uralten Ghettoblaster, der in den Pausen zwischen den Liedern hörbar quietschte, und unserer Sitznische im Jackson Hole, wenn uns wie so oft ein Fressflash überkam. Bald schon verschwammen all diese Tage glücklich ineinander, denn in dem trostlosen Jahr von Janice’ Unfall im All war Perkus Tooth wohl mein bester Freund. Vermutlich war er die Attraktion und ich der Schaulustige, aber Perkus zählte mich sicherlich genauso zu seiner Sammlung wie ich ihn zu meiner.
Ich schaute mir Echolalie an. Wie Brando seinen verhinderten Interviewer quälte, war wirklich witzig, auch wenn sich mir der tiefere Sinn des Ganzen nicht erschloss. Wahrscheinlich fehlte mir das notwendige Hintergrundwissen. Als ich den Film zurückgab und das erwähnte, runzelte Perkus die Stirn.
»Hast du Die Entstehung gesehen?«
»Nein.«
»Alles, was sich versteckt?«
»Auch nicht.«
»Hast du überhaupt einen Film von Morrison Groom gesehen, Chase?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Wie schaffst du es zu überleben?«, fragte er nicht unfreundlich. »Wie kommst du in der Welt zurecht, ohne zu verstehen, was um dich herum los ist?«
»Dafür habe ich doch dich. Du bist mein Gehirn.«
»Ha, mit deinem Aussehen und meinem Köpfchen könnten wir weit kommen«, scherzte er mit Humphrey-Bogart-Stimme.
»Genau!«
Irgendwas schien ihn daran zu erheitern, denn er kletterte barfuß auf seinen Stuhl und vollführte einen kleinen Affentanz, wobei er aus dem Stegreif sang: »Wäre ich dein Hirn, hättest du ein Problem … du hättest dir das falsche ausgesucht!« Es steckte eine gewisse Eleganz in seinem dünnen, drahtigen Körper und seinem Quadratschädel mit den würdevollen Geheimratsecken und den feinen Gesichtszügen. »Dein Hirn ist auf Droge, dein Hirn steht in Flammen …«
Trotz dieser durchgeknallten Vorwarnung nahm sich Perkus meiner vermeintlichen Erziehung an, überhäufte mich mit Videos und DVDs und setzte sich für die grundlegenden Lektionen selber mit mir hin. Perkus’ Apartment war der perfekte Ort zum Genuss allerlei archivalischer Wunder, sei es am Küchentisch oder auf den durchhängenden Stühlen vor dem Flachbildschirm: Bootlegs unveröffentlichter Platten seiner musikalischen Heroen wie Chet Baker, Nina Simone oder Neil Young und grobkörnige Mitschnitte seltener Noir-Filme aus dem Nachtprogramm. Unter diesen Schätzen war das Video einer neunzigminütigen Folge der Krimiserie Columbo von 1981, bei der Paul Mazursky Regie geführt hatte und John Cassavetes einen frauenmordenden Dirigenten spielte, die Kontrastfigur zu Peter Falks zerknautschtem Inspektor. Mit von der Partie als Cassavetes’ verwöhnte Kinder waren Molly Ringwald und meine Wenigkeit. Mazursky hatte den Fernsehfilm zur selben Zeit heruntergerissen, als er auch Der Sturm drehte, eine Theaterfassung mit Cassavetes und Ringwald, aber leider nicht mit mir. Das sagt eigentlich alles über meinen Erfolg als Schauspieler, die Decke, an die ich immer gestoßen bin – Fernsehen ja, aber nie die große Leinwand.
Cassavetes gehörte zu Perkus’ großen Helden, also hatte er eine Wiederholung in den frühen Morgenstunden aufgezeichnet. Auf dem Video waren auch Werbesendungen aus den Mittachtzigern, in denen O. J. Simpson noch durch Flughäfen sprintete. Ich hatte die Columbo-Folge seit der Erstausstrahlung nicht mehr gesehen, und sie weckte in mir ein Gefühl bittersüßer Vertrautheit. Nicht dass ich Mazursky, Falk, Cassavetes und Ringwald besonders gut gekannt hätte, dennoch fühlte es sich an, als sähe ich ein Familienvideo. Wodurch ich den merkwürdigen Eindruck bekam, ich hätte bereits hier in Perkus’ Apartment gehaust, mehr als zwanzig Jahre bevor ich ihn traf. Sein kulturelles Wissen und die eigenartigen Verbindungen, die er darin knüpfte, ließen es wirken, als wäre dieser gemeinsame Moment vor dem Fernseher vorherbestimmt gewesen. Ja, als hätte ich mit zwölf Jahren in dieser begrabenen und vergessenen Folge an der Seite von John Cassavetes eine Form des persönlichen Dialogs mit meinem zukünftigen Freund Perkus Tooth aufgenommen.
Perkus schenkte den verzogenen Gören wenig Beachtung, sein Interesse galt den Szenen mit dem großen Regisseur und Peter Falk, und er durchkämmte den Film nach dem leisesten Anklang von Genialität, der an ihre grandiose Zusammenarbeit in Cassavetes’ eigenen Filmen oder in Elaine Mays Mikey und Nicky erinnerte. Er wies bewundernd auf Details hin, die ich nicht einmal wahrgenommen hatte, weder damals als Kinderdarsteller am Set noch jetzt als Zuschauer. Außerdem katalogisierte er mögliche Verbindungen innerhalb des kulturellen Kosmos, der ihn interessierte.
Zum Beispiel: »Dieser mickrige kleine Fernsehfilm ist einer der letzten Auftritte von Myrna Loy. Kennst du Myrna Loy, aus Der dünne Mann? Sie hat in den Zwanzigern in unzähligen Stummfilmen mitgespielt.« Mein Schweigen nahm er als Aufforderung, mit seiner Echolotung fortzufahren. »Auch in Das Leben ist Lüge von 1958, mit Montgomery Clift und Robert Ryan.«
»Ah.«
»Nach einem Roman von Nathaniel West.«
»Ah.«
»Natürlich ist er nicht wirklich gut.«
»Mhmm.« Ich betrachtete die alte Dame neben Peter Falk und wollte fühlen, was Perkus fühlte.
»Montgomery Clift ist auf dem Quäkerfriedhof in Prospect Park in Brooklyn beerdigt. Kaum jemand weiß, dass er dort liegt, oder dass es überhaupt einen Friedhof in Prospect Park gibt. Als Teenager hab ich mich mit einem Kumpel nachts reingeschlichen, aber wir konnten sein Grab nicht finden, nur einen Haufen abgerissener Voodoo-Hühnerköpfe und andere verbrannte Opfergaben.«
»Wow.«
Während ich Perkus nur halb zuhörte, starrte ich auf mein kindliches Ich, ein Geist in der Verkleidung eines Zwölfjährigen, der die Flure von Cassavetes’ Haus durchspukt. In Perkus’ Sammlung konnte man hinter jeder Ecke unverhofft auf sich selbst treffen, wie in einer Art Spiegelkabinett.
Perkus monologisierte weiter: »Peter Falk hat zur selben Zeit auch in dem Gnuppet Movie mitgespielt.«
»Tatsächlich.«
»Ja. Genau wie Marlon Brando.«
Tataa! Wieder eine Verbindung in der Perkusphäre!
Anfangs war ich völlig perplex, vielleicht sogar eifersüchtig, als ich erfuhr, dass auch andere das Allerheiligste der 84th Street betreten durften. Der erste war Perkus’ Dealer, der die Plexiglasdöschen mit Chronic brachte. Foster Watt hieß er. Watt, jung und misstrauisch, das stachelige Haar nach vorne gekämmt, trug eine rote Vinyljacke und schwarze Jeans, hatte einen Beeper und rief nur feste Kunden zurück – um dazuzugehören, musste man ihm vorgestellt werden, sonst löschte er die Nummer. Perkus versicherte ihm, ich sei »cool« und bloß zu Besuch, kein Kandidat für Watts Kundenkartei. Sofort erlosch Watts geschäftliches Interesse an mir. Chronic war nur eines seiner Produkte: Er zeigte uns eine ganze Palette von Cannabissorten, deren ertragreiche Zweiglein hinter dem Plexiglas mit Namen wie SILVER HAZE, FUNKY MONKEY, BLUEBERRY KUSH, MACK DADDY oder, etwas unheimlich, wie ich fand, ICE etikettiert waren. Es können auch noch mehr gewesen sein. Perkus bediente sich scheinbar wahllos, er frischte nicht nur seine Vorräte an Chronic auf, sondern kaufte auch etliche andere Sorten. (Wenn ich diese in der Folge mit ihm rauchte, konnte ich nie den geringsten Unterschied feststellen: Ich wurde von jeder der Sorten total high.) Geschäft getätigt, Watts weg.
Wichtiger war Biller, auch wenn er das Apartment nie wirklich betrat. Von seiner Existenz erfuhr ich durch ein Klopfen an Perkus’ Küchenfenster, das zum Luftschacht auf der Rückseite des Gebäudes hinausging. Ich hörte das eindringliche Geräusch zuerst und ignorierte es. Ich war gerade hochgekommen, während Perkus schon wieder dabei war abzuheben, die Flügel auszubreiten. Doch dann wurde er darauf aufmerksam und verstummte. Er ging nicht sofort zum Fenster, sondern schob Sachen auf dem Küchentisch zusammen, die, wie ich erst jetzt merkte, absichtlich bereitgestellt worden waren: Einen Bagel mit Frischkäse und Lachs in Wachspapier – ein vergessenes Frühstück, hatte ich fälschlicherweise angenommen. Eine wunderschöne alte Taschenbuchausgabe von Raymond Chandlers Fahr zur Hölle, Liebling, eines jener Bücher, wie sie Perkus sonst immer in Pergamentpapier einschlug. Einen Joint, den er gedreht und zur Seite gelegt hatte, und den er nun in einen kleinen Druckverschlussbeutel tat. Und ein Bündel Ein- und Fünf-Dollarnoten, das zerknüllt war, als käme es direkt aus seiner Hosentasche. Alles wanderte in eine weiße Papiertüte, die vielleicht noch vom Bagelkauf stammte. Dann öffnete Perkus das Fenster und winkte unten jemandem zu. Der Abstand zum blanken Betonboden des Hinterhofs bedeutete, dass Biller mit einem Stein geworfen oder mit einem Stock oder Kleiderbügel angeklopft haben musste. Mit gestrecktem Arm war er gerade mal in der Lage, die weiße Tüte von Perkus entgegenzunehmen. Vornübergebeugt sah ich von meinem Stuhl als Erstes seine Finger, die, braun und vertrocknet, nach den Almosen griffen. Dann stand ich auf und sah ihn ganz.
Es war Anfang Oktober, sechs oder sieben Uhr abends, noch nicht dunkel, noch nicht kühl. Dennoch war Biller eingewickelt in Jacken und Mäntel. Einige davon schien er auf links zu tragen. Bevor ich sein dunkles Gesicht ausmachen konnte, sah ich einen Golem aus zerknittertem Stoff, kariertem Innenfutter und fleckigen Daunenschläuchen. Seine riesigen Pranken schoben die weiße Tüte in einen Stoffbeutel mit dem Aufdruck BARNES & NOBLE, der ihm unter der äußersten Schicht von der Schulter hing. Erst nach und nach hob sich Billers Gesicht von der Abenddämmerung ab. Obwohl Wangen und Hals von eingewachsenen Barthaaren verunstaltet waren, die man nicht hätte wegrasieren können, und sich sein ungleichmäßig und fettig aussehender Afro in Proto-Dreadlocks verwandelte, strahlten seine schönen Augen in der Umrahmung eine freundliche Zurückhaltung aus. Ich hatte das Gefühl, sie beide mit meiner Gafferei bloßgestellt zu haben. Also setzte ich mich wieder und wartete ab.
»Wer ist das?« Die Stimme des Mannes war ruhig und ausgeglichen.
»Keine Sorge«, erwiderte Perkus. »Er ist ein Freund.«
»Ich hab ihn schon mal gesehen. Ich dachte, er wär aus dem Haus.«
»Er ist nicht aus dem Haus. Vielleicht kennst du ihn von woanders her.«
Ich spielte mit einem Tellerchen voller Biscotti, während sie über mich redeten. Der Kaffee, den Perkus kurz vor dem Klopfen aufgesetzt hatte, gluckerte leise.
»Ich wollte dich nicht mit Besuch überraschen«, fuhr Perkus fort. »Ich dachte, du würdest früher kommen.«
»Der Tiger ist schuld«, sagte Biller. »Sie haben praktisch die ganze Second Avenue gesperrt. Ich bin einfach nicht rübergekommen.«
Das war das erste Mal, das ich von dem riesigen entflohenen Tiger hörte, der Teile der East Side terrorisierte. Oder ich hatte schon vorher davon gehört und es wieder vergessen. Jedenfalls hatte ich keinen Grund, es nicht als Märchen von Biller abzutun. Ein Tiger konnte gut das Wahrzeichen sein für die Widrigkeiten, denen ein Obdachloser ausgesetzt war. Kein Wunder, dass er all die Jacken brauchte.
Perkus antwortete neutral: »Halb so wild. Kannst du wieder zurück?«
»Ich lauf Richtung Downtown.« Für jemanden, der in einem Hinterhof Bagels schnorrte, hörte sich Biller sonderbar entschlossen an. Second Avenue, Downtown – wie groß war seine Umlaufbahn?
»Okay, bis morgen.«
»Ich dachte, er wär schon weg, wenn du kommst«, sagte Perkus, nachdem er das Fenster geschlossen und mir den Namen der Erscheinung genannt hatte. »Er möchte nicht gesehen werden. Früher hat er vorne gewartet, bis ein paar Arschlöcher aus dem Haus dreimal hintereinander die Polizei gerufen haben. Also hab ich ihm gezeigt, wie er in den Hof kommt, wo das Brandy’s seinen Müll stehen hat.«
»Wo wohnt er?«
Perkus zuckte die Schultern. »Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwo wohnt, Chase. Er sagt, er schläft manchmal unter einem Wassertank in der Orchard Street, in einem Block, den die Mafia kontrolliert, so dass niemand argwöhnisch wird oder ihn behelligt. Ich glaub eher, er schläft oft einfach in den U-Bahnen, wenn er nach Downtown fährt.«
»Aber warum … fährt er nach Downtown? Oder … kommt hier hoch?«
»Ich hab nie gefragt.« Perkus goss zwei Tassen Kaffee ein und drehte einen neuen Joint aus dem losen Gras, das auf dem Linoleum verstreut lag, als Ersatz für den einen, den er Billers Carepaket beigelegt hatte. Die Sorte hieß Silver Haze. Sie mit Biller zu teilen schien auf einmal wie eine Art Kommunion, von oben in die bittstellenden Hände gelegt, eine Geste der Gleichheit und Brüderlichkeit: Ich therapier mich selbst, warum nicht auch du dich? Und was war mit der alten Chandler-Ausgabe – hatte Perkus sie doppelt oder verlagerte er seine wertvolle Sammlung nach und nach zu Biller auf die Straße? Perkus fand anscheinend, dass man Bücher verschlingen sollte wie Sandwiches.
Er hatte meine Faszination bemerkt. »Ich stell dich ihm vor«, sagte er. »Er ist am Anfang etwas scheu.«
Marihuana mochte für Perkus eine Konstante gewesen sein, aber Kaffee war seine Muse. Mit seinem verwirrten Auge schien er seine heißgeliebte Kaffeetasse zu bewachen, während er einen anschaute. Möglicherweise war es gar kein körperlicher Defekt als vielmehr eine Alarmanlage, eine evolutionäre Diebstahlsicherung für sein Käffchen. Als ich einmal kurz allein in seiner Wohnung war, fand ich unter den verstreuten Papieren einen Fetzen mit Lyrik, das einzig Schriftliche neben seinen kritischen Exegesen, was ich je von ihm gesehen habe. Eine unvollständige, verworfene Ode: »O Koffein! du zeitgemäßes Ziehn Fliehn / ich hab dir ins Gesicht gespien / du hast mir ins Gesicht / übers Gesicht …« Und tatsächlich waren auf dem Blatt zahlreiche Abdrücke einer Kaffeetasse zu sehen.
Ich stellte mir vor, wie das Schreiben von einem Migräneanfall unterbrochen wurde, wie der Stift aus Perkus’ Hand glitt, während der Cluster-Kopfschmerz ihn übermannte. Es war unmöglich, sich das nicht so vorzustellen, nachdem man ihn einmal im Klammergriff eines solchen Anfalls gesehen hatte. Eines Tages hatte er angerufen und mich eingeladen vorbeizukommen, dann erwischte es ihn. Die Tür war unverschlossen, und er bat mich vom Sofa aus herein, in Anzughose und einem vergilbten T-Shirt, mit einem kalten Waschlappen über den Augen. Er sagte, ich solle Platz nehmen und mir keine Sorgen machen, aber seine Stimme schwand dahin, wurde in seine schmächtige Brust gesogen. Ich war sofort überzeugt, dass er aus jener Halbwelt zu mir sprach, jenem Totenreich, das er mit seiner ersten Beschreibung des Cluster-Kopfschmerzes heraufbeschworen hatte.
»Diesmal ist es schlimm«, sagte er. »Und der erste Tag ist immer der schlimmste. Alles ist zu hell.«
»Du weißt es nie im voraus?«
»Es gibt erste Anzeichen, ein, zwei Stunden vorher«, krächzte er. »Die Welt beginnt zu schrumpfen …«
Ich wollte ins Bad, doch er sagte: »Nicht. Ich hab gekotzt.«
Was ich dann tat, ist zugegebenermaßen untypisch für mich: Ich ging hinein und wischte Perkus’ Erbrochenes weg. Als ich in der Küche nach einem Lappen suchte, stieß ich dort auf das reinste Chaos, halbvolle Müslischüsseln und Tassen mit eingetrockneten Kaffeeresten. Während Perkus schwer atmend auf dem Sofa lag, hantierte ich leise in der Küche herum und brachte alles halbwegs in Ordnung. Die ganze Zeit hoffte ich, dass er in meiner Obhut nicht ernsthaft erkrankte – er wirkte so geschwächt, als würde er sich die nächsten Tage nicht vom Sofa rühren können. Und abgesehen von Biller, der nur vor dem Fenster stand, hatte ich außer seinem Dealer nie eine Menschenseele in Perkus’ Apartment gesehen. Der Küchentisch war übersät mit Marihuana, ein Teil war durch ein Metallsieb gedrückt worden, an den anderen Büscheln hingen noch die Samen. Ich fegte alles zurück in ein Plastikdöschen mit der Aufschrift FUNKY MONKEY und legte die fertiggedrehten Joints in die Pfefferminzdose, die Perkus für diesen Zweck bereithielt. Dann wurde ich immer zwanghafter (obwohl ich in meinem Apartment Ordnung halte, hatte mich Perkus’ Chaos vorher nie gestört) und fing an, die herumliegenden CDs zusammenzuräumen und sie in die passenden Hüllen einzusortieren. Diese Beschäftigung half mir, mich zu beruhigen – eine andere Form der Selbsttherapie. Denn die Konfrontation mit Perkus’ Migräne hatte mich verunsichert und Selbstzweifel geschürt, aber ich konnte ihn nicht einfach allein lassen. Ich machte keine Anstalten, meinen Aktionismus zu verbergen, und Perkus kommentierte es zunächst nicht weiter als mit einem leisen Stöhnen. Doch nachdem ich eine Zeitlang mit seinen CDs herumgeklappert hatte, sagte er: »Such Sandy Bull.«
»Was?«
»Sandy Bull … ein Gitarrist … die Songs sind sehr lang … das Einzige, was ich in dem Zustand hören kann … es lenkt mich von diesem Pochen in meinem Kopf ab …«
Ich fand die CD und legte sie ein. Die Musik schien mir ein unerträgliches Gedröhn zu sein, beim besten Willen nicht psychedelisch, eher geeignet für einen Harem als fürs Krankenzimmer. Andererseits verstand ich wirklich nichts von Musik oder Kopfschmerzen.
»Du kannst ruhig gehen …«, sagte Perkus. »Ich schaff das schon …«
»Soll ich etwas einkaufen?«
»Nein … in diesem Zustand kann ich nichts essen …«
Nun ja, Perkus konnte jetzt sicherlich keinen der faustgroßen Jackson-Hole-Burger verspeisen. Ich fragte mich jedoch, ob nicht ein wenig Gemüse oder ein Teller Suppe angebracht wären, aber ich wollte ihn nicht bemuttern. Also ließ ich die gruselige Musik so laut laufen, wie Perkus es wünschte, löschte das Licht und ging. Ich fühlte mich seltsam leer und wusste mit meiner Zeit nichts anzufangen. Die Nachmittage und Abende mit Perkus waren schnell zur Normalität geworden, und das Sonnenlicht draußen erschien mir völlig ungewohnt. Ich konnte mich nicht mehr entsinnen, wann ich das letzte Mal nicht angenehm benebelt durch die Lobby spaziert war, hinein in den Pulk von Gästen vor Brandy’s Piano Bar, die das Schild ignorierten und auf dem Gehweg rauchten und laut schwatzten, während Klaviergeklimper und unregelmäßiger Gesang aus der Bar auf die Straße drangen. Jetzt war alles still, die Stühle standen noch verkehrt herum auf den Tischen. Und ich hatte nur Perkus im Kopf, ans Sofa gefesselt, die geschwollenen Augen unter einem Waschlappen.
Das nächste Mal, als ich Perkus sah, machte ich den Fehler, ihn zu fragen, ob seine ellipsistischen Absenzen auf irgendeine Weise mit seinem Cluster-Kopfschmerz zusammenhingen. Die Woche zuvor hatte er damit angegeben, sich beliebig in diesen Erleuchtungszustand versetzen zu können; und wie er dort zusätzliche Dimensionen zu sehen bekomme, Welten innerhalb der Welt. Seine besten Texte, hatte er erklärt, würden getragen von dieser Einsicht in ellipsistisches Wissen.
»Da gibt’s keinen Zusammenhang«, sagte er jetzt, in unserer Nische im Jackson Hole, während sein spinnendes Auge hervortrat. »Cluster-Kopfschmerz ist wie eine Todesstarre, da geht gar nichts mehr … ich bin nicht ich selbst … ich bin niemand. Bei einer Ellipse bin ich ganz ich selbst, Chase.«
»Ich habe mich nur gefragt, ob das nicht irgendwie zwei Seiten derselben Medaille sind …« Oder zwei Arten, aus demselben Kopf zu gucken, dachte ich, ohne es zu sagen.
»Da brauch ich nicht mal anfangen zu erklären. Es ist völlig verschieden.«
»Tut mir leid«, sagte ich spontan, um ihn zu beruhigen.
»Was tut dir leid?« In seinem Eifer, mich zu widerlegen, spuckte er ein Stück Hamburger aus.
»Ich habe es nicht so gemeint.«
»Eine Ellipse ist wie eine Fensteröffnung, Chase. Oder wie – ein Kunstwerk. Die Zeit bleibt stehen.«
»Ja, das sagtest du.« Der ausgespuckte Fleischbrocken lag von ihm unbemerkt neben seiner Serviette.
»Cluster-Kopfschmerz dagegen – ist der Feind.«
»Verstehe.« Er hatte mich überzeugt. Viel hatte es dazu nicht bedurft. Dafür wollte ich ihn nun überreden, einen ostasiatischen Heilpraktiker aufzusuchen, den ich kannte, einen Meister der chinesischen Medizin, der in Chelsea praktizierte und eine Wartezeit von sechs Monaten oder länger hatte. Er half Manhattans Reichen und Berühmten, akupunktierte und linderte ihren obligatorischen Stress und ihre dekadenten Leiden. Ich nahm mir fest vor, es später zu versuchen, wenn Perkus sich wieder beruhigt hatte. Ich gönnte ihm seine Ellipsen, er sollte sie ganz und gar genießen, gönnte sie ihm ohne Cluster-Kopfschmerz – wie sehr ich auch befürchtete, das eine sei der Preis für das andere. Ich tat dies aus ganz eigennützigen Gründen, denn mir dämmerte allmählich, dass Perkus Tooth – sein Gerede, sein Apartment, der Raum, der sich geöffnet hatte, seit ich ihm bei Criterion über den Weg gelaufen war, seit ich ihn angerufen hatte – meine Ellipse war. Es war bei mir vielleicht nicht angeboren, aber ich hatte es dennoch durch ihn entdeckt. Wohin mich Perkus mit seinen Tiraden, seinem Enthusiasmus, seinen unvermittelten Abschweifungen auch mitnahm, es waren Welten innerhalb der Welt. Ich wollte nicht, dass er in der Totengruft der Migräne erstickte. Perkus war das Gegenteil von meiner kosmischen Verlobten – meine Sorge um ihn hatte eine Bedeutung für das tägliche Leben.
Perkus Tooth hatte recht. Ich kann es genauso gut zugeben, dass ich als Tischdekoration bei Abendgesellschaften diene. Es ist etwas Angenehmes an mir. Ich gleite reibungslos dahin auf den Kugellagern des Charmes, habe ein gemäßigtes Charisma, das niemandem weh tut. Als Schauspieler im Ruhestand repräsentiere ich die Künste, verbreite jedoch nicht die störende Aura der Unzufriedenheit, des Ehrgeizes oder der Bedürftigkeit. Jeder begreift sofort, woher mein Geld kommt – Tantiemen –, und dass ich genug davon habe. Leute mit Geld wollen sich in ihrer privaten Zeit keine Gedanken darüber machen, ob ihre Künstlerfreunde selber genug haben, oder, schlimmer noch, wissen, dass sie keines haben. Es war während einer dieser typischen Abende mit vorbeiziehenden Gesichtern, die ich am nächsten Morgen schon wieder vergessen haben würde, als ich Richard Abneg vorgestellt wurde.
Maud und Thatcher Woodrows Maisonettewohnung besaß die irritierende Form eines kleinen Townhouse, das sich an eins der repräsentativen Apartmenthäuser auf der Park Avenue herangeschlichen hatte und von dem Monolithen aufgesaugt und einverleibt worden war. Nachdem der Besucher den musternden Blick des Doorman passiert hatte und in die Eingangshalle getreten war, ließ er die polierten Fahrstühle mit den Rosenholzintarsien, die zu den Zehn-Millionen-Dollar-Apartments führten, links liegen und stieg eine kleine Innentreppe hoch, sechs Marmorstufen, die sich zu einem kunstvoll verzierten Türeingang hin verjüngten, hinter dem er von einem weiteren, vornehmeren, weitaus gewissenhafteren und intelligenteren Doorman in Empfang genommen wurde, dem persönlichen Türsteher der Woodrows, der jeden Gast mit Namen begrüßte, selbst beim ersten Besuch. Dieses Haus-im-Haus sollte den Bewohnern der Apartments, diesen Fahrstuhlkarrieristen, die glaubten, ganz oben angekommen zu sein, deutlich machen, euer Drinnen ist unser Draußen, und so wird es auch immer bleiben. Distinktion war auf der Park Avenue durch schieren Reichtum kaum zu erlangen, doch die Woodrows hatten es sich etwas kosten lassen. Wenn es dazu eines surrealistischen Anstrichs bedurfte, na schön. Im Innern war kein Unterschied zu einem imposanten historischen Townhouse festzustellen, das sich nun einem modernen Stil öffnete, die Wände gespickt mit schwarz gerahmten Fotografien und fotorealistischen Gemälden hinter Museumsglas, und mit einem geschwungenen Treppenaufgang, der sich ebenso als Bühne anbot wie jener in Der Glanz des Hauses Amberson. Dennoch war ihr Zuhause von der Straße aus nicht sichtbar. Der Straße brauchte man nichts deutlich zu machen.
Ein ganz bestimmtes Drehbuch gehörte ebenso dazu. Ich würde während des Aperitifs nicht von meiner Astro-Verlobten sprechen, die hinter einer dünnen Stahl-und-Kachel-Haut gefangen war in den unendlichen Weiten des Weltraums. Nein, das sollte ich mir aufsparen. Nachdem alle ihren Spaß gehabt hätten, die Kerzen zu zwei Dritteln heruntergebrannt und die Gläser gerade wieder gefüllt worden wären, würde ein Moment kommen, in dem jemand zu meiner Rechten oder Linken sich nach ihr erkundigte, und als hätten sie sich vorher abgesprochen, würden alle Gespräche verstummen, so dass der ganze Tisch geschlossen meiner traurigen Geschichte lauschen könnte. Janice Trumbulls Schicksal, das unabdingbar mit mir verbunden war, würde nicht unerwähnt bleiben, denn es war alles andere als ein Geheimnis – sie alle hatten schließlich über sie in der Zeitung gelesen. Die anderen Gäste würden sich also mit ernsten Gesichtern vorbeugen, um schamlos zuzuhören, was ich zu berichten hatte, der »wahren Geschichte«. Und um Sympathie zu heucheln, wie das Publikum bei einer Lyriklesung.
Der Aperitif war dem Smalltalk vorbehalten. Acht oder neun von uns hatten sich in dem schicken Salon eingefunden, darunter auch Maud und Thatcher, unsere Gastgeber, während ihre Bediensteten sich zwischen uns hindurchschlängelten, Getränkebestellungen entgegennahmen und Canapés servierten. Naomi Kandel, die lesbische Galeristin, hatte ihr Glas zum Gruß erhoben, als ich hereingekommen war, und ich hatte mich in ihre Richtung treiben lassen. Etwas stämmig, aber hübsch anzusehen in ihrem Abendkleid, die verschmitzten Augen voller natürlicher Ironie, versprach sie etwas Abwechslung in den Abend zu bringen. Obwohl wir ja alle freiwillig zugesagt hatten, mussten wir uns die Situation schönreden, indem wir uns vorstellten, wir seien versklavt worden. Naomi stand mit einer anderen Frau zusammen, einer kurvenreichen Mittvierzigerin in einem glitzernden gelblichbraunen Kleid. Sie betrachteten gemeinsam eine gerahmte Zeichnung, vielleicht eine Neuerwerbung der Woodrows, eine präzise, architektonische Aufsicht auf einen dunklen Trichter zwischen zwei Bürotürmen. Winzige Figuren blickten vom Gehweg in die Tiefe.
»Kennst du Sharon schon?«, fragte Naomi.
»Ich hatte noch nicht das Vergnügen.«
»Sharon Spencer, Chase Insteadman.«
»Ich bewundere Ihre Arbeit«, sagte Sharon Spencer. Sie hielt meine Hand einen Augenblick länger als nötig. Ich fragte mich, von welcher Arbeit sie sprach. War sie ein Fan von Martyr & Pesty? Wenige wagten das von sich zu behaupten. Und Sharon, so attraktiv sie war, schien ein wenig zu alt, um die Glanzzeiten dieser Sitcom miterlebt zu haben. Sie war also entweder höflich oder schüchtern, entschied ich. Ich stellte mich zu ihnen vor die Zeichnung.
»Von Laird Noteless«, sagte Naomi. »Es ist eine Studie für Ausgelöschtes Gebäude.«
»Bist du seine Galeristin?«, fragte ich Naomi.
Sie zuckte verneinend die Schultern. »Es gibt nichts zu verkaufen. Noteless rückt seine Zeichnungen normalerweise nicht raus. Er hortet sie oder vernichtet alles und lässt nur die Hauptwerke gelten. Ich glaube, Maud und Thatcher helfen ihm bei der Baugenehmigung für das Ausgelöschte Gebäude.«
»Es ist noch nicht gebaut worden?«, fragte Sharon Spencer überrascht.
»Noch nicht.«
Sie schüttelte den Kopf. »Absurd, welche Hürden sie einem in den Weg stellen.«
»Wo ist eigentlich dein Mann?«, fragte Naomi trocken, ohne ihre Langeweile zu verbergen, vielleicht auch, um jeden Flirt im Keim zu ersticken.
»Reggie kommt später«, seufzte Sharon Spencer. »Er muss noch arbeiten. Im Moment geht in Downtown alles drunter und drüber.«
Reggie, so viel verstand ich, war einer derjenigen, die Geld bewegten und dabei versuchten, es zu mehren. Sie alle hatten unser Mitleid verdient, klare Sache, die Geldmänner. Leistungsorientiert und ausgepowert stapften sie durch den grauen Nebel. Doch verglichen mit ihren Ehefrauen waren sie Tagelöhner.
Maud Woodrow kam zu uns herüber und eiste mich los, um mir Harriet Welk vorzustellen, eine Lektorin bei Knopf. Maud und Harriet hatten sich kennengelernt, als der Verlag für ein Coffee-Table-Book über volkstümlichen Schmuck aus dem 19. Jahrhundert die Genehmigung brauchte, einen Teil von Mauds Sammlung fotografieren zu lassen. Obwohl Harriet möglicherweise die jüngste Akteurin auf diesem glatten Parkett war, präsentierte sie sich souverän und aufgeschlossen. Es war Harriet, die Richard Abneg mitgebracht hatte. Er stand noch auf der anderen Seite des Raumes, wo Thatcher Woodrow auf ihn einredete. Kein männlicher Gast erschien im Kreis der Woodrows, ohne dass ihm Thatcher nicht zuerst seine Duftmarke aufgedrückt hätte. Und ganz ihrem neuen Gesprächspartner verpflichtet, gab Harriet ein paar Anekdoten über Richard zum Besten, den sie ihren »säkularen« Freund nannte.
»Du meinst vermutlich ›platonisch‹.«
»Platonische, säkulare, alte Freunde. Etwas darüber hinaus ist zwischen uns nicht vorstellbar.« Sie machte mich auf ihn aufmerksam, einen kleinen, behäbigen Typen, der in dem Ambiente mit seinem weit geschnittenen dunkelgrauen Anzug, dem heraushängenden Flanellhemd und einem dunklen Bart, der über die trotzigen Wangen bis zu den lebhaften Augen wucherte, wie ein Trickfilm-Kommunist wirkte. Er stand Nasenspitze an Nasenspitze mit Thatcher und umklammerte den Stiel eines Martiniglases, als sei es der Griff einer Axt, mit der er sich den Weg freihacken würde, wenn Thatcher nicht bald aufhörte, anzugeben.
»Schon verstanden«, erwiderte ich. »Ihr seid hier Soloartisten. Einzelkämpfer.«
Sie seien Highschool-Freunde, erzählte sie, würden sich noch aus den Zeiten der Schulkorridore, Trinkwasserbrunnen und sexuellen Peinlichkeiten an der Horace Mann kennen. »Wenn man jemanden so lange kennt, ist man vertraut mit all seinen Persönlichkeitswechseln.«
»Immerhin wechselt er seine Persönlichkeit ab und zu.«
Richard Abneg hatte als Radikaler begonnen, als Anarchist. Sein prägendes Erlebnis waren die Unruhen im Tompkins Square Park gewesen, als die Polizei den rebellischen Geist der Lower East Side zu unterdrücken versucht hatte. (Ich erinnerte mich vage daran, eine Art Erbsünde der Stadt.) Abneg hatte daraufhin die Besetzung eines legendären Gebäudes an der Ecke Neunte und Avenue C angeführt, eine in Ehren gehaltene letzte Bastion, ein Fuß in der sich schließenden Tür des Fortschritts. Daraus hatte sich eine Karriere im Mieterschutz ergeben, mit zähen Verhandlungen im Auftrag derjenigen, die bei der großen Parade der Gentrifizierung zum Zuschauen verdammt waren. Jetzt arbeitete Abneg ironischerweise für Bürgermeister Arnheim und kümmerte sich um die Aufhebung der gebundenen Mieten. Für viele, die ihn von früher kannten, sei er ein ausgemachter Verräter, sagte mir Harriet Welk. Doch Abneg war das Pflichtgefühl in Person, er wies immer wieder darauf hin, wie viel schlimmer alles ohne sein Eingreifen wäre, und verteidigte diesen höheren Realismus als notwendiges Übel. Vertraute wie Harriet wussten, was es ihn gekostet hatte, diesen Schritt zu tun, diesen Teufelspakt zu schließen. Sie ließen die Ironie an der Sache freundlicherweise unerwähnt. Was Abneg jedenfalls immer weitergetrieben hatte, war ein gewisses Bewusstsein für seinen wichtigen Platz im Leben der Insel. Er hatte sich nie vor etwas gedrückt. Und den Bart, auch da war er sich treu geblieben, trug er schon immer. Er hatte ihn sich wachsen lassen, als er fünfzehn war und Charles Bukowski und Howard Zinn und Emmett Grogan las. Ich saugte diese Informationen von Harriet auf und stellte mich auf ihn ein. Wovor sie mich nicht gewarnt hatte, war, dass ich ihn mögen würde.
Richard Abneg steuerte jetzt auf uns zu. Er streckte mir eine schwielige Hand hin, doch während ich sie schüttelte, richtete er sich an Harriet Welk.
»Hast du sie gesehen?«
»Wen?«
»Nicht hingucken, nicht hingucken. Die Straußenfrau.«
Er meinte Georgina Hawkmanaji. Ich hatte sie hereinkommen sehen. Für ihr mit Federn hochgestecktes Haar, ihren langen blassen Hals und die schmalen Schultern, ihren üppigen Po war »Straußenfrau« eine angemessene Bezeichnung. Um die zwanzig Millionen schwer durch irgendwelchen geerbten armenischen Plunder, ausgebildet in Zürich und Oxford, aber klar, eine Straußenfrau von der Statur und wahrscheinlich auch von der Seele her. Sie war gut einen Kopf größer als Abneg.
»Verzeihung«, sagte er unvermittelt und ließ meine klaustrophobischen Finger los. »Nur keine falschen Hoffnungen, ich werde mit ihr nach Hause gehen.«
»Ich gebe dir einen Vorsprung«, sagte ich. »Sie lebt hier im Gebäude, im Penthouse.«
»Gut so, ich bekomme klare Signale.«
»Dann bloß nichts anbrennen lassen.«
»Ich doch nicht.«
Wie es der Zufall wollte, wurden Richard Abneg und ich, als es Zeit fürs Abendessen war, zu beiden Seiten von Georgina Hawkmanaji plaziert. Ohne zu zögern und ganz instinktiv baute er von Anfang an darauf, Georgina mehr oder weniger zu übergehen und sich gleichzeitig buchstäblich auf ihren Schoß zu setzen, indem er sich vorbeugte und mich für sich einzunehmen suchte. Aus Erfahrung wusste ich, dass die Konversation mit Georgina zur Sisyphusarbeit werden konnte – sie war nicht dumm, sondern im Gegenteil auf allen Gebieten bewandert, aber ihre förmliche, besonnene Art konnte einem das Gespräch verhageln. Also bewunderte ich seine Strategie. Abneg benutzte Georgina als Bande. Sie musste ihm nicht folgen, sondern nur hin und wieder etwas besonders Nachdrückliches in seiner Rede bestätigen. Und dazu seine Speicheltröpfchen erdulden, die auf der Brust ihres hochgeschlossenen Seidenkleids landeten, kleine Glitter, die sich dort ansammelten wie eine neue Konstellation am Sternenhimmel.
Richard Abneg liebte es, seinem Ego freien Lauf zu lassen und Geschichten von Geschäften zu erzählen, bei denen man nach dem Handschlag die Finger zählte und immer ein paar fehlten, bei denen man nie glauben durfte, angesichts des Einsatzes als Gewinner hervorzugehen. Zwischen den witzigen Anekdoten deutete er seinen Lebensweg als einen voller schmerzlicher Kompromisse. Er stilisierte sich als Beschützer des Sandkastenidealismus gegen den Sog der großen Veränderungen in der Stadt, Veränderungen, die nicht so sehr auf zynischer Gleichgültigkeit beruhten, als vielmehr dem natürlichen Lauf der Dinge unterworfen waren. Den Großteil seiner Überzeugungen über Bord zu werfen konnte einen in Zeiten privater Freibeuterei davor bewahren, alles zu verlieren.
Abnegs Stimme war anzüglich und sarkastisch, die eines echten Grobians, obwohl er nur auf sich selbst herumtrampelte. An einem bestimmten Punkt schlug Thatcher Woodrows innerer Testosteronzähler Alarm, und er lehnte sich herüber zu unserem Ende des Tisches. »Kennen Sie Bürgermeister Arnheim eigentlich persönlich?«