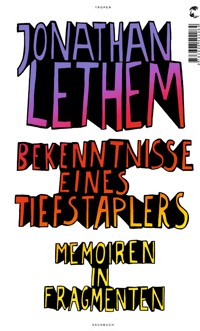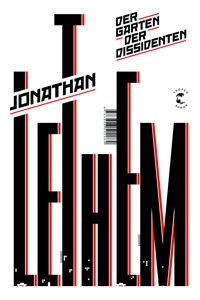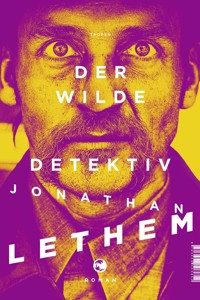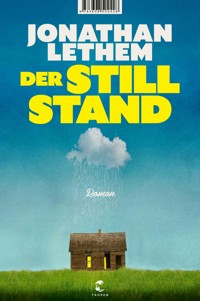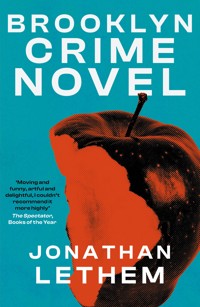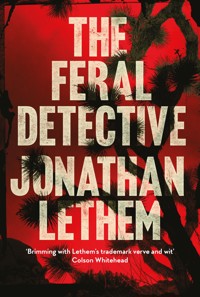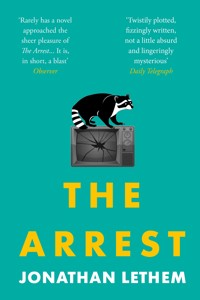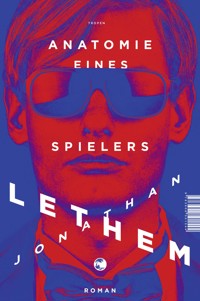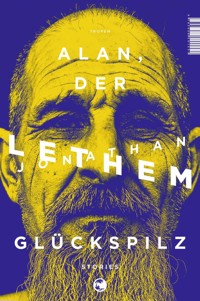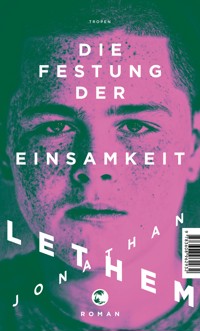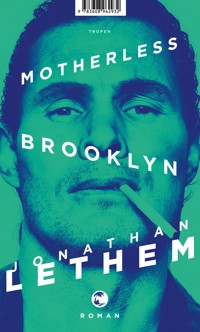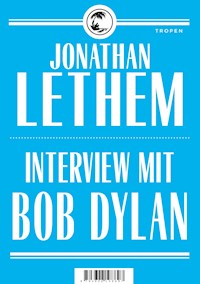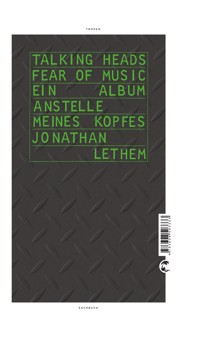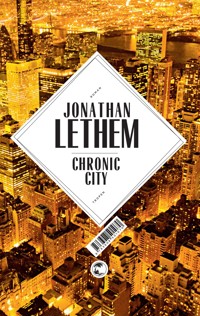20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jede Stadt verdient ein solches Buch.« Colum McCann SWR Bestenliste Mai 2025 Die Dean Street in Brooklyn ist mehr als eine Straße. Hier werden Träume wie harte Währung gehandelt, treffen reiche Kids auf Jungs aus der Hood und große Verbrechen auf kleine Gaunereien. Mit meisterhafter literarischer Finesse erzählt Jonathan Lethem die wechselvolle Geschichte von einer der hippsten Straßen New Yorks. Ein Blick hinter die Kulissen einer Stadt und einer Zeit, in der vieles immer stärker zur bloßen Fassade gerät. Die Dean Street gleicht einer Bühne. Täglich wird hier ein Tanz aus Macht, Geld und Gewalt aufgeführt. Wem gehört das Pflaster? Wer zahlt den Preis fürs Überleben? Einmal wird ein Kind am Eisstand Zeuge einer Schießerei, ein anderes Mal wird ein paar Blocks weiter ein anderes Kind dabei erwischt, wie es im Kiosk ein Erwachsenenmagazin mitgehen lässt. Rivalisierende Gangs streiten sich über das Recht, wer in der Straße Hockey spielen darf, um die Ecke wirft jemand versehentlich einen Baseball in die Windschutzscheibe eines Autos. Doch hinter all diesen Ereignissen lauern immer andere Strippenzieher: Eltern, Polizisten, Vermieter und diejenigen, die in der Stadt die Schlagzeilen und Gesetze schreiben. Sie alle prägen dieses Viertel, seine Geschichte und seine Gegenwart. Jonathan Lethem, einer der großen Erzähler Amerikas und selbst ein Kind Brooklyns, hat diesem Viertel eine grenzenlose Liebeserklärung geschrieben: witzig, vielschichtig und unfassbar berührend. »Ein großer Lesegenuss. Ein brillantes Buch, das alle Genregrenzen sprengt.« Percival Everett
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jonathan Lethem
Der Fall Brooklyn
Aus dem Amerikanischen von Thomas Gunkel
Roman
TROPEN
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Tropen
www.tropen.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Brooklyn Crime Novel« im Verlag Harper Collins, New York
© 2023 by Jonathan Lethem
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung einer Abbildung von © gettyimages/Busà Photography
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50244-2
E-Book ISBN 978-3-608-12388-3
Für Lynn Nottage
I.
Jeder wird ausgeraubt
»Es wäre dumm zu behaupten, dass alle Renovierungsgebiete ungefährlich sind oder eine Gegend sich nach Beginn der Renovierung auf wundersame Weise in ein kriminalitätsfreies Paradies verwandelt … Findet man die Verbrechen in einer Gegend besorgniserregend, sollte man sich nicht auf das Urteil eines einzigen Menschen verlassen, sondern bei der Polizei nachfragen, was sie über den betreffenden Straßenzug und die nähere Umgebung zu sagen hat. Man sollte Leute fragen, die noch dort wohnen. Die Auskünfte früherer Bewohner sind oft nicht besonders zuverlässig.
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Viertel, in dem viele Häuser renoviert werden, ungefährlicher wird, sei es durch Bürgerpatrouillen, durch Druck auf die Polizei oder weil sich mehr Menschen in den Straßen aufhalten. Die Wegbereiter einer aufstrebenden Gegend wie Crown Heights dürften aus vielerlei Gründen Spottpreise zahlen, nicht zuletzt wegen der höheren Verbrechensrate.«
– Joy und Paul Wilkes,
You Don’t Have to Be Rich to Own a Brownstone
»Als wir unsere Produktionspläne für THECASEAGAINSTBROOKLYN bekannt gaben … die spektakulären Enthüllungen über die Korruption zwischen Polizei und Buchmachern … rechneten wir damit, dass Kriminelle und Gewalttäter uns Ärger bereiten würden. Wir rechneten mit Drohungen und Schlimmerem von den Gangstern aus Gowanus.
Doch wir hatten nicht erwartet, dass ganz normale Bürger das freie Kino ablehnen würden. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass bedeutende Bürger Brooklyns uns ›verbieten‹ würden, den Film im Bezirk Brooklyn zu zeigen. Aber man sagte uns, wir sollten wegbleiben … sonst!
Wir glauben, dass die Bürger von Brooklyn die Wahrheit erfahren wollen. Wir glauben, dass Sie THE CASE AGAINST BROOKLYN gut finden werden.«
– Annonce,
Brooklyn Daily Eagle, 6. Juni 1958
»Manhattan keeps on makin it / Brooklyn keeps on takin it«
– Boogie Down Productions,
»The Bridge Is Over«
1. Quarters, 1. Teil (1978)
Eine erste Geschichte. Der Beginn unserer Ermittlung.
Zwei weiße Jungs in einer Wohnung im ersten Stock, über einem Laden in der Court Street, zwischen Schermerhorn und Livingston Street gelegen.
Die Jungs, beide vierzehn, sind genüsslich mit etwas beschäftigt, das zwischen den Zähnen eines kleinen, an einem Tisch befestigten Schraubstocks klemmt. Sie machen sich an dem Ding mit einer Eisensäge zu schaffen. Die Säge, der Schraubstock, die ganze Ausstattung gehört dem geschiedenen Vater des einen Jungen, der, abgesehen von den Tagen, an denen sein Sohn zu Besuch kommt, allein hier lebt. Der Vater arbeitet als Therapeut, würde aber gern Schmuck herstellen. Deshalb der Schraubstock, die Eisensäge. Der Vater ist an diesem Morgen nicht zu Hause.
Das Ladenlokal unter dem Apartment beherbergt ein italienisches Restaurant, das The Queen heißt. Ein kleiner Speisesaal mit roten Plüschvorhängen, acht bis zehn eng beieinander stehende Tische. Das Lokal wird von manchen Leuten als Atavismus betrachtet, ein Restaurant der »gehobenen Küche«, wie es vermutlich nur Mafiosi lieben oder Nostalgiker, die sich nach einem Brooklyn sehnen, das zu diesem Zeitpunkt schon kurios ist. Aber noch nicht gänzlich verschwunden.
Auch Mafiosi können Nostalgiker sein. Wahrscheinlich sind sie es sogar oft.
Den Inhabern des Restaurants gehört das ganze Gebäude. Ihnen zahlt der Vater die Miete. The Queen hat noch ein Gegenstück, die Queen Pizzeria. Ein gut gehender Pizzaschuppen, zwei Häuser weiter. Eingekeilt zwischen dem vornehmen Queen und der schlichten Pizzeria ist ein mittelgroßes Pornokino. Die Betreiber haben das Kino von den Besitzern der beiden Restaurants gemietet. Zwei der Unternehmen, das Pornokino und die Pizzeria, müssen das dritte – das vornehme Restaurant – über Wasser halten.
Ein Stück Pizza kostet fünfzig Cent.
Eine U-Bahn-Marke kostet fünfzig Cent.
Hmmm. Ist das eine goldene Regel der Zusammengehörigkeit? Die Stadt ein verstecktes, unübersetzbares System? Oder könnte hier die einzige Religion der Preis der Dinge sein?
Kehren wir zu den Jungs zurück. Was steckt da im Schraubstock?
Es ist eine Münze. Ein amerikanisches Fünfundzwanzig-Cent-Stück, ein Washington-Quarter von 1968, aus der Münzanstalt in Denver. Der Sohn des Therapeuten und Schmuckherstellers führt die Säge. Behutsam lässt er sie die Rille entlanggleiten, bis der Quarter zerteilt ist. Die Jungs grinsen, freuen sich kichernd und überdreht. Der Schraubstock wird geöffnet, der eine halbe Quarter gedreht und wieder eingeklemmt. Erneut setzt die Säge an. Das schmale Sägeblatt gräbt sich in die halbe Münze und halbiert sie ein weiteres Mal. Der andere Junge nimmt das Ergebnis in Augenschein. Zu sehen sind nur noch Washingtons stolze Stirn und Nase und die Buchstaben LIB. Die Jungs haben einen Quarter-Quarter erschaffen.
Die beiden frischen Viertel-Quarters landen auf dem Tisch, beim Rest ihrer Fleißarbeit: einem Haufen zerstörter Münzen. Fast alles Fünfundzwanzig-Cent-Stücke, halbiert oder geviertelt. Auch ein paar Nickels sind darunter. Dimes? Zu klein. Pennys, die Mühe nicht wert. Im Zimmer hängt der scharfe Geruch von heißem Metall, von winzigen Münzsplittern.
Die Jungs widmen sich dieser völlig sinnlosen Tätigkeit, nachdem sie zusammen hier übernachtet haben. Es ist zehn Uhr morgens. Sie sind wie Fliegen im Netz des Sommers zwischen achtem und neuntem Schuljahr gefangen, dem Wechsel auf die Highschool, der großen Unübersichtlichkeit des Übergangs von diesen Straßen in die Stadt im Großen.
Nichts wird mehr so sein, wie es war.
Sie schaufeln sich die zerstörten Münzen in die Hände und stopfen sie in ihre Hosentaschen, bis die ganz ausgebeult sind. Die zwischen ihnen fließende Energie ist stark und ausgelassen. Doch trotz ihrer selbstbezogenen Gerissenheit ist es die Freude über etwas Feiges. Klar, sie sind Vandalen – so viel steht fest. Sie sind dafür bekannt, überall in der Stadt Graffiti gesprüht zu haben. Wenn sie mutig waren, auf Züge. Öfter aber auf Backsteinmauern, Metalltüren, Lastwagen. Den Court-Street-Bus haben sie nachts mit Eiern beworfen, aus den Fenstern ebendieses Apartments (der geschiedene Vater zählte seinen Vorrat an Eiern nicht nach). Was wollen sie damit beweisen, dass sie die Münzen zerstören?
Die Jungs gehen zur Wohnungstür hinaus, die dreifach gesichert ist, unter anderem mit einem Stangenschloss, das sich bis zum Fußboden zieht, steigen die Hintertreppe hinunter und machen sich auf den Weg zur Straße.
KAPITEL 17 der US-Gesetzgebung behandelt die »Entstellung, Beeinträchtigung und Fälschung von Münzen. § 332. Münzverfälschung; Änderung der amtlichen Maßstäbe oder Veruntreuung von Metallen.«
Die beiden begehen also ein Verbrechen.
Ist es wahrscheinlich, dass sie deshalb verhaftet werden?
Eher nicht.
In der Welt dieser weißen Jungs sind die Polizisten im Fernsehen stärker präsent als im echten Leben. Polizeibericht, Adam-12, Kojak, das verdammte Landei McCloud.
Kein Polizist aus dem Fernsehen wird mit quietschenden Reifen halten und sie wegen der Entstellung von Münzen verhaften.
Die Jungs überqueren die Atlantic Avenue, gehen die Court Street entlang in Richtung italienisches Viertel, ihre alte Schule, die Sozialsiedlung, Cobble Hill Park. Mit Sicherheit wissen wir nur, dass die Quarters im Wert von mehreren Dollar, die in ihren Taschen klimpern, nicht mehr zum Kauf von U-Bahn-Marken oder einem Stück Pizza benutzt werden können. Sie haben ihr Geld ruiniert! Was soll das?
2. Niemand weiß (jederzeit)
In dieser Geschichte geht es um das, was niemand weiß.
Sie spielt an einem Ort, von dem jeder glaubt, dass er ihn kennt. Aber niemand weiß etwas über diesen Ort oder hat jemals etwas gewusst.
Vielleicht übertreibe ich.
Trotzdem macht sich kaum jemand die Mühe zu wissen. Zum Beispiel, dass die Familie von Malcolm X in den Stunden und Tagen nach seiner Ermordung in einem Safe House an der Ecke Dean und Nevins Street versteckt wurde. Niemand weiß das. Oder man hat es vergessen.
Und man hat auch vergessen, dass Willie Sutton an der Ecke Pacific Street und Third Avenue verhaftet wurde. Als er gefragt wurde: »Warum rauben Sie Banken aus?«, antwortete er: »Weil da das Geld ist.«
Das weiß niemand mehr, falls man es je gewusst hat.
Niemand weiß, dass Isaac Asimov in den 1940ern ein Jahr lang in 213 Dean Street wohnte. Um sich dafür zu interessieren, müsste man ein Nerd sein. Aber selbst dann, wie sollte man es herausfinden? Der Mann hat vierhundert Bücher geschrieben. Sogar, wenn man fünfzig davon gelesen hat, würde man achtlos an dem Haus vorbeigehen.
Niemand weiß, dass H. P. Lovecraft, der paranoide Rassist, in den 1940ern in 169 Clinton Street an der Ecke State Street gewohnt hat. Er lebte in tiefstem Elend, hockte dort in seiner Angst vor dem Anderen. »Die Bevölkerung ist ein unentwirrbares, rätselhaftes Durcheinander. Syrische, spanische, italienische und negro Elemente vermischen sich, während nicht weit entfernt einzelne von Skandinaviern und Amerikanern bewohnte Straßenzüge liegen. Es ist ein Babel aus Lärm und Schmutz, das seltsame Schreie ausstößt, die den gegen seine rußigen Kais leckenden öligen Wellen und den ungeheuren Orgellitaneien der Schiffssirenen antworten.«
Hau ab, du!
Jemanden wie dich brauchen wir hier nicht.
Und fünf Minuten später geht er, Brooklyn will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
So eine Gegend ist das. Ein Babel aus Lärm und Schmutz, aber es ist unser Babel aus Lärm und Schmutz, und die vielen Trümmer, die man heute vor sich hat, kann man nicht durchforsten, ganz zu schweigen von den Verschrobenheiten, die für immer verschwunden sind.
Ein Beispiel: In 246 Dean Street stürzte ein Reihenhaus ein. Es war eins der vier ungewöhnlichen Holzhäuser in diesem Straßenzug, wahrscheinlich keine gute Idee, sie zwischen die Brownstones zu quetschen. Regen drang ein, durchs Dach, durch die Fugen. Den Steinen der Brownstones machte das nichts aus; auf ihnen wuchs Moos. Doch die Holzkonstruktion saugte die Feuchtigkeit auf. Sie sackte ein und verrottete, und als man es bemerkte, war es bereits zu spät.
Als es eingestürzt war, war es billiger, die Ruine in der Erde ihres eigenen Fußabdrucks und hinten im Garten zu begraben. Und als schließlich Hippies das Grundstück erwerben, zusammen mit dem Brownstone daneben, dem mit den bemoosten Steinen, um das Ganze zu renovieren, sind sie erstaunt, dort im Boden einen Berg von Putz und Putzträgern, zerbrochenen Badezimmerfliesen und Trümmern eines marmornen Kaminsimses zu finden. Sie hatten geplant, einen Garten anzulegen, na, dann viel Glück. Es ist, als hätte die Erde sich aufgetan und das Haus zermalmt und halb verschlungen. Als wäre dort eine Bombe explodiert.
Warum wurden in diesem Straßenzug aus Steinbauten die vier hölzernen Giebelhäuser eingezwängt? Wer hat dort gewohnt? Warum ist das eine eingestürzt? Wie kam es zu der Entscheidung, es an Ort und Stelle zu beerdigen? Niemand weiß es, niemand schert sich darum. Hier in der Gegend nennen wir das wild parken.
Niemand weiß, was vor fünf Minuten hier war, kurz bevor man herkam, geschweige denn vor hundert Jahren.
Niemanden interessiert, dass niemand es weiß.
An diesem Ort, den es einmal gab, in einer Zeit, in der die Stadt ein Synonym für Verbrechen war, wurde niemand fürs Vergessen verhaftet.
3. Weiße Jungs ohne Namen (generell)
Warum haben die weißen Jungs mit den zerstörten Münzen keine Namen?
Sie brauchen keine.
In diesen Straßen, in dieser Brooklyn Crime Novel, gibt es einfach zu viele von diesen weißen Jungs. Einige werden wieder auftauchen, andere nicht. Das spielt keine Rolle. Bei dieser Ermittlung nehmen wir eine breitere Perspektive ein.
Hier kommt ein Tipp: Behalten Sie von den weißen Jungs den verhätschelten Jungen und den Sohn des Millionärs im Auge, wenn sie in Erscheinung treten.
Auch den jüngeren Bruder, der in der nächsten Geschichte auftauchen wird.
Und den Schwarzen Jungen, der gerade die Straße entlangkommt.
4. Hockeykrieger (1976)
Ein Schwarzer und drei weiße Jungs gehen mit Hockeyschlägern westwärts die Dean Street entlang und überqueren die Smith Street. Dann, an der Court Street, wo die Dean ausläuft und ihren Namen in Amity ändert, betreten sie Cobble Hill. Von dort wenden sie sich nach Süden, die Clinton Street entlang, Richtung Carroll Gardens, dem italienischen Viertel.
Zwei der drei weißen Jungs sind dreizehn. Der dritte, ein Elfjähriger, ist ein jüngerer Bruder.
Der jüngere Bruder ist, offen gesagt, ein Kompromisskandidat. Sie brauchen ihn für ein Viererteam. Sie sind mit einer eingespielten rein italienischen Truppe, die sie in der Henry Street erwartet, zum Streethockey verabredet.
Der jüngere Bruder musste erst überredet werden, weil – Hockey? Streethockey? Doch sein älterer Bruder nimmt ihn nur noch selten mit, und ihm gefällt, dass es noch immer passieren kann. Sein älterer Bruder und seine Freunde haben gesagt, sie bräuchten ihn.
Dann also Streethockey. Warum nicht.
Keiner der drei weißen Jungs ist Italiener. Sie wohnen, wie der Schwarze, alle in der Dean Street.
Wenn sie schon keine Italiener sind, sind sie dann was anderes? Klar, ein Mischmasch. Ein undefinierbarer Haufen WASPs, Halbjuden, Hippies, was auch immer. Keiner mit einer Identität, die es mit der der Italiener aufnehmen könnte.
Sie sind Brownstoners.
Der Schwarze Junge ist zehn Monate älter, ein Schuljahr höher an der staatlichen Schule und vom Stellenwert selbst dem ältesten der drei weißen Jungs weit voraus, die er gerade für eine erwartbare Niederlage in das fremde Revier von Carroll Gardens führt.
Weiß einer dieser vier Jungs, wie man in Turnschuhen Hockey spielt – und sei es auch nur Streethockey? Nicht wirklich.
Der Schwarze Junge ist ihre größte Hoffnung, wegen seines Selbstvertrauens, seiner Energie und seines Könnens bei Straßenspielen im Allgemeinen.
Der jüngere Bruder hingegen dürfte so gut wie nutzlos sein. Man muss ihn bestimmt immer wieder aufmuntern, damit er weiterspielt, so, wie man ihn auf dem Weg in das unbekannte Viertel ständig aufmuntern muss. Der jüngere Bruder könnte ein Totalausfall sein. Aber wenn sie mit weniger als vier Spielern aufkreuzen würden, bräuchten sie gar nicht erst anzutreten.
Sie sind jedenfalls eine seltsame Truppe. Die italienischen Jungs werden sie plattmachen. Es hat etwas Ruhmvolles, zu wissen und doch nicht zu wissen, wo sie da reingeschlittert sind. Es ist allein schon unglaublich, dass sie es geschafft haben, vier Hockeyschläger aufzutreiben – die Kelle gesplittert und komplett mit Isolierband umwickelt, auch wenn sich darin die Aussichtslosigkeit ihrer Aufgabe zeigt.
An der Ecke Kane Street begeben sie sich eine Straße weiter westwärts und gehen am stillen Schulhof der P. S. 29 vorbei, um zur Henry Street zu gelangen. Es ist ein Samstagnachmittag Anfang Mai. Hier bleiben wir zurück und lassen die Jungs in das honigfarbene Licht einbiegen, das sich über die Dächer wölbt, durch das Laubdach sickert und sich auf die kunstvollen Simse der Brownstones legt. Wir lassen sie einen Moment aus den Augen, lassen sie unbegleitet ihrem Schicksal entgegengehen. Das liegt näher an der Wahrheit. Niemand sieht sie, nicht in diesem Moment.
Ein Mittel gegen Lyrismen. Halten wir das Licht, besonders das honigfarbene Licht, von unseren Augen fern. Nur die Fakten, Mann – keine malerischen Effekte. Wir sind hier, um Verbrechen aufzulisten. Oder vielleicht, um Vorfälle, die keine Verbrechen und eher die Ausnahme sind, von einem allgemeinen kriminellen Hintergrund zu unterscheiden. Uns geht es nicht darum, Licht auf Gesichtern zu schildern oder Licht, das durchs Laub auf Simse fällt. Die Stadt ist ein Netz von schematischen Darstellungen. Versuchen wir, ein paar Nadeln in die Karte zu stecken. Unnötig, Schmetterlinge aufzuspießen. Keine Schmetterlinge, kein schmeichelndes Licht.
Wir folgen dem Beispiel der Jungs: Hüte deine Geheimnisse, verberge deine geheimen Exzesse. Sollte es zwischen zwei dieser vier Dean-Street-Jungs eine spezielle Anziehungskraft oder Romanze geben, so wird sie jetzt strikt hinter der kriegerischen Fassade dieses Nachmittags bewahrt. Vier Körper marschieren, die Schläger geschultert. Ein Anblick, den wir noch nie gesehen haben.
An der Ecke Henry und President Street treffen die vier auf vier andere. Ein Tag der Vierergruppen. Das sind nicht ihre vorgesehenen Gegner, die warten vermutlich sechs Straßen weiter. Es sind vier andere Italiener, die an der Straßenecke auf Stühlen sitzen, vor einem unbeschilderten Clubhaus, einem kleinen Laden mit schwarz gestrichenen Fenstern. Wir sprechen hier natürlich von Einheimischen, es sind der Nationalität nach keine Italiener, womöglich war keiner von ihnen je in Italien, vielleicht hat einer eine aus Scham verschwiegene puerto-ricanische Mutter, aber komm schon, dasisnichIhrErnst, wirwissenwovonwirhierreden, das ist ein italienisches Viertel, und da gibt es ein Selbstverständnis, eine Klarheit, die im Gegensatz zu dem seltsamen Mischmasch der vier Jungs mit ihren Schlägern fast eine Wohltat sein könnte. Das Alter der Italiener reicht von vierzehn, dem Alter des Schwarzen Jungen, bis zu einem, der zwanzig sein könnte, aber mit seiner Bomberjacke und seinen geflochtenen Halbschuhen jünger erscheinen will. Er hat einen schmalen Oberlippenbart, der aus etwas Härterem als Flaum besteht. Beim Anblick der Dean-Street-Jungs erheben sich die vier und zeigen ein dreistes, schwerfälliges Erstaunen über das, was da vor ihnen steht.
»Das kann nicht euer Ernst sein.«
»Was?«
»Was soll das? Was habt ihr vor?«
»Wir haben ein Spiel.«
»Mit den Schlägern geht ihr nirgends hin. Auf dem Absatz kehrt, und das will ich nicht noch mal sagen.«
»Komm schon, wir haben ein Spiel.«
»Ein Spiel, sagt er. Ich treib mit dir gleich ein Spiel. Dann landest du auf dem Arsch und schreist nach deiner Ma, und sie fragt, was ist los, und dann sagst du, keine Ahnung, ich bin in einem Spiel aus Versehen auf den Arsch gefallen.«
»Er treibt sein Spielchen mit deiner Mutter.« Eine zweite Stimme, um klarzumachen, was Sache ist.
Der jüngste Italiener streckt die Hand aus und schlingt die Finger um den Schläger eines der Dean-Street-Jungs, der ihn aber nicht loslässt. Ein kurzes Tauziehen, dann schlägt der älteste und größte Italiener, der mit dem schmalen Bart, die Hand des Jüngeren weg.
»Wir tun euch einen Gefallen.«
»Wir treffen uns mit Vinnie«, sagt der Schwarze Junge. »Die warten auf uns.«
»Wo? Wer?«
Das Spiel soll in der Summit Street stattfinden, der ruhigsten Straße in Carroll Gardens, hinter der Pfarrkirche von Sacred Hearts of Jesus and Mary & St. Stephen, wovon nichts erwähnenswert ist, nicht einmal, wenn es ihm auf der Zunge läge. »Vincent.«
»Wer?«
»Vincent, Vinnie.«
Nach dem Gesichtsausdruck der Italiener zu urteilen, könnte Vinnie der jüngere Bruder oder der größte Feind von irgendwem sein. Oder ein Hund vom Mars.
»Warum treibst du dich mit diesen Typen rum?«, fragt Oberlippenbart den Schwarzen Jungen. »Was soll das werden? Das ist doch unsinnig.«
»Streethockey.«
»Was ist das überhaupt?« Die Fragen führen unausgesprochen auf ontologisches Gelände, zu fundamentalen Themen des Seins. »Was hab ich hier vor mir? Sag’s mir einer, denn ich kapier’s nicht.«
»Lasst uns einfach vorbei.«
»Was bist du überhaupt? Sag’s mir. Bist du Jude? Weiß irgendwer, was ich hier vor mir hab?«
Eine weitere Klarstellung: »Weiß es deine Mutter?«
»Komm schon.«
»Er sagt: Komm schon. Ihr könnt von Glück reden, dass wir eure Schläger nicht endgültig demolieren. Wo habt ihr die überhaupt her? Triangles? McCrory’s? Die sollten euch so was nicht verkaufen, das ist in eurem Fall unverantwortlich. Was ist das, medizinisches Klebeband? Ihr habt euren Schlägern eine Schlinge verpasst?«
»Panzerband.«
»Wenn ich eins weiß, dann, dass das kein Panzerband ist.«
Aus irgendeinem Grund finden das die Italiener zum Brüllen komisch. Die Stimmung ist plötzlich so heiter und ansteckend, dass die Dean-Street-Jungs ebenfalls lächeln und mit verblüffter Erleichterung kichern. Dann, als wäre das Gelächter das Signal, dass der Wortwechsel zu einem Ergebnis gelangt ist, sagt Oberlippenbart: »Nein, im Ernst, verschwindet von hier. Ihr werdet diese Straße nicht überqueren. Geht heim, bevor wir euch mit euren Panzerband-Schlägern erschlagen, ihr nichtiger Haufen.«
Die anderen Italiener stimmen ein.
»Nichtige Mutter.«
»Wir ficken sie mit dem Schläger.«
»Los. Verschwindet. Geht mir aus den Augen.«
Die Dean-Street-Jungs wissen, wann sie besiegt sind, und treten auf der Henry den ungeordneten Rückzug an. An der Kane Street sagt der Schwarze Junge: »Hier lang! Wir gehen nach Columbia Heights und machen einen Umweg. Die Kane Street führt direkt hin!«
Einer der weißen Jungs stimmt bereitwillig zu, ein anderer nicht. »Vergiss es, du hast die Typen doch gesehen, die machen uns fertig.« Der jüngere Bruder hat die Augen weit aufgerissen, womöglich von der Begegnung an der Ecke traumatisiert.
»Wir können jetzt nicht den Schwanz einziehen. Vinnie und seine Jungs warten auf uns.«
»Es ist zu spät.« Die Zeit scheint tatsächlich zu verrinnen, die Sonne eine verschwommene Kugel, die sich auf ihrem Weg immer wieder hinter den Dächern versteckt.
»Auf geht’s, meine Brüder, gehen wir!« Der Führungsanspruch des Schwarzen Jungen ist nicht zu bändigen. Sie gehen westwärts, eine nervöse Schar, die dennoch wie eine Einheit handelt. Das heißt, bis sie zur verschandelnden Grenze des Viertels kommen, dem Brooklyn-Queens Expressway. Statt oben zu verlaufen, ist der Expressway an dieser Stelle wie ein schroffer Burggraben ins natürliche Netz der Brooklyner Straßen geschnitten. Ein dröhnender Graben voller Autos und grauen Schadstoffen, die so grob sind, dass sie sich zwischen den Zähnen festsetzen.
Der kleine Bruder widersetzt sich und will den Highway nicht überqueren. Die Deckung der baumgesäumten Straßen zu verlassen, war schlimmer, als er befürchtet hat. Aber das hier fühlt sich an, als würde er ins Nichts stürzen. »Lasst uns zurückgehen.«
Der ältere Bruder putzt ihn herunter. »Zurück? Wir sind doch schon fast da! Wir müssen das Spiel durchziehen!«
Der Schwarze Junge ist einfühlsamer. »Keine Sorge, Mann, die können uns nicht sehen.« Er gestikuliert lebhaft mit seinem Schläger. »Hört zu, wir bleiben auf der Hicks, gehen aber auf der anderen Seite des Highways, dann sehen sie uns nicht. An der Sackett und der Union kann man den BQE wieder überqueren, die können unmöglich beide Straßen überwachen und sind sowieso zu faul, von ihren verdammten Plastikkästen aufzustehen.«
Sein Grips und seine Ausdruckskraft, der Schwall der Straßennamen, die unablässige Beschwörung der Überzeugung, dass die anderen sie nicht sehen können. All das ist im Augenblick unwiderstehlich, selbst für den Jüngeren, dem die Tränen in den Augen stehen. Niemand korrigiert ihren Anführer, dass es Stühle und keine Plastikkästen waren. Sie überqueren den Highway und schleichen auf der Hicks südwärts.
Doch der italienische Trupp hat gegen jede Hoffnung und Wahrscheinlichkeit mitten am Nachmittag eine sinnlose Motivation entwickelt. Sie haben ihre Stühle verlassen. Und sie kennen die Brücken über den BQE an der Sackett und an der Union, die nicht weit voneinander entfernt sind. Dort warten sie, springen dann vor, zeigen auf die Dean-Street-Jungs und schlagen mit der Faust in die Hand, als erwarteten sie einen Flyball.
»Lauft!«
Die Dean-Street-Jungs fliehen auf der Sackett zum Hafen und erreichen Columbia Heights. Nach einem kurzen Moment, in dem die Gruppe sich aufzulösen droht, weil zwei nordwärts und zwei südwärts gehen, versammeln sie sich in ihrer Hilflosigkeit wieder hinter dem Schwarzen Jungen. Überraschenderweise hat er Mut gefasst und geht südwärts, tiefer in das fremde Revier hinein, noch immer darauf beharrend, das Spiel nicht zu verpassen.
Jetzt heult der jüngere Bruder. Ist das Red Hook? Er weiß es nicht. Nach Red Hook wollte er noch nie, erst recht nicht an diesem Tag, nur mit dem seltsam furchtlosen Schwarzen Jungen als Führer. Der Name Red Hook hat ihn schon immer beunruhigt. Wie die Namen anderer unbesuchter Orte deutet er auf eine Reise in eine unerwünschte Vergangenheit hin. Als hätte Red Hook vom Brooklyner Festland getrennt werden sollen, amputiert, um aufs Meer hinauszutreiben.
Und dort mit Hockeyschlägern hingehen? Könnten sie nicht wenigstens die zurücklassen?
Der jüngere Bruder ist durch seine Rolle als jüngerer Bruder innerhalb der Gruppe isoliert. Er ist auf dem Gehsteig allein, abgekapselt, als stünde er unter Quarantäne. Als könnten seine Tränen, sein irrationales Geflenne ansteckend sein. Vielleicht weint er ihretwegen, wegen des Geheimnisses, von dem jeder weiß.
Es dauert nur noch zwei Monate, bis dem jüngeren Bruder etwas sehr Schlimmes zustoßen wird.
Vielleicht weint er, weil er spürt, dass es bevorsteht. An jenem schlimmen Tag im Juni wird er nicht weinen, wie er es heute beim Überqueren des BQE in das unbekannte Territorium von Red Hook getan hat. Er wird gar nicht weinen.
Man kann so etwas nicht immer verstehen. Man kann nicht immer voraussagen, wann man in Tränen ausbricht.
Also gehen sie weiter. Aber gibt es die Verabredung überhaupt noch? Auch nur die geringste Chance, dass Vincents Viererteam nicht abgewunken und sich etwas anderem gewidmet hat? Haben sie den Sieg für sich in Anspruch genommen, falls sie sich überhaupt an die Herausforderung erinnerten?
Der Dean-Street-Trupp ist jetzt weit von zu Hause entfernt. Vielleicht waren sie das schon immer. Wie lange werden sie durchhalten? Werden sie sich noch mal mit den vier älteren Italienern auseinandersetzen oder vielleicht mit etwas anderem Unvorhergesehenen, während sie die Straßen in Richtung eines Hockeyspiels entlangzockeln, das aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht stattfinden wird?
Schalten Sie wieder ein, denselben traurigen Sender.
5. C., 1. Teil (ein Schnappschuss)
Was sieht dieser Schwarze Junge in seinen weißen Freunden?
Oder will er etwas von ihnen?
Oder sollen sie etwas in ihm sehen oder von ihm wollen?
Was bringt ihn dazu, sich den weißen Jungs aus der Dean Street – noch dazu beim Hockey – als Anführer anzudienen oder ihnen beizubringen, wie man einen Gummiball richtig von der Treppe wirft, beim Skully-Spiel einen Kronkorken über den Asphalt schnipst oder in einer Bodega eine Limonade klaut. Er hat sogar das Gefühl, ihnen beibringen zu müssen, wie man richtig die Straße entlanggeht, nicht alle fünf Schritte den Hals nach hinten zu recken und, für jeden sichtbar, Schwäche zu signalisieren. Er bringt ihnen alle Tricks aus dem Lehrbuch bei – alle Tricks aus dem Buch seines Körpers.
Vor Jahren war der Magical Negro eine Vorstellung, die man nur beklagen oder ins Lächerliche ziehen konnte, jedenfalls nichts, dem man entsprechen wollte, doch dem Schwarzen Jungen aus der Dean Street ist diese Rolle zugefallen, für alle Interessenten im Umkreis von fünf Häuserblocks.
Was ist nötig, um sich hier einen Namen zu machen? Nennen wir ihn C.
Jetzt stellen Sie die Frage noch mal. Was sieht C. in diesen Jungs?
Die Antwort ist womöglich gar nicht so sehr, dass er etwas in ihnen, den weißen Jungs, sieht. Klar, er sieht sie. Aber er spürt ihre Eltern. Ihre Eltern und seine Mutter. C. ist eine Stimmgabel für Eltern. Er hat um diese Fähigkeit nicht gebeten. Wie die meisten Kräfte ist sie Fluch und Segen zugleich.
C. hört die Eltern, wenn sie sprechen, und auch, wenn sie es nicht tun. Aber sein Bewusstsein für die weißen Eltern kommt erst später. Zuerst kommt unvermeidlich die Einstimmung auf seine eigene Mutter.
Sie stammt, anders als sein Vater, von einer Insel. Haiti. Sie arbeitet als Krankenschwester im Brooklyn Hospital im Fort Greene Park und erzählt die reinsten Horrorgeschichten aus der Notaufnahme. Um genauer zu sein, über die schmutzige Unterwäsche der weißen Kinder, wenn sie mit gebrochenen Gliedmaßen vom Spielplatz eingeliefert werden. Vor allem die Privatschulkinder aus Brooklyn Heights. Je reicher, desto schmutziger.
»Man behandelt sie wie alle anderen«, sagt sie über die weißen Leute, noch bevor er richtig begreifen kann, wovon sie überhaupt redet. »Sie wissen es nicht besser.«
(C.s Vater, der aus Bushwick stammt, drückt es sehr viel einfacher aus. »Lass dich von ihnen nicht in Schwierigkeiten bringen. Pass auf, dass du es ihretwegen nicht mit den Bullen zu tun kriegst. Denn du kannst sicher sein, dass die Bullen dich und nicht die weißen Jungs einbuchten.«)
Die Philosophie seiner Mutter dringt von allen Seiten auf ihn ein. Sie kommt aus dem Nichts. Beim Eierkochen oder wenn sie ihm beibringt, wie man seine Fliege zum Kirchgang bindet, etwas, das er nie richtig hinbekam. Ihre Gedanken flatterten heraus wie Spruchbänder:
»Du musst ihnen klarmachen, wer du bist. Glaub ja nicht, dass sie es schon wissen.«
Stets beginnt sie mit einer Behauptung, die ihm fragwürdig erscheint, aber egal. Für sie ist es die reine Wahrheit. »Es ist dein Viertel. Behandle sie wie Gäste in deinem Haus.«
Oder: »Stell dich kurz vor, schau ihnen in die Augen. Nenn die Eltern Mister oder Missus Soundso.«
Oder: »Siehst du den Schmutz unter den Fingernägeln dieses Jungen? Wissen diese Leute denn nicht mal, wie man ein Kind wäscht?«
Oder: »Bring den Jungen zur Schule und danach wieder zurück, ist mir egal, ob du unterwegs kein einziges Wort mit ihm sprichst.«
Zu den vielen Dingen, vor denen er die weißen Kinder instinktiv schützen musste, wird C. Jahre später reumütig denken, gehörte auch das harte Urteil seiner Mutter.
Sie betrachtet ihn, als sie sich auf den Weg zur Kirche machen, sieht, wie sein Blick seitwärts gleitet, um die morgendliche Straße in sich aufzunehmen, und sagt: »Sie wissen nicht mal, wie man richtig spielt.«
Es ist, als wüsste sie schon vor ihm, was er später am Nachmittag tun wird. Er wird die Fliege weglegen – irgendwo hat er noch immer eine Zigarrenkiste mit diesen Dingern –, um nach draußen zu laufen und einen wirren Haufen weißer Jungs in unterschiedlichem Alter und mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu so etwas Ähnlichem wie einem Stickball-Spiel zu überreden. Auf welcher Grundlage? Was wusste er, das sie nicht wussten? Als Grundlage diente C. ein Schwarz-Weiß-Film mit Willie Mays in irgendeiner Straße in Harlem, in dem er die Kanaldeckel als Spielfeldmarkierung nutzt und zwei Jungs nacheinander die Hände um einen Schläger legen, um zu ermitteln, wer als Erster dran ist.
Zur Hölle mit Eeny Meeny Miny Moe, man müsste taub sein, um das Echo in diesem Mist nicht herauszuhören.
Als wüsste seine Mutter schon vor ihm, was er tun wird, oder als würde sie vielleicht sogar dafür sorgen, dass es passiert.
Vielleicht ist die Antwort auf die Frage von C.s Rolle als Fürsprecher und Beschützer der weißen Jungs tatsächlich so einfach: Seine Mutter sorgte dafür, dass er sie spielte.
6. Die Schreierin (1975–1982)
In der Hoyt Street, zwischen Dean und Pacific, in einem heruntergekommenen Haus mit bröckelnder Fassade und abblätternder Farbe, erscheint in einem Fenster im zweiten Stock regelmäßig die Schreierin. So etwas wie eine albtraumhafte Rapunzel, ein weißes Mädchen, verrückt, ins Haus verbannt. Sie blickt auf die Straße hinaus und schreit. Unverständlich, unberechenbar und verdammt laut!
Wen schreit sie an?
Jeden, der vorbeigeht.
Manchmal niemanden, dann sind es bloß verrückte, in den blauen Himmel oder auf die stummen Fenster des katholischen Krankenhauses gerichtete Rufe.
Doch immer öfter trifft es die Jungs, die kommen, um sie aufzustacheln.
Die weißen und die Schwarzen Jungs und die Puerto-Ricaner (von denen manche Dominikaner sind, doch diesen Unterschied begreifen die weißen Jungs nicht). Der Block der Schreierin bildet eine Art Schutzraum, eine neutrale Zone. Die Situation gleicht einem universellen Lösungsmittel, einem Stoff, der jeden galvanisiert, der von ihren irren, aus den Wolken geschleuderten Blitzstrahlen getroffen wird.
Den Jungs kommt es allmählich wie etwas Sexuelles vor, aber daran will keiner denken. Der Witz über die polnische Stripperin: Zieh so viele Sachen wie möglich an. Nur zu, versuchen Sie’s, brüllen Sie Ihre Stand-up-Nummer zu ihr hinauf. Als versuchte man, einen Gummiball aufs Dach zu werfen, schwerer, als es aussieht. Die Schreierin hat keinen Sinn für Witz. Und sie hat den längeren Atem.
Die Hoyt Street, der Weg zur A-Train von den Sozialwohnungen der Gowanus Houses, ein Spießrutenlauf für beklommene neue Pendler, die Strecke zu einem gespenstischen Krankenhaus, geleitet von Nonnen, wohnhaft in Reihenhäusern, die irgendwann Zigmillionen wert sein werden. Aber der Block gehört der Schreierin, durch das absolute Gesetz der Aggression.
Es ist eine Zeit der Sirenen, die Feuerwehr in der State Street dröhnt in den südwärts verlaufenden Straßen Nevins und Hoyt, bis tief nach Gowanus, um sich um brennende Wohnungen in den aufzuglosen Häusern, Ofenbrände in Wyckoff Gardens, die vermutlich von der Mafia angezündeten Lagerhäuser und Leichenhallen zu kümmern oder vielleicht den brennenden chemischen Schlick zu löschen, der auf dem Kanal schwimmt.
Bei Tag und Nacht jederzeit Schreie aus den oberen Fenstern, das Gestöhn von herumliegenden Körpern, die auf den Gehsteigen an der Atlantic Avenue oder in vernagelten Ladeneingängen ihren Rausch ausschlafen.
Reichlich Musik plärrt aus offenen Wohnzimmerfenstern und vermischt sich auf der Straße mit dem, was aus den Autos dringt, Merengue und Jackson 5, Harold Melvin and the Blue Notes, vielleicht ein paar Töne Funkadelic oder Pink Floyd.
Money, it’s a hit!
Aber es ist auch ein Reich toter Punkte, seltsamer Schluchten und Täler in der akustischen Sphäre, oft kommt nachmittags zwischen zwei Dean-Street-Bussen, die halbstündig fahren, kein einziges Auto vorbei.
Die Schreierin ist jedenfalls einmalig, Avantgarde wie John Cage oder La Monte Young. Sie ist pre-punk!
Entweder kein Einziger oder hundert Leute haben wegen der Schreierin die Cops verständigt, beides ist gleichermaßen plausibel und sinnlos. Was sollen die Cops denn machen, ihrer Familie sagen, dass man sie auffordern soll, damit aufzuhören? Meinen Sie, das hätte man noch nicht probiert?
Jahrzehnte später ist es ein Test: Bist du wirklich aus dieser Gegend, weißt, wie es früher war, wie du behauptest? Ja? Kennst du die Dean Street, Pacific, Bond? Erinnerst du dich an den Buggy-Lebensmittelladen an der Ecke Bond Street? Klar. Oder vielleicht. Hilf meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Erinnerst du dich noch an das Local Level? Glaub nicht, denn das war kein Ort, der einen Sinn ergab. Erinnerst du dich an Ziad’s? Da gab’s gute Sandwiches.
Aber kannst du dich noch an die Schreierin erinnern?
Wer das kann, ist wie ein Freimaurer, er kennt das geheime Zeichen. In einem geteilten Land gab es eine Fanfare, das Horn der Jägerin. Die Jungs kannten es genau.
Vielleicht besteht das Verbrechen darin, sich zu erinnern?
Die Schreierin schreit noch immer.
7. Apropos Polizei (1971–1982)
An einem schwülen Sommertag 1971 wird ein siebenjähriger weißer Junge aus der Dean Street auf der westlichen Seite der Nevins Street, in der Nähe des Fischmarkts, von einem streunenden Hund gebissen. Was hat der Siebenjährige in dieser Gegend zu suchen? Wer weiß. Das sind frei umherlaufende Stadtkinder. Niemand hat ihm gesagt, dass er sich einem streunenden Hund nicht nähern soll. Er mag Hunde.
Der Hund fügt ihm eine blutende Wunde zu, der Junge schreit auf. Der Hund – ein geducktes, zutrauliches, bemitleidenswertes Tier – trottet über die Nevins und sucht Schutz in einer offenen Garage. Der Junge – ein geducktes, zutrauliches, bemitleidenswertes Kind – verschwindet um die Ecke nach Hause. Die Eltern erscheinen, bemüht, den Hund zu identifizieren. Hat er einen Besitzer? Hat er Schaum vor dem Maul?
Die Polizei wird von zwei verschiedenen Nachbarn telefonisch verständigt. Polizisten von zwei Revieren, dem 78. und dem 77., tauchen auf. Die beiden Polizistenpaare treffen etwa zur selben Zeit ein, was an diesem knallheißen Nachmittag in dieser hoffnungslosen Gegend nicht besonders schnell ist. Wegen eines tollwütigen Hundes? Ein Wunder, dass sie überhaupt gekommen sind, und dann noch in doppelter Ausführung. Doch als sie da sind, konfrontiert mit der Aussicht, den knurrenden Köter aus der Garage zerren und zur Untersuchung ins Tierheim oder zum Tierarzt bringen zu müssen, während die Eltern alles Mögliche fordern, und danach mit dem ganzen Papierkram konfrontiert zu sein, wägen die Polizisten ihre Optionen ab.
Wo genau wurde der Junge gebissen? Hier vor dem Fischgeschäft? Auf dieser Seite der Nevins? Das ist der 77. Bezirk. Wo hat sich der Hund verkrochen? Auf der anderen Straßenseite? Das ist der 78. Während Eltern und Nachbarn ungläubig dastehen, beginnen die beiden Polizistenpaare, sich über ihre Zuständigkeit zu streiten – ist der Tatort oder das Versteck des geflohenen Köters entscheidend? Beide Seiten wollen die Arbeit dem anderen Duo aufhalsen.
Das ist eine altbekannte Polizeigeschichte. Es ist die lokale Version einer O.-Henry-Erzählung oder eines Norman-Rockwell-Gemäldes, nur mit mehr Blut, einem möglicherweise tollwütigen Hund, einer nach Terpentinlappen stinkenden Garage, die jeden Moment in schwarz qualmenden Flammen aufgehen könnte, und, da das hier die zu den Wyckoff-Gardens-Häusern führende Nevins Street ist, mit vielen Leuten, die kopfschüttelnd vorbeigehen und sagen: »Wer, zum Teufel, hat denn die Bullen gerufen?« oder »Seht euch mal diese bescheuerten Polizisten an, haben Angst vor einem dreckigen alten Hund«.
Andere Geschichten könnten vertraulicher sein und nur unter den Kindern im Viertel zirkulieren.
Dass irgendwann am helllichten Tag, ohne Vorwarnung oder Erklärung, ein Streifenwagen in der Bergen Street hielt, und die Polizisten die selbst gebastelten Skateboards zweier schwarzer Jungs, bestehend aus einem Brett, das auf Rollschuhen befestigt war, über den Knien zerbrachen. Völlig grundlos. Sie warfen sie in den Rinnstein und fuhren davon, ohne auch nur zu lachen.
Dass an den brütend heißen Nachmittagen, wenn irgendwer – ein älterer Bruder oder ein Onkel mit einem Schraubenschlüssel? – das Ventil eines Hydranten aufdrehte, um die Kinder aus der Straße im Wasserstrahl herumtollen zu lassen und ihn mit einer an beiden Enden offenen Blechdose auf die Kinder selbst oder auf die offenen Fenster unvorbereiteter Autofahrer zu richten, irgendwann die Cops vorfuhren, alle verjagten und das Ventil wieder zudrehten. Aber das war ein Vorgang, der so natürlich war wie ein Krokodil, das in einer Disney-Doku die Flamingos an einer Wasserstelle aufscheuchte. Das hatte nichts Persönliches, und es war so witzig, zu sehen, wie die Cops die Ärmel hochkrempelten und sich im Wasserschwall nasse Füße holten, dass sich das Ganze fast schon allein deshalb lohnte.
Oder dass einmal ein Streifenwagen an dem zeitvergessenen Straßenzug der 5th Street unweit der 2nd Avenue geparkt war, dieser mikrokosmischen Industriebrache, die zwischen den beiden Armen des Gowanus Canal eingezwängt ist, und durchs Heckfenster die Hinterköpfe von zwei Polizisten zu sehen waren, der blau-weiße Plymouth Fury auf seinem Chassis sanft auf und ab wippend. Die Geschichte stammt von einem älteren Bruder, doch alle Dean-Street-Jungs geben sie als ihre eigene aus. Sie ist vorzeitig schal geworden, weist aber, wie so oft bei den Jungs, eine zimperliche Auslassung auf, sodass manche Jüngeren die Pointe nicht mal verstehen, wenn sie die Story selbst erzählen.
Zwei Nutten, die ihnen einen blasen? Dafür ist auf dem Rücksitz eines Streifenwagens nicht genug Platz.
Haben sie sich einen runtergeholt? Sich gegenseitig einen runtergeholt? Schluss mit den Spekulationen.
Doch vor allem lebt der Geist der Polizei auf dem städtischen Metallschrottplatz unter der Brooklyn Bridge, einem Ort, zu dem sich jeder geierige Junge, der die Überreste durchforsten will, durch den gewellten Maschendrahtzaun mühelos Zutritt verschaffen kann. Hier liegt das Material zur Errichtung einer ganzen Stadt, die Infrastruktur untoter Amtsgewalt: verbeulte, klapprige Aktenschränke, entsorgte Straßenschilder, herausgerissene Parkuhren, alles gestapelt wie Legos oder Lincoln Logs oder Teile des blöden Baukastens im Keller, für den dein Vater es aufgegeben hat, dein Interesse zu wecken. Warum mit Miniaturen spielen, wenn hier das echte Zeug rumliegt, noch dazu kostenlos, sofern man den Willen aufbringen kann, es wegzuschleppen? Hier gibt es wunderbarerweise ausrangierte Teile von Streifenwagen, die Stoßstangen, die Käfige, die die Vordersitze von der Rückbank trennen. Die Originaltüren alter Autos, mit dem antiken Polizei-Emblem. Von Armaturenbrettern abgeschraubte Kurzwellenfunkgeräte.
Die Jungs gehen zu diesem Schrotthaufen, um herumzuklettern und ihren Träumen nachzuhängen. Letztlich schleppen sie nur selten etwas weg, außer ihren Träumen von kaputten, mit Dimes vollgestopften Parkuhren, wenn man die bloß aufbrechen könnte.
Einfach zu schwer.
Diese Teile wieder zu einer festen Vorstellung von »Polizei« zusammenzusetzen, kommt ihnen so aussichtslos vor, wie die Regeln wechselseitigen Parkens zu begreifen, über die sich alle beschweren. Im Grunde gleichen die Polizisten, die in ihren Wagen die Dean Street entlangfahren, der Straßenreinigung, für die dieser Tanz offenbar Platz schafft: lächerliche klotzige Kisten, die selbst schmutzig sind, den Dreck nur sinnlos hin und her schieben und dann weiterfahren.
Die Polizei ist bloß die Begleiterscheinung einer Stadt, die das ganze Gebiet abgeschrieben hat. So, wie die Banken die Gegend ausgrenzen, wie das Umweltministerium sie trotz der Menschen, die dort leben, als Industriegebiet ausgewiesen hat, wie man einen Feueralarm auslösen kann, ohne zu wissen, ob das Signal die Feuerwehr ausrücken lässt oder sie gerade etwas Besseres zu tun hat. Die Schreierin ist bei euch der einzige Bürgermeister.
Dieses Abgeschriebensein ermöglicht es den weißen Jungs, ihrerseits die Cops abzuschreiben. Die Polizisten der Siebzigerjahre jagen niemandem Angst ein. Sie sind nicht militarisiert, zumindest keiner von denen, die die Jungs zu Gesicht bekommen. Sie lassen sich eher alberne Koteletten und Schnurrbärte wachsen, träge aussehende Männer, die für ihren Job ungeeignet sind. Baretta und Columbo haben mehr mit dem Alltag der Jungs zu tun als diese uniformierten Trottel. Leicht, ihnen auszuweichen, wenn man weiße Haut und die geringste Begabung für Ehrerbietigkeit hat. Und sobald die Cops losgefahren sind, kann man in Richtung des sich entfernenden Wagens Wichsbewegungen machen.
Die meisten weißen Jungs, wenn auch nicht alle, können notfalls eine gewisse Ehrerbietigkeit aufbringen.
Aber keiner der Schwarzen Jungs kann notfalls weiße Haut vorweisen.
Haben die Schwarzen Jungs aus der Dean Street also ein anderes Empfinden? Wenn, dann ist es etwas, das sie, beim gemeinsamen Spiel auf der Straße, stumm in ihren Körpern tragen.
8. Juden in der Sozialsiedlung (196?–198?)
Es gibt mindestens zwei jüdische Familien, die in Wyckoff Gardens wohnen. Warum fühlt sich das so persönlich an, dass man kaum davon sprechen kann? Sie sind dort, vor aller Augen versteckt, aber es fühlt sich nicht richtig an. Sobald sie weg sind, wird es sein, als wären sie nie da gewesen.
Die eine ist eine robuste Familie von sechs Personen, die beiden Söhne und die beiden Töchter mit rosigen Wangen, was heißen soll, dass hier alles falsch schreit. Sie sind anscheinend mit einem kompletten Vorstadthaus hergezogen, darunter auch eine fünfteilige Sitzgarnitur, in eine der größten Wohnungen in Gebäude 3, mit Blick auf Wyckoff. Wenn ein anderer weißer Dean-Street-Junge zu Besuch kommt, muss er zumindest nicht die Innenhöfe der Siedlung durchqueren. Dennoch bringt der ältere Bruder den Freund des jüngeren nach solchen Besuchen auf der Nevins zur Dean Street zurück. Das geschieht nur aus Höflichkeit, ist aber unübersehbar und ärgerlich für alle.
Der Jüngste war trotz seiner zwölf Jahre noch nie in Manhattan. Zumindest nicht, dass er wüsste. Äußerst erstaunlich für einige der Jungs, mit denen er seither spielt, und sie weisen ihn darauf hin, dass es doch nur drei U-Bahn-Stationen entfernt ist. Ihr Freund zuckt mit den Schultern, er steht ihrem Hinweis nicht ablehnend gegenüber und hofft, irgendwann hinzufahren, doch die Gelegenheit dazu hat sich einfach noch nicht ergeben. Seine Familie ist nach Brooklyn ausgerichtet, die Cousins sind in Midwood und darüber hinaus verstreut. Verwandte halten sie für wahnsinnig, weil sie hier leben. Wenn sie die Wohnung in Wyckoff Gardens verlassen, fahren sie zehn Stationen mit der F-Train zur Avenue N.
Die andere Familie? Eltern mit einer Tochter. Eine jüngere Familie. Sie sind jüdische Hippies, mit einem stärkeren ideologischen Fundament an diesem Ort – die Eltern haben sich bei der Bürgerrechtsbewegung kennengelernt, in einem Bus bei der Freiheitsfahrt von Newark nach Arkansas. Sie kennen Manhattan gut, fahren oft nach Chinatown und in die Bleecker Street zum Jazz, um ihr Leben vor der Geburt des Kindes wachzuhalten.
Verwandte halten sie für wahnsinnig, weil sie hier leben.
(Beide Paare werden sich vor dem Ende der Siebzigerjahre scheiden lassen, aber das hat nichts mit der Sozialsiedlung oder dem Judentum zu tun, es ist eher eine Modeerscheinung, die über diese Generation junger Eltern hinwegfegt und nur wenige Überlebenskünstler und Außenseiter übrig lässt.)
Was katalogisieren wir hier? Sind Juden in Wyckoff Gardens ein Rätsel oder nur eine ungewöhnliche, unbehagliche Erinnerung? Ein Hinweis oder eine falsche Fährte?
9. Dilettantischer Diebstahl eines Heavy-Metal-Magazins (1977)
Ein weißer Junge in einem kleinen puerto-ricanischen Zeitschriften- und Süßwarenladen in der Bergen Street, unweit der Smith, hinter der U-Bahn-Station der F-Train, nicht größer als ein Wandschrank.
Könnte sein, dass er nur in den Laden geschlüpft ist, um irgendeinem Ärger aus dem Weg zu gehen, den er auf der Straße gespürt hat, ob real oder bloß eingebildet. Ein anderer Junge, dem er ausweichen wollte, einer, dem man nicht entkam, indem man einfach die Straßenseite wechselte. Er hätte nach dem Unterricht nicht so lange im Kunstkurs bleiben sollen, was hat er sich dabei gedacht? Die aus dem Gebäude strömenden Kinder sind sein einziges Versteck, in ihrem Schutz gelangt er ins sichere Fahrwasser von Dean und Hoyt.
Also tut er eine Weile so, als würde er sich umsehen, aber was ist das da, ein Hochglanzcomic mit einem verrückten Logo, irgendein internationales Underground-Magazin, das so dick und glänzend ist wie eine Nummer von Playboy? Was soll das? Mit Airbrush-Bildern von Brüsten?
Nur ein einziges Exemplar, eine falsche Lieferung oder ein Artefakt aus einer alternativen Realität, das aus der anderen Welt in diese geraten ist.
Die Frau am Tresen könnte eine dieser versteinerten Cafeteriagestalten sein, vor Müdigkeit unempfänglich für die Anwesenheit des Jungen. Vielleicht ist das der Tag seiner lang erträumten Unsichtbarkeit! Idiotische Annahme, er ist der einzige Mensch in diesem Raum. Doch der Junge schiebt das unglaubliche Magazin mit überflüssiger Heimlichtuerei unter sein Hemd und schlüpft zur Tür. Schafft es nur einen Schritt über die Schwelle, bevor sie hinter ihm ist und seinen Arm wie mit Klauen festhält. Sie sind gleich groß, was nicht heißt, dass sie groß ist, aber ihn nicht un-klein macht.
Klemmen, klauen, stehlen, das entspricht den Gepflogenheiten. Der Junge hat das lange genug am eigenen Leib erfahren, hat regelmäßig sein Taschengeld rausgerückt, seine Busfahrkarte, seine Armbanduhr, seinen Stolz und seine Moral. In dieser Gegend nimmt man sich, was man haben will, jeder weiß das. Anscheinend alle außer dieser fassungslosen Puerto-Ricanerin, die nicht nur das Magazin zurückhaben will, sondern mit ihrem Blick auch noch eine Erklärung oder Entschuldigung einfordert. Der weiße Junge zuckt mit den Schultern.
Sie redet schnell, aber auf Puerto-Ricanisch, was zugegebenermaßen ein ziemliches Glück für ihn ist.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht von seiner jämmerlichen Aktion in die Welt seiner Eltern oder der anderen Dean-Street-Jungs dringt, ist gering. Und es gibt ihm einen Grund für seinen stummen Abgang, zumindest glaubt er das.
Trotz seiner Scham flucht er über das verlorene Magazin. Wie wahrscheinlich ist es, dass er je ein zweites Exemplar dieses bizarren Dings zu Gesicht bekommt? Was wird damit passieren?
Mit brennenden Wangen schleicht der weiße Junge auf dem Gehsteig davon. Vielleicht kann er einen geschickteren Freund hinschicken, um es noch mal zu probieren. Oder ein Zweierteam, um die Frau abzulenken? Der Laden ist unheimlich klein. Zwei weiße Jungs in vorgetäuschtem Tumult wären dort wie die Zwischendeck-Nummer der Marx Brothers. Er hätte nicht so unbeherrscht sein sollen, doch das Magazin wirkte auf seine Sinne wie eine Droge, ein Ruf von einem unvorstellbaren Planeten.
Er muss einen Freund schicken, um es für ihn zu stehlen, aber wie soll er es vor dem Freund verstecken?
Oder es vielleicht kaufen, aber dann muss er der Frau noch mal gegenübertreten. Das Magazin wird sich in Dunst auflösen.
Er kann das einfach nicht gut.
In einer Welt des Verbrechens ist er der Versager.
10. Gentrifizierung (vor 1964)
Das Wort existiert, war aber nicht immer da. Wann haben sie es zum ersten Mal gehört? Bezeichnet es etwas Bestimmtes?
Ein Katastrophengebiet, eine Unsicherheit in jemandes Wünschen?
Das Wort, das diesen Jahren später angeklebt wird, wie man ein Gemälde in einen Rahmen klebt, liegt bereits in der Luft – sofern man hinhört. War das Wort von Anfang an in Scham und Verwirrung gehüllt, wie ein vorwurfsvolles Attribut, das auf die Schwelle ihrer Tage gemalt ist?
Die Dean-Street-Jungs halten sich lieber an das, was sie sehen und spüren können.
In dem Ausmaß, in dem die Jungs das Wort verstehen, spaltet es sie nicht. Man kann gegen Gentrifizierung sein, klar. Das heißt, wenn deine Eltern es dir ausführlich genug erklärt haben, bevor du die Müslischüssel ins Spülbecken wirfst, deine Turnschuhe bindest und zur Haustür hinausläufst. Aber nur, weil deine Familie dagegen ist, bedeutet das nicht, dass irgendwer je einwilligen würde, im anderen Team zu spielen. Wahrscheinlich bist du nie einem Rassisten, einem Nazi oder auch nur jemandem begegnet, der für Nixon gestimmt hat. Wir sind hier alle gute Menschen.
Ein anderer Grund, warum diese ganze Gentrifizierungssache ein bisschen unklar, vielleicht auch ein bisschen theoretisch erscheint, zeigt sich, wenn man sich mit bloßem Auge in der Gegend umsieht.
11. An einem Gebäude arbeiten (1981)
Zwei weiße Jungs, die im zweiten Stock eines halb entkernten Reihenhauses an der Wickoff Street Putzträger und Putz von den kaputten Innenwänden einer früheren Pension reißen, ohne Lüftungsanlage oder Staubmaske, geschützt nur durch dicke Arbeitshandschuhe, ansonsten in T-Shirt und Jeans. Angeheuert wurden sie von einem der Väter, der das abbruchreife Haus samt dem daneben, das in ähnlichem Zustand ist, für ein Butterbrot gekauft hat.
Keine Väter, die Banker sind, aber vielleicht haben sie mit Bankern zu tun?
Das bedarf weiterer Ermittlungen.
Doch das ist keine Gentrifizierung, nein. Das ist eine Arbeit, die man mit den eigenen Händen verrichtet. Es sei denn, man kann ein paar Jugendliche dazu überreden. Renovierung ist etwas Körperliches. Schweißtreibend und ein Sommerjob, bei dem man sich die Hände schmutzig macht. Ein paar Dollar in der Tasche, die für künftige bei Bleecker Bob’s gekaufte LPs stehen. Die Kameradschaft zweier frisch in die Höhe geschossener, furchtloser Menschen, bereit, eine Straße entlangzugehen, in der sie sich bisher ängstlich verbargen – furchtlos besonders heute, da sie im Besitz eines Klauenhammers und eines Brecheisens sind.
Die zerstörten Eingeweide der Gebäude ringsum bezeugen den unübersehbaren Vorgang. Berge von Putz, Latten und korrodierten Rohren, die – wenn die Leute in der Straße Glück haben – in Eimern zu gemieteten Containern die Treppen hinuntergeschleppt werden. Sonst stopft man alles in Metalltonnen und betet, dass die städtische Müllabfuhr es abtransportiert. Fensterrahmen und zertrümmerte Türen, die Kanten schartig von rissiger Bleifarbe, auf leeren Grundstücken aufgehäuft oder zur Abgrenzung hinten im Garten verwendet, wo niemand Geld für Maschendrahtzäune ausgeben will.
Verrostete Fensterflügelgewichte, zu dreieckigen Haufen gestapelt wie nicht explodierte Artilleriemunition auf dem Schwarz-Weiß-Foto eines Schlachtfelds.
Jungs glauben immer, sie könnten mit diesen Dingern Schwertkämpfe ausfechten, bis sie eins hochheben und es ihnen fast den Arm aus dem Gelenk zieht.
Italienische Meister der Gipsdecken und Marmorkamine, Brownstone-Alchemisten, werden aus den Krypten der Vergangenheit oder vielleicht auch nur einem drei U-Bahn-Stationen entfernten Viertel angefordert, um handwerkliche Wunder an Gebäuden zu vollbringen, die wahrscheinlich zum letzten Mal von ihren Großvätern instand gehalten wurden.
Irgendwann sieht man dann ein Reihenhaus mit Fenstern aus Betonschalstein, flacher Fassade und ohne Gesims, die Fensterstürze aus Brownstone längst vom sauren Regen zersetzt. Und wenn man am nächsten Tag nach oben blickt, stehen Männer auf dem Dach, mit einem Flaschenzug, in dem ein neuer gusseiserner Sims über dem täglichen Verkehr des Straßenzugs baumelt, und es ist ein Wunder, dass niemand zu Schaden kommt.
So was wird immer noch hergestellt! Kann ich die Nummer des Mannes haben, der ihren angebracht hat?
Versuchen Sie’s. Wenn er abhebt, wird er Ihnen sagen, dass er die nächsten anderthalb Jahre ausgebucht ist, Sie aber auf eine Liste setzt.
Sie müssen persönlich vorbeigehen und ihm ein paar Zwanziger zustecken, so läuft das da.
Aber wenden wir uns wieder den beiden Jungs zu, die im wirbelnden Staub der kaputten Zimmer im zweiten Stock der Ruine an der Wyckoff arbeiten. Was für ein Loch. Ein Wunder, dass sie nicht durch die Dielen gebrochen sind oder die Treppe eingestürzt ist, die keine Geländerpfosten mehr hat, sodass das Geländer frei schwingt und beim Hinuntersteigen keine Hilfe darstellt. Alles ist in Staub gehüllt, weiß und grau, und da, wo er braune Flecken verdeckt, die hoffentlich die verdunsteten Reste von Kaffeepfützen oder einer Dose Bohnen sind und nicht Blut oder Scheiße, ist das ein wahres Glück. Die Aussage, dass die Pensionen für die nächste Welle von Brownstonern instand gesetzt werden mussten, wirkt fadenscheinig. Konnte dieses Gebäude je so prachtvoll gewesen sein wie die an der Dean Street oder Pacific, ganz zu schweigen von den vornehmen Gegenden an der Clinton Street oder Pierrepont? Wo sind all der Marmor und Gipsputz hin? Warum sind die Wohnzimmerfenster nicht drei Meter hoch wie an der Dean? Die Zinndecken scheinen schon immer hier gewesen zu sein, auch wenn das Linoleum im Lauf der folgenden Jahrzehnte in gewaltigen Schichten aufgeklatscht wurde.
Was, wenn das Brownstone-Brooklyn von Anfang an mit Attrappen gespickt ist? Falsche Fassaden, ein potemkinsches Dorf?
Vielleicht ist der Vater, der die beiden eingestellt hat, verrückt und glaubt, dass jeder hier leben will.
Vielleicht sind alle Vernünftigen weg, und die These, dass diese sogenannte Gentrifizierung an Dynamik gewinnen kann, gleicht einem Schneeballsystem oder Kettenbrief, der aus Gleichgültigkeit gescheitert ist. Die Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, sitzen auf den Schulden und Verbindlichkeiten, weil niemand so dumm ist, nach ihnen an Bord zu kommen.
Das Problem von anderen. Die Träume der Jungs haben einen kürzeren Horizont, sie wollen den Putz aus den Haaren spülen und sich mit ein paar Mädchen von der Saint Ann’s School an der Promenade treffen, Mädchen, die angedeutet haben, sie würden sich vielleicht darauf einlassen, mit ihnen ins 8th Street Playhouse zu gehen, wo Pink Flamingos läuft, obwohl vorher eine Party stattfindet, die wahrscheinlich so gut sein wird, dass sie dort nicht wegwollen. In einer Schlauchwohnung im West Village, die einem anderen geschiedenen Vater gehört, viele vom Flur abgehende Zimmer, in denen man womöglich rummachen kann. Irgendwer hat gesagt, jemand bringe LSD mit, das hat noch keiner von ihnen ausprobiert.
Doch im Moment wünschten sie vor allem, sie hätten ein Transistorradio dabei.
Einer der beiden bricht eine Innenwand auf und lässt Putzträger auf den Boden krachen. Zumindest die Muskelarbeit macht Spaß – sie sind Zerstörer. O ja, o ja, sie sind wie entfesselt, autorisiert, das alte Reich zu stürmen, statt es zu bestaunen, die Reihen der Messinglampen in den Antiquitätenläden an der Atlantic, die schicken Klamotten.
Plötzlich eine Entdeckung. In der Wand ist ein Bündel Groschenhefte versteckt, wer weiß, wie lange schon, zusammengebunden mit einer Schnur. Der Wandzerstörer zieht den tristen Schatz heraus.
Vier Nummern von Sexology. Ein sammelbandgroßes, in Schwarz-Weiß gehaltenes, krypto-wissenschaftliches lüsternes »Gesundheitsmagazin« aus den frühen Vierzigerjahren, das die Nerven der beiden weißen Jungs beim ersten und zweiten Anblick und darüber hinaus erregt und schockiert – seine Kraft könnte unerschöpflich sein. Ein ungewollter, aber unwiderstehlicher Weg in die dunkle Tatsache eines Sexuallebens, das dem vorausgeht, über das sie nachdenken wollen (nämlich ihrem eigenen). Sexology weckt finstere Begierden, die älter sind als das farbige Hochglanzsensorium von Bob Gucciones vaselinverschmiertem Objektiv. Es könnte die Pornografie ihrer Großväter sein.
Jedes Foto eine durch eine Röntgenbrille gesehene viktorianische Ansichtskarte. Jedes Schaubild gleicht der angestaubtesten Illustration eines wissenschaftlichen Lehrbuchs, die man je in der Grundschule verunstaltet hat. Alle beworbenen Apparaturen sehen aus wie Wärmflaschen.
Sie haben Hammer, Brecheisen und Handschuhe beiseitegelegt und sitzen im Schneidersitz auf dem schmutzigen Boden, um die verstaubten Scheußlichkeiten besser genießen zu können. Einer täuscht Begeisterung vor, der andere gibt sich angewidert. Sie könnten genauso gut die Rollen tauschen – sie brauchen bloß die Möglichkeit, ihre inneren Pole von Anziehung und Abschreckung zu ordnen.
»Meine Fresse.«
»Das ist so irre. Schlafzimmertragödien. Wenn Liliputaner Normale heiraten. Ehe auf Probe bei Polynesiern – mit Bildern!«
»Ich muss das aus meinem Gedächtnis streichen.«
»Nein, warte. Können Menschen sich mit Tieren kreuzen?«
»Oh, Scheiße, was ist denn eine Gonadektomie?«
»Nein, nein, guck dir das mal an, der Public Universal Friend, das ist ein Quäker-Transvestit. Der PUF!«
»Erzähl bloß meinem Dad nichts davon.«
»Willst du mich verarschen? Keinem erzählen wir davon. Ich mach eine verrückte Collage draus, die irrsten Poster für Matthews Band. Sag niemandem, wo wir das herhaben.«
»Auf keinen Fall.«
Der Schatz wird in einem Rucksack verstaut.
Das Bündel Groschenhefte ist ein Strudel menschlicher Bedeutungen, über die sie nachdenken müssten, doch meistens sträuben sie sich dagegen. Es ist zu viel für sie. Stattdessen schneiden sie die Seiten in Stücke und machen die besagten Collageposter für die Bands ihrer Freunde. Auch dabei meiden sie die grässlichsten Seiten, ziehen Zeichnungen Fotos und mechanisch aussehende antiquierte sexuelle Hilfsmittel den anthropologischen und medizinischen Bildern vor.
Die Existenz der Magazine und der Ort, an dem sie versteckt waren, weisen in die Richtung eines weiteren Rätsels, das die beiden weißen Jungs gern meiden würden: das der Männer, die in den Pensionen wohnten. Die unmittelbare Vorgeschichte ihres Viertels, die offenkundig und unausgesprochen, unverstanden vor ihnen liegt.
Die Männer mit fettverschmierten Fedoras, in Anzughosen und Unterhemden, mit Kochplatten in ihren Zimmern, zu sechst oder zehnt in einem Reihenhaus wohnend, einem dieser künftig restaurierten Brownstones, dieser Cinderella-Gebäude. Männer mit verblüffenden Nationalitäten, Geschichten und Lastern, ehemalige Werftarbeiter, Marines, Vertreter, Spieler, Impresarios unerquicklicher Varieténummern, mutmaßliche Sterno- und Formaldehydtrinker, Männer, die an kleinen Familiensorgen gescheitert sind, die geschworen haben, Geld in die alte Heimat zu schicken, es versäumt haben und dann verstummt sind, Italiener, Polen, Portugiesen, Dominikaner, Kubaner, Schwarze aus den Südstaaten, Schwarze von den Inseln, Afrikaner, Mohawks – Mohawks? – und andere, Männer, die völlig verwahrlost sind, jegliche Würde ausgelöscht, Männer, die keinerlei Schicksal haben.
12. Der Fleck, 1. Teil (1989)
Ein Schwarzer betritt ein Brillengeschäft an der Atlantic Avenue.
Draußen regnet es. An der Tür wartet ein Pappkarton auf Regenschirme.
Durch diese Tür kommen nicht allzu viele Leute. Wir bleiben in dem langen Tal zwischen der Erfindung dieses Viertels und der Akzeptanz dieser Unternehmung als vollendete Tatsache. Die triumphalistische Phase ist noch Jahrzehnte entfernt. War die Gentrifizierung verfrüht?
Beim Ertönen der Türklingel drehen sich die weiß bekittelten Optiker um.
»Sie sind wieder da.«
»Verdammt richtig.« Der Schwarze streift seine Schuhe ab und kommt herein. Er trägt eine Baseballkappe und seine Brille.
Der Optiker rührt sich nicht. »Sie brauchen nicht zu fluchen.« Er hat ihm die Brille erst gestern verkauft. Hundert Dollar in bar, und nicht aus einem Geldbeutel.
Der Kunde tritt von einem Fuß auf den anderen. Er schiebt das Kinn vor, hat die Hände am Körper. »Sehen Sie. Der gleiche verdammte Mist.«
Der Optiker knurrt und sieht sich die Sache an. »Ein Fleck.«
»Zerkratzt«, sagt der Kunde. »Genau wie die letzte. Warum haben Sie mir die verdammte Brille verkauft, wenn Sie das Problem nicht beheben können?«
»Ein Fleck. Wischen Sie ihn weg. Hier.«
Der Kunde weicht ihm aus. »Erzählen Sie keinen Blödsinn. Das kann ich nicht wegwischen. Die Brille ist schon im Eimer. Genau wie die alte.«
»Lassen Sie mich mal sehen.«
»Wo ist der Arzt? Ich will mit dem Arzt sprechen.«
»Das ist mein Kollege. Er ist kein Arzt. Zeigen Sie mal.«
»Sie sind nicht der Arzt, Mann.« Der Kunde tänzelt davon.
»Wir haben den gleichen Beruf«, sagt der Optiker. »Wir fertigen Brillen an.«
Der zweite Optiker kommt von hinten, und der Kunde grinst. »Das ist der Mann, den ich sehen will!«
Der Zweite begreift. »Ist an der Brille etwas auszusetzen?«
»Dasselbe wie gestern. Sehen Sie.« Er nimmt die Brille mit der rechten Hand und reicht sie dem zweiten Optiker.
»Zunächst einmal, nehmen Sie die Brille mit beiden Händen ab, wie ich’s Ihnen gezeigt habe.« Der zweite Optiker fasst die Brille an den Scharnieren und demonstriert es ihm. Er hält sie sich vors Gesicht.
»Sie haben draufgetatscht. Das ist das Problem.«
»Nein.«
»Das sind Fingerabdrücke.«
»Verdammt, Doktor. Ich zeig Ihnen die alte. Sie können nicht mal das Problem beheben.«
»Das Problem ist, dass Sie draufgetatscht haben. Hier.« Der zweite Optiker taucht die Brille in ein Reinigungsmittel und trocknet sie mit einem Poliertuch ab. Der Kunde beugt sich vor, um besser zu sehen.
»Was machen Sie, reiben Sie sich ständig die Augen?«, fragt der erste Optiker, der jetzt lächelt.
»Halten Sie die Klappe.« Der Kunde zeigt mit dem Finger auf ihn. »Sie sind in dieser Angelegenheit nicht mein Arzt.«
»Niemand ist das«, sagt der erste Optiker. »Dafür brauchen Sie keinen Arzt. Sie müssen einfach nur die Finger von Ihren Augen lassen.«
»Halten Sie die Klappe.«
Der zweite Optiker starrt den ersten wütend an. Er gibt die Brille zurück. »Zeigen Sie mal, wie Sie sie aufsetzen.«
Der Kunde neigt den Kopf und führt die Brille ans Gesicht.
»Moment, ich konnte nichts sehen«, sagt der erste Optiker. »Ihre Kappe war im Weg.«
»Setzen Sie sie noch mal auf«, sagt der zweite.
»Genau dasselbe.« Der Kunde schüttelt den Kopf. Er nimmt die Brille ab, wieder mit einer Hand. »Sehen Sie. Immer noch da. Kleine Kratzer.«
Der erste Optiker tritt näher. »Sie haben sie schon wieder verschmiert. Als ich nichts sehen konnte. Es liegt daran, wie Sie sie aufsetzen.«
»Ich bezeichne das als dauerhaften Fleck. Ich hab hundert Dollar bezahlt. Da hätte ich genauso gut die alte behalten können.« Er drückt die Brille dem ersten Optiker in die Hand.
»Die ist bloß schmutzig. Ihre Hände sind schmutzig.«
Der Kunde runzelt die Stirn. »Das ist schwach, Doktor. Ich komme her, um Ihnen eine Brille mit Kratzern zu zeigen, ich suche Hilfe. Sie sagen, ich brauch eine neue Brille. Jetzt hat die auch einen dauerhaften Fleck, und Sie sagen, ich hab schmutzige Hände. Das ist die Brille, die Sie mir verkauft haben, Mann.«
»Ihre alte Brille, die hatten Sie wie lange, zehn Jahre? Die Scharniere waren ausgeleiert, der Nasensteg war nicht mehr da. Die Gläser haben Ihre Wange berührt. Die Brille, die ich Ihnen verkauft habe, ist in Ordnung. Sie müssen Ihre Gewohnheiten ändern.«
»Gewohnheiten!«
»Er ist ein Clown. Wir hätten ihn gestern rauswerfen sollen.«
»Stattdessen haben Sie mein Geld