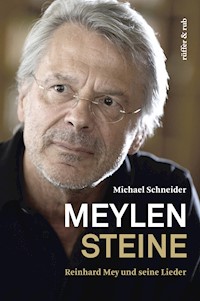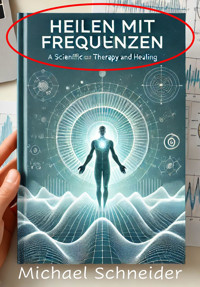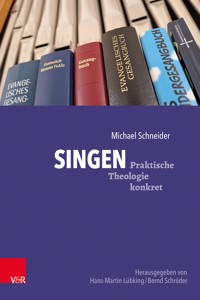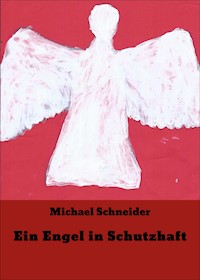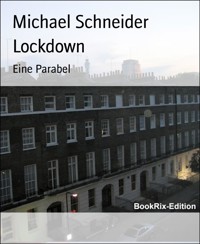Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Forscherteam um Professor Heinrich Baumann und seine Kollegin Elisabeth ist auf der Suche nach dem Geheimnis des Hunderte Jahre alten Indianergrabs des Sagenumwobenen mächtigen Häuptlings Chuwanga. Doch was sie finden übertrifft all ihre Vorstellungskraft. Kurze Zeit später werden die beiden Freunde Stanford und Wilhelm immer tiefer in die Geschehnisse die mit der Entdeckung des Grabs einhergehen hineingezogen. Mit der Hilfe ihrer neuen Freunde und Feinde müssen Sie alle Register ihres Könnens ziehen um gegen einen scheinbar Überlegenen Gegner zu bestehen. Ihre Heldenreise führt sie durch die weite Prärie, zu verlassenen Geisterstädten und zu einem befestigten Ford, lässt sie einem Zug hinterherjagen und eine Wagenburg errichten. Können sie über sich hinauswachsen und das größte Abenteuer ihres Lebens meistern, welches sie in immer größere Gefahren führt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schneider
CHUWANGA
Das Grab des Häuptlings
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort:
1. Das Grab
2. High Noon
3. Die Belagerung
4. Für eine Handvoll Dollar
5. Der Gefangenenaustausch
6. Der mit den Toten tanzt
7. Der Pakt mit dem Teufel
8. Das Eiserne Pferd
9. Der Wolf und die Dunkelheit
10. Die Geisterstadt
11. Die Verdammten
12. Die Wagenburg
13. Das Fort
14. Böses Erwachen
15. Spiel mit dem Feuer
16. Die Gejagten
17. Erbarmungslos
18. Chuwangas Rache
19. Die glorreichen…
20. Das Lied von Feuer und Tod
21. Das letzte Kapitel
Das ENDE?
Impressum neobooks
Vorwort:
Chuwanga
Das Grab des Häuptlings
Michael Sherman
Impressum
Texte: © Copyright by Michael SchneiderUmschlag: © Copyright by …Verlag: Michael Schneider
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich um Fiktion handelt, welche zu keinem Zeitpunkt einen Anspruch auf Richtigkeit realer Ereignisse erhebt.
Sämtliche Ähnlichkeiten zum Beispiel mit Filmen insbesondere Western, Fernsehserien und anderem sind gewollt und als Hommage an jene anzusehen.
Fantasie ist wichtiger als Wissen –
Denn Wissen ist begrenzt.
Albert Einstein
Liebe/r Leser/in der/die sie sich für dieses Werk entschieden haben. Ich bitte sie mich auf einer kleinen Reise zu begleiten. Was insofern viel verlangt ist, da sie noch nicht wissen, wohin sie diese Reise führen wird. Doch sie waren mutig genug gewesen, sie anzutreten, also warum auf halbem Wege aussteigen?
Es wird eine Achterbahnfahrt, die sie und mich an interessante und manchmal auch dunkle Orte führen wird. Aber auch an Spannende und wir werden hoffentlich gemeinsam Spaß daran haben und vielleicht sogar ein paar Mal schmunzeln können.
Vielen Dank für ihren Mut.
1. Das Grab
Die Flammen loderten so heiß, dass die Luft um sie herum flimmerte. Es sah aus, als wäre die Welt an dieser Stelle der Realität entrückt. Feurige Klauen griffen nach seiner Seele. Er spürte es kaum noch. Für einen Moment war auch er nicht mehr Teil dieser Welt. War auch er der Realität entrückt. Alles um ihn herum begann sich zu verändern. Als würde Etwas jedes Geräusch, jeden Geruch, einfach alles verschlingen. Dann hörte er sie. Sie sprachen nicht wirklich mit ihm, ihre Stimmen waren nur in seinem Kopf. Aber er verstand sie trotzdem. Es war nicht das erste Mal, dass er, der Hüter dieses Ortes, auf diese Weise mit ihren Ahnen sprach. Nur hatten sie diesmal nichts Gutes zu verkünden. Etwas Schlimmes würde passieren und dem alten Indianerschamanen Autanka war schnell klar, dass es etwas mit den vier Fremden zu tun haben musste die seine Späher schon vor geraumer Zeit entdeckte, hatten. Außer ihm lebten nur noch zehn weitere Stammeskrieger in ihrer kleinen Enklave. Es war mehr eine Ansammlung einfacher Zelte und ein paar weniger grob gezimmerter Unterstände als ein richtiges Dorf. Ganz in der Nähe gab es einen Fluss, der irgendwo oben auf dem Berg entsprang. Dieser war, verglichen mit anderen Bergen in der Umgebung genau genommen auch eher ein Hügel. Er sandte einen seiner Gefährten aus, um aus dem Fluss Trinkwasser zu holen. Sein Blick schweifte jedoch immer wieder zum Berg hinauf. Er musste schon die ganze Zeit daran denken, warum er und die anderen hier waren. Warum sie alles aufgegeben hatten, keine Familie gründeten wie die anderen, sondern ihr Leben opferten, um das zu schützen, was sich dort oben befand. Er sah auf die gegenüberliegende Seite vom Berg hinüber.
In der Ferne stieg Rauch auf. Eine Nachricht für ihn. Die Reiter würden bald hier sein. Die Dunkelheit brach herein und es wurde jetzt immer kälter. Er musste sich bereit machen, um ihren Empfang zu bereiten. Woher kamen sie und wie hatten sie von diesem Ort erfahren? Und noch wichtiger, in welchem Zusammenhang standen sie mit dem großen Unheil, das ihm ihre Ahnen voraussagten?
Die weite Prärie lag erhaben und mächtig vor ihnen. So riesig und einsam und zugleich unergründet und gefährlich für den der sich nicht auskannte, der nicht wusste, wie er mit ihr umzugehen hatte. Die Prärie überlebt nur wer sie versteht.
Es war bereits früh am Abend, als die vierköpfige Gruppe den Pass durch die unwirkliche von groben Felsen durchzogene Landschaft Nordamerikas erreichte. Die Sonne begann schon am Horizont zu verschwinden und es wurde nun immer schneller kälter. Die vier schützten ihre Körper mit dicken Kapuzenmänteln aus Büffelleder. Sie bewegten sich kaum, nur ihr Atem, der vor ihren bedeckten Mündern zu Nebel gefror, zeugte von leben. Während ihre Pferde nur langsam vorankamen. Die drei vorderen Personen führten jeweils ein mit Taschen und Koffern bepacktes zweites Pferd hinter sich her, während der letzte, der ein ganzes Stück hinter ihnen ritt, noch zusätzlich zwei bepackte Maulesel ziehen musste.
Die Tiere schnauften weißen Atem aus. Auf ihrem Fell glitzerte die Feuchtigkeit. Inzwischen zehrte jeder Schritt an ihren Kräften. Eine totenstille lag über dem Tal, das sie durchquerten. Vor ihnen erhob sich ein gewaltiges Gebirge in welchem sich ihr Ziel verbarg. Der kalte Wind zerrte immer stärker an ihnen. In der ferne vernahmen sie das müde Heulen eines Coyoten.
Die Hufen der Tiere hinterließen Spuren in dem sandigen Boden und wirbelten ihn gleichzeitig auf. Winzige Krabbeltiere wurden einfach zertreten, Kleine Nagetiere wurden aufgescheucht und verkrochen sich vor Angst. Selbst ihr Geruch wurde, getragen vom seichten Wind, über die Prärie verteilt. Alles daran war irgendwie falsch. Sie veränderten schon jetzt alles in ihrer Umgebung. Nichts und niemand war vor ihnen sicher. Ihre sogenannte Zivilisation würde früher oder später alles zerstören. Sie gehörten nicht hierher. Sie hatten hier nichts zu suchen.
Es war nun schon dunkel, als sie endlich in dem kleinen Dorf aus einfachen Zelten und Hütten ankamen. Der alte Autanka erwartete sie bereits.
Er begrüßte sie freundlich und lies ihnen, beim Absteigen helfen. Überrascht stellte er fest, dass einer von ihnen selbst ein Ureinwohner war. Aber noch überraschter war er, als eine der drei anderen Personen die Kapuze beiseitezog und eine wunderschöne Dame zum Vorschein kam, deren makelloses Gesicht von bezaubernden blonden Locken umrahmt war. Sie hatte etwas Anmutiges fast schon Erhabenes an sich. Unter anderen Umständen und wäre er nur ein paar Jahre jünger gewesen, er hätte sie sicher sehr attraktiv gefunden. Die dritte Person war ein älterer Herr Mitte fünfzig, also immerhin noch ein paar Jahre jünger als er selbst. Auch er war ordentlicher gekleidet und sehr viel gepflegter als es normalerweise für Leute, die man hier draußen vermutet hätte, üblich war. Nur der letzte sah wie ein typischer Cowboy aus, wie er es bei allen Vier erwartet hatte. Er blieb etwas abseits bei den Tieren stehen und schien nur so etwas wie ein Bediensteter zu sein. Autanka bat die anderen, sich zu ihm ans Feuer zu setzen, und bot ihnen ein heißes Getränk an, welches sie dankend annahmen. Er wusste nicht, wer sie waren oder was sie wollten, hielt es jedoch für das klügste freundlich zu bleiben, obwohl ihm nichts lieber gewesen wäre als sie schnell wieder loszuwerden.
Die Frau und der Alte sahen eigentlich nicht gefährlich aus und der Cowboy würde es kaum mit einem Dutzend von ihnen aufnehmen können, dennoch würde etwas passieren und diese Leute hatten etwas damit zu tun. Autanka sah sich den Indianer genauer an. Er war noch sehr jung. Obwohl sie eindeutig zum selben Stamm gehörten, war er ihm noch nie zuvor begegnet. Der Schamane hatte diesen Ort seit vielen Monden nicht mehr verlassen. Vermutlich hatte er seine Aufgabe schon vor der Geburt des Mannes angetreten. Autanka wachte über all das, was tief im Inneren einer Höhle in dem Berg über ihnen schlummerte. Ein uraltes Geheimnis. Nur er und zehn ihrer besten Krieger waren dazu bestimmt worden den Rest ihres Lebens damit zu verbringen das zu schützen, was dort oben war. Doch inzwischen waren die anderen mindestens genauso alt wie er selbst. Sein ganzer Stamm lebte verteilt über mehrere Dörfer. Die anderen hätten ihnen längst Jüngere zur Ablösung entsenden sollen, doch es ist keiner mehr bereit, sein Leben der Sache zu opfern. Man glaubt nicht mehr an die alten Geschichten. Niemand von ihnen hat es mit eigenen Augen gesehen. Es liegt keine Ehre darin das Jagen, das Reiten und das Kämpfen gegen die weißen Einwanderer gegen die Einsamkeit dieses abgelegenen Versteckes einzutauschen.
Obwohl er wusste, dass sie ihn nicht verstehen würden, sprach er direkt die zwei Weißen an und nicht den anderen Indianer, ihm war klar, dass er nur als Übersetzer fungieren würde. Er fragte sie, was sie herführte und der Mann begann zu erzählen. Der fremde Indianer übersetzte, wie schon zuvor, nur andersherum. Sein Stamm lebte früher über das ganze Tal verteilt in mehreren kleinen oder größeren Dörfern. Nun gab es nur noch wenige davon. Trotzdem wusste Autanka, aus welchem er gekommen sein musste, er war früher oft dort. Sie waren gute Jäger, aber gegen die weißen Einwanderer hatten sie keine Chance, das wussten sie und deshalb versuchten sie gar nicht erst sie zu vertreiben, sondern arrangierten sich mit ihnen. So hatten sie den großen Krieg des weißen Mannes gegen sein ganzes Volk überlebt. Nein, er hatte diesen jungen Krieger vorher noch nie gesehen. Aber er kannte ihn, er kannte ihn, weil er wie er war. Er musste der Sohn von Hokrath sein, dem Medizinmann seines Dorfes. Ein ehrenhafter Mann. Jünger als er selbst aber dennoch vor ihm in die ewigen Jagdgründe gegangen. Die Weißen hatten alles zerstört, doch Autanka empfand keinen Hass. Ihre Ahnen hatten diesen Weg für sie vorherbestimmt, es gab keinen Grund an ihrem Plan zu zweifeln.
Der Mann stellte sich als Professor Heinrich Baumann vor, die Frau war seine Assistentin, Elisabeth von Veegen. Sie waren hier, um für ein Museum die Kultur der Ureinwohner zu studieren. Die Nachwelt solle erfahren, wer hier gelebt hat, bevor Leute wie er herkommen und diese Kultur und ihre Geschichte endgültig ausrotten. Das sagte er zumindest. Die drei waren erschöpft und baten darum über Nacht im Dorf bleiben zu dürfen, um am nächsten Morgen mehr über ihre Pläne zu erzählen. Er beschloss ihrer Bitte nachzukommen und stimmte zu.
Der Vierte, der Professor nannte ihn einmal Franz, hatte es sich inzwischen in dem kargen, mit Ästen und trockenen Blättern behängten Verhau, neben ihren Pferden gemütlich gemacht. Während die anderen ihre Nachtlager in der Nähe von Autankas Zelt aufgeschlagen hatten. Faryk schlief auf einer traditionellen Decke, nur mit dem Büffellederumhang bedeckt. Die zwei Weißen hatten ein Zelt aus dünnen Leinen. Es war so völlig anders als sein eigenes mit Tierhäuten bespanntes Tipi, als Stamme es aus einer vollkommen anderen Welt. Genau wie seine Bewohner.
Autanka dachte intensiv über die zwei nach. Der Alte hatte lichtes graues Haar, dennoch sah er nicht alt aus, nicht so wie die Alten, die er kannte. Er nannte sich Professor, was auch immer das war. Faryk hatte ihm erklärt das es ein ähnlicher Titel, wie Medizinmann sei, doch wirklich verstanden hatte er es nicht. Sein Gesicht war faltig aber gepflegt und glattrasiert. Es machte ihm Angst. Hätte ihn jemand direkt nach dem Grund dafür gefragt, er hätte es nicht sagen können. Vielleicht war es sein Lächeln, das wirkte als bedeute es etwas völlig anderes als er es von Menschen, die lächelten gewohnt war. Aber vielleicht waren es auch seine Augen, diese kalten, starren Kugeln, die er hinter dünnen Scheiben aus Glas zu verbergen versuchte.
Das Einzige, was ihn noch mehr erschaudern, lies als dieser Weiße alte Mann, war die dürre Frau mit den langen blonden Haaren, die sie bei ihrer Ankunft zu einem strengen Zopf gebunden hatte und die nun locker über ihren Schultern hingen. Er wusste, dass sich viele Weiße Frauen vollkommen anders als die aus seinem Volk verhielten, doch diese hier unterschied sich noch sehr viel mehr von anderen Frauen, viel mehr. Auf den ersten Blick wirkte sie möglicherweise schwach und verletzlich, doch darauf war er keinen Moment hereingefallen und das hatte sie sofort bemerkt, denn das war das eigentlich unheimliche an ihr. Hinter dem verletzlichen Äußeren steckte ein derart intelligentes Wesen, das gleichzeitig nach noch mehr Wissen gierte, das es ihn erstarren ließ. Er konnte nicht warten, er musste etwas tun, sofort.
Er wusste nicht, was sie wirklich in seinem Dorf wollten, doch er war fest entschlossen, es herauszufinden, jetzt gleich. Er weckte den Übersetzer. Und während sich die zwei anderen wieder anzogen, begann Faryk zu erklären.
In seinem Dorf erzählte man ihnen die Geschichte des berühmten und mächtigen Häuptlings Chuwanga, der vor hundert Jahren über alle Stämme des Landes herrschte.
„Man sagte uns, sein Grab sei hier oben in ihrem Dorf. Wir haben uns extra auf die beschwerliche Reise gemacht um…“ begann der Professor zu erklären.
„Ich bitte euch Fremde." erwiderte Autanka entsetzt. "Genießt unsere Gastfreundschaft. Wir geben euch Wasser und etwas von unserer bescheidenen Nahrung. Sowie ein Lager für die Nacht. Doch haltet inne in dem, was ihr vorhabt. Ich werde euch alles, was es über Chuwanga zu wissen gibt, erzählen. Doch dann müsst ihr gehen. Niemals dürft ihr sein Grab entweihen, versteht ihr.“
Sie schienen wirklich eingeschüchtert von seinen Worten zu sein, also erzählte er ihnen alles, was er wusste.
„Er war auserwählt, eins zu sein mit der Natur. Hart wie Stein, robust wie ein Baum, still wie das Wasser des mächtigen Sees. Und so schnell wie der Puma und stark wie ein Bär. Seine Weisheit, so unendlich wie der Horizont.
Er war streng, aber gerecht. Als er jedoch älter wurde, suchte er nach einem weg, um sein Leben zu verlängern, damit seine Herrschaft niemals enden würde. Er nutzte die Geheimnisse der Natur, die seit Generationen nur an die wahren Häuptlinge weitergegeben wurden. Und schließlich fand er auch, was er gesucht hatte. - Die Unsterblichkeit.“
die anderen sahen sich verwundert an.
„Und was ist dann in dem Grab?“ Platzte es schließlich aus der Frau heraus. Autanka war nicht überrascht, dass sie es war. Er lächelte.
„Das ist genau der Grund, warum ihr seine Ruhestätte niemals betreten dürft. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde als wir niederen Wesen es jemals verstehen würden. Er ernährte sich vom Blut der Natur und labte sich an ihren Geistern. Es gibt nicht nur eine Art der Unsterblichkeit. Chuwanga hat die Mysterien der Natur verstanden, er wurde eins mit ihr. In den Höhlen auf dem Hügel dort, liegt nur eine leere Hülle. Und dennoch ist Chuwanga noch immer mächtiger, als wir alle zusammen es jemals werden könnten. Deshalb wird er jeden bestrafen, der es wagt, seine Ruhe zu stören.“ Er gab ihnen zu verstehen, dass dies alles war, was er darüber zu sagen hatte. Sie schienen es begriffen zu haben, denn sie fragten ihn nicht weiter aus. Aber vielleicht waren sie auch einfach nur zu erschöpft, um ihm zu widersprechen. Wortlos legten sich wieder zum Schlafen nieder. Er hoffte inständig, dass sie intelligent genug waren, um am nächsten Morgen ihre Pferde zu satteln und dorthin zurückzukehren, von wo auch immer sie gekommen waren.
Er vermochte nicht einmal daran zu denken was passieren würde, wenn sie es nicht taten.
Irgendwie hatte er immer geahnt das der Tag kommen würde, an dem er gezwungen war zu handeln. An dem er verteidigen musste wegen dem er hier war. Nachdenklich streiften seine Blicke über die ehrwürdigen Hügel. Er versuchte sich daran zu erinnern was gewesen war. An die Jahre die hinter ihm lagen. Die Winter die sie erlebt hatten. Wie sie durch die Wälder gestreift waren auf der Suche nach Nahrung und um zu jagen. Er sah zu dem kleinen Fluss hinüber in dem sie immer fischten. Ihm wurde klar wie schön es doch eigentlich war, trotz der Einsamkeit.
Die Nacht war fast vorbei, als Autanka unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Ein kräftiger Cowboy zog ihn ohne große Schwierigkeiten auf die Beine. Zuerst glaubte er, es sei der Diener der Fremden, der die Nacht bei ihren Pferden verbringen wollte. Dann bemerkte er allerdings, dass in seinem Zelt noch zwei weitere Cowboys mit gleicher Statur standen. Die zwei anderen wirkten jedoch noch viel heruntergekommener als der Erste. Selbst jemand wie er der sein Dorf nie verlies, erkannte dass die zwei Mexikaner Verbrecher waren. Sie führten zwei der Fremden, Baumann und Faryk, zu dem großen Platz mit der Feuerstelle vor seinem Zelt, wo er die vier Besucher am Abend empfangen hatte. Das Feuer, das nur noch leicht geglüht hatte, als er sich schlafen gelegt hatte, brannte nun wieder. Jemand hatte frisches Holz hineingelegt. Es musste schon vor einer Weile entzündet worden sein. Draußen waren noch mehr von ihnen, an die vierzig Mann müssen es wohl gewesen sein. Die anderen zehn Mitglieder seines Stammes wurden ebenfalls aus ihren Zelten geholt oder knieten bereits gefesselt davor. Zwei Cowboys durchwühlten das Gepäck der Fremden. Neben ihnen lag Baumanns Diener reglos auf dem Boden bei ihren Pferden.
Einer der Gesetzlosen, den er sofort als den Anführer erkannte, stolzierte auf sie zu. Er war ordentlicher gekleidet als die anderen und machte auch sonst einen sehr viel offizielleren Eindruck. Sein Hut war ganz anders als die seiner Begleiter, irgendwie speziell. Er war schmaler und mit einem leuchtend roten Band verziert, sowie einer dezenten Feder. Er trug Hohe fein säuberlich geputzte Stiefel, einen langen schwarzen Mantel mit schicken glänzenden Knöpfen und bestickten roten Tüchern. An seinem Gürtel hing ein Säbel, dessen Scheide mit goldenen Tüchern verziert war. Er trug sein Haar länger als die meisten anderen weißen Männer, allerdings hatte Autanka auch in seiner Jugend, bevor er hier seine Aufgabe antrat, nicht sehr viele Weiße gesehen. Das Gesicht des Fremden war in dem fahlen Licht schwer zu erkennen, schien aber nichts Besonderes an sich zu haben, das ihn von den anderen unterschied. Einzig in seinen stechenden grünen Augen erkannte Autanka etwas abgrundtief Böses. War er es, vor dem ihn seine Ahnen warnen wollten?
Seine linke Hand umschloss den Oberarm der blonden Frau. In seiner rechten, die in einem auffälligen schwarzen Handschuh steckte, hielt er eine schwere Peitsche.
„Blackfist.“ Stöhnte Baumann erschrocken. „Was tun sie hier?“
„Tut mir leid.“ Hauchte ihm Elisabeth in einem Tonfall entgegen, der keine Zweifel daran ließ, dass sie log. „Aber ich konnte nicht warten.“ Der Mann mit der schwarzen Faust ließ sie los und sie ging zu ihren Pferden hinüber. Dann trat sie gegen den Cowboy am Boden, sodass sich dieser mühsam regte. „Steh auf du versoffenes Schwein.“ Sie öffnete eine Satteltasche, nahm etwas heraus und kam dann zu ihnen zurück.
„Was ist das?“ fragte Autanka besorgt.
Sie drehte den zwei Finger dicken Zylinder, aus dem ein geflochtener Docht hing in ihrer Hand und betrachtete ihn eingehend.
„Das mein Freund, öffnet uns die Tür zu Chuwangas Grab.“
Baumann riss sich los und raunzte sie an.
„Wer gibt hier eigentlich die Befehle?“
Blackfist ging dazwischen. Er drängte die zwei Streithähne auseinander, obwohl er eindeutig den Eindruck machte, als hätte er sie lieber weiter streiten sehen.
„Immer mit der Ruhe, wir haben unsere Pläne nur ein paar Stunden vorverlegt. Wir machen es immer noch auf ihre Art.“
„Aber ich dachte, ihr wärt friedliche Forscher“, entgegnete Autanka entsetzt.
„Wir schon, aber unser Freund hier leider nicht.“ Erwiderte Baumann mit trauriger Stimme. Er hatte kaum ausgesprochen, da schwang der Anführer der Räuberbande auch schon seine Peitsche um den Hals des alten Indianers. Autanka ging keuchend in die Knie. Sein Hals schmerzte und war mit roten Striemen bedeckt. Das Ende der Peitsche hatte sich so präzise um seine Kehle geschnürt, dass er kaum noch Atmen konnte. Sein Besitzer hatte so etwas eindeutig nicht zum ersten Mal getan.
„Das werdet ihr bereuen. Es ist noch nicht zu spät, ich flehe euch an, haltet inne. Ihr wisst nicht was…“ Autanka legte alle Kraft in seine Worte, die dennoch nicht mehr als Flüsterlautes röcheln waren. Blackfist zog noch stärker an seiner Lederpeitsche und riss Autanka zu Boden. Seine Kameraden wehrten sich vehement und versuchten sich aus ihren Umklammerungen zu befreien, doch es gelang ihnen nicht. Autanka sah, wie einige von ihnen hinterrücks niedergestochen wurden. „Hört auf damit.“ Protestierte er weiter. „Ihr begeht einen schlimmen Fehler.“ Blackfist reichte seine Peitsche einem seiner Leute, der auf einem Pferd saß.
„Semo. Zeig diesem unbelehrbaren indianischen Großmaul, wer hier einen Fehler begangen hat.“
Autanka griff panisch nach der Schlinge, um seinen Hals und versuchte sie zu lösen, doch vergeblich, er bekam sie einfach nicht ab. Zu fest hatte sie sich darum geschnürt. Der Mann gab seinem Pferd die Sporen und ritt in vollem Galopp davon. Den Medizinmann schleifte er hinter sich her, bis nichts mehr außer einem unansehnlichen Klumpen von ihm übrig war.
„Musste das Sein?“ fragte Elisabeth leicht angewidert, während sie gleichzeitig ihren Blick beschämt abwendete. Der Anführer der Banditen sah sie nur ungläubig an, antwortete aber nicht.
„Erschießt die anderen.“ Befahl er seinen Leuten, während er hämisch grinsend zu Baumann trat. „Also Herr Professor sie haben uns gerufen und nun sind wir hier. Wie also sieht ihr Plan aus?“
„Mein Plan?“ Seine Stimme zitterte noch immer, während er scheinbar überlegen musste, was er nun tun sollte.
„Das durften sie nicht tun.“ Fuhr ihn Faryk an. „Das war nicht Teil unserer Abmachung, dafür habe ich sie nicht hierhergebracht.“ Der junge Indianer protestierte so lauthals, dass er damit Bösewicht Blackfist zu verärgern begann.
„Jetzt nicht.“ Raunzte ihn Baumann an, blieb dabei aber gleichzeitig so ruhig, wie es ihm unter diesen Umständen möglich gewesen war.
„Sollen wir den auch töten?“ Blackfist sah Faryk verächtlich an.
„Nein, nein, schon gut.“ Baumann schob sich gerade noch dazwischen. „Das Dynamit, nehmen sie das Dynamit mit und dann müssen wir da den Berg rauf.“ Blackfist sah nach oben. Ein steiniger Pfad, der zur Kuppe hinaufführte, war zwischen hohen Bäumen zu erkennen. Dann nickte er Baumann zu und rief nach einigen seiner Leute. „Carlos, du und dein Bruder holt das restliche Dynamit.“ Er zeigte auf zwei andere Mexikaner. „Ihr zwei helft ihnen.“ Und zu einem der anderen, „Henry, du bleibst mit dem Rest hier unten und räumst diese…“ Er sah zu den Leichen der Indianer, die am Boden lagen und dann zu denen, die noch am Leben waren, aber gefesselt neben den anderen lagen. „…Schweinerei auf.“
Dann ging er mit Baumann und Elisabeth, ihrem Mitarbeiter Franz und den vier Mexikanern mit dem Sprengstoff zum Grab hinauf. Hinter ihnen hallten die Schüsse durchs Tal.
Kurze Zeit später betraten Heinrich Baumann und die anderen trotz der Warnungen des Schamanen das alte Indianergrab. Zuvor hatten sie mit den Dynamitstangen, die sich in ihren Satteltaschen befunden hatten, einen Eingang freigesprengt.
Außerdem hatten sie den Eingang, der hinter Gestrüpp verborgen war mit Holzbalken abgestützt, die Thompsons Männer auf ihrer Kutsche mitführten.
Das fahle Licht von Elisabeths Fackel erhellte nur langsam einen kleinen Teil der Höhle. Doch schon jetzt war ihr klar, dass, dass was sie hier frei gelegt hatten, riesig sein musste. Und uralt. Diesen Ort hatte seit Ewigkeiten niemand mehr betreten. Obwohl es genau das war, worauf sie seit Monaten gewartet hatte, alles, worauf sie hingearbeitet hatte, lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. Sie hoffte, dass es all die Mühen, die sie auf sich genommen hatte, alles, was die dafür getan hatte, wert war, und sie hier finden würden, wonach sie suchten.
Baumann tauchte neben ihr auf und stieß sie wie beiläufig an. Der Rempler war so überraschend, dass Elisabeth ihre Fackel fallen ließ. Bevor sie sich jedoch danach bücken konnte, kam ihr der Professor zuvor. Er hob das noch immer brennende Holz auf und reichte es ihr. Dabei kam er ihrem Gesicht mit seinem sehr nahe. Schockiert und irgendwie angewidert, wollte sie zurückweichen, doch er umschloss mit beiden Händen ihr Handgelenk und hielt sie fest.
„Hintergehen sie mich nie wieder.“ Flüsterte er ihr mit finsterer Stimme zu, ließ ihr Handgelenk wieder los und ging ohne ein weiteres Wort weiter in die Höhle hinein. Else blieb einen Augenblick wie angewurzelt stehen. Sie kannte ihn lange genug, um zu wissen, wie ungewöhnlich dieses Verhalten für ihn war, dass er es in diesem Moment aber auch todernst meinte.
Baumann und die anderen gingen langsam weiter hinein und Else konnte nun im Schein ihrer Fackeln mehr erkennen. Sie hatte sich nicht geirrt, sie war riesig.
„Kommen sie, meine Liebe?“ rief ihr Baumann in übertrieben freundlichem Ton zu, so als wäre das mit seiner Drohung von eben nie geschehen. Elisabeth nickte und schließlich ging auch sie langsam weiter. Die Wände waren kahl aber irgendwie glatt. Sie hatte angenommen, die Indianer hätten Chuwangas Grab für ihn erschaffen, doch hier lag sie offenbar falsch. Diese Höhle musste natürlichen Ursprungs sein. Wassermassen, die hier durchgeflossen waren, hatten sie über Jahrtausende hinweg geformt. Nun war das Wasser weg und die Indianer hatten sie für ihre Zwecke genutzt.
Sie fragte sich immer mehr ob, dass was sie hier taten, wirklich richtig war. Heiligte der Zweck wirklich jedes Mittel?
Die Fackeln erleuchteten einen weiteren Teil der Höhle. Eine Art Kammer. Von hier ging es augenscheinlich nicht mehr weiter. Sie verteilten brennende Fackeln überall an den Wänden, um für gleichmäßige Lichtverhältnisse zu sorgen. Die Wände waren hier sehr viel unebener. Es waren Stücke herausgebrochen. Mehrere mannsgroße Felsbrocken lagen auf dem Boden verteilt. In die hintere Wand hatte jemand eine Art Schrein gehauen. Darauf und auf dem Boden davor und auch noch daneben verteilt befanden sich jede Menge Grabbeigaben. Das meiste war aus Ton gefertigt oder aus Holz geschnitzt. Es gab geflochtene Körbe, in denen sich womöglich einmal Blumen oder Früchte befunden hatten. Auf dem Schrein selbst befanden sich eine goldene Krone, ein Stab mit Edelstein, sogar goldene Becher und noch einige kleinere Gegenstände aus Gold.
Goldfunde waren nicht ungewöhnlich für diese Gegend. Der Goldrausch war einer der Hauptgründe für die rasante Besiedlung durch die weißen Einwanderer. Und das damit verbundene Aussterben der Ureinwohner. Doch von den Indianern geschaffene Utensilien, sogar eine Krone, das war ihr höchstens von den Azteken bekannt. Die hier lebenden Stämme müssen unter Chuwangas Führung sehr viel fortschrittlicher gewesen sein als sie gedacht hatten. Womöglich hatten sie die vermeintlichen „Wilden“ doch unterschätzt und in Wahrheit waren sie die unterentwickelte Rasse?
Poltern und klirrender Lärm durchbrachen die Stille ihrer Gedanken. Blackfists Leute nahmen alles mit, was sie finden konnten. Sollten sie doch, ihr gleich. Sie wollte nur das eine.
Elisabeth und den Professor interessierten all die anderen Dinge nicht, sie waren hinter etwas ganz anderem her. Sie sahen sich alles genau an, doch das, was sie eigentlich wollten, war nicht dabei. Plötzlich jauchzte Baumann auf. Er hatte etwas entdeckt. Einen Luftzug. Vorsichtig tastete er die Gegend darum ab. Und – verschwand. Er hatte sich durch einen schmalen versteckten Spalt in der Felswand gequetscht. Nun sah sich auch Elisabeth die Stelle genauer an. Tatsächlich befand sich dort ein kaum sichtbarer Durchgang. Vom Professor fehlte jedoch jede Spur. Elisabeth wollte ihm gerade folgen, als sie einen markerschütternden Schrei vernahm.
Emilio, der jüngere der zwei mexikanischen Brüder hatte etwas entdeckt. Er hatte versehentlich einen Teil eines Felsens beiseitegeschoben, als er sich daran gelehnt hatte. Doch dieser Felsbrocken war kein Fels. Als Elisabeth näherkam, erkannte sie, dass es ein Sargdeckel war.
Als sie den gut erhaltenen Leichnam betrachtete, lief ihr ein erregender Schauer über den Rücken. Hatte Sie endlich gefunden, wonach sie gesucht hatten? Irgendetwas musste in dieser Höhle sein, dass die Zersetzung des toten Häuptlings Verhinderte. Oder hatte er tatsächlich den Schlüssel zur Unsterblichkeit gefunden? Sie hatte dafür so viel auf sich nehmen müssen, so viele Qualen durchgestanden, doch nun war er zum Greifen nah. Sie sah ihn lange fasziniert an, konnte den Blick einfach nicht abwenden, als wäre sie versteinert. Seine Haut war fahl, fast grau. Sie wirkte irgendwie knitterig, wie altes Pergamentpapier. Sein Gesicht war eingefallenen wie bei einer verdorrten Traube. Dennoch hatte er etwas erhabenes fast Göttliches an sich. Man sah noch immer, wie groß und muskulös er gewesen war. Er sah genauso aus wie in den alten Geschichten beschrieben. Er musste etwa vierzig Jahre alt gewesen sein. Trotz seiner so hochrangigen Position als größter Häuptling aller Zeiten, wie er ihnen ständig angepriesen wurde, trug er nur relativ einfache Kleidung. Kein prächtiger und ausgefallener Kopfschmuck zierte sein Haupt. Nur ein einfaches Lederband mit einer Art Brosche. Sein einst kräftiger Oberkörper war lediglich mit einer leichten Stoffweste bedeckt, welche aber sehr bunt verziert war. Um die feste kniehohe Hose aus Tierleder war ein stabiler Gürtel mit auffälliger Schnalle gebunden und seine Füße steckten in zwei für sein Volk ungewöhnlich hohen Stiefeln, welche ebenfalls auffällig verziert waren. Außer dem Häuptling selbst konnte sie in dem Sarg nichts weiter Interessantes entdecken. Sie konnte es kaum erwarten ihn, in ihrem Labor in New York, zu untersuchen.
Sofort wies sie Franz an, ein paar Proben zu entnehmen, falls er ihnen draußen doch noch zerfallen sollte.
Dann bat sie Fist darum, die zwei Mexikaner zum Tragen der Leiche heranziehen zu dürfen.
Emilio hatte sich inzwischen wieder beruhigt und war damit beschäftigt seine Taschen weiter zu füllen. Gerade hatte er einen Becher aus Chuwangas Sarg entwendet.
„Was soll der Quatsch.“ Carlos schlug ihm das Ding aus der Hand, dass es scheppernd durch die Höhle flog. „Pack doch nicht jeden Müll ein, nur die wertvollen Sachen. Die Pferde müssen schon genug Plunder tragen.“ Er sah böse zu Else hinüber, die sich bemühte nicht hinzuhören.
„Sag mir nicht immer, was ich tun soll.“ Erboste sich Emilio und griff nach seinem Colt.
„Dann mach nicht ständig Fehler.“ Tönte der Größere zurück. „Komm schon. Wir sollen den Knaben da auf eines der Pferde des Professors packen.“
Emilio nahm die Hand vom Hüftholster und atmete tief durch.
„Was für eine Drecksarbeit. Was wollen die mit der toten Rothaut? Im Museum ausstellen?“ Er griff nach den Lederriemen, die um den gesamten Körper des Toten gelegt worden waren. Doch, obwohl er noch immer von mächtiger Statur war, war er inzwischen so zusammengefallen, dass sie nicht mehr hielten und der ganze Körper unter lautem Poltern herunterfiel. „Ich schwöre dir,“ echauffierte sich der Jüngere, „sobald wir hier fertig sind, nehme ich meinen Anteil und verschwinde.“
„Ist bestimmt auch besser so, wenn du mal ein paar Tage ausspannst.“
Die zwei hoben Chuwanga wieder auf und gingen mit ihm nach draußen.
Elisabeth malte sich in Gedanken aus, was sie zuerst tun würde, wenn es ihnen wirklich gelungen sei das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt zu haben.
Plötzlich stand Baumann wieder neben ihr.
„Wo waren sie?“ fragte sie wie beiläufig.
Er hatte nasse Hände bekommen.
„Da hinten ist nichts, nur ein Wasserfall, der von weiter oben hier durchläuft. Die Strömung ist immens stark.“ Er bemerkte den leeren Sarg. „Und was haben sie hier?“
„Wir haben ihn gefunden.“ Platzte es aus Franz heraus, der bisher zu Recht ruhig geblieben war. Else hielt ihn für einen grandiosen Trottel, der nur wenn er schwieg, gerade noch zu ertragen war.
„Sie bringen ihn gerade raus.“ Ergänzte sie.
„Was?“ Baumann war schockiert. „Warum haben sie mir nicht Bescheid gesagt? Wie gut ist er erhalten?“
„Sein Zustand ist überraschend…“ er hörte gar nicht mehr hin, sondern lief mit großen Schritten hinaus. Elisabeth sah ihm erleichtert hinterher. Sie war froh, dass er so schnell wieder weg war. Sie musste jetzt eine Weile mit ihren Gedanken alleine sein. Nach einem längeren Fachgespräch mit dem Professor war ihr gerade so gar nicht zumute. Es fiel ihr schwer, ihre Gefühle im Zaum zu halten. Die Erleichterung den schwierigsten Teil endlich hinter sich zu haben wollte sich einfach nicht einstellen. Es erschien ihr alles zu unrealistisch, irgendwie zu schön, um wirklich wahr zu sein.
„Mir ist schlecht.“
Elsa sah sich noch ein wenig um, sie wollte ganz sicher sein, dass sie nichts übersehen hatten. Blackfist und seine Vandalen hatten jedoch ganze Arbeit geleistet und kaum noch etwas übrig gelassen das sie hätte untersuchen können.
„Mir ist schon ganz schwindelig.“
Dennoch wurde sie das ungute Gefühl nicht mehr los, dass sie etwas falsch gemacht hatten. Irgendetwas stimmte nicht.
Aber vielleicht war es auch etwas ganz anderes. Obwohl sie es sich selbst nicht eingestehen wollte und es zu ignorieren versuchte, war das schlechte Gewissen über den Tod der Indianer nicht zu leugnen.
„Mein Arm juckt so komisch, ich glaube, mich hat etwas gestochen. Vielleicht hat mich aber auch diese Spinne da gebissen?“
Sie konnte sich einfach nicht konzentrieren. Irgendetwas störte sie.
„Wenn ich nicht gleich ..."
„Jetzt seien sie doch verdammt noch mal endlich still,“ raunzte sie Franz an. Doch der jammerte und wimmerte weiter, bis sie endlich nachgab. „Wann hören sie endlich auf mit dem Saufen?“
„Ich habe gar nicht…“
„Hier drin ist stickige Luft, warum gehen sie nicht ein bisschen raus?“ schlug sie vor. Zuerst wollte er etwas erwidern, nickte dann aber nur und ging.
Elisabeth wurde das ungute Gefühl nicht mehr los. Selbst als sie schon wieder auf ihren Pferden saßen und diesen gottlosen Ort hinter sich ließen. Sie versuchte, die düsteren Gedanken abzuschütteln, die ihren Verstand umnebelten. Im nächsten Ort würden dieser Verbrecher Blackfist und seine widerliche Meute ihren Anteil nehmen. Sie selbst würde den Zug Richtung Heimat besteigen, und dann würden sich ihre Wege endlich trennen. Und sie wäre schon bald wieder zuhause bei ihrem kranken Vater.
2. High Noon
Stanford kniff die Augen zusammen. Er durfte jetzt nur nicht aufgeben. Seine Gegner würden es auch nicht. Das waren knallharte Gangster. Er war bereits zu weit gegangen, um jetzt noch umzukehren. Es wäre auch viel zu spät gewesen, er steckte bereits mitten im Schlamassel. Er konnte nur weiter machen, eine andere Option gab es nun nicht mehr.
Noch einmal analysierte er seine Chancen. Keiner der anderen hatte bisher eine Schwäche gezeigt. Doch das war noch kein Grund zur Sorge, wenn Stan von einem mehr als genug hatte, dann von seinem typisch englischen Stolz. Andere nannten es Überheblichkeit. Er selbst eine Tatsache. Aus seiner Sicht war er fast allen anderen in diesem Teil der Welt, zumindest geistig, überlegen.
Wenn er es geschickt anstellte und er war sicher, dass ihm das Gelingen würde, konnte er das alles hier noch zu einem guten Ende bringen. Zumindest für sich.
Er zog vorsichtig seine Hände an seinen Oberkörper und linste auf das, was sich in ihren Innenflächen befand. Full House! Zwei Asse und drei Damen. Er war zufrieden, aber auch erfahren genug, um zu wissen, dass es immer einen gab, der noch ein weiteres Ass im Ärmel hatte…
Die vier Kontrahenten hatten die ganze Nacht über gespielt. Sie waren einfach nacheinander hereingekommen, hatten ein paar Worte miteinander gewechselt und sich dann an den runden Tisch ziemlich in der Mitte des Saloons gesetzt. Doch was als harmloser Zeitvertreib einiger Durchreisender begonnen hatte entwickelte sich schnell zum knallharten Nervenkitzel.
Das Geld wechselte ständig hin und her, so dass keiner von ihnen aufgeben wollte. Die Stimmung, auch unter den anderen Gästen des Hauses, wurde immer gereizter. Der Barkeeper hatte sich nicht getraut, sie rauszuschmeißen, und hatte sich deshalb sogar extra zwischendurch ablösen lassen. Ein paar Schaulustige, hatten ebenfalls die Nacht über durchgehalten. Manche hatten sogar eine kurze Pause gemacht, nur um dann wieder vorbeizukommen. Auch die einschlägig bekannten Damen des Ortes hatten sich zwischenzeitlich abgewechselt, die Hoffnung auf, zahlende Kundschaft, jedoch langsam aufgegeben. Die vier Kontrahenten kümmerten sich gar nicht um die anderen Anwesenden, sie interessierte nur ihr Spiel. Dennoch schien der Anblick der Chips Stapel, die gleichwohl für echtes Geld standen, eine geradezu hypnotische Wirkung auf die jungen Frauen zu haben.
Der Saloon des kleinen Goldgräberstädtchens Nojust ähnelte eher einer Spelunke. Der einzige Raum wirkte vor allem durch die Deckenhöhe von geschätzten vier Metern, riesig. Dennoch war so ziemlich die gesamte Fläche mit kleinen Runden Tischen für maximal 4 Personen und den dazugehörigen Stühlen vollgestellt. Fast die ganze rechte Seite vom mittig gelegenen Eingang wurde von einem massiven Holztresen eingenommen, der bis zur hinteren Wand reichte. Dort gab es noch eine Art Hintereingang, der zu einem Nebengebäude führte, in welchem die Küche und Lagerräume lagen. Auf der anderen Seite, links von der Eingangstür gab es eine lange Holztreppe nach oben, von dort gelangte man durch eine weitere Tür zu einem Holzgerüst, welches zu den oberen Zimmern des zweiten Gebäudes führte, welche ausnahmslos von alleinstehenden Damen bewohnt wurden. Das einzige Mobiliar, das kein Tisch oder Stuhl war, war ein Klavier in der hinteren linken Ecke unter der Treppe. Es schien jedoch bisher niemanden zu geben, der darauf spielen konnte oder wollte.
Stanford hatte das Gefühl seit Tagen dort festzusitzen und nichts anderes zu tun als auf diese Karten zu starren. Wie lange sie wirklich schon dort gesessen hatten, wusste er gar nicht. Er konnte kaum noch die Augen offenhalten. Dennoch musste er durchhalten, musste weiter machen. Immer wieder schob er die Finger seiner beiden Hände zusammen und bewegte ihre Gelenke, bis sie knackten. Er hoffte nur, dass die anderen nicht merkten, wie erschöpft er bereits war.
Für eine unendlich scheinende Weile gingen die Pokerchips, die ihnen der Wirt freundlicherweise gegen ihr echtes Geld eingetauscht hatte, immer wieder hin und her, es zeichnete sich lange Zeit keiner ab der als erster die Segel streichen müsste. Doch irgendwann in der Nacht hatten die Chips Stapel der zwei Mexikaner begonnen immer höher zu werden. Aber Stanford und auch der andere hatten sich davon nicht beirren lassen und die Ruhe bewahrt. Sie spielten immer weiter, Runde für Runde. Jede Straße, jedes Pärchen, jeder noch so kleine Bluff brachten ihn seinem Ziel näher.
Und so hatte sich schließlich das Blatt gewendet. Das Glück schien nun endlich dem Engländer hold zu sein und sein Stapel begann wieder anzuwachsen, während die der anderen allmählich schrumpften. Er legte drei Damen vor sich auf den Tisch. Schon wieder gewonnen. Unter den mürrischen Blicken der anderen zog er die Chips aus der Mitte zu sich herüber.
Er war von den vier Männern am ordentlichsten gekleidet und erweckte eher den Eindruck eines durchreisenden Geschäftsmannes. Während die zwei Mexikaner eher wie Viehdiebe aussahen, hatte der Deutsche etwas von einem typischen Holzfäller. Seine kurzen dunkelblonden Haare und das schmale faltenlose Gesicht ließen ihn trotz der breiten Schultern, jünger wirken.
Das mexikanische Großmaul und sein stiller Begleiter verloren nun allmählich nicht nur ihre Chips, sondern auch die Geduld. Während der Deutsche Taugenichts hingegen immer mehr auf die Verliererstraße geriet. Stanford war zufrieden und hoffte, dass es nun bald vorbei sei.
Stanford sah zu dem Deutschen hinüber. Der verzog keine Miene, wie schon den ganzen Abend. Stan wusste, dass er nichts auf der Hand hatte, er bluffte. Der, den sie Gringo nannten, war leicht, zu durchschauen, bisher war er es gewesen, der am häufigsten die guten Karten bekommen hatte. Jedoch meist nichts dabei herausholen konnte. Der andere wurde Chico genannt und was ihm an Kraft und Körpergröße fehlte, machte er mit seiner großen Klappe und seiner ungeheuren Dummheit wieder wett. Er war der Schwierigste, weil unberechenbarste Gegner. Er hatte zurzeit noch das meiste Geld von ihnen allen vor sich liegen. Und nun wollte er natürlich das ganze Spiel gewinnen. Das war Stanfords Chance. Chico konzentrierte sich aufs Gewinnen, nicht aufs Spielen. Und wer nicht voll bei der Sache ist – verliert!
Der Deutsche war ein gutaussehender Junge, jedenfalls den Blicken der Damen nach zu urteilen. Doch wenn man genau hinsah, verbarg sich unter dem Dreitagebart, dem schmuddeligen Cowboyhut und dem markigen Westernlook ein ziemlicher Milchbubi. Stan lachte bei dem Gedanken. Er ging All In. Stan ging mit. Und er behielt recht, er hatte tatsächlich geblufft. Stanford griff unter den strengen Blicken der Anderen, den ganzen Pott in der Tischmitte ab. Er selbst verzog, wie schon während des gesamten Spiels, keine Miene.
Der Deutsche strich die Segel und war raus. Er nahm es wie ein Mann und verließ den Saloon eher erleichtert als enttäuscht. Ein fairer Verlierer?
„Wussten sie das der Begriff Pokerface nur wegen mir entstanden ist?“ Stan versuchte vom Abgang des Deutschen abzulenken und gleichzeitig die Stimmung wieder etwas anzuheben, indem er sein ausdrucksloses Gesicht erklärte.
„Nein,“ erwiderte Chico genervt. „Woher auch, du hast es uns ja gerade erst zum dritten Mal erzählt.“
„Innerhalb der letzten zwei Stunden,“ ergänzte der Andere. „Und jetzt halt deine verdammte Klappe und spiel weiter.“
„Warum habe ich das Gefühl, dass hier niemand an anständiger Konversation interessiert ist?“
„Weil wir Pokern und nicht Konwa... Konfer... Dingsen…“ Anstatt die Stimmung etwas aufzulockern, hatte er Chico offensichtlich nur noch wütender gemacht.
„Jetzt sag doch auch mal was.“ Schimpfte er in Gringos Richtung.
„Ja genau, äh…“
„Fresse!“ erwiderte Chico genervt. Bevor es noch Streit geben würde, teilte Gringo lieber Karten aus.
Die Mexikaner ergriff jedenfalls neuer Ehrgeiz und vor allem Chico begann immer offensiver zu spielen. Zunächst schien seine Taktik aufzugehen und er strich eine Handvoll Pokerchips ein. Doch dann gewann der Engländer Runde um Runde. Chico wurde immer unruhiger und sein Stapel immer kleiner.
Inzwischen war es früh am Morgen. Die Bewohner des kleinen Ortes schienen allmählich wach geworden zu sein und interessierten sich für das, was im Saloon vorging. Ein alter Mann auf Krücken und mit nur einem Bein humpelte mit seinem Hund an ihnen vorbei und versuchte dabei jedem der drei in die Karten zu sehen. Chico sah ihn so böse an, als wolle er ihn gleich hier vor Ort auffressen.
Manche Leute hatten sogar Kinder dabei. Eine mexikanische Familie war mit ihren vier Töchtern und einem Sohn aufgetaucht und hatte sich an den Nachbartisch gesetzt. Der Vater sah immer wieder freundlich zu Stan hinüber, als wolle er ihm damit andeuten, dass er auf seiner Seite war. Ein hochgewachsener dürrer Mann mit langem schwarzem Mantel und einer Art Zylinder auf dem Kopf redete nacheinander mit allen Leuten in dem Gebäude, außer den drei Pokerspielern. Besonders intensiv zuerst mit dem Barmann dann mit der Familie. Die Frau und die Kinder versuchten ihn, zu etwas zu überreden, und schließlich gab er nach, setzte sich ans Klavier und begann zu spielen. Nicht besonders gut, aber zumindest klang die Musik fröhlich. Die Menschen hier schienen sonst nicht viel zu erleben, wenn ein paar Pokerspieler, die die ganze Nacht durchgespielt hatten, bereits eine solche Attraktion für sie darstellten. Die Drei spielten jedenfalls weiter, doch ihren Zusehern schien es auch nach einer ganzen Weile noch nicht langweilig geworden zu sein.
Gringo hatte ausgeteilt und Stanford sah sich seine Karten an. Mit dem Blatt war durchaus etwas machbar, dachte er sich. Er begann zu setzen und Gringo ging jedes Mal mit. Du armer Tölpel, lachte er in sich hinein. Du bist einfach, zu leicht zu durchschauen. Gringo ging All In und wollte sehen. Stan hatte vier Buben und Gringo nur drei sechser. Damit waren es nur noch zwei. Doch Gringo lies den anderen nicht alleine, schob nur seinen Stuhl ein wenig zurück. Wollten sie Stan etwa verunsichern?
Der Barkeeper stellte jedenfalls schon einmal vorsorglich die Flaschen seines teureren Gesöffs unter die Theke und einige Besucher rückten näher an die Hintertür. Der Mann am Klavier hörte auf zu spielen und der Hund legte die Pfoten über seine Schnauze. Nur die Damen schienen sich zu freuen. Hofften sie vielleicht, dass bald einer von ihnen seinen Gewinn wieder loswerden wollte?
Stanford behielt die besseren Karten. Zweimal Sieben und drei Asse. Wieder ein Full House. Genau wie Chico, nur das seines kleiner war. Drei achten und zwei – Asse? Verflucht. Das waren fünf. Er hatte nicht aufgepasst.
Plötzlich sprang der Mexikaner auf und beschimpfte den Engländer. Dabei riss er den ganzen Tisch um und alles darauf fiel scheppernd zu Boden. Jeder im Raum sah verstohlen in eine andere Richtung, doch keiner hatte den Mut, sich zu rühren.
„Du spielst falsch, Engländer.“ Schimpfte Chico.
„Sie bezichtigen mich der Arglist?“
Die beiden Mexikaner sahen sich verwundert an.
„Ähm?“
„Zeig deine Ärmel her.“ Befahl der Mexikaner. Fand jedoch nichts. „Wie hast du es gemacht?“
„Sir, ich betrüge nicht.“
„Und ob du betrogen hast. Du hast es doch auch gesehen Gringo.“ Sein Kumpan nickte eifrig. „Also los, zeig es ihm.“ forderte der Mexikaner den verdutzten Cowboy auf und schubste ihn zu dem Engländer.
„Ein Duell?“ fragte der Mann im Anzug erstaunt, aber nicht ängstlich. Ein Duell? Die zwei sahen sich verunsichert an. Aber Chico kam wohl zu dem Entschluss, dass es genau das war, was sie jetzt wollten.
„High Noon. Zwölf Uhr mittags!“ erwiderte er. Gringo sah noch immer nicht begeistert aus. Im Gegensatz zu Chico war er wohl nicht so scharf auf ein Duell um Leben und Tod.
Der Engländer nahm eine Taschenuhr aus seiner Hemdtasche und sah genervt darauf.
„Oh je, es ist doch grad erst Nachmittag geworden, da müssen wir ja noch einen ganzen Tag warten, bis es wieder Zwölf wird.“ Die zwei sahen ihn wieder so verwundert an, als käme er von einem anderen Stern oder so etwas, während er gemächlich seine Uhr wieder zurücksteckte. „Sorry Peoples aber da hab ich keine Zeit.“ Er sah in die verwirrten Gesichter der Desperados. Chico lief rot an wie eine Tomate und setzte zu einem wütenden Schrei an. Doch Stanford ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
„Aber warum eigentlich immer High Noon? Weshalb denn nicht gleich?“ Die zwei Mexikaner sahen sich nervös an. Sie fragten sich wohl, ob er nur so tat oder tatsächlich so dumm war.
„Ok, warum eigentlich nicht!“
Stanford klatschte aufmunternd in die Hände.
„Na dann los. Lasst uns die Klingen kreuzen.“
Fast der ganze Ort war nun vor dem Saloon auf der Straße. An die Hundert Menschen vielleicht. Der Besitzer des Saloons versprach dem Sieger ein Freibier. Die Damen versicherten dem Engländer, dass sie auf seinen Sieg hofften und er später noch gerne auf ihre Zimmer kommen dürfe. Im Gehen zwinkerten sie jedoch dem anderen zu. Ein schlanker Mann in einem gepflegten hellen Anzug kam auf die drei zu. Es war der ebenfalls mexikanisch aussehende Familienvater. Er wirkte auf Stan anders als der Rest der Leute hier, irgendwie intelligenter. Er hatte etwas von einem Bürgermeister. Er sagte, er sei Arzt und bot den Kontrahenten Medizinische Versorgung an, sofern diese hinterher noch von Nöten sein würde.
„Dr. Mendoza mein Name. Tut mir zwar leid, aber ich hoffe sie verstehen, dass eine umfangreiche Behandlung teuer werden kann. Daher müsste ich vorher abrechnen.“ Doch Stanford sah dafür keine Veranlassung.
„Wir werden abrechnen, und zwar mit dem hier,“ erwiderte Chico und schwang seinen Colt. Er und Gringo nahmen auf der Breiten Straße Aufstellung. Eigentlich handelte es sich nur um einen plattgetretenen Pfad, der mitten durch den Ort führte. Welcher wiederum lediglich aus ein paar teils kargen Hütten bestand. Es gab ein paar kleinere Läden, Stallungen für die Pferde und bei ihrer Ankunft hier hatte Stan hinter den Häusern der Hauptstraße eine Mühle und ein Sägewerk gesehen. Sie nannten den Ort Nojust. Kein Gesetz! Das schien zu stimmen. Ein Sheriffs Office gab es zwar, doch von einem Gesetzeshüter keine Spur. Gleich schräg gegenüber, praktisch als Mittelpunkt des ganzen Ortes stand eine etwas heruntergekommene Kirche. Sie war wohl als Erstes hier und man hatte den Rest einfach Drumherum gebaut.
Chico rief etwas auf Mexikanisch und spuckte dann verächtlich auf den Boden. Der Doc sah zu den beiden Mexikanern und dann wieder besorgt zu Stanford. Er wiederholte sein Angebot, nun etwas energischer.
„Sie sollten sich das wirklich gut überlegen, die zwei sehen aus wie echte Revolverhelden und sie…“
„Und ich mein Herr, wie sehe ich aus?“
„Sie nicht.“
„Ich bin auch keiner.“ Mendoza sah nicht aus, als würde ihn das Beruhigen. „Ich bin Spieler. Also, die Karten sind verteilt. Lasst uns spielen.“ Mendoza lächelte nun, doch noch immer nicht beruhigt, eher resigniert.
„Armer Irrer. Aber er hat wohl recht, er wird keinen Arzt brauchen.“ sagte er zu dem Mann im schwarzen Anzug, der auf dem Klavier gespielt hatte. „Das ist dein Kunde.“ Der Bestatter lächelte und überprüfte noch einmal, ob der eilig herbeigeholte Sarg die richtige Größe hatte.
Gringo hatte sich inzwischen in Stellung gebracht und Chico war zu den anderen Schaulustigen unter das Vordach des Saloons zurückgekehrt. „Können wir endlich anfangen?“ rief er ungeduldig.
„Gemach!“ erwiderte Stanford ruhig und schlenderte zur Straße. Der Engländer sah dabei nach oben zur Sonne.
„Lassen sie uns die Plätze tauschen. Ich kann um diese Uhrzeit immer so schlecht Richtung Norden zielen.“ Klagte er.
Der Mexikaner sah ihn verächtlich an.
„Ein Betrüger und ein Feigling noch dazu. Pah.“ Er spuckte erneut vor ihm aus.
„Na gut, wenn sie unbedingt wollen.“ Er ging nun doch zu der Stelle, wo er stehen müsste. Ganz gemächlich. Der Engländer hatte es eindeutig nicht sehr eilig. „Aber dann kann ich für nichts garantieren. Möglich das ich dann seeehr weit am Ziel vorbeischießen würde.“ Er zielte mit dem Finger auf Gringo und begann dann zu taumeln, als sei er betrunken, dabei wanderte der Finger hin und her und schließlich zeigte er auf seinen großspurigen Kumpan Chico.
„Okay, okay,“ gab dieser schließlich nach. „Dann tausch halt den Platz mit ihm. Ist doch völlig egal auf welcher Seite der Straße er im Staub liegt.“
Eiligst begab sich der Engländer auf den von ihm bevorzugten Platz. Als die zwei sich dabei etwa in der Mitte begegneten, sahen sie einander grimmig an. Wer von ihnen würde wohl schneller ziehen und als Sieger aus diesem Duell hervorgehen? Der steife Engländer, der nicht aussah, als wisse er überhaupt was er hier tat oder der stille Gringo, der von seinem Kumpan Chico zu diesem Duell gedrängt wurde?
Nun waren beide bereit. Doc Mendoza vergewisserte sich noch einmal davon und gab das Duell dann frei. Gringo zog seinen Revolver einen Bruchteil schneller und ging fast im selben Augenblick getroffen zu Boden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hielt er sich sein blutendes Bein.
„Aber wie?“ keuchte Chico entsetzt. Die Menge starrte nur fassungslos auf den Mann am Boden. Der Engländer gab sich große Mühe seinen eiligst gezogenen Colt wieder wegzustecken. Während der Doktor zu Gringo lief, um ihn notdürftig zu versorgen.
„Du hast schon wieder betrogen.“ Schrie Chico nun entsetzt auf. Stan tat jedoch vollkommen unschuldig.
„Entschuldigt vielmals mein Herr, aber wie soll ich das bitte gemacht haben. Wie ihr seht, habe ich ihn zuerst getroffen.“
„Aber er hatte seine Waffe noch gar nicht gezogen.“ Der Mexikaner wandte sich an die aufgebrachte Menge, die dicht an dicht hinter ihm stand. Der Engländer lachte falsch und musste plötzlich unsicher husten.
„Da habt ihr wohl etwas Falsches gesehen, das kommt davon, wenn man um diese Uhrzeit gen Norden blickt.“
„Mach mich nicht wütend.“ Der Mexikaner baute sich bedrohlich vor ihm auf, obwohl er ein gutes Stück kleiner war. Der Engländer ließ sich jedoch wie immer nicht aus der Ruhe bringen. „Zeig mir deinen Colt.“ Forderte Chico. Stan wich aus, als der Mexikaner danach griff. „Ich wette, die Trommel ist noch voll.“
„Jetzt geh doch endlich aus der Schusslinie.“ Der Deutsche lag gegenüber dem Saloon in dem Glockenturm der alten Kirche, direkt neben dem Büro des Sheriffs auf der Lauer. Er hatte alles beobachtet, was vor dem Saloon geschehen war. Von hier oben hatte er einen perfekten Blick. Alles hatte gut funktioniert. Genauso wie Stanford es von Anfang an geplant hatte. Zuerst hatten sie Chico gewinnen lassen, damit er anbeißen würde, dann hatte Wilhelm angefangen für Stan zu spielen. Der brauchte schließlich nur noch dafür sorgen, dass ihn Chico für einen Betrüger hielt, und schon schnappte ihre Falle zu. Stanford hatte bisher alles wie vereinbart hinbekommen. Als ihr Zielobjekt jedoch an der falschen Stelle stand, hatte er kurz gezweifelt, aber der Engländer war ein gewitzter Bursche, das musste er ihm wirklich lassen. Er hatte dafür gesorgt, dass Wilhelm wieder freies Schussfeld hatte und ihn von hier oben direkt ins Bein treffen konnte. Doch nun wurde es brenzlig, Stanford war nicht schnell genug gewesen und der Mexikaner hatte bemerkt, dass nicht er es war, der geschossen hatte, sondern der Deutsche mit seinem maßgefertigten Präzisionsgewehr. Er musste es noch einmal tun und auch den anderen Mexikaner erwischen, doch Stanford stand nun wieder in seiner Schusslinie.
Plötzlich herrschte Aufruhr, die Menge geriet durcheinander. Stan nutzte die Situation, um ihm wieder freies Schussfeld zu ermöglichen. Doch nun war es dafür zu spät.
Es war nur eine Sekunde, die er zu ihm hochsah, doch sie reichte aus, um dem Deutschen verständlich zu machen, dass die Sache aus dem Ruder gelaufen war. Irgendetwas stimmte nicht, aber was war schief gegangen? Was hatten sie denn bloß übersehen?
Er überlegte kurz abzuhauen, doch es war zu spät. Jemand hielt ihm den Lauf einer Winchester an die Stirn.
Gerade in dem Moment, als der Mexikaner den Colt des Engländers zu fassen bekam, steckte ihm jemand den Lauf eines anderen in die Nase.
„Fallen lassen!“ brummte eine mürrische Stimme. Unter den Bürgern von Nojust machte sich eine gewisse Unruhe breit.
Stanford konnte nicht anders, entgegen ihrer Regeln sah er zu seinem Partner hoch. Hinter dem Deutschen auf dem Glockenturm standen zwei Bewaffnete. Es war zu spät, sie hatten ihn bereits erwischt.
Kleine Kinder spielten fröhlich jauchzend am Wasser des kleinen Baches oder ließen zufrieden die nackten Füße in selbigem baumeln. Die Erwachsenen Männer fischten mit langen Holzspießen oder groben Netzen, welche von den Frauen noch vor Ort immer wieder repariert wurden. Einige der älteren Frauen sammelten im nahe gelegenen Wäldchen Beeren und Früchte, während sich einige der älteren Kinder um die Pferde kümmerten, die auf einer Wiese bei ihrem Dorf grasten. Alles war so friedlich und ruhig, die perfekte Idylle. Wie in einem Traum den man nie wieder loslassen will.
Doch dann hatte sich alles von einem Moment auf den anderen vollkommen verändert. Ganz plötzlich waren da diese Schreie, diese entsetzlichen Schreie. Und Blut überall Blut. Tot und verderben, wohin man blickte. Es war so unvorstellbar grausam. Über das ganze Dorf verstreut lagen tote Körper. Aus allen Richtungen hörte man winseln und flehen. Alle, die nicht tot waren, lagen im Sterben oder litten Höllenqualen, schlimmer als der Tod. Pferde wieherten, trampelten alles nieder, während sie panisch flohen. Vögel kreischten, als spürten sie den Schmerz der Opfer mit. Plötzlich wurde es heiß, Feuer loderten auf, immer stärker und verbrannten die blutgetränkte Erde.
Dann war stille, kein Windhauch war mehr zu spüren, alles war kalt und tot. Alles ausgelöscht in einem einzigen Flügelschlag des mächtigen Adlers.
Und mittendrin stand da ein kleines Mädchen. Zart und unschuldig. Es verstand nicht, was da gerade geschehen war. Warum war das alles passiert? Was hatten sie getan? Womit hatten sie das verdient? Sie waren einfache Jäger, nahmen sich nur das von der Natur, was sie zum Überleben brauchten. Für gefällte Bäume pflanzten sie neue. Töteten nur so viele Tiere einer Art, dass genug übrigblieben, um sich weiter fortzupflanzen. Sie ehrten alles Leben, waren im Einklang mit allem um sie herum. Weshalb bestraften die Geister sie dann?
Sie spürte die Hitze, als alles zu brennen begann. Und dann sah sie ihn, wie er über ihnen beugte, ihre Eingeweide herausriss und sich an ihnen labte wie ein Tier. Er genoss es, sie zu töten, als ernährte er sich von ihrem Schmerz. Er war so voller Zorn und Hass, als sei er das Böse in Menschengestalt.