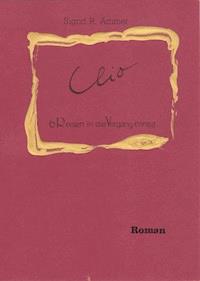
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Clio Meyer besucht die Ruinen von Mykenae. Königin Klytemnästra führt Clio eine überraschend andere Version von Mord und Opferung vor. Auf einer 2. Zeitreise besucht Clio eine matriarchal organisierte Stadt. Sie erlebt die Wahl des Jahreskönigs, die Heilige Hochzeit und die Opferung des Königs. Auf ihrer 3. Reise verwandelt sich die Autofähre in ein minoisches Handelsschiff. Auf Kreta erlebt sie Stierspiele, Feste, Brände, Erdbeben und böse Vorzeichen einer gesellschaftlichen Veränderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Copyright: © 2013 Sigrid R. Ammer
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.com
ISBN 978-3-8442-3362-9
*
*
*
„31. August. Aus dem Polizeibericht.
In der Nacht vom 29. auf 30. August ereignete sich auf der Bundesstraße 2 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein roter Volkswagenbus, von der österreichischen Grenze herkommend, kam aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab, fuhr einen Abhang hinunter, stieß gegen einen Baum und fing sofort Feuer. Die 28 Jahre alte Frau, die den Unglückswagen lenkte, erlitt tödliche Verbrennungen, konnte aber von den Polizeidienststellen bereits identifiziert werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverlauf nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.“
Am 1. September gab Herr R. Z. folgendes zu Protokoll:
„Ich fuhr in der Unfallnacht auf der Bundesstraße 2 auf die österreichische Grenze zu. Als ich in die übersichtliche, weite Linkskurve einbog, sah ich zwei Wagen auf gleicher Höhe fahrend auf mich zukommen. Als sie an mir vorbeigerast waren – ich hatte mein Tempo sofort verringert – erkannte ich den, der in der Mitte der Straße fuhr, als Polizeiwagen, der offensichtlich einen roten VW-Bus, der am Abgrund entlang fuhr, zum Anhalten zwingen wollte.
Wenige Sekunden später hörte ich ein Krachen. Da mir ein sofortiges Umdrehen an dieser Stelle verkehrstechnisch unmöglich war, fuhr ich circa 500 Meter weiter zum Gasthof „Lamm“. Dort angekommen, erinnerte ich mich, dass ich diesen VW-Bus – er war an allen Seiten mit bunten Blumen bemalt – am Nachmittag vor dem Gasthof gesehen hatte. Im „Lamm“ brannte noch Licht, ich lief hinein und sagte dem Wirt, den ich seit meiner Kindheit kenne, Bescheid und fuhr zurück zur Unfallstelle.
Schon von weitem erkannte ich den hellen Lichtschein eines Feuers. Als ich die Unfallstelle erreichte, war die Polizei offensichtlich dabei, die Feuerwehr und den Rettungswagen zu verständigen, denn einer der Polizisten telefonierte. Drei andere Beamte standen mit Maschinenpistolen bewaffnet um das brennende Auto herum, während ein fünfter einen Feuerlöscher betätigte. Allem Anschein nach waren sie auf der Jagd nach Terroristen.
Inzwischen hatten eine Menge Neugierige angehalten und schauten den Abhang hinunter dem schrecklichen Schauspiel zu. Ich weiß noch, wie ich dachte: ‘Glauben die wirklich, dass Terroristen aus dem brennenden, totalbeschädigten Auto herauskriechen und sie bedrohen könnten?’ Aber ein Beamte kam sofort aus dem Polizeiauto heraus und schrie: „Die Unfallstelle sofort frei machen. Weiterfahren! Sofort weiterfahren!“ Ich sagte: „Ich möchte eine Zeugenaussage mache.“ Er schaute mich misstrauisch an und sagte nur knapp und mit der Hand an seiner Maschinenpistole: „Es gab keine Zeugen des Unfalls, fahren Sie sofort weiter.“ Drei weitere Polizeiwagen waren inzwischen herangekommen, die Unfallstelle wurde abgeriegelt. Ich hörte nur noch die Sirenen der Feuerwehr und des Rettungswagens, als ich nachdenklich in die Nacht hinein nach Hause fuhr.
Verzeihen Sie, wenn ich eine persönliche Bemerkung mache. Sie haben, wenn ich so sagen darf, in der Frau, die da verbrannt ist, eine Unschuldige hingerichtet.“
MYKENΑΕ oder Unter schwarzen Schleiern
1. BUCH1. TEIL1
Clio schaute den Touristen nach, die den Mauern der mächtigen Burg Mykenä folgend die Rampe hoch zum Löwentor gingen. Sie hörte ihre Ohhhs und Ahhhs, das unvermeidliche „very nice“ und „fantastic“ und wäre am liebsten gleich wieder umgekehrt. Aber sie hatte die Übersetzung eines Buches über Mykenä zu machen. Und so ließ sie sich von der Touristenmenge vorwärtsschieben. Sie schaute die riesigen Steinquader an, und sie waren ihr plötzlich so vertraut, als würde sie sie schon seit langem kennen. Sie legte sich eine Erklärung zurecht und dachte ´Sicher, ich war ja manches mal als Kind mit meinem Vater hier. Wie langweilig Vaters Kommentare waren! Wenn ich mit den Steinen spielen wollte, gab es ein großes Geschrei. Nichts war erlaubt gewesen als Staunen. Ich fand damals nichts zum Staunen. Jetzt, ja, jetzt bin ich schon beeindruckt!´
Sie trat aus dem Touristenstrom, blieb stehen, holte ein Taschentuch aus ihrer Tasche und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Ihr war auf merkwürdige Weise nicht wohl. Sie fand die Mauern bedrückend. Sie erschrak und ging mit vorsichtigen Schritten weiter, als ob der Boden unter ihr nachgeben könnte oder die Quadersteine so eng zusammenrücken könnten, dass sie dazwischen zerdrückt würde. Aber sie luden sie ein, nicht freundlich, sondern mit einer Geste, die keinen Widerspruch duldete.
Sie stand noch immer vor dem Tor, Touristen mit Kameras vor dem Bauch baumelnd, schlenderten ihr entgegen oder überholten sie eilends. Sie achteten nicht auf die finstere Drohung, die aus den Mauern kroch, nach Clio griff und sie in ihren Bann schlug.
Clio ging unsicher ein paar Schritte auf das gewaltige Tor zu, das jetzt eng und schwersteinern vor ihr stand. Wieder wollte sie fliehen und schaute Hilfe suchend hinauf zu dem Steindreieck über dem Türsturz, von wo aus die hochaufgereckten gesichtslosen Löwinnen sich ihr zuwandten. Der Stein begann zu wachsen und formte sich zu Köpfen mit Rachen, Augen und Ohren. Beide starrten auf Clio hinunter, voll Erstaunen, als würden sie sie wiedererkennen. Und wirklich drang ihr steinerner Blick bis in Clios Herz und ließ sie tief und befreit aufatmen.
Als ein kleiner Junge neben ihr rief: „Papi, den Löwen haben sie aber schön die Gesichter zertrümmert!“, da schmolzen die Steine, waren wieder nur noch jahrtausende alte gesichtslose Steinfiguren, das sogenannte Löwentor, fotografisches Objekt, Schaustück für die Dia-Sammlung.
Aber in Clio hatte ein Funke aufgeleuchtet, der ihr Mut gab, ihren Weg fortzusetzen in dem Gedanken: ‘Ich habe ihnen nicht zum ersten Mal ins Gesicht gesehen, ich kenne sie.’ Sie setzte ihren Fuß über die steinerne Schwelle und schaute zum Burghügel hinauf. Ihrer inneren Stimme folgend ließ sie das Gräberrund rechts liegen und begann, den steilen Weg hinaufzusteigen. Bevor sie sich nach links, der oberen Burg, zuwandte, drehte sie sich noch einmal um und stellte fest, dass das Steindreieck über dem Tor von der Innenseite leer war.
Sie setzte ihren Weg den Burghügel hinauf fort, ging nachdenklich, in sich gekehrt. Als sie eine Gabelung erreichte, schlug sie, ohne lange darüber nachzudenken, den Weg nach Südosten ein. Sie ging ein Stück, sah dann, dass der Pfad nach Norden abbog und hielt inne. Sie schaute hinunter in die Ebene, die der Burg zu Füßen liegt. Weit unten wandt sich die Straße, die das Tal heraufführt. Sie überließ sich den Eindrücken der Natur, die sie umgab. Hinter ihr die Berge, die im Rücken der Burg diese wie natürliche Schutzwälle umstanden und von eigentümlich violett-grüner Färbung waren. Vor ihr, wo der Burghügel ins Tal hinein flacher ausläuft, standen die Straße entlang und im ausgetrockneten Flussbett leuchtend rot und weiß blühende Oleanderbüsche.
Clio erfreute sich eine Weile an den Farben der Landschaft, nahm dann ihren Weg wieder auf; sie kehrte der Ebene den Rücken und folgte dem Pfad nach Norden, ging auf die sie magisch anziehenden Mauerreste zu. Der Weg endete am Fuß einer halb verfallenen Treppe. Links ragte eine hohe Mauer auf, rechts war die Treppe begrenzt von zerbröckeltem Mauerwerk, im Hintergrund wurde sie überragt von einem jener violetten Gipfel des Bergkamms. Über alles wölbte sich ein tiefblauer Himmel.
Sie nahm die Stufen langsam, gleichzeitig ergriffen und erstaunt über die Lebendigkeit und Vertrautheit der Umgebung. Ihr war merkwürdig zumute; eine seltsame Spannung erfüllte sie, als sie Stufe um Stufe die Treppe hinaufstieg. Eine angespannte Erwartung, gemischt mit Neugier breitete sich in ihr aus. Sie erreichte den Treppenabsatz und sah, dass er von einer hohen Mauer begrenzt und der höher führende Teil der Treppe eingestürzt war. Ihr Weg schien hier zu enden. Sie stand kopfschüttelnd und enttäuscht vor der Mauer. Schließlich drehte sie sich um, wollte zurückgehen, um einen anderen Weg ins Megaron, das Haus der Königin, zu finden.
Sie ließ ihren Blick noch einmal über die Landschaft gleiten, die sich ihr zu Füßen ausbreitete. Die Sonne stand schon hoch, blendete. Clio schloss einen Moment lang die Augen, um das Bild in sich aufzunehmen.
2
Wie sie die Augen wieder öffnet, befindet sie sich im Halbdunkel. Ihre vom Sonnenlicht noch geblendeten Augen können erst nichts erkennen. Als sie sich an die neue Umgebung gewöhnt haben, bemerkt sie, dass spärliches Licht aus hochgelegenen Fenstern ein Treppenhaus angenehm dämmrig erfüllt. Ihr Herz beginnt heftig zu schlagen, ihre Knie zittern ein wenig, so dass sie sich gegen die Wand lehnen muss.
Als sich ihre Augen ganz an das Halbdunkel gewöhnt haben, kann sie eine hölzerne Treppe, bunt bemalte hölzerne Säulen, die das Dach tragen und den Wänden entlanglaufende rote und weiße Rosetten und Spiralen unterscheiden. Voller Staunen steigt sie die Treppe hinauf. Ein wenig Tageslicht fällt auf den oberen Absatz durch eine Tür, die hinaus in einen kleinen Vorhof führt. Sie blinzelt in das helle Licht der Mittagssonne. Erwartungsvoll geht sie weiter und erreicht, durch ein Tor tretend, einen weiten Hof.
Die in hellem Ocker getünchten Wände liegen in angenehmem Schatten. Sie schaut sich um und ist überwältigt von der Einfachheit und Großartigkeit dieser Baukunst und den heiteren Farbspielen. Die flachen Dächer der an den Hof grenzenden Gebäude sind über das Mauerwerk in den Hof hinein vorgezogen, so dass eine Art Wandelgang entstanden ist, dessen Gebälk von einer Reihe schlanker, rot bemalter Holzsäulen getragen wird und dessen Wände Friese von Halbrosetten in Rot, Weiß und Blau schmücken. Sie geben dem Hof eine Heiterkeit, die die düsteren Mauern nicht erwarten ließen.
Ihr gegenüber liegt eine offene Halle, deren Dach von zwei ebenfalls schlanken Holzsäulen getragen wird; neben der rechten erblickt Clio einen festgefügten steinernen Altar, auf dem ein Tonkrug und eine Schale stehen, und an dessen Seite eine alabasterne Rinne entlang läuft. ‘Für das Blut der Opfertiere?’ Opfer und Blut erinnern sie an die Geschichte dieses Palastes, und ein Schatten fällt über alle Heiterkeit. Ihr Gesicht verdunkelt sich, und sie spürt, wie sich unter einem kalten Lufthauch die Haut ihres schweißnassen Rückens eisig zusammenzieht.
Entschlossen überquert sie den weiten Hof, geht an dem Altar vorbei, zwischen den beiden Säulen hindurch auf die hohe, hölzerne, zweiflüglige Tür zu, die in das Innere des Megarons führt. Voller Staunen bleibt Clio vor der Tür stehen. Sie ist hingerissen von der prachtvollen Arbeit: Silber- und Goldornamente. Sie entdeckt Bilder, die aussehen, als seien sie mit einem schwarzen Metall gemalt, erkennt Löwen, Bäume, einen Altar, schlanke Säulen und Doppeläxte; merkwürdige Zeichen im Himmel, der über einer doppelten Wellenlinie silbern leuchtet. Über allem schwebt die zierliche Sichel des Mondes. Allein Clio hat keine Geduld, sich in all die Wunderwerke der Tür zu vertiefen, aber sie ist berührt von dieser ihr fremden Symbolwelt.
Entschlossen ergreift sie die Türknäufe, die mit einer feinen Silberhaut überzogen sind und sich kühl anfühlen. Sie lehnt sich gegen die schweren, hohen Türflügel und ist erstaunt über die Leichtigkeit, mit der sie sich wie von selbst in ihren Angeln drehen.
Wieder steht sie im Halbdunkel eines Raumes, aus dessen hohen Fenstern schräg das Tageslicht über den Fußboden fällt, dessen große quadratische, mit roten, blauen und gelben Ornamenten verzierte Felder von weißen Alabasterplatten eingesäumt sind. Sie hält inne und wagt nicht, mit ihren staubigen Schuhen auf diesen kunstvollen Boden zu treten. Sie folgt den Steinplatten, bis sie vor einem schweren, bunt bestickten Vorhang steht, der den Vorraum vom Thronsaal trennt. Sie zögert. Ihr Herz beginnt schneller zu pochen.
Wie sie auf den Mut, den Vorhang zurückzuschlagen, wartend dasteht, hört sie eine tiefe, angenehme Frauenstimme dumpf und unwirklich aus der Tiefe des Raumes rufen:
„Clio!“
Sie erschrickt und tritt einen Schritt zurück. Wieder vernimmt sie die Stimme:
„Clio! Komm herein zu mir! Ich habe lange auf dich gewartet!“
Da streckt sich Clio, schlägt den Vorhang zurück und betritt das Megaron, den Saal der Königin.
Ihr erster Blick fällt auf das Feuer, das in der Mitte des Raumes brennt. In seinem unruhigen Schein wirken die vier schwarzen hohen Säulen rund um die Feuerstelle merkwürdig lebendig. Aus den frisch aufgelegten schweren Holzscheiten steigt eine Rauchsäule sich kräuselnd nach oben, verliert sich in der Höhe der Halle und verschwindet durch eine Öffnung in der Decke. Clio lächelt, als sie den kleinen blauen Himmelsfleck bemerkt, die einzige Farbe, die ihr Auge vorerst entdecken kann. Sie ist bezaubert von der ungewohnten Mischung aus Feuerschein und Tageslicht, das zusätzlich durch die schmalen zur Ebene hin schauenden Fensteröffnungen in der rechten Wand fällt.
„Willkommen, Clio!“, sagte die Stimme wieder, und sie versucht im Halbdunkel die Gestalt zu erkennen, die zu ihr spricht. Da erhebt sich aus einem im plötzlich auflodernden Feuer blau, silbern und golden funkelnden Thronsaal eine große, schlanke, ungefähr fünfzig Jahre alte Frau, über deren Schultern und nackte Brüste langes, schwarzes, gewelltes Haar herabfällt. Ihr rotes Jäckchen ist unter den Brüsten geschlossen, seine kurzen Ärmel lassen die Arme von den Ellbogen an frei.
Clio betrachtet die hoheitsvolle Gestalt und beantwortet ihr warmes Lächeln mit einem erstaunten und bewundernden Blick. Die Frau trägt einen langen, in viele Falten gelegten Rock, der mit einem bunten Strichmuster bestickt ist. Clio fragt sich, wer sie wohl sein möge, und wartet auf ein Zeichen.
Die Frau nickt ihr aufmunternd zu, und Clio geht ihr durch die Halle entgegen. Da sieht sie im schwarzen Haar einen schmalen goldenen Reif blinken, der ihr im Schein des Feuers wie eine Krone erscheint. ‘Eine Königin’, denkt Clio.
„Richtig, Clio“, sagt die Frau, „ich bin eine Königin, ich bin Klytemnästra.“
Clio weiß nicht, wie sie eine Königin von Mykenä begrüßen soll, und sagt nur einfach:
„Guten Tag, Klytemnästra“, und senkt den Kopf ein wenig dabei.
„Komm näher zu mir“, sagt Klytemnästra und küsst Clio, die näher herangetreten ist, auf die Stirn. „Du bist gekommen, um etwas über dich zu erfahren Clio. Komm, setz dich zu mir ans Feuer!“
Clio lässt sich von Klytemnästra zu der mit herrlichen Schnitzereien verzierten beim Feuer stehenden Bank führen und denkt dabei: ‘Eigentlich will ich ja lieber etwas über dich erfahren.’ Klytemnästras Bemerkung kommt ihr merkwürdig vor. Sie kannte ihre Geschichte aus der Schulzeit, und eigentlich war es ja nicht so sehr Klytemnästras Geschichte, als die des Agamemnon. Sie versucht, rasch den Mythos zu rekapitulieren: ‘Paris entführt die schöne Helena nach Troja. Menelaos, der Gatte, ruft zum Krieg auf, und Agamemnon wird Heerführer der Griechen. Die Winde stehen schlecht in Aulis, so dass der Priester Kalchas die Opferung der Iphigenie verlangt. Agamemnon opfert tatsächlich seine eigene Tochter, der Wind kommt auf, und sie segeln davon, um zehn Jahre lang um Troja zu kämpfen. Erst mittels des Tricks mit dem hölzernen Pferd gelangen die Griechen in die Stadt, plündern sie, schleppen die Menschen als Sklaven weg und kehren siegreich in die Heimat zurück. Agamemnon wird noch am Tag seiner Heimkehr von Klytemnästra ermordet, Jahre später von seinem Sohn gerächt, der seine Mutter ermordet und später von einem Gericht in Athen merkwürdigerweise freigesprochen wird. Warum eigentlich?’ Clios Gedanken bleiben an dieser Frage hängen. Inzwischen haben sich die Frauen ans Feuer gesetzt, und nach einer Weile fragt Klytemnästra:
„Du kennst also meine Geschichte, Clio?“
„Wir haben in der Schule die Orestie gelesen, aber ich war keine gute Schülerin, was Geschichte anbetrifft. Verzeih also, wenn ich dir nicht richtig antworten kann.“
„Clio, du bist aus einer anderen Zeit. Aber was weißt du über mich? Und weißt du das Richtige? Die Wahrheit? Sind eure Sänger ehrlich?“
Clio hebt ein wenig verlegen die Schultern.
„Erzähl mir, es interessiert mich, wirklich, Clio!“
Clio wendet ihr Gesicht ab, damit Klytemnästra die Schamröte, die ihr Gesicht in noch dunkleres Rot taucht als das Feuer, nicht sehen kann, und versucht krampfhaft, mehr über diese Frau in der Geschichte zu finden. Ihr Gedächtnis ist wie leergefegt. Sie starrt ins Dunkel des Saales, als könnten ihr von dort die Gedanken zuströmen. Klytemnästra sagt leise, mit ermunternder Stimme:
„Versuch es, Clio. Mach mir die Freude, erzähl mir die Geschichte!“
Klytemnästra verstummt wieder und horcht aufmerksam auf Clios Schweigen.
Das Eindrucksvollste für Clio ist, dass Klytemnästra eine Mörderin ist. Sie hat ihren Mann umgebracht, um weiter mit ihrem Freund Ägist, oder wie er hieß, ungestört leben zu können. Es passte ihr gar nicht, dass Agamemnon aus Troja zurückgekommen ist. Clio versucht, einen anderen Anfang zu finden und denkt: ‘Ich kann doch Klytemnästra nicht im ersten Satz als Mörderin bezeichnen!’
„Ja“, sagt Klytemnästra in Clios Gedanken hinein, „du hast recht. Ich habe Agamemnon umgebracht. Ist es das, was dir zu meiner Geschichte einfällt?“
Clio starrt wieder ins Feuer, ihr wird unheimlich. ‘Es war nicht zufällig gewesen vorhin, Klytemnästra liest meine Gedanken.’
„Clio“, sagt Klytemnästra, „schau mich an!“
Und in der Aufforderung kommt all die Hoheit zum Ausdruck, die diese Frau ausstrahlt. Clio hebt den Kopf und sucht den Blick Klytemnästras, über deren Gesicht der Feuerschein flackert. Clio erschrickt und, als könnte Klytemnästra auch ihre Gefühle erkennen, sagt diese ruhig:
„Hab keine Angst, ich bin nur ein durch dich lebendig gewordener Schatten aus der Geschichte, der zu dir spricht und der keine andere Macht hat als die, die du ihm gibst und die in dir selbst liegt. Du bist ich, denn ich bin ein Teil deiner Geschichte, die du in dir trägst, ich bin ein Teil von dir. Indem du gelernt hast, mich als Mörderin zu sehen und zu hassen, hast du auch gelernt, dich selbst zu hassen.“
Clio ist verwundert und wendet sich von Klytemnästra ab. Sie möchte sich der Macht dieser Frau entziehen. Sie versucht, zu ihrer Geschichte zurückzufinden, klammert sich an die Fakten, an das, was sie gelernt hat. Sie will nichts mit Klytemnästra zu tun haben und denkt trotzig: ‘Ihr habt ihn zusammen umgebracht, du und dein Freund, damit Agamemnon nicht euer Liebesverhältnis stört, damit ihr weiter dem Vergnügen leben könnt. Agamemnon hat zehn Jahre lang erbittert um Troja gekämpft und ist als Sieger hierher zurückgekehrt. Dein Mord war der Dank dafür. Wie habe ich dich bloß so sympathisch finden können, als ich hier hereinkam! An deinen Fingern klebt Blut.’
Solange Clio diese Gedanken durch den Kopf gehen, schaut sie fest in Klytemnästras Augen, die warm und weise auf sie blickten, aber immer trauriger werden, je mehr sich Clio in ihrer Abneigung verstrickt. Aber da ist auch ein Funkeln in Klytemnästras Augen, er spricht von Empörung, Auflehnung und Zorn.
„Eure Sänger haben mich ein zweites Mal ermordet“, ruft sie, und Clio antwortet:
„Du kennst die Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Ich sehe Trauer und Zorn in deinen Augen, Klytemnästra. Etwas muss falsch sein daran. Sprich zu mir, bitte!“
Klytemnästra fällt in Schweigen, dann steht sie auf, geht um die Feuerstelle herum, legt ein paar Scheite in die Glut und schaut durch die aufstiebenden Funken hinüber zu Clio. ‘Aber ich kann doch nicht Gedanken lesen’, denkt Clio. ‘Klytemnästra muss zu mir sprechen, laut, damit ich sie höre. Oder will sie nicht mehr? Habe ich sie beleidigt und alles verdorben? Ist alles vorbei; und ich muss gehen? Will Klytemnästra, dass ich gehe?’
3
Klytemnästra kommt zurück, stellt sich vor Clio und sagt:
„Du bist ein Kind, Clio. Ich weiß, dass du meine Gedanken nicht erkennen kannst, schon damals vor dreitausend Jahren, als ich lebte, hatten wir es verlernt. Erst als Schatten habe ich die Fähigkeit zurückbekommen. Träume und Gedanken sind große Mächte zum Nutzen und zum Schaden. Steh auf, Clio!“
Clio tut, wie Klytemnästra sie geheißen hat. Diese schaut ihr in die Augen und sagt:
„Du sollst nicht hassen, weder mich, noch meinen Teil in dir. Ich will dir meine Geschichte zeigen, die Wahrheit und auch – meine Schuld. Urteile dann über mich, über dich!“
Sie führt Clio zu einem der hohen, schmalen Fenster und sagt:
„Schau hinaus, Clio.“
Clio sieht nicht, was sie erwartet hat: die Ebene von Argos, sondern ein riesiges Feldlager am Meer. Schiffe, Kriegsschiffe, liegen vor Anker. Zehntausende von Männern zwischen tausenden von Zelten. Im Zentrum des Lagers drei große, prächtige Zelte, rund um einen Platz, in dessen Mitte ein Altar steht. Es wimmelt von Menschen, die aufgeregt hin und her laufen. Plötzlich vernimmt Clio einen Fanfarenstoß, und sie wendet ihren Blick in die Richtung, aus der er kam. Sie sieht zwei Schimmel an der Spitze einer kleinen Gruppe von Reitern, die sich dem Lager nähert. Wie sie herankommt, erkennt Clio, dass es Frauen sind, die als erste in das Lager einreiten. ‘Wer mögen die beiden Frauen auf den Schimmeln sein’, denk Clio und merkt, dass Klytemnästra sich ihr zuwendet und sie anlächelt.
„Schau genau hin, Clio! Erkennst du keine der beiden Frauen?“
Clio wartet, bis sie näher gekommen sind.
„Aber das bist ja du!“, ruft Clio erstaunt aus.
„Ja, die eine bin ich, und die andere ist meine Tochter Iphigenie. Ich hasste diesen Ritt ins Lager, ich hatte mich gesträubt dagegen und nicht einsehen können, warum Iphigenie unbedingt mit Achill verheiratet werden sollte. Ich mochte diesen Achill nicht. Er ist ein Schwärmer und ein Schwätzer, weich, aber rücksichtslos im Kampf. Ich dachte, er will Iphigenie haben aus Machtgier. Bei uns zuhause in Sparta hätte er den Thron mit ihr bekommen. Aber in Mykenä herrschen andere Sitten. Ich konnte das Motiv nicht finden, ich war ganz verblendet von meiner Abneigung. Er ist ein Abenteurer und liebt nichts mehr als Waffengeklirr. Ich hasse das. Ich hasse die Gewalt. Hätte ich die Macht gehabt, die meine Vormütter hatten, dieser Kriegszug wäre undenkbar gewesen. Menelaos wollte Helena zurück haben, weil er nichts ist ohne die Königin in Sparta! Aber Helena, meine Schwester, war frei zu gehen, wohin sie wollte und mit wem sie wollte. Sie war Spartanerin, und bei uns war das der Brauch unter Frauen.“
Clio hört verwirrt zu und beobachtet gleichzeitig die Vorgänge im Lager.
Iphigenie ist ein hochgewachsenes junges Mädchen, fast noch ein Kind. Bevor sie vom Pferd springt, wirft sie mit einer stolzen Kopfbewegung ihr langes blondes Haar nach hinten und rückt ihr Stirnband zurecht. Sie führt ihr Pferd zu einer der Frauen des Gefolges und sagt zu ihr:
„Ich werde auf einem anderen Pferd nach Hause reiten. Nimm du Artemis und vergiss nie, wohin sie mich zuletzt getragen hat, denn ich werde als eine andere diesen Ort verlassen.“
Sie lächelt der Frau zu und übergibt ihr die Zügel. Dann steht sie mit hoch erhobenem Haupt und erwartet die Heerführer und Helden, die langsam auf die Gruppe zukommen.
Auch Klytemnästra ist abgestiegen und steht nun an der Seite ihrer Tochter, den Männern des Heerlagers entgegenschauend. Die begleitenden Frauen stehen dicht hinter der Königin und ihrer Tochter, rund um alle im Halbkreis die Reiter neben ihren Pferden. Von allen Seiten des Lagers strömen Soldaten neugierig herbei, kreisen die Neuangekommenen ein, die den Heerführern gegenüber stehen.
Clio kann zuerst Klytemnästras Widerwillen gegen Achill nicht teilen. Er ist der strahlende Held aller Beschreibungen, seine Arm- und Beinschienen blinken in der Sonne. Sein mächtig gewölbter Brustharnisch und der rosshaarumwallte Helm lassen ihn größer, breitschultriger und schrecklicher erscheinen. Sie sieht, wie er ein paar Schritte auf Iphigenie zu macht und dabei sein anfängliches Lächeln verschwindet, wie seine Gesichtszüge starr werden und aggressiv und wie eine tiefe Falte des Widerwillens zwischen seinen buschigen Augenbrauen erscheint. Clio erschrickt zutiefst bei der Erkenntnis, dass dieser Mann über Leichen geht. In der strahlenden Rüstung steckt ein düsterer, egoistischer Mann, der mitleidlos auf sein Ziel zugeht, koste es, wen immer es wolle.
Achill wirft die Schultern zurück, als ob er einen dunklen Gedanken abschütteln wollte. Aller Lärm im Lager ist plötzlich verstummt, als Klytemnästra König Agamemnon auffordert:
„Sprich, Agamemnon!“
„Wir haben lang auf euch gewartet, doch seid willkommen hier. Zu einem Fest bleibt keine Zeit, unsere Flotte liegt bereit zur Abfahrt.“
Klytemnästra schaut Agamemnon fest in die Augen.
„Du hast recht, Agamemnon, nur zögernd haben Iphigenie und ich uns auf den Weg hierhier gemacht. Es widerstrebt mir alles, was mit dieser Verbindung in Zusammenhang steht. Auch die Eile und der Tag. Nach meinen Berechnungen kann kein Tag so ungünstig sein wie dieser. Des Mondes Neigung und der Sterne Stellung lassen mich das Schlimmste ahnen. Doch daneben sendet Artemis für Iphigenie die besten Zeichen. Die Deutung fällt mir schwer, aber meine Ahnungen sind dunkel.“
„Klytemnästra, hör nicht auf die dunklen Schreckenszeichen! Wir feiern die Hochzeit meiner Tochter mit dem größten Helden der Hellenen. Es ist die Eifersucht der Mutter, die ihr Kind verliert, die aus dir und deinen dunklen Mächten spricht.“
Agamemnon wendet sich seiner Tochter zu, die im gleichen Augenblick, um der Missachtung ihres Vaters zuvorzukommen und weil sie schon lange hätte sprechen müssen, sich an Achill wendet und sagt:
„Ich grüße dich, Achill, du bist ein großer Held, dessen Ruhm durch alle Länder geht. Und manche Frau würde dich gern zu ihrem Gatten wählen. Mir jedoch ist die Wahl aus der Hand genommen. Mein Vater hat für mich gewählt, wie’s neuer Brauch seit einiger Zeit in diesem Lande ist. Ich achte dich, Achill, aber ich hätte nimmer dich zum Gatten mir erwählt. So beuge dich nach alter Sitte denn vor meiner Mutter und Königin und bitte sie, dass sie die Worte spricht, die dich zum Gast in unserer Sippe machen!“
Achill schaut hilflos um sich, als Iphigenie darauf wartet, dass er tut, was sie ihn geheißen hat. Da tritt Agamemnon einen Schritt näher, zögernd nur, als müsste er seine Scheu erst in sich niederkämpfen. Dann sagt er mit harter, ein wenig zu lauter Stimme, Klytemnästra fest im Auge:
„Solches Tun mag bei euren Stämmen Sitte sein, die sich von der Achäer Sitte gänzlich unterscheidet. Achill wird niemals knien. Und nun zur Sache, weshalb ihr hergkommen seid. Zwar hab ich nie dein Priesterinnenamt bezweifelt, doch werde ich selbst in meinem Amt als Priester die Zeremonie leiten. Die Königin hat einen langen Weg hinter sich. Sie sollte sich schonen und für heute dem König die heilige Handlung überlassen, die Kalchas vorgeschlagen hat.!“
Klytemnästra, die Agamemnons Blick mit aller Festigkeit erwidert hatte, schaut nun zu Kalchas hin und aus ihren Augen spricht Zweifel, gar Verachtung. Und so auch aus ihrer Stimme.
„Du, Kalchas, stehst da im Gewand der Priesterin und weißt sehr wohl, dass uns Frauen vor langer Zeit ganz allein dies Amt gebührte, bis ihr in unsere Kleider schlüpftet, um mit dem Kleid auch Amt und Macht zu übernehmen. Sieh dich vor, Priester, was du sagst und prophezeist, dass du nicht unser Land ins Elend stürzt und seine Menschen!“
Um Kalchas zusammengepresste Lippen spielt ein Zug Verachtung, aber in seinen Augen steht auch Angst. Beides entgeht der Königin nicht, die sich von ihm ab- und wieder Agamemnon zuwendet:
„Im Heerlager mag des Königs Stimme gelten, und wenn er bestimmt, er solle selbst des Amtes walten, so soll er’s tun!“
Agamemnons und Kalchas’ Blicke treffen sich und sprechen von Erleichterung, als ob eine Schlacht gewonnen wäre. Auch Achill und Menelaos nicken sich unmerklich zu, bekräftigen das Einverständnis. Dann sagt Agamemnon zu Klytemnästra:
„Ich sehe, dass du ängstlicher geworden bist, Königin, denn du hast schwere Reiter mitgenommen. Gib ihnen den Befehl sich zurückzuziehen! Denn ihr seid jetzt in Sicherheit und in der Obhut meines Heeres.“
„Nicht der wilden Tiere wegen, die in den Wäldern uns hätten gefährlich werden können“, spricht Klytemnästra, „habe ich Ägists Angebot, mir Soldaten mitzugeben, angenommen, König Agamemnon. Vielmehr erwarte ich den Angriff von Menschenseite, obwohl ich es mir nicht erklären kann.“
Agamemnon beißt sich auf die Lippen und scheint zu überlegen, bis er spöttisch lächelnd sagt:
„Zehn mal zehntausend Soldaten füllen die Ebene, Klytemnästra, glaubst du wirklich, dass – wenn ich dir übel wollte – deine kleine Truppe dir helfen könnte? Schick sie weg!“
Ironie und Überlegenheit sprechen aus Agamemnons Worten. Aber Klytemnästra antwortet:
„Sie würden kämpfen und für und mit uns sterben, glaube mir. Und Blut im Heerlager, im Kampf geflossen, wäre doch ein schlechtes Omen für deinen Kriegszug, nicht?“
Agamemnon schweigt betroffen, denn Klytemnästra hat recht: Wenn eines Mannes Blut im Handgemenge fließen würde, welcher von den Kriegern würde gegen ein solch schlechtes Omen noch mit ihm in den Krieg ziehen?
Agamemnon hebt unerwartet die Hand und schreit:
„Ergreift sie!“
Der Überfall ist perfekt: Die abgesessenen Reiter kommen nicht einmal dazu, ihre Waffen zu ergreifen, sie werden gefesselt und auf ihre Pferde gebunden; Klytemnästra und Iphigenie werden von rohen, rauhen Männerhänden gepackt, ebenso die Frauen, die sie begleiten. Alle Gefangenen werden weggeführt, nur Klytemnästra und Iphigenie werden zum Platz vor den Zelten gestoßen.
Klytemnästra blickt finster und murmelt:
„Meine Ahnungen, meine Ahnungen, ich hab’s gewusst, dass der König Schlechtes im Schilde führt, wahrhaft, ich hab’s gewusst.“
Als sie vor den Zelten ankommen, herrscht sie Agamemnon an:
„Was soll das alles, König? Ich verlange Aufklärung! Und das sofort!“
Betretenes Schweigen, bis Agamemnon wieder das Wort ergreift:
„Du siehst, Königin, der Altar ist nicht mit Blumen geschmückt und keine Hochzeit wird gefeiert werden. Kalchas“, und hier hält er eine Sekunde inne, als wolle er sich entschuldigen und alle Schuld auf den Priester schieben, „Kalchas“, setzt er noch einmal an, „hat mir die Opferung Iphigeniens befohlen, sollen die Winde endlich günstig werden für unseren Kriegszug und wir segeln können.“
„Meine Tochter, mein Blut, willst du opfern, dich am Leben, an der Zukunft selbst vergreifen, wahnsinniger Mann? Dein Krieg soll höher stehen als mein Kind? Der Fluch der Mutter …“
Schmutzige Männerhände schließen Klytemnästra den Mund.
„Schnell, bringt mir die Tochter her“, schreit Agamemnon.
Vier Soldaten ergreifen die junge Frau, stoßen sie dem Altar zu, und aus dem jungen, blühenden Antlitz weicht die Farbe. Hunderttausend Männer starren auf Iphigenie, die ihr Haupt zurückwirft und ihrem auf die Stufe des Altars getretenen Vater entgegensieht. Tochter und König stehen sich gegenüber, und Iphigeniens Blick stößt in den Blick ihres Vaters wie ein Adler auf seine Beute. Leise, eindringlich sagt sie:
„Nicht, Vater, tu es nicht!“
Ein unsicheres Flackern steht plötzlich in Agamemnons Augen. Der Dolche in seiner Hand zittert, als er barsch befiehlt:
„Legt sie auf den Altar, rasch!“
Kalchas singt die Opferlieder, Stimmen fallen zögernd ein, die Luft zittert. Die Soldaten heben Iphigenie auf den Altarstein und biegen ihren Kopf über seinen Rand. Als sich Agamemnon über seine Tochter beugt, verfängt sich auf’s neue ihr Blick in dem seinen.
„Nein, Vater, nein!“, beschwört Iphigenie ihren Vater, aber auch Agamemnon singt die Hymne mit, versucht, sich aus dem Blick der Tochter loszureißen, der wild und zornig ist, und Agamemnon wird von Angst ergriffen, singt schneller, um zum Ende zu kommen. Hast ist in allem.
„Bedenke, Vater, das wird Übles nach sich ziehen!“
Voller Angst schreit Agamemnon:
„Knebelt sie! Bevor sie Unheil im Fluche über uns alle bringt!“
Einer der Soldaten reißt ein Stück Stoff von seinem Hemd und stopft den nach Schweiß stinkenden Fetzen in Iphigeniens Mund, den seine Linke mit roher Gewalt sie zu öffnen zwang. Über der Kehle blinkt das Opfermesser in der Sonne. Manch einer der Soldaten hätte in die Knie gehen mögen beim Anblick des jungen, sonnengebräunten Halses. Aber noch ist das feierliche Lied nicht zu Ende gesungen, da fällt der Dolch herab und senkt sich tief in Iphigeniens Kehle, aus der das Blut hochspritzt.
Klytemnästra legt ihre Hand auf Clios Arm, die sich der Königin zuwendet und sieht, dass sie die Augen geschlossen hat und der Schmerz ihr Gesicht entstellt. Die große, starke Königin stützt sich auf Clio. Klytemnästra seufzt tief auf, streckt sich dann und sagt:
„Wir müssen es bis zu Ende sehen, Clio. Nur für dich und die Zukunft gehe ich noch einmal durch all den Schmerz, weil du die Wahrheit kennen musst.“
Kalchas kniet auf der Altarstufe und fängt in dem goldenen Kelch das kostbare Blut des Opfers auf. Da befreit sich Klytemnästra aus dem eisernen Griff des Soldaten und geht mit wankenden Schritten zum Altar und auf Agamemnon zu. Niemand rührt sich, noch sind alle wie zu Stein erstarrt, selbst Kalchas kniet wie eine Statue unbeweglich neben dem toten Opfer.
Endlich beginnt Klytemnästra zu sprechen, mit verhaltener, bebender Stimme:
„Du hast eine Mutter gemordet und meine Tochter. Es mag Leben geboren werden ohne Vater, ohne Mutter – nie. Du hast die Mörderhand erhoben gegen die Mutter, die Tochter, das Leben selbst. Kriegsruhm, Heldentum und Beute stehen dir höher als das Leben. Du handelst nach anderem, mir fremdem Gesetz, ich werde nach meinem handeln. Vergiss nie, dass ich aus Sparta komme und als Priesterin mein Gesetz erfüllen werde.“
Sie wendet sich von Agamemnon ab, geht ein paar Schritte auf den Altar zu und stürzt zu Boden. Keiner der Männer kann sich aus der Erstarrung lösen, die sich wie ein Bann über dem ganzen Lager ausgebreitet hat. Aller Augen sind auf die Königin gerichtet, die sich auf ihre Knie erhebt, ihre Arme gegen den Himmel streckt und einen solch erschütternden Schrei aus ihrer Brust entlässt, dass alle ein Schrecken erfasst und ihre Glieder bis ins Innere zu Eis erstarren. Niemand hat einen solchen Schrei jemals gehört, so hoch, so laut und so lang: geballter, sich entladender Schmerz.
Und die Königin rauft sich das Haar und zerreisst ihre Kleider. Und immer wieder erzittert die Luft von dem Schrei ihrer gepeinigten Seele, unter dem ihr Körper bebt. Ihr Gesicht ist voll Staub, ihre Hände schwarz von Erde. Sie schlägt die Fäuste gegen ihre Brust, fällt dann vornüber und verbirgt ihr Gesicht von neuem an der Erde, trommelt mit den Fäusten gegen den Boden, als wollte sie die Erde öffnen, um darin zu versinken und in der Unterwelt mit ihrer geliebten Tochter vereint zu sein.
Immer mehr Krieger fallen ergriffen auf ihre Gesichter und in plötzlicher Einsicht und Erinnerung alter Mächte beginnen sie, ihre Kleider zu zerreißen und mit ihrer Königin zu klagen und zu trauern.
Aber da fegt plötzlich ein Windstoß über die Ebene und bläht die Bahnen der Zelte. Das erlöst endlich Agamemnon aus dem Bann. Er reckt sich und schreit Befehle unter die Menge seiner Krieger. Auch in Achill kommt Leben. Er rennt von einem zum anderen der klagenden Krieger, schüttelt sie und schreit:
„Auf, auf was soll das Gejammer!? Das Opfer war gut! Der Wind ist günstig, auf die Schiffe, fort, hinaus auf See! Wir schleifen das stolze Ilion! Wir holen Helena zurück, die Königin von Sparta! Und alles Gold der Tojaner!“
Das bringt die Männer wieder auf die Beine. Sie laufen zu ihren Zelten; die Nasen in die Luft gereckt, riechen sie den Wind und die See, die Abenteuer und die Beute. Wenig später sind die Zelte abgebrochen, der Altar und alles Kriegsmaterial auf die Schiffe gebracht. Das Heer lässt zertrampeltes Gras, aufgebrochene Erde und erloschene Feuer zurück. Der Platz ist verwüstet und leer.
Nur Klytemnästra und ihre Frauen singen verloren in der Ebene Klagelieder um die Tote. Endlich erhebt sich Klytemnästra mühsam auf ihre Beine, schaut auf die Frauen, die mit ihr ausgeharrt haben und gibt ihnen ein Zeichen. Sie erheben sich und begleiten ihre Königin, die langsam zum Meeresufer hinunterschreitet. Dort angekommen, starrt Klytemnästra hinaus aufs Meer, den im Dämmerlicht und Dunst des Abends verschwindenden Schiffen nach. Sie erhebt die Arme und ruft gegen die tobenden Wellen:
„Nichts fruchtet der Krieg, Agamemnon! Er wird unsere Söhne fressen, er wird unsere Töchter schänden, und er wird dich töten, des sei gewiss!“
4
Clio fühlt in sich die Einsamkeit dieser Frau aufsteigen. Sie zittert und spürt, dass sie die Zähne aufeinanderpresst und ihre Tränen versiegen. Hass hat den heißen Schmerz verdrängt. Sie wischt sich die Feuchtigkeit aus dem Gesicht und denkt: ‘Wie muss sie ihn hassen!’ Sie wendet sich Klytemnästra zu, die neben ihr steht, aufrecht, bewegungslos, genau wie die Klytemnästra am Ufer. Sie schaut noch einmal hinaus, aber vor ihr liegt jetzt die weite Ebene der Argolis. Sie fühlt die Kälte des Steins, gegen den sie sich mit geschlossenen Augen lehnt. Ihre Hände sind kalt, sie friert. Sie schaut sich um und findet sich allein.
„Komm, Clio!“, hört sie Klytemnästra, die in den Saal zurückgegangen ist, „komm hierhier zum Feuer, wärme dich!“
Clio setzt sich auf die Bank am Feuer, aber diesmal Klytemnästra gegenüber. Diese versinkt in Schweigen, starrt ins Feuer, aus dem knisternd Funken hochspringen. Lange wartet Clio und wagt nicht, Klytemnästra in ihren Gedanken zu unterbrechen. Ihre Züge verfinstern sich zusehends, ein innerer Kampf zeichnet ihr Gesicht.
Vor Clios Seele stehen noch immer die Bilder, die sie gesehen hat, und ihre Gefühle reißen sie hin und her zwischen Schmerz, Mitleid, Bewunderung, Hass. Dann ist ihr, als hätte Klytemnästra sie vergessen, aber sie weiß, sie wird zu sprechen beginnen, ihr sagen, was nicht in ihren Geschichtsbüchern geschrieben steht. Clio wird ruhiger und wartet.
Als Klytemnästra zu sprechen anhebt, ist Clio nicht sicher, ob sie wirklich zu ihr spricht, denn sie starrt ins Feuer und scheint weit weg zu sein. Unverwandt hält sie ihren Blick auf die Flammen gerichtet, als wären sie ein Buch, aus dem sie ein altes, vergessenes Märchen vorliest. Mit leiser, tiefer Stimme beginnt Klytemnästra:
„Es war einmal eine Welt, in der Frieden herrschte. Alle Menschen waren gleich, von einer Mutter geboren, die alle ihre Kinder gleich liebte. Sie lebten friedlich und kannten keine Waffen. Sie waren gut zu ihrer Mutter, der Erde, die ihnen gab, soviel sie brauchten. Sie ehrten sie und brachten ihr Opfer, damit die Früchte wachsen, jedes Jahr aufs neue und keiner hungern musste. Die Frauen bauten Häuser, legten Dörfer an und umgaben sie mit niedrigen Mauern, gerade hoch genug, dass kein wildes Tier sie überspringen konnte. Sie machten sich Abbilder ihrer Göttin, der Mutter Erde, die sie anbeteten. Jeder arbeitete nach seinen Kräften, viel oder wenig, die Mutter gab jedem, was er brauchte: Ein Haus, ein Kleid und Brot. Sie lachten viel, sie sangen und tanzten für die Göttin und für sich selbst. Ihr Herz war friedfertig, sie kannten keinen Hass noch Neid. Was da war, besaßen alle; das heißt niemand: die Werkzeuge, die Spindeln, die Krüge und alle anderen Dinge des täglichen Lebens. Sie arbeiteten gemeinsam und was geschah, geschah im Einvernehmen und zum Wohle aller. Sie waren Kinder einer Großen Mutter, sie aßen alle aus derselben Schüssel und tranken aus dem gleichen Krug.
So lebten die Mütter und die Kinder zusammen, arbeiteten, aßen und tranken und freuten sich des Lebens. Und wenn die Männer von ihren fernen Streifzügen zurückkamen und ihnen anboten, die Beute mit ihnen zu teilen, da nahmen sie davon, und es war ein Fest in den Häusern. Ein Mann, der eine Frau mochte, schnitt das beste Stück aus dem Tier, bot es ihr an und hoffte, dass sie ihn erwähle. Und wenn sie es tat, war der Mann glücklich.
Nach dem Fest tanzten sie um das Feuer bis spät in die Nacht, und die Frauen wählten sich einen der Männer und luden ihn ein in ihr Haus, mit ihr zu schlafen, in ihrer Wärme und auf weichen Fellen. Wenn die Männer dann wieder davonzogen und die Mütter ihnen die herangewachsenen Jungen mitgaben, da fiel mancher Mutter und manchem Sohn der Abschied schwer.“
Klytemnästra hält inne und seufzt, schaut aber nicht auf. Alles, was sie gesagt hat, kommt Clio wie ein Mächen vor, eine Beschreibung des Paradieses, eines Goldenen Zeitalters. Wie sie anfängt, über diese Begriffe nachzudenken, fühlt sie Wehmut in sich aufsteigen. ‘Hat es das gegeben, ein Paradies? Sind wir vielleicht wirklich Vertriebene?’ Ahnung steigt in ihr auf und eine Sehnsucht und etwas wie Erinnerung, fast eine Gewissheit. ‘Wenn ich doch glauben könnte, dass es eine andere Geschichte gibt.’
„Klytemnästra. Bitte erzähl weiter. Aber du musst verstehen, dass mir das alles wie ein Märchen vorkommt.“
„Clio“, sagt Klytemnästra ein wenig scharf, so dass sie zusammenschrickt, „Clio, einmal wirst du verstehen müssen, dass der Beweis in dir selbst liegt, dass du selber der Beweis bist. Vielleicht wird es lange dauern, bis du deine Wurzeln wiederfindest, aber die Zeit ist unendlich. Lass mich fortfahren in meinem Märchen, wie du es nennst.
Das Goldene Zeitalter war vorbei, als die Barbaren in dieses Land einfielen. Nur die Göttin weiß, woher sie gekommen sind und warum sie gerade dieses Land heimgesucht haben. Sie hatten keine Häuser, nur Zelte, sie hatten keine Kleider, nur Felle, sie führten unzählige Schafe mit sich, aber keine Frauen. Sie brachen herein wie ein heulender Nordwind, kalt, scharf. Sie brandschatzten die Dörfer, die alle wehrlos lagen, und sie mordeten Menschen, die nicht wussten, was Feindschaft und Krieg und Hinterlist sind. Sie erschlugen die Männer, die nie einen Mord gesehen hatten. Andere nahmen sie mit und machten sie zu Sklaven, ein Wort, das die Sprache nicht kannte. Sie schleppten die Frauen weg und taten mit ihnen, was sie wollten und achteten sie nicht als die Töchter der Großen, unserer aller Mutter.
Sie trugen den Namen des Vaters und nannten sich Söhne des gleichen Vaters. Aber sie nannten sich auch die Plünderer der Städte, und sie trugen aus ihnen weg, was sie fanden. Sie wussten nicht, was Arbeit ist und lebten von ihrem Vieh und davon, was das Schwert ihnen einbrachte.
Sie holten die Mädchen aus den Häusern und zwangen sie, in ihren Zelten zu leben und mit ihnen zu wandern wie ihr Vieh, wo doch der Mann ein Gast im Hause seiner Frau sein soll, wo nur der König wird, den die Königstochter erwählt. So ist noch Odysseus König von Ithaka geworden, denn Penelope war die Krone. Meine Schwester Helena hat Menelaos zum König gemacht über Sparta. Aber ich bin gekommen in Agamemnons Haus, was bitter war.
Aber die, die kamen, verachteten die Frauen, auch die Männer deshalb, weil sie friedfertig waren und nur Tiere zu töten verstanden mit ihren Pfeilen; weil sie sich von den Früchten der Erde ernährten. Auch haben die, die kamen, Götter mitgebracht, Vatergötter, denen sie huldigten, und sie leugneten die Große Göttin, die die Unterwelt, die Erde und den Himmel bewohnt. Ihre Götter streiten sich um Frauen und Besitz, sie hetzen die Menschen gegeneinander auf und verherrlichen den Krieg. Sie entreißsen der Frau das heilige Amt der Priesterin und machen sich selbst zu Priestern. Wie lächerlich ein Mann, der Priester sein will, mir ist! Sie haben sich Götter erfunden, die gebären können! Es ist ekelhaft, niederträchtig und widernatürlich.
Sie neiden uns unsere Fruchtbarkeit. Wie können die Männer die Natur verstehen, wo sie nie geboren haben und nur ausgehen zu zerstören im Widersinn ihres Denkens?! Zerstören, was wir unzählige Monde bewahrt und gepflegt haben, wovon wir uns ernährt haben und unsereTöchter und Söhne!
Die, die hierher kamen, haben nichts selbst geschaffen, sich alles zusammengestohlen. Sie haben sich Burgen bauen lassen und Häuser, ihre Schiffe sind nicht die ihren und selbst ihre Kleidung haben sie in diesem Lande nähen gelernt!
Sie ausgezogen, um ihre Lehrmeisterinnen zu vernichten und deren Inselreich Keftiu, aus Rache, weil sie nichts hatten und alles nehmen mussten. Sie haben einen Gott des Lichts erfunden, sie haben den Tag und seine Sonne zum Beherrscher der Menschen gemacht und ihn über die alles Leben spendende Nacht erhoben. Sie sind auf Vernichtung aus und werden auch mich zerstören und mein Blut, wie Agamemnon es rechtlos getan, als er meine Tochter ermordet hat. So werde auch ich fallen von Sohnes Hand und mit mir wird endgültig zugrunde gehen das natürliche Reich der Mütter und der einen Großen Göttin des Friedens und der Eintracht. Clio“, Klytemnästra und hebt ihren Kopf, um ihr in die Augen zu schauen, „seit die Männer ihr Haupt zu den Wolken erheben, verkehrt sich die Welt, und sie werden nicht ruhen, bis sie die uns anvertraute Erde unterworfen und zerstört haben.“
Clio sah eine Schreckensvision aufsteigen, als sie fortfuhr:
„Ich sehe unsere Mutter darniederliegen, sie stoßen giftige Pfeile in ihren geliebten Leib, sie ziehen in Heerscharen von kranker Neugier getrieben in den Kampf gegen sie überall, wohin sie ihr Fuß trägt. Mit Macht reißen sie ihren Leib auf, kriechen in sie hinein, damit sie um Erfahrungen reicher weiterziehen und die offene Wunde zurücklassen.
Und die Flüsse füllen sich mit ihrem Morast und die Fische erreichen sterbend auf den Fluten liegend und tot das Meer. Den Vögeln fallen die Schwingen ab, sie stürzen tot auf die Erde herab. Die Blumen verlieren ihre Farben, ihre Köpfe sinken zur Erde und verwelken auf ewig; von den Bäumen sehe ich die Blätter fallen. Und Feuer bricht aus der Erde hervor und ein Sturm trägt die Feuerwolke in alle Himmelsrichtungen; die Menschen, Clio, die Menschen, sie sterben qualvoll. Die Mutter liegt tot, sie haben sie ermordet, sie haben dich ermordet, Mutter, Gaia, Erde!“
Klytemnästra fällt erschöpft in langes Schweigen. Clio starrt sie an, die weit entfernt, ganz abwesend ist und sehr alt aussieht.
Clio denkt an ihre eigene Welt, und ihre Verzweiflung wird größer durch ein Gefühl der Ohnmacht.
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung schließen Clio die Augen, und sie schlägt die Hände vor ihr Gesicht. Sie hört Klytemnästra fragen:
„Ist dir nicht gut, Clio?“
„Was du gesehen hast, Klytemnästra, hat in mir einen Schwindel der Hoffnungslosigkeit verursacht.“
Klytemnästra schaut lange auf Clio, dann ins Feuer.
„Clio, Gaia wird auferstehen, sie ist unsterblich! Mache sie lebendig, Clio, in dir, in deiner Welt, und sie wird durch’s All tanzen immer auf’s Neue!“
Beide Frauen versinken in Schweigen, bis sich Klytemnästra langsam erhebt, ein Scheit ergreift und auf die Glut fallen lässt, so dass Funken stieben nach allen Seiten und schnell erlöschende Lichter in den dunklen Raum werfen.
5
„Es ist Zeit, Clio. Sie kommen zurück. Ich muss mich vorbereiten. Tritt zu mir ans Fenster und sieh, wie erfüllt die Ebene von Kriegern ist!“
Clio folgt Klytemnästra zum Fenster und sieht einen langen, breiten Heereszug sich wie eine dicke Schlange durch das Tal herauf auf die Burg zu bewegen.
„Er hat so viele Helden besiegt in diesem langen Krieg, er hat eine großartige und blühende Stadt zerstört und ausgeraubt und niedergebrannt, die Menschen darin ermordet oder verschleppt und zu Sklaven gemacht. Sein Handwerk ist Mord gewesen zehn Jahre lang und der Streit um Frauen!
Ich habe all die Jahre dieses männerarme Land regiert und Ägist gewählt, damit er meine Herrschaft und mein Bett mit mir teile. Agamemnon ist durch Blut und Tränen gewatet bis an die Knöchel; er hat sich Frauen genommen, wo und wann er wollte, er hat sie auf sein Lager gezerrt, wenn ihn die Lust dazu trieb und die Langeweile; und er hat sie aus seinem Zelt gejagt, wenn er ihrer überdrüssig war. In der Kriegsbeute fand sich schnell Ersatz.
Wie du die Frauen missachtest, Agamemnon! Du hast deine Hand erhoben in Aulis gegen meine Tochter, an der du kein Recht hattest, und du hast seither wieder und wieder Mütter gemordet und Frauen und Mädchen geschändet. In ihnen allen hast du die Erde, unsere Mutter, beleidigt, fortwährend, selbst in jedem Mann, den du erschlagen, denn auch dieser war von einer Mutter geboren. Ihr schwarzes Antlitz wird mir die Kraft geben, das Urteil, das gerechte, an dir, Agamemnon, zu vollstrecken. Ich habe es gelobt der Göttin in Aulis, und so wahr ich Priesterin bin, ich werde meines blutigen Amtes walten.“
Clio sieht, wie sich Klytemnästras Gesicht wieder verändert. Sie steht hoch aufgerichtet vor der Feuerstelle. Aus den Scheiten schlagen hohe Flammen, deren Widerschein Klytemnästras Gesicht in das zürnende Antlitz einer rächenden Göttin verwandelt. Lange
hat Klytemnästra so gestanden, als sie sich niederbeugt, ihre Finger in die Asche taucht und ihr Gesicht damit bestreicht.
„Die Nacht hat dich geboren, die Nacht wird dich verschlucken. Ich bin die Nacht, Agamemnon!“
In Clio fährt ein Schreck, als sie Klytemnästra so sprechen hört und ihr Gesicht mit schwarz-grauer Asche so entstellt sieht.
„Clio“, erhebt Klytemnästra ihre Stimme wieder, ohne sie anzusehen, „gib mir das Netz und die doppelt geschliffene Axt aus der Truhe!“
Clio geht zu der einen der beiden in Feuerschein getauchten Truhen, die zu brennen scheinen. Sie schlägt den schweren Eichendeckel hoch und sieht keinen weiteren Gegenstand darin als die von Klytemnästra verlangten Dinge. Clio greift nach dem Netz, das sorgfältig zusammengefaltet neben der Axt liegt. Sie holt auch die Axt aus der Truhe und geht zurück zu Klytemnästra, die noch immer über das Feuer hinweg zum Eingang starrt. Sie reicht Klytemnästra die Axt. Diese hält sie über das Feuer und spricht:
„Heiliges Feuer, uns von Gaia aus der Erde geschlagenes und nie erlöschendes Feuer, das ich vom Herde meiner Mutter gebracht und das ich gehütet habe viele Jahre, heiliges Feuer, dich rufe ich an in mir und außer mir. Heute dienst du der dunklen Göttin, die brennt in meinem Hass. Dich, Nemesis, Rächerin gebrochenen Rechts, rufe ich an. Gib mir Stärke und Heiligkeit, dass ich tue, was mein Amt und dein Gesetz von mir verlangen.
Hell leuchte mir deine Fackel, Demeter, Göttin der Erde, segne den doppelten Mond in meiner doppelt geschliffenen Axt heut zum Verderben, zum Verderben dessen, der dich verderben will. Sein Blut soll fließen, damit die Erde versöhnt wird.“
Clio sieht, wie die Axt zu glühen beginnt und Klytemnästra ganz in hochschlagende Flammen gehüllt erscheint. Atemlos wohnt sie dieser feierlich-grausigen Szene bei. Ihre Seele ist ganz erfasst von einem Feuer, in dem Tod und Vergeltung zu neuem Leben verschmelzen.
„Gib mir das Netz, Clio!“, sagt Klytemnästra und streckt ihr die linke Hand hin, über die Clio das feingewirkte Netz aus roten und schwarzen Maschen legt. Und Klytemnästra fährt fort:
„Lange habe ich an dieses Netzes feinen Maschen gewirkt, in dem ich den Mörder meiner Tochter fangen werde. Es wird seine letzte Hülle sein, in der ich ihn binden und bergen werde zugleich, denn die, die ihm seine Mutter gegeben hat, hat er verwirkt. Agamemnon, du wirst in dem Netz umkommen, das du zu zerreißen gewagt hast. Darin will ich dich zurückgeben an die Erde, um sie im Opfer zu versöhnen mit dem Verbrechen.“
Es schien Clio, als sei Klytemnästra durch das Feuer hindurch auf den Eingang zugegangen. Bevor sie den Saal verlässt, sagt Klytemnästra, ohne sich umzuwenden:
„Warte hier, Clio, bis ich mein heiliges Amt vollzogen habe!“
Langsam schreitet Klytemnästra aus dem Saal. Kurz darauf dringen triumphierende Fanfarenstöße gedämpft durch Tür und Vorhang vom Vorhof zu Clio herein. Sie kündigen Agamemnons Ankunft auf der Burg an. Bald vernimmt Clio Waffenklingen, Wagengeratter und das helle Wiehern von Pferden, dazwischen laute, lachende Stimmen, Singen und Frohlocken. Der eben noch tote Palast ist von Leben erfüllt.
Lange steht Clio gebannt und horcht hinaus auf die Rufe und den Lärm. Schließlich geht sie zurück und setzt sich wieder ans Feuer. Sie weiß, was in diesen Augenblicken geschieht, aber sie weiß nicht, wie lange sie so verharrt hat, als plötzlich aller Lärm erstirbt und wieder Totenstille einkehrt.
Der Vorhang öffnet sich, und Klytemnästra tritt ein. Blut tropft von ihrer Doppelaxt, und ihr Kleid und ihre Hände sind rot davon. Sie kommt auf Clio zu, hält vor dem Feuer inne und sagt:
„Meine Tochter, höre mich, ich habe deinen Tod gerächt; Erde, höre mich, ich habe Agamemnons Verbrechen gesühnt. Und seine Hände und seine Füße ruhen in seinen Achselhöhlen, dass der Mörder den Weg zurück nicht gehen kann und kein Werkzeug seine Hand ergreife, ihn zum Mörder der Mutter zu machen. Aber du, Iphigenie, liebster Spross meines Schoßes, wirst Agamemnon jetzt entgegengehen, wenn er den Fluß des Leidens überquert, denn Verzeihen ist dein Teil, nachdem ich das Gesetz der Erde erfüllt und den Fluch geendet habe dieses Hauses, das schon zuviel Blut hat fließen sehen!“
Clio erkennt Klytemnästras furchtbaren Irrtum, erschrickt bei dem Gedanken, dass Klytemnästra ermordet werden wird. Mit einem Mal zerreißen Klageschreie die Luft und holen Clio aus ihren Gedanken in die Wirklichkeit der Burg von Mykene zurück.
„Leg die Axt in die Truhe zurück!“, sagt Klytemnästra. Ihr ruhiges, klares Gesicht ist jetzt überstrahlt von einem erlösten Lächeln.
„Es ist getan! Meiner Tochter und der Erde sind Recht widerfahren, die Ordnung ist wieder hergestellt.“
Clio erkennt den zweiten, noch furchtbareren Irrtum Klytemnästras: Ihre Tat ist keine Erneuerung, sondern der Schlussstein der alten Ordnung, das Recht der Mutter ist zu Ende gegangen, ihr Reich zerstört. ‘Wir haben alles verloren, unsere Welt ist untergegangen’, denkt Clio, und geht auf Klytemnästra zu, nimmt die blutige Axt ohne Schrecken, bringt sie wie die Reliquie einer toten Religion zur Truhe zurück, legt sie hinein und schließt den Deckel.
„Hole mir jetzt den Krug mit Wasser vom Altar, damit ich mich reinige, Clio!“
Clio geht an Klytemnästra vorbei durch den Vorraum hinaus und bringt, wonach sie verlangt hat. Als sie zurückkommt, sieht sie die Königin vor dem Thron stehen.
„Komm, Clio, stell die Schüssel vor mich auf den Boden und leere mir das heilige Wasser über meine blutigen Hände!“
Clio hält den Krug nahe über Klytemnästras Hände, von denen Blut und Wasser in die Schüssel rinnen. Dann wäscht Klytemnästra ihr Gesicht, und nachdem sie sich so gereinigt hat, setzt sie sich auf ihren Thronsessel und sagt leise:
„Agamemnon hat Unerhörtes getan, er hat den Kampf des Hellenenvolkes höher geschätzt als mein Blut. Ich weiß keine Antwort als diese: das uralte Gesetz zu erfüllen. Wenn dieses Gesetz aber nicht mehr gilt, habe ich kein Recht auf Reinigung von diesem Blut. Dann, wehe mir und meinen Kindern!“
Clio trägt Krug und Schüssel hinaus in den Hof, der leer liegt und stumm. Nur ein paar Fackeln an den Wänden erleuchten ihn geisterhaft. Seine Heiterkeit ist erloschen, gespenstisch drohend umschließen ihn die Mauern, in denen sich Risse auftun, aus denen langsam der Mörtel rieselt und die Steine fallen. Clio schaut hilfesuchend hinauf in den dunkler werdenden, mondlosen Nachthimmel. Da hört sie eine Stimme sagen:
„Himmelskönigin, Königin der Nacht, du hast deinen Sternenmantel ausgebreitet. Alles war anders, und wenn der Mond wieder aufgeht, wird wiederum alles anders sein. Ja, Clio, wenn die Himmelskönigin, die gerecht ist und Frieden bringt, wieder ihren Thron besteigt und die Welt nicht eingestürzt und zerstört ist, dann wird alles wieder anders sein!“
Clio sieht am Eingang des Hofes eine in schwarze Gewänder gehüllte Gestalt stehen, die mit heller Frauenstimme aus dem Dunkel zu ihr gesprochen hat.
„Ich bin Kassandra“, hört Clio sie sagen, „die Seherin, der keiner glaubt. Hör zu Clio, als Klytemnästra Agamemnon erschlug, hat sie auch mich erschlagen. Nicht nur hab ich ihr Recht in Agamemnons Bett verletzt, nein, sie hat mich im Zorn erschlagen, denn ich habe ihr vorhergesagt, dass sie umkommen wird durch Orest, der seinen Vater rächen und eine neue Zeit heraufführen wird. Klytemnästra konnte den Fluch nicht beenden, der auf diesem Hause liegt, wie sie wohl gedacht hat, und auch ihr Mutterrecht zählt schon nicht mehr. Aber Klytemnästra hat mir geglaubt und so vom Fluche mich erlöst, den Apoll, der junge Gott, mir angetan. Aber es war Klytemnästras letzter Sieg. Noch ein Mal hat die untergehende Nacht den heraufziehenden Tag besiegt, zum letzten Mal.
Ich sage dir Clio, erst wenn Tag und Nacht gleich viel wiegen, wird kein Blut mehr der Menschen Hände bedecken. Der Gott des Tages wird der Göttin der Nacht die Hand reichen. Glaube mir, denn Klytemnästra hat den Fluch ja von mir genommen!“
Clio horcht in die Nacht, aber die Stimme aus dem Dunkel ist verstummt. Sie überquert den Hof, geht auf den Eingang zu, wo sie Kassandra hat stehen sehen. Aber da liegt nur ein großer schwarzer Stein, der aus der Mauer vor den Eingang gerollt ist. Clio steht sinnend eine Weile, weiß nicht, ob sie phantasiert hat und ist doch sicher, dass sie Kassandras Stimme gehört hat, die die Ohnmacht, die Angst und die Verzweiflung, die sie im Thronsaal ergriffen hatten, aus ihrer Seele verscheuchte. Nachdenklich dreht sie sich um und geht in den Thronsaal zurück, wo sie die Königin noch immer auf ihrem Sessel sitzend findet. Klytemnästra sagt zu der eintretenden Clio:
„Komm zu mir, mein Kind, setz dich hierhier.“
Clio geht hin und setzt sich auf die steinerne Stufe, auf der der Sessel steht und lehnt ihren Kopf an das Knie der Königin. Die beiden Frauen sind sich vertraut, als kennten sie sich seit Ewigkeiten. ‘Bald musst du sterben’ denkt Clio, `und der Fluch des Hauses´ wird noch einmal wirken.
„Ja, Clio, ich habe mich geirrt damals, mein Gesetz gilt nicht mehr, und der Vater wird kommen im Sohn und tun, was Apollon, der junge Gott, ihm gebietet. Er wird kommen gegen seinen Willen, denn er ist mein Sohn, von meinem Blut und kennt mein Gesetz. Es ist ein uraltes Gesetz, und Orest wird der Anfang eines neuen sein. Mein Herz ist zerrissen, Clio, es blutet vor Schmerz, weil es noch immer an die Vergangenheit glaubt und doch die Zukunft kennt, die schreckliche, die Kassandra mir geweissagt hat und der ich geglaubt und sie in Verzweiflung darüber erschlagen habe. Wann, Clio, wird der Fluch zu töten, dem ich selbst die Hand gereicht habe, wieder vom Menschen genommen. Wann werden Recht und Frieden herrschen?“
Deutlich spürt Clio, dass Klytemnästras Stärke ganz aus der Vergangenheit kommt und keine Zukunft hat. Sie möchte der Königin, Mut zusprechen – und auch sich selbst. Sie ist ihr verwandt, sie ist ihre Mutter, ja sie selbst.
„Ich werde durch Orests Hand fallen, es schreckt mich nicht. Das Furchtbare ist, dass ich selbst mich zum Werkzeug unseres Untergangs gemacht habe. Ich habe zur Axt gegriffen, und ich werde durch die Axt umkommen: Ich selbst habe dem neuen Gesetz die Hand gereicht. Nicht mehr die Liebe wird regieren, sondern der Hass und das Schwert!“
Clio denkt an all die furchtbaren Kriege und Metzeleien und Massenmorde, mit denen ihre Welt überzogen ist wie mit einem Krebsgeschwür und die nie mehr zu enden scheinen, weil die Menschen vergessen haben, dass es eine andere Welt geben hat.
„Ich habe Kassandra erlöst von ihrem Fluch“, fährt Klytemnästra fort, „erlöse du mich von dem meinen, überwinde die Axt in dir, überwinde das Schwert im Manne. Ich vermag nichts mehr, Clio. Ich habe mein Werk vollendet, wo deines erst beginnt. Und doch musst du noch mein Ende sehen und was der junge Gott daraus gemacht hat, weil du nur so die ganze Wahrheit erfahren kannst.
„Geh, Clio“, und Klytemnästra streicht Clio bei diesen Worten sanft über ihr Haar, „leg Scheite nach, die Kälte kriecht aus diesen Mauern in der Nacht. Geh, Clio, sei stark, mach dir ein loderndes Feuer, und du wirst sehen. Die Flammen werden dir die Wahnsinnstat eines Sohnes zeigen, der nichts weiter ist als seines Gottes Werkzeug, der ihn missbraucht im Kampf in seinem Namen und für sein neues Gesetz.“
6
„Apoll hat meinen Sohn durch den Seher Loxias lang mit viel Unheil bedrohen müssen, bis er ihn dahin gebracht, seine eigene Mutter zu ermorden. Doch Pythias Spruch gilt auch für mich. Ich habe mit Waffen gewagt, für Mutterrecht zu kämpfen, weil die Zeit so weit schon fortgeschritten, dass keine Wahl mir mehr geblieben war. So bin auch ich mit Schuld beladen, wenn auch anders, als die meisten Menschen denken.
Ohne Wahl blieb auch Orest, mein armer Sohn, den Apollo treibt und auch die Pythia mir als Drachen schickt, den ich an meiner Brust genährt, damit ich durch ihn fallen soll. Er tut, was Gott und Göttin ihn geheißen, ohne Freiheit, ohne Wahl. Sie wird die Rachegeister schicken für den Muttermörder, Apollo ihn erlösen. Verstrickt sind beide wir in alt und neues Recht und eines nur kann siegen, eins muss untergehen!“
Klytemnästra macht eine Pause, streicht wieder über Clios Haar, wie einem Kind, das man aufmunternd in eine Prüfung schickt und sagt dann noch einmal:
„Geh, Clio, damit die Flammen dir die Bilder zeigen können!“
Zögernd steht Clio auf, schaut der Königin noch einmal fest in die Augen, als könne sie daraus Kraft schöpfen und geht dann hinüber zum weit heruntergebrannten Feuer. Vorsichtig legt sie die schweren Scheite auf die Glut, dann tritt sie zwei Schritte zurück, lehnt sich gegen die schwarze Säule und beobachtet die langsam wieder hochzüngelnden Flammen. Scheu hält sie so die Mitte zwischen Klytemnästra und dem Feuer, aus dem die schrecklichen Bilder steigen sollen. Sie möchte Klytemnästra nahe sein, wie einem Schutz, aber auch mit offenen Augen dem ins Gesicht sehen, was geschen soll.
Als die Flammen immer höher züngeln, erkennt Clio darin die Gestalt eines jungen Mannes, die dasteht in staubigem Mantel und schmutzverkrusteten Sandalen. Seine Gesichtszüge sind noch die eines Jünglings: weich und sympatisch. Aber in seinen Augen leuchtet eine seltsame Glut, die im Widerstreit zu dem jungenhaften Antlitz steht. Etwas Fiebriges ist in seinem Blick, etwas Rastloses, Krankes, und dann erkennt Clio einen Schatten, der sein ganzes Gesicht verfinstert.
In diesem Augenblick taucht auch Klytemnästra in den Flammen auf und fragt den jungen Mann nach seinem Begehren.
„Ich komme einen langen Weg“, antwortet dieser, „und möchte Euch eine Nachricht bringen, auch für mich um Gastrecht bitten!“
„Seid willkommen in diesem Haus, was es birgt ist euer. Kommt herein und gebt mir Kunde von dem was Ihr mir sagen wollt!“
Orest erzählt ein wenig hastig und mit unsicherer Stimme:
„Als ich auf meinem Wege den Strophius traf, sagte er zu mir: Wenn dein Weg ohnehin nach Argos führt, so sag in Mykenä doch Bescheid, dass Orest gestorben sei, und dass ich’s nicht vergessen soll.“
In den jetzt rot, weiß und violett hochschlagenden Flammen, verzerrt sich Klytemnästras Gesicht im Schmerz.
„Ich habe ihn als Knaben weggebracht, um ihn dem Fluche zu entziehen, der dieses Haus verfolgt, er war – nachdem die Tochter mir genommen war – meine Hoffnung, das Glück hier einmal zu erneuern. Sie ist dahin, und niemals sehe ich ihn wieder.“
Klytemnästra weint um ihren Sohn und sagt mit tränenerstickter Stimme:





























