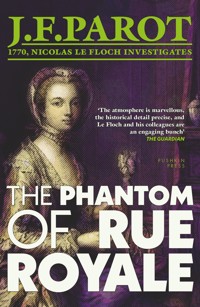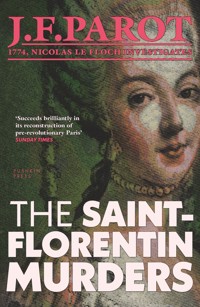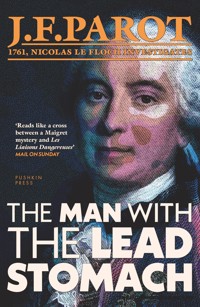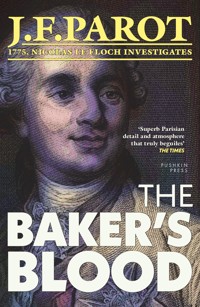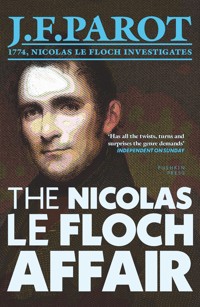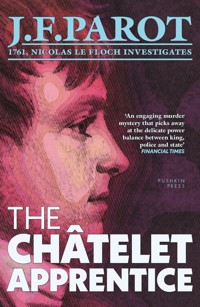13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissaire Le Floch-Serie
- Sprache: Deutsch
Oktober 1774: Im Stadthaus des Ministers Saint-Florentin wird der Hausverwalter in der Küche verletzt aufgefunden. Er liegt ohnmächtig in einer Blutlache. Dicht bei ihm, ein Zimmermädchen, tot. Die Verstorbene trug für eine Frau ihres Standes auffällig kostspielige Ohrringe und Schuhe. Nicolas Le Floch und sein Helfer, der Inspektor Pierre Bourdeau, merken bald, dass die Dienerschaft dieses Stadthauses die reinste Schlangengrube ist. Jeder traut jedem alles Schlechte zu.
Die Autopsie ergibt, dass das Zimmermädchen mit einer Art Pflock ermordet worden ist. Passt diese tödliche Verwundung nicht auffällig gut zu dem Hausbesitzer selbst, zu Monsieur Saint-Florentin? Dieser hat nach einer Kriegsverletzung vom König eine silberne Hand geschenkt bekommen, die auf seinem Armstumpf sitzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Commissaire Le Floch durchlebt eine schwere Zeit: König Ludwig der XV., der ihm wohlgesinnt war, ist im Mai 1774 gestorben, und ein halbes Jahr später hat sein Nachfolger noch keine rechte Autorität. Le Flochs langjähriger Mentor und Chef, Polizeipräfekt Gabriel de Sartine, wurde in ein anderes Amt weggelobt. Wie dessen Nachfolger, Polizeipräfekt Le Noir, ihn einschätzt, weiß Nicolas noch nicht so recht. Der erste Auftrag, den er von ihm erhält, ist gänzlich ungewohnter Natur: In den südlichen Regionen Frankreichs ist unter dem Vieh Milzbrand ausgebrochen. Ein Übergreifen der Seuche auf Paris ist unbedingt zu vermeiden. Nicolas soll den Viehhaltern und vor allem den Händlern, die das Futter für das Vieh beschaffen, die dringend nötigen Vorsichtsmaßnahmen einschärfen.
Auf überraschende Weise schließt sich dieser Auftrag mit einem anderen Ermittlungsfall zusammen, den der Commissaire nicht von Le Noir, sondern von einem Minister erhalten hat: Es handelt sich um die Ermordung eines Zimmermädchens in einem prominenten Pariser Haus.
Zum Autor
Jean-François Parot, 1946 geboren, studierte an der Sorbonne in Paris Geschichte und Ethnologie, absolvierte eine Ausbildung als Ägyptologe und spezialisierte sich auf das 18. Jahrhundert. Nach dem Militärdienst schlug er die diplomatische Laufbahn ein. Seine Romanreihe um Commissaire Le Floch wurde nicht nur in Frankreich, sondern auch in vielen anderen Ländern ein großer Erfolg. Jean-François Parot verstarb am 23. Mai 2018.
Jean-François Parot
CommissaireLE
FLOCH
und die silberne Hand
Roman
Aus dem Französischen von
Michael von Killisch-Horn
BLESSING
Titel der Originalausgabe: Le crime del ’hôtel Saint-Florentin
Verlag der Originalausgabe: Edition Lattès, Paris
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright 2004, Edtion Lattès
Copyright © 2019 der Übersetzung by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN:978-3-641-25047-8V001
www.blessing-verlag.de
Für Arlette und Richard Benais
Inhalt
Liste der handelnden Personen
Prolog
I Der Lauf der Tage
II Das Hôtel Saint-Florentin
III Schlangennest
IV Verwirrung
V Zwischen Stadt und Faubourg
VI Ablenkungen des Herzens
VII Diese Welt
VIII Navigation
IX Annäherungen
X Bicêtre
XI Manöver
XII Erklärungen
XIII Fallen
Epilog
Danksagung
Liste der handelnden Personen
Nicolas Le Floch, Marquis de Ranreuil: Polizeikommissar im Châtelet
Louis Le Floch: sein Sohn
Antoine-Gabriel De Sartine, Comte d’Alby: Marineminister
Jean-Charles Le Noir: Polizeipräfekt, Lieutenantgénéral de police
Charles Henri Sanson: Henker von Paris
Augustin Testard du Lys: Lieutenant criminel
Louis-Phélypeaux de Saint-Florentin:Duc de La Vrillière:Minister der Maison du Roi
Amalie-Ernestine de Saint-Florentin: Duchesse de La Vrillière
Victor-Scipion de La Garde: Marquis de Chambonas, Schwiegersohn des Duc de La Vrillière
Jean-Frédéric Phélipaux: Comte de Maurepas, Erster Minister
Marie-Jeanne Phélipaux: Comtesse de Maurepas, Schwester des Duc de La Vrillière
Louis François De Vignerot Du Plessis: Duc de Richelieu, Marschall von Frankreich
Pierre Bourdeau: Polizeiinspektor
Père Marie: Amtsdiener im Chatelet
Rabouine: Spitzel
Aimé de Noblecourt: ehemaliger Staatsanwalt
Marion, Poitevin und Catherine: Bedienstete von Noblecourt
Guillaume Semacgus: Marinewundarzt
Thierry de Ville D’avray: Erster Kammerdiener des Königs
Jean-Benjamin de La Borde: sein Vorgänger
La Satin: Mutter von Louis Le Floch
La Paulet: Bordellbesitzerin
Jacques de Vaucanson: Erfinder von Automaten
Monsieur de Gévigland: Arzt
Monsieur Bourdier: Ingenieur und Erfinder
Comte D’arranet: Marineadmiral
Aimée D’arranet: seine Tochter
Anselme Vitry: Gärtnerjunge
Marguerite Pindron: Kammerzofe
Jean Missery: Maître d’hôtel
Eugénie Gouet: Kammerfrau der Duchesse de La Vrillière
Marie Meunier: Geliebte des Duc de La Vrillière
Jeanne Le Bas, genannt Jeannette: Kammerzofe
Charles Bibard, genannt Provence: Kammerdiener des Duc de La Vrillière
Pierre Miquete: Schweizer des Hôtel Saint-Florentin
Jacques Blain: Concierge
Jacques Despiard: Küchenjunge
Gilles Duchamplan: älterer Bruder der verstorbenen Madame Missery
Nicole Duchamplan: seine Frau
Hélène Duchamplan: Schwester Louise de l’Annonciation, ältere Schwester der verstorbenen Madame Missery
Eudes Duchamplan: jüngerer Bruder der verstorbenen Madame Missery
Nicolas Edme Restif de La Bretonne: Publizist, Schriftsteller
Madeleine Josse: La Roussillon, Prostituierte
Père Longères: Viehzüchter
Claude und Antoine Richard: Gärtner des Trianon
Lord Ashbury: englischer Spion
Prolog
Die dunkle Nacht nahm den Dingen alle Farben.
Maurice Scève
Sonntag, den 2. Oktober 1774
Was bedeutete dieses ungewöhnliche Rendezvous? Sie würde ihm derartige Launen austreiben, er würde schon sehen. Was bildete er sich ein! Die Etage der Dienerschaft bot genügend Gelegenheiten, um sie nicht zu unwillkommenen nächtlichen Eskapaden zu zwingen. Ein Glück, dass ihre Aufgaben in den Gemächern von Madame diesen gut aussehenden Weiberhelden für einen Großteil des Tages von ihr fernhielten. Er nutzte häufig ihren Aufenthalt in den Gemeinschaftsräumen des Hôtel Saint-Florentin aus, um … Nun ja, der Mann war eben unersättlich.
Aber was konnte sie ihm schon mit Recht verweigern? Sie verdankte ihm schließlich ihre Stelle und damit eine gewisse Sicherheit.
Die Wartezeit verlängerte sich, und der Kerzenstummel, der die Fleischküche spärlich beleuchtete, würde nicht mehr lange brennen. Es handelte sich um einen großen, dunklen Raum mit Kaminen aus geschwärzten Steinen, auf deren vorgebauten Simsen allerlei Gerätschaften wie Bratspieße, Zahngestänge und Fettpfannen standen und lagen.
Sie musste lachen über ihre Dreistigkeit: Jeden Tag stahl sie Kerzenstummel in den Gemächern der oberen Etagen und vermehrte dadurch ihren Vorrat. Ein paarmal wäre sie beinahe ertappt worden. Sie musste sich nicht nur vor ihrer stets wachsamen Herrin in Acht nehmen, sondern auch vor den anderen Dienstboten, die ihr Konkurrenz beim Klauen machten und wie sie hinter allem her waren, was einen einträglichen Wiederverkauf versprach. Das Kerzenwachs wurde dabei nach Gewicht berechnet.
Ein metallisches Klirren zerriss die Stille. Ihr Herz schlug so wild, dass es wehtat. In banger Erwartung hielt sie den Atem an, ohne dass etwas geschah. Wieder eine dieser Ratten, dachte sie, die man einfach nicht loswurde. Eines dieser räudigen und satten grauen Viecher, die sich von den Küchenabfällen und den Resten ernährten, die in der großen Vorratskammer aufbewahrt wurden. Dort fanden sich ebenfalls genügend Sachen, mit denen sich gute Geschäfte machen ließen. Die besten Stücke verkaufte sie an ein paar Wirtshäuser und die Essensreste an einen dieser Hersteller von Suppen aus Abfällen, deren dampfende Wagen den Ärmsten auf den Straßen für ein paar Kupfermünzen einen Augenblick des Trostes schenkten. Eine Erfahrung, die sie vor gar nicht so langer Zeit selbst gemacht hatte, nachdem sie aus ihrem Elternhaus geflohen war. Noch immer meinte sie, diesen säuerlichen und fauligen Nachgeschmack im Mund zu haben, den kein Gewürz zu übertönen vermochte. Allein beim Gedanken daran wurde ihr übel.
Nach wie vor spitzte sie die Ohren in der Hoffnung, den schweren Schritt ihres Liebhabers zu hören. Ein fernes Miauen ertönte. Sie konnte sich ein spöttisches Lachen nicht verkneifen; die Kater hier waren zu nichts nutze, gemästet, wie sie von den Resten eines reich gedeckten Tisches waren. Lediglich ihre Augen, die in der Dunkelheit leuchteten, vermochten jemanden zu erschrecken, öfter hingegen erschraken sie selbst. Wenn sich eine Ratte von beachtlicher Größe, die gelblichen Zähne gefletscht, vor ihnen aufrichtete, traten sie kampflos den Rückzug an. Aber es waren nicht die Katzen, die ihr Angst machten. In den Ställen ihres Vaters, eines Viehzüchters im Faubourg Saint-Antoine, trieben sich die furchterregendsten Katzen herum, angelockt von den unzähligen Mäusen, die sich dort im Stroh und im Futter verbargen.
Sie wollte nicht mehr an die Vergangenheit denken, versuchte sie vielmehr auszulöschen. Doch es half alles nichts, sie sah die letzten Momente, die sie mit ihrer Familie verbrachte hatte, immer wieder vor sich. Ihr Vater wollte sie unbedingt mit dem Sohn eines Nachbarn, einem Gärtner, verheiraten. Obwohl durchaus gut gebaut, war dieser Junge mit den vorstehenden Augen nicht nach ihrem Geschmack. Seine Art, ihr den Hof zu machen, war mehr als merkwürdig, denn sie bestand fast ausschließlich in langatmigen Aufzählungen von Salaten oder von Regeln für den Anbau in Frühbeeten, das Ganze ausgeschmückt mit Überlegungen, ob man Alleen lieber mit Hecken, Spalieren oder einem Zaun aus Rebpfählen säumen sollte. Der Antrittsbesuch bei den Vitrys hatte sie in ihrer Ablehnung bestärkt.
Deren Haus bestand unten aus einem einzigen großen Raum, in dem die Familie lebte und aß. Der Boden bestand aus gestampfter Erde, kein Vergleich also zu den gewachsten Fliesen in der elterlichen Wohnküche. Strohstühle, ein großer Tisch aus verwittertem Holz, ein Kachelofen, ein Springbrunnen aus Kupfer und ein schäbiges Buffet bildeten die ganze Einrichtung. Im ersten Stock gab es zwei Schlafzimmer mit einfachen Betten, von denen eines, in dem der Sohn schlief, das Nest des künftigen Paares werden sollte. Mutter Vitry, eine große, schwarzhaarige, dürre Frau mit Fingernägeln, die schmutzig und schadhaft vom Wühlen in der Erde waren, zählte ihr in schroffem Ton die Pflichten einer Gärtnersfrau auf. Sie müsse bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit um fünf Uhr morgens aufstehen und bis acht Uhr abends arbeiten. Mit einer einzigen Pause, um schnell und ohne Zeit zu verlieren eine Suppe oder einen Brotkanten zu essen. Und selbstverständlich müsse sie den Eltern ihres Mannes gehorchen, als wären es ihre eigenen.
Ihr Widerwille nahm zu, als man auf den Ehevertrag zu sprechen kam und auf das, was die Eheleute einzubringen hatten. Für sie war das neben einer Mitgift, deren Höhe die Augen der künftigen Schwiegereltern leuchten ließ, eine sich über Monate hinziehende Lieferung von frischem Dung für die Beete der Vitrys.
Am Tag der Verlobung und der Unterschrift vor dem Notar suchte sie, gequält von der Aussicht auf ein Leben an der Seite dieses Tölpels, aus einer plötzlichen Anwandlung heraus das Weite und ließ Kälber, Kühe, Ochsen, Misthaufen und Salate, einen verdatterten Verlobten und zwei bekümmerte Familien einfach stehen. Da sie fürchtete, gesucht zu werden, tauchte sie in der Großstadt unter, um sich im Meer der Menschenmassen zu verlieren.
Vater Pindron, tief gekränkt von der Handlungsweise seiner Tochter, unternahm nichts, um sie zu finden. Sie hatte die Familie entehrt, für ihn war sie gestorben und wurde sofort enterbt. Ihn selbst brachte die Schmach um. Er wurde krank, legte sich ins Bett und starb ein paar Tage später, während seine Witwe sich ins heimatliche Burgund zurückzog. Den Hof samt Inventar und Vieh hatte sie zu einem guten Preis einer vermögenden Familie von Viehzüchtern aus dem Faubourg verkauft, die sich notariell verpflichtete, ihr bis zu ihrem Tod eine Pension zu zahlen.
Ihre Tochter Marguerite hingegen irrte monatelang durch Paris, schlief auf den Quais und richtete sich Verstecke in den Pyramiden des Port au Bois ein, entweder am Quai Saint-Paul oder zwischen den Fässern am Quai de la Rapée. Das vom Fluss angeschwemmte Holz war teilweise zu vier- oder dreieckigen Pyramiden aufgeschichtet worden, ein großer Teil indes war unordentlich gestapelt oder willkürlich hingeworfen worden, sodass ein Labyrinth mit geheimnisvollen Ecken und Winkeln, Biegungen und Gässchen entstanden war, in dessen Innerem des Nachts ein bunt zusammengewürfeltes Völkchen unterkroch und frühmorgens verstört und müde wieder zum Vorschein kam.
Die wenigen Louisdor, die Marguerite ihrem Vater gestohlen hatte, waren schnell aufgebraucht, aber da sie lesen und schreiben konnte, nutzte sie diese Kenntnisse bei den Ärmsten, um bis zum Winter durchzukommen. Eines Abends, an dem sie verzweifelt war und Hunger und Kälte sie quälten, begegnete sie einem gut gekleideten jungen Mann, der sie in seine Wohnung mitnahm und sie, nachdem sie sich gewaschen hatte, zu seinem willenlosen Geschöpf und Lustobjekt machte. Er kleidete sie ein, gab ihr zu essen und stellte sie seinem Schwager vor, der Maître d’hôtel beim Duc de La Vrillière war. Ihre Freude, eine Arbeit gefunden zu haben, verflog schnell. Sie war dort die Letzte in einer Armee von Dienstmädchen, die die Nachttöpfe und Eimer leerten, die ekelhaftesten Arbeiten erledigen und die bittersten Abfuhren einstecken mussten.
Sie brauchte nicht lange, um zu begreifen, dass sie dem Schwager zu Willen würde sein müssen. Dieser, seit zwei Jahren Witwer, ertrug die Einsamkeit nicht und war hinter allem her, was im Hôtel Saint-Florentin Röcke trug. Sogleich entbrannte er für ihre Schönheit und Jugend. Anfangs widersetzte sie sich seinen Avancen, doch die Angst, wieder auf der Straße zu landen, war groß. Und so vertraute sie sich ihrem angeblichen Wohltäter, dem ebenso gut aussehenden wie skrupellosen jungen Mann, an, der sie auslachte und sie zusätzlich auszunutzen begann.
Immer häufiger lieh er sich kleine Summen von ihrem Lohn. Marguerite wusste nicht mehr, wie sie die Fesseln, die sie einschnürten, trotz ihrer Zwangslage abstreifen und sich der ständigen Avancen eines alten Knackers erwehren sollte. Alle möglichen Launen und Listen bot sie auf, um ihn sich vom Hals zu schaffen, scheute selbst vor flüchtigen Affären mit jüngeren Domestiken nicht zurück und machte keinen Hehl aus ihren Seitensprüngen, alles in der Hoffnung, dass er sich angewidert von ihr abwandte. Vergeblich. Damit steigerte sie sein Verlangen nach ihr nur. Unaufhörlich quälte ihn die Eifersucht, und es kam zu schrecklichen Szenen zwischen ihnen.
Tränen traten ihr in die Augen. Das alles war nämlich nicht das Schlimmste. Die Ereignisse, die sich drei Tage zuvor abgespielt hatten, wollten ihr nicht aus dem Kopf. Ihr junger Liebhaber war am Abend nach seinem Dienst erschienen, um sie abzuholen. Sie hatte durch eine Hintertür das Haus verlassen müssen, um zu ihm in seine Kutsche zu steigen. Nach einer langen Fahrt hatte er sie in ein ihr unbekanntes Haus geschleppt und sie gezwungen, eine mehr als unanständige Kleidung anzuziehen. Warum hatte sie das mit sich machen lassen? Sie versuchte zu verdrängen, was dann gefolgt war, und die schrecklichen Bilder zu löschen. Wie hatte es dazu kommen können? Sie hatte nicht protestiert, war gleichsam verblüfft und gefesselt gewesen von der rauschhaften Wildheit der irrwitzigen Szenen ringsum.
Ein leichter Luftzug drückte die Flamme nieder, die Kerze flackerte einen Augenblick und erlosch, einen scharfen Geruch verbreitend. Das hatte gerade noch gefehlt! Es gab keine Möglichkeit, sie wieder anzuzünden. Ganz allein an diesem menschenleeren Ort, wurde sie von Angst gepackt, bildete sich sogar ein, dass sich um sie herum etwas bewegte. Tiere und zahllose Insekten suchten häufig zu Beginn des Herbstes die Wärme der Küchenräume. Hinter ihr knackte irgendetwas, gefolgt von einem Geräusch, als würde etwas über den Boden gleiten oder gezogen werden.
Widerwillig zwang sie sich, sich umzudrehen, konnte aber nichts erkennen. Sie hatte das Gefühl, dass ihr das Atmen schwerfiel, dass sie keine Luft mehr bekam und zunehmend von Panik ergriffen wurde. Als sie in einer spontanen Anwandlung in Richtung der Treppe stürzte, die nach oben führte, wurde sie von einem unsichtbaren Arm gepackt und gegen einen Körper gepresst. Ein furchtbarer Schmerz durchzuckte den Ansatz ihres Halses, das Blut floss in Strömen, und sie brach zusammen, ohne zu spüren, dass sie starb.
Am frühen Morgen entdeckte ein Küchenjunge zwei leblose Körper, den von Marguerite Pindron, deren Kehle durchschnitten worden war, und den von Jean Missery, dem Maître d’hôtel, der bewusstlos und verletzt war. Ein Messer lag neben ihm auf den Fliesen, inmitten einer Blutlache.
I
Der Lauf der Tage
Die Zeit enthüllt die Geheimnisse; die Zeit bringt Gelegenheit hervor; die Zeit bestätigt gute Ratschläge.
Jacques Bénigne Bossuet
Sonntag, den 2. Oktober 1774
Nicolas betrachtete verstohlen das Gesicht seines Sohnes. Genauso hatte er in seiner Jugend ausgesehen, mit diesem lebhaften Gesichtsausdruck seines Vaters, des Marquis de Ranreuil, wenn er sich aufgerichtet hatte, um seinem Gesprächspartner in die Augen zu blicken. Die Satin, seine Mutter, schimmerte in der unbestimmten Sanftheit der noch nicht voll ausgebildeten Gesichtszüge durch. Insgesamt hatte die noble und ungezwungene Haltung des Jungen nichts von der für dieses Alter typischen linkischen Art. Er diskutierte mit Monsieur de Noblecourt unter Verwendung von griechischen und lateinischen Zitaten, in denen der ehemalige Staatsanwalt bisweilen mit einem Lächeln sprachliche Fehler und Barbarismen korrigierte.
In dessen Wohnung in der Rue Montmarte wurde die Vorstellung von Louis Le Floch mit einem festlichen Souper gefeiert. Ruhig und glücklich, spürte Nicolas die Wärme, die seine Freunde Semacgus, Bourdeau und La Borde mit ihrer Anwesenheit ausstrahlten. Er selbst mischte sich nicht ins Gespräch ein, wünschte sich vor allem, dass Louis, der zu seiner Freude sehr entspannt wirkte, ganz ungezwungen seinen Platz fand. In diese Vaterrolle, die ihn zugleich überwältigte und ängstigte, hatte er sich erst nach und nach eingefunden.
Das Jahr endete besser, als es begonnen hatte. Die Erinnerungen an die Verschwörungen und Ermittlungsverfahren, die ihm nach dem Tod von Madame de Lastérieux, seiner Geliebten, das Leben schwer gemacht hatten, wurde allmählich schwächer. Ebenso wie die Trauer um den verstorbenen König, die sich in eine Art sanften Schmerz zu verwandeln begann. Diese aufregende Zeit seines Lebens hatte ihn überdies die Existenz eines Kindes entdecken lassen, das vor fünfzehn Jahren aus seiner Liaison mit der Satin hervorgegangen war.
Seitdem war es turbulent zugegangen, und die Ereignisse hatten sich überstürzt. Kaum hatte sie davon erfahren, dass Louis der Sohn der Satin war, hatte die alte Paulet sich eingeschaltet und ihren Landsitz in Auteuil verlassen, wo sie seit der Aufgabe ihres Bordells ein frommes Leben führte. Sie war nach Paris gefahren, um Monsieur de Noblecourt aufzusuchen und bei ihm dafür zu plädieren, dass Louis offiziell einen Vater bekam. Der alte Staatsanwalt hatte die Angelegenheit sehr ernst genommen und mit den Eltern gesprochen.
Dabei waren von beiden Seiten Bedenken geäußert worden. Von der Satin, weil sie Nicolas’ Reaktion gefürchtet hatte, denn zu gut erinnerte sie sich, dass er sie vor vielen Jahren nach dem Vater ihres Kindes gefragt und sich bereit erklärt hatte, gegebenenfalls die Verantwortung zu übernehmen. Daraufhin hatte sie seine Vaterschaft verneint, um ihm keine Schwierigkeiten zu machen. Und nach wie vor fürchtete sie, dass die Anerkennung dieses Sohnes aus einer illegitimen, als unehrenhaft betrachteten Beziehung gesellschaftliche und berufliche Nachteile für Le Floch nach sich ziehen würde.
Nicolas hingegen, der immer noch zärtliche Gefühle für diese Frau hegte, die er gleich nach seiner Ankunft in Paris kennengelernt hatte, war von Skrupeln geplagt worden, weil er die neue Besitzerin des Dauphin couronné, eben die Satin, dadurch verletzen würde, dass er den gemeinsamen Sohn von ihrem unehrenhaften und verdorbenen Milieu fernhielt. Unter keinen Umständen hatte er die natürlichen Bindungen zwischen einem Sohn und seiner Mutter zerschneiden wollen.
Diese Quadratur des Kreises wurde von Monsieur de Noblecourt gelöst, indem er mit der Feder in der Hand daranging, die Interessen und Gefühle der anwesenden Parteien in Einklang zu bringen, so heikel sie sein mochten. Die Satin würde wieder ihren Mädchennamen Antoinette Godelet annehmen und ihre derzeitige Beschäftigung aufgeben. Mithilfe von Nicolas sollte sie von einem Paar, das sich zurückziehen wollte, ein Geschäft für Mode- und Toilettenartikel in der Rue du Bac erwerben. Das Schwierigste war gewesen, die Paulet zu überzeugen, die, ihrer Nachfolgerin im Bordell beraubt, getobt und in ihrem Zorn zu der Wortmächtigkeit eines Marktweibs zurückgefunden hatte, wie Nicolas es noch von früher kannte.
Monsieur de Noblecourt hatte gewartet, bis der Wutausbruch vorbei war, und sodann ein Wunder bewirkt. Es war ihm gelungen, seinen beruhigenden Einfluss auf die gute Dame zu nutzen und mit höflichen Komplimenten ihr Wohlwollen zu erringen. Nach und nach hatte sie sich beruhigt und murrend allem zugestimmt, ja, sie tat sogar noch mehr. Da ihr Etablissement florierte und zunehmend durch seine Eleganz an Renommee gewann, hatte sie beschlossen, um der Satin zu danken, ihr als Ergänzung zu dem Geschäft in der Rue du Bac das kleine Zwischengeschoss zu kaufen.
Damit hatte dem endgültigen Schritt nichts mehr im Wege gestanden. Nicolas erkannte vor dem Notar seinen unehelichen Sohn an, der sofort seinen Namen bekam, und nutzte seinen Einfluss, um im Polizeiarchiv alles verschwinden zu lassen, was auf die frühere Tätigkeit der Satin hinwies. Nachdem das geschehen war, konnte endlich Louis über diese für seine Zukunft so entscheidenden Ereignisse informiert werden. Eine überaus heikle Sache, weil sie den Jungen durcheinanderzubringen drohte. Monsieur de Noblecourt hatte angeboten, die Aufgabe zu übernehmen, doch Nicolas war es lieber gewesen, seine Vaterrolle in einer Atmosphäre völliger Offenheit zu beginnen und seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Im Übrigen hatte er sich nichts vorzuwerfen, da er noch nicht lange von der Existenz seines Sohnes wusste. Die Frage war gewesen, was Louis zu dem Ganzen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen sagen würde und zu den Entscheidungen, an denen er nicht einmal beteiligt gewesen war.
Bevor sie sich zum ersten Mal unter vier Augen trafen, hatte Nicolas sich überlegt, wie er selbst in diesem Alter gewesen war, und hatte das ferne Bild seiner selbst heraufzubeschwören versucht. Gleich das erste Treffen war zu seiner Beruhigung gut verlaufen. Unter den Bäumen des Hauses der Paulet in Auteuil hatte er von seinem Leben erzählt, dabei allerdings vermieden, etwas zu sagen, was die Liebe des Jungen für seine Mutter tangiert hätte. Louis’ Reaktionen waren erstaunlich offen und vernünftig gewesen, und er hatte Nicolas sofort mit einer langen Reihe von Fragen bestürmt. Es war der Auftakt für ihre Vater-Sohn-Beziehung gewesen. In der Folge hatten sie sich häufig getroffen, vor allem in Vaugirard bei seinem Freund Semacgus, und mittlerweile war eine liebevolle Vertrautheit entstanden.
Sobald Nicolas über den Wissensstand seines Sohnes im Bilde war, hatte er ihn im Collège des Oratoriens de Juilly angemeldet. Zu seinem Bedauern waren seine jesuitischen Lehrer inzwischen aus dem Königreich ausgewiesen worden, aber zum Glück entsprach die zugleich moderne wie klassische Erziehung, die dieses von den französischen Oratorianern geleitete Kolleg vertrat, durchaus den Ideen, mit denen Nicolas in seiner Jugend durch seinen Vater in Guérande inspiriert worden war. Man legte in diesem Orden insbesondere großen Wert auf die moderne Literatur und den Fremdsprachenunterricht. Die Ferien würde Louis in Paris verbringen, die eine Hälfte der Zeit in der Rue Montmarte und die andere in der Rue de Bac.
»Wann werde ich den König sehen, Vater?«
Aus seinen Gedanken an die Vorgeschichte dieses Abends gerissen, zuckte Nicolas zusammen und wurde sich bewusst, wo er war. Das Essen begann. Marion und Catherine hatten soeben ein dampfendes Omelett mit Kalbsnieren aufgetragen.
»Ich werde dich an irgendeinem Sonntag nach Versailles mitnehmen«, erwiderte er. »Wir werden der Messe beiwohnen, wo du in aller Ruhe Seine Majestät beobachten kannst, anschließend wirst du ihn in der Grande Galerie aus noch größerer Nähe sehen.«
Louis lächelte. Sein Gesichtsausdruck versetzte Nicolas einen Stich ins Herz, weil er für einen kurzen Augenblick denjenigen von Isabelle, seiner Halbschwester, darin wiederfand.
»Wie geht es Monsieur Le Noir?«, fragte La Borde, der ehemalige Erste Kammerdiener des verstorbenen Ludwig XV.
»Wenn ich ihn mal sehe, geht es ihm so weit gut«, erwiderte er mit einem Anflug von Bitterkeit.
»Ich bin es der Wahrheit schuldig zu betonen«, sagte La Borde, »dass es niemanden gibt, der sich mehr als er für die Oper interessiert.«
»Ich fürchte«, sagte Semacgus mit einem ironischen Unterton, »dass sein Wunsch, sich vertreten zu lassen, bei unserem Freund die Loyalität gegenüber dem Nachfolger des schmerzlich vermissten Sartine überwiegt.«
Nicolas nickte.
»Das ist einer dieser Sätze«, schaltete sich Noblecourt ein, »die zu viel oder zu wenig andeuten. Die Sentenz ist ein wenig kurz für eine so beträchtliche Macht. Sartine hatte die Befugnisse seines Amtes noch vergrößert. Was wird der Neue daraus machen?«
»Oh, er ist ein wichtiger Mann geworden, ohne einen Titel zu tragen«, meinte Bourdeau. »Sie kennen seinen außergewöhnlichen, verborgenen Einfluss. Er schlägt zu, oder er rettet. Er verbreitet Finsternis oder Licht. Seine Autorität ist ebenso taktvoll wie ausgedehnt. Er fördert und demütigt nach Lust und Laune, ganz, wie es ihm beliebt.«
Nicolas nickte.
»Sartine liebte Perücken, Le Noir liebt wappengeschmückte Einbände.«
»Das Problem ist«, warf Louis schüchtern ein, »dass weder die einen noch die anderen die Leere zu überdecken vermögen.«
Alle applaudierten, während Nicolas lächelte.
»Wie unser verstorbener König zu sagen pflegte«, bemerkte La Borde, »guter Rassejagdhund.«
»Das hat er von seinem Großvater, der Marquis war nie um eine geistreiche Bemerkung verlegen.«
»Meine Herren«, sagte La Borde, »erlauben Sie mir, Sie den Wohlgerüchen dieses köstlichen Omeletts zu überlassen. Ich will noch die Zartheit der Nieren betonen. Ich habe zu Ehren des jungen Ranreuil mit Hand angelegt wie einst im Trianon und will zusammen mit Catherine meine Überraschung vollenden. Semacgus, bereiten Sie unseren Gastgeber darauf vor, der Versuchung zu widerstehen? Louis, begleiten Sie mich, ich brauche einen Küchenjungen.«
Der Junge erhob sich, er war groß für sein Alter. Wie viele Dinge er noch zu lernen hatte, dachte Nicolas. Reiten, Jagen, Fechten … Schließlich war er vom Geblüt der Ranreuils. Er verfiel wieder ins Nachdenken.
Gewiss, er war vom neuen Polizeipräfekt rasch empfangen worden, nachdem er, Sartines Rat folgend, gleich in den ersten Tagen um eine Audienz gebeten hatte. Hinter dem Schreibtisch stehend, an dem sich sein Vorgänger mit seinen Perücken zu beschäftigen pflegte, hatte Le Noir sich in seiner ganzen Größe und Leibesfülle präsentiert. Eine kräftige Nase überragte einen Mund mit fleischiger Unterlippe, deren Bewegungen Ablehnung und Verachtung ausdrückten und den Blick auf ein Doppelkinn lenkten. Seine lebhaften Augen, die den Gesprächspartner fixierten, ließen einen leichten Hochmut, einen unbestreitbaren Skeptizismus und eine Selbstgefälligkeit ahnen, aus denen er keinen Hehl machte. Eine Allongeperücke unterstrich das makellose Weiß eines Beffchens aus Batist, das sich wie eine wogende Flut über seine schmucklose Robe ergoss. Das Gespräch, durch die Ankunft eines Besuchers abgekürzt, war nicht sonderlich ersprießlich und nicht seinen Erwartungen entsprechend verlaufen.
»Monsieur le Commissaire«, hatte Le Noir gesagt, »mein Vorgänger hat Sie empfohlen. Ich habe mir kürzlich selbst ein Bild machen können von dem Geschick und der Berufserfahrung, die Sie in heiklen Angelegenheiten bewiesen haben. Andererseits hat die Erfahrung mich gelehrt, dass die persönlichen Methoden, so nützlich und wirksam sie sein mögen, nichtsdestotrotz intrigante Adelsspiele gewesen sind, derer die Macht letztlich überdrüssig wurde. An meiner Seite werden Sie nicht die gleiche Position wie bei Monsieur de Sartine innehaben. Ich beabsichtige, die Verfahrensweisen bei Anklageerhebungen neuen Regeln zu unterwerfen, die meinen eigenen Vorstellungen mehr entsprechen.«
»Ich stehe im Dienste des Königs, Monseigneur.«
»Er schätzt Sie, Monsieur, er schätzt sie sehr«, hatte Le Noir mit einer Spur Gereiztheit zugegeben, »das wissen wir. Doch die Regeln sollten für alle gleich sein. Ältere Kommissare könnten sich gekränkt fühlen …«
Hätten sie es mal getan, war es Nicolas durch den Kopf geschossen.
»Konkret ausgedrückt, würden sie es nicht goutieren, wenn einer ihrer jüngeren Kollegen die Aufmerksamkeit und Gunst von oben monopolisiert. Könnten wir Ihnen ein spezielles Viertel anvertrauen? Das scheint nicht sehr ratsam, denn Sie haben andere Kommissare ziemlich schikaniert …«
»Monseigneur!«
»Ich weiß, was ich sage, unterbrechen Sie mich nicht. Zahlreiche Klagen und Beschwerden sind bereits bis zu mir gedrungen. Es wäre klug, Monsieur, wenn Sie sich ein angenehmes Leben machen, sich ausruhen, jagen und abwarten würden, bis die Zeiten wieder günstiger für Sie werden. Das Amt eines Polizeikommissars im Châtelet kann übrigens zu einem guten Preis weiterverkauft werden. An Interessenten mangelt es nicht. Denken Sie darüber nach. Ich empfehle mich, Monsieur le Commissaire.«
Nicolas hatte nichts unternommen, um dieser eisigen Ungnade entgegenzutreten. Das widerstrebte seinem rechtschaffenen Wesen, dem es fernlag, Unterwürfigkeit zu heucheln. Zudem war er mehr um Bourdeau als um sich selbst besorgt. Immerhin hatte sein Assistent eine Reihe jüngerer Kinder und war für deren Versorgung allein auf die Bezüge seines Amtes angewiesen, zumal die damit verbundenen und nicht unbeträchtlichen Nebeneinkünfte ebenfalls wegfallen würden. Deshalb hatte Nicolas Vorkehrungen getroffen, um seinem Freund eine ansehnliche Unterstützung zukommen zu lassen, die er, um ihn nicht zu kränken, als Nachzahlungen vergessener Spesen bei früheren Untersuchungen deklarieren würde. Er selbst hatte sich in einer Art quasi religiösem Fatalismus verschlossen, da seine Zukunft sich sowieso nicht ändern ließ, und nur zögerlich mit Noblecourt und La Borde darüber gesprochen.
Ersterer bestärkte ihn in dem Entschluss, sich von den vorübergehenden Wechselfällen, die jede Karriere im Dienst des Königs prägten, nicht irritieren zu lassen. Die Zeit sei ein großer Meister im Regeln der Dinge, fasste der alte Staatsanwalt seine Lebenserfahrungen zusammen, und unter diesen Umständen habe ein anständiger Mann lediglich eine Pflicht, nämlich den Schein zu wahren. Auf diese Weise werde er beweisen können, dass er sich nicht unterkriegen lasse von etwas, das ein gewöhnlicher Sterblicher als Katastrophe ansähe.
Monsieur de Noblecourt, der das Jahrhundert und die Menschen kannte, war überzeugt, dass Le Noir seine anfänglichen Vorurteile überdenken würde. Das sei die erste, ganz natürliche Reaktion eines Mannes, der die anderen und sich selbst beeindrucken wolle. Nicolas dürfe nicht vergessen, dass er der Protégé und Freund von Monsieur de Sartine sei und dass dieser intrigiert habe, um ihn auf seine Stelle berufen zu lassen, in der Hoffnung, im Hintergrund weiterhin die Maschinerie des Staates beeinflussen zu können und zugleich ein herausragendes Instrument der Einflussnahme auf den König in der Hand zu haben. Die Reaktionen auf den neuen Polizeipräfekten, die ihm, Monsieur de Nobelcourt, zu Ohren kämen, würden eine ganz andere moralische Landschaft zeigen als jene, die Nicolas beschreibe. Man spreche von einer großen Klarheit der Ideen, von angenehmer Unterhaltung, großer Verstandesschärfe und einer hervorragenden Urteilsfähigkeit. Seine gründlichen und ernsthaften Studien hätten die Anmut seines überaus liebenswürdigen Geistes nicht beeinträchtigt. Außerdem sei er ein aufgeklärter Liebhaber der Künste und der Literatur. Kurz, er halte es für dringend geboten abzuwarten, weil Ereignisse, von denen wir unseren Ruin erwarten, manchmal zu unserer Rettung führen würden.
Was La Borde ihm gesagt hatte, ging in die gleiche Richtung. Er habe gleich am Tag nach dem Tod des Königs beschlossen, eine glückliche, nunmehr abgeschlossene Vergangenheit zu vergessen und sich damit abzufinden, dass er künftig zum alten Eisen gehöre. Er selbst beschäftige sich jetzt mit Dingen, die er aufgrund seines Amtes beim König vernachlässigt habe. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit vertraute er Nicolas an, dass der verstorbene König versprochen habe, ihn für ein finanzielles Opfer zu entschädigen, zu dem er einst bereit gewesen sei, um in seinen Dienst zu treten.
Mehr noch: Er gestand Nicolas, der nicht schlecht staunte, dass er den Entschluss gefasst habe, nach einem oberflächlichen und undisziplinierten Leben solide zu werden. Dazu gehöre, dass er soeben Adélaïde-Suzanne de Vismes geheiratet habe, die neunzehn Jahre jünger sei als er. Die Zeremonie, die für den ersten Juli geplant gewesen sei, sei auf den September verlegt und wegen der Staatstrauer im kleinen Kreis gefeiert worden. Seine Frau, aufgrund der Ereignisse, die ihre Hoffnungen auf ein glanzvolles Fest enttäuscht hätten, am Boden zerstört, jammere und weine in einem fort. Und da er gerade in redseliger Stimmung war, vertraute La Borde Nicolas, vermutlich unter dem Eindruck von dessen plötzlicher Vaterschaft, an, dass er vor vier Jahren eine uneheliche Tochter aus seiner Liaison mit der Guimard, einer berühmten Schauspielerin, anerkannt habe. Dieses Geständnis schien ihn erleichtert zu haben, und für einen Augenblick seine eigenen Sorgen beiseiteschiebend, hatte er sich erneut denen seines Freundes zugewandt.
Mit flammenden Worten hatte er versucht, Nicolas aus seiner trüben Stimmung zu holen. Man habe ihm eine Auszeit geschenkt, und jetzt solle er sie verdammt noch mal auch nutzen und seinen Sohn mit seiner ganzen Liebe und Zuneigung verwöhnen! Ein Mann, der die Welt studiert habe, wisse, wann es Zeit sei zu handeln. Er müsse seine Mittel anpassen und seine Einsichten in den Dienst dessen stellen, was ihm am Herzen liege. Sein Rat lasse sich in der Formel »offenes Gesicht und geheime Gedanken zusammenfassen. Verschleierung und Geheimnisse müssten gepflegt werden, und deshalb solle Nicolas eine Zeit lang hinter dem Marquis de Ranreuil zurücktreten. Er, La Borde, empfehle ihm, die unangenehmen Begleiterscheinungen einer scheinbaren Ungnade zu nutzen und sie wie einen Panzer zu tragen in einer Gesellschaft, in der die geringste Schwäche bemerkt werde und Waffen bereitgehalten würden, um einen zu verspotten oder zu zerstören. Er solle sich an den richtigen Orten blicken lassen und dafür sorgen, dass er dem König durch seine regelmäßige Anwesenheit und seine Erfahrung bei der Jagd auffalle, an denen er dank der Gunst Ludwigs XV. teilnehmen dürfe. Keine dieser Aktivitäten werde Monsieur Le Noirs Vorhaben, ihn auszugrenzen, rechtfertigen oder ihn darin bestärken können. Man kläre nichts durch Reden. Zum Schluss hatte La Borde noch betrübt angemerkt, dass die Zeiten sich geändert hätten – ein witziger Einfall von Monsieur de Maurepas zähle in der Umgebung des Thrones mehr als der Schutz eines treuen Dieners.
Nicolas hatte sich die klugen Ratschläge seiner Freunde zu Herzen genommen und war zu der Überzeugung gelangt, dass die Rettung in der Mehrdeutigkeit seines Verhaltens lag. Trotz des Geredes und der Gerüchte würden sich die Hartherzigen und Heuchler der Stadt und des Hofes vergeblich abmühen, über ihn zu tratschen. Jeder würde sich seine eigene Meinung über den Fall des »kleinen Ranreuil« bilden, jeder allerdings eine andere. Er musste das Bild nur noch mit ein paar Pinselstrichen für die Klatschkolumnisten, die ständig auf der Lauer lagen, vollenden, um die weniger Leichtgläubigen zu überzeugen: eine schmeichelhafte, flüchtige Affäre mit einer indiskreten Dame, ein wenig höfliche Herablassung und vor allem deutliche Aufmerksamkeiten des Königs.
Amüsiert stellte er fest, dass er sich als Höfling nicht schlecht machte. Während des Aufenthalts des Hofes in Compiègne im August hatte er beim Halali mehrmals direkt hinter dem König gestanden und von der guten Laune seines Herrn profitiert. Sie waren vom Gefolge beobachtet worden, wie sie angeregt über die Qualität eines Tieres oder über die Taktik seiner Verfolgung plauderten. Hatten sie ihr Opfer gestellt, schoss er bewusst daneben, wohl wissend, dass es Ludwig XVI. erfreute. So sehr, dass er ihm als Zeichen seiner Wertschätzung die Gewehre des verstorbenen Königs schenkte, die dieser bei einer seiner letzten Jagden dem Kommissar geliehen hatte.
All das erregte Aufsehen am Hof, wo sein Stern, den man bereits für erloschen gehalten hatte, plötzlich wieder in hellem Glanz erstrahlte, sodass sogar diejenigen herbeieilten, um ihn zu beglückwünschen, die ein paar Tage zuvor noch geflissentlich durch ihn hindurchgesehen hatten. Er zweifelte nicht daran, dass das Gerücht dieses großen Erfolgs Monsieur Le Noir zu Ohren kommen werde – immerhin verfügte er über genug Spitzel am Hof, um ihn über jede Einzelheit zu informieren, die sich in der Welt der Höflinge und im Umkreis des Königs ereignete. Die letzten turbulenten Monate, in denen das Schicksal alles heftig durcheinandergewirbelt hatte, waren in der Tat sehr schnell vergangen. Ein Ruf riss ihn aus seinen Gedanken.
»Die gefüllte Lammkeule à la royale, begleitet von mit Knoblauchpilzen gefüllten Teigtaschen«, posaunte La Borde und präsentierte mit ausgetreckten Armen eine Silberplatte, von der duftende Dampfkringel aufstiegen.
»Man könnte meinen, er sei ein Herold, der das französische Wappen zur Schau stellt«, rief Noblecourt, dessen Augen vor Gier leuchteten. »Es fehlt ihm nur noch der Tappert, dieser wunderschöne alte Waffenrock, der leider aus der Mode gekommen ist.«
»Und was ist das?«, fragte La Borde pikiert und deutete auf die weiße Schürze, die er umgebunden hatte.
Hinter ihm erschien jetzt Louis, das Gesicht gerötet von der Hitze der Feuerstellen in der Küche, mit einer Porzellanschüssel, die gefüllt war mit einer Pyramide aus Teigtaschen.
Nicolas stimmte in die allgemeine Fröhlichkeit ein. »Und was werden wir dazu trinken?«
Bourdeau holte zwei Flaschen unter dem Tisch hervor. »Einen pflaumenfarbenen Saint-Nicolas de Bourgeuil.«
»Meine Herren, meine Herren«, meldete sich Noblecourt zu Wort, »während Poitevin aufschneidet, schlage ich vor, dass Monsieur de La Borde uns zum Aperitif den üblichen erklärenden Vortrag hält.«
»Darf ich Sie, Monsieur«, warf Louis ein, »nach dem Grund für diesen Brauch fragen?«
»Junger Mann, seit Ihr Vater die Freude in dieses Haus zurückgebracht hat, eine Freude, die Ihre Anwesenheit in unserem Kreis noch steigert, ist es eine Tradition, die an einem Feiertag wie diesem nicht zu respektieren ich mir übel nehmen würde. Die unter diesem Dach zubereiteten köstlichen Gerichte verdienen es, nicht allein mit dem Gaumen, sondern desgleichen mit den Ohren gekostet zu werden.«
»Und den Augen«, rief Semacgus. »Das ist übrigens der einzige Sinn, den ich akzeptiere.«
»Und ich«, konterte Noblecourt, »versichere, dass ich heute Abend meinem Arzt nicht gehorche, sondern entschlossen bin, meine drei Sinne in gebührender Weise zu befriedigen.«
»Meine Herren«, begann La Borde, »darf ich Sie zunächst darauf hinweisen, dass ich die Ehre hatte, dieses Gericht vor dem verstorbenen König zuzubereiten, und dass Madame de Pompadour es sich trotz ihres kranken Magens hat schmecken lassen?«
»Die gute Dame war sehr nachsichtig«, sagte Semacgus.
»Keineswegs, sie nahm ein zweites Mal.«
»Meine Herren, lassen Sie die Scherze«, flehte Noblecourt, »das Essen wird kalt.«
»Stellen Sie sich eine schöne Lammkeule vor«, fuhr La Borde voller Emphase fort, »ein paar Tage im Kühlen aufbewahrt, damit sie zart und mürbe wird. Zunächst muss man den Knochen durchbrechen und das Fleisch herausschneiden, ohne die Hülle zu verletzen. Dafür habe ich auf das Können eines Meisters zurückgegriffen.«
»Ein Rotisseur aus der Rue Saint-Honoré?«, fragte Nicolas.
»Keineswegs. Ein Marinewundarzt, der ein wahrer Meister im Schneiden und Aushöhlen ist.«
»Es stimmt, dass meine Klingen sehr nützlich gewesen sind«, erklärte Semacgus und schloss dramatisch die Augen.
»Pfui, Sie Schlimmer!«, rief Noblecourt. »Sagen Sie mir nicht, dass Sie Ihre Instrumente benutzt haben, die dazu dienen …«
»Ich sollte es Sie glauben lassen, um Ihnen den Appetit zu verderben.«
»So werde ich nie weiterkommen«, seufzte La Borde, »wenn Sie mich ständig unterbrechen. Das aus dem Inneren geholte Fleisch müssen Sie fein hacken und mit ein wenig Speck, Kalbsnierenfett, Pilzen, Eiern, Salz, Pfeffer und Gewürzen mischen, dann alles sorgfältig durchkneten, um sicherzustellen, dass die Würze sich gleichmäßig verteilt. Anschließend füllen Sie die Haut mit der Masse, damit die Keule wieder ihre natürliche Gestalt bekommt, binden sie von allen Seiten mit einem Bindfaden zusammen und braten sie an, bis sie eine schöne Bräune hat. Dann geben Sie sie in einen Topf mit einer guten Bouillon double und einem Stück halb gebratenem Rindfleisch, das seine Säfte an sie abgeben und ihr mehr Geschmack verleihen wird. Fügen Sie mit Nelken gespickte Zwiebeln und ein Bouquet garni hinzu und drehen Sie die Keule nach einer guten Stunde im Topf um. Um festzustellen, ob sie gar ist, überprüfen Sie mit der Fingerkuppe die Weichheit des Fleisches. Wenn Sie die Sauce reduziert haben, übergießen Sie die fachgerecht aufgeschnittene Keule mit dieser köstlichen, sämigen Flüssigkeit.«
Vivatrufe begleiteten Monsieur de La Bordes Ausführungen. Alle schickten sich an, ein Gericht zu würdigen, das sich besser mit dem Löffel als mit Messer und Gabel essen ließ. Nicolas beobachtete aus den Augenwinkeln seinen Sohn, glücklich, dass er mit geübter Eleganz aß, worin sich wie in anderen Verhaltensweisen das Erbe des Marquis de Ranreuil, aber auch die angeborene Anmut seiner Mutter widerspiegelte.
»Das ist ein Gericht«, sagte Noblecourt, »wie geschaffen für meine alten Zähne.«
»Die knusprige Kruste verbindet sich prächtig mit der weichen Füllung«, fügte Semacgus hinzu. »Und dieses violette Getränk harmoniert gut mit dem Lamm.«
»Nicht wahr?« Bourdeau war hocherfreut. »Ich finde, dass die Knoblauchpilze in diesem dünnen Teig ihren vollmundigen Geschmack und alle Düfte des Waldes bewahren.«
Noblecourt wandte sich an Louis. »Das«, sagte er, »ist ein Souper, an das Sie sich im Collège erinnern werden und das Ihnen schöne Träume schenken wird.«
»Ich werde mit Dankbarkeit daran denken, Monsieur«, versicherte der Junge, »wenn ich zähes gekochtes Rindfleisch und stinkenden Hering essen werde. Hoffentlich stärkt es wenigstens meinen Mut.«
Alle lachten. Derweil stellte Catherine eine Platte mit Krapfen, die mit kandierten Quitten gefüllt und mit Zucker bestäubt waren, auf den Tisch. Der alte Staatsanwalt lächelte und gab Poitevin ein Zeichen, der daraufhin verschwand und mit zwei Päckchen zurückkam.
»Junger Mann.« Noblecourt öffnete das größere. »Ich litt als Schüler ebenso wie Sie unter harter Disziplin und Hunger. Meine Mutter, die Mitleid mit mir hatte, gab mir Quittengelee mit, den ich jeden Abend lutschte, um meinen Heißhunger zu stillen.« Er nahm eine Reihe runder, flacher Holzdosen aus dem Päckchen. »In diesen kleinen Behältern finden Sie mit ein wenig Weißwein vermischtes Quittengelee, das Ihren Hunger stillen und zugleich Bauchschmerzen lindern wird, die das schlechte Essen im Kolleg zweifellos auslösen dürfte. Sie müssen sie allerdings sorgfältig verstecken, da Diebstahl in derartigen Institutionen an der Tagesordnung ist. Wenn Sie maßvoll damit umgehen, sollte der Vorrat bis Weihnachten reichen.«
Nach dieser Ansprache des Hausherrn an seinen jungen Gast wandte sich die Unterhaltung allgemeineren Themen zu.
»Trägt man am Hof immer noch Trauer für unseren König?«, fragte La Borde mit dieser gespielten Gleichgültigkeit, die kaum verbarg, wie sehr es ihn betrübte, nicht mehr im Mittelpunkt der Welt von Versailles zu leben.
Nicolas antwortete ihm. »Man empfiehlt einen Anzug aus Tuch oder Seide, je nach Wetter, schwarze Seidenstrümpfe, Degen und Silberschnallen, an den Fingern nicht mehr als ein Diamant. Und ein Hemd mit schmalen, gesäumten Manschetten. All das bis zum ersten November; ab der Vigil vor Weinachten wird es dann weniger strenge Vorschriften geben.«
»Sie wissen eine ganze Menge dafür, dass Sie bei Hof nicht besonders wohlgelitten sind«, merkte La Borde an.
»Ich habe dort nach wie vor meinen Platz, da ich dem Rat meiner Freunde gefolgt bin.«
»Man berichtete mir«, sagte Noblecourt, »der König habe Monsieur de Maurepas, seinem wichtigsten Berater, befohlen, gewisse Missbräuche abzuschaffen. Merkt man schon etwas davon?«
»Man hat hundertdreißig Pferde und fünfunddreißig Stallburschen für die königliche Parforcejagd gestrichen«, erklärte La Borde.
»Großartig«, sagte Bourdeau spöttisch. »Man reduziert die Pferde, und gleichzeitig gibt der König den Launen der Königin nach und vergrößert seinen Haushalt, obwohl er weiß Gott genug Personal hat. Und zu allem Überfluss braucht sie noch einen Großalmonesier speziell für das religiöse Leben bei Hof und einen Bediensteten für das Siegelwachs!«
»Man sieht, dass Bourdeau ebenfalls gut unterrichtet ist«, spottete Semacgus.
»O nein«, erwiderte der Inspektor. »Ich beobachte lediglich aufmerksam, wo das Geld des Volkes verschwendet wird.«
»Es ist lange her, dass Sie Ihre bissige Kritik geäußert haben.«
»Ich sage und behaupte«, echauffierte sich der Inspektor, »dass die Schaffung von Hofämtern einen Haushalt belastet, der durch die militärischen Operationen auf Korsika ohnehin überstrapaziert ist. Denken Sie allein daran, dass die Inselbewohner nicht ermessen, was für ein Glück sie haben, Franzosen zu sein. Rebellen und Banditen verwüsten die Landschaft und erpressen unter massiven Drohungen Geld.«
»Das nimmt in der Tat täglich größere Ausmaße an. Unser Befehlshaber vor Ort, Monsieur de Marbeuf, hat soeben die Hochebene des Niolo befriedet. Man hat vor den Kirchen Delinquenten gerädert, in Anwesenheit der Bevölkerung. Sechshundert Gewehre sind in einer Klostergruft beschlagnahmt worden, was eine furchtbare Vergeltung zur Folge hatte: Zwei Mönche wurden auf der Stelle gehängt. Es ist vorherzusehen, dass die Sache sich hinziehen wird, und wer weiß, ob wir das Ende erleben werden.«
»Blasen wir nicht Trübsal«, schaltete Noblecourt sich ein. »Reden wir von Erfreulicherem. La Borde, ich bin sicher, dass Sie die erste Vorstellung von Orphée et Eurydice von Monsieur Gluck gesehen haben. Was sagen Sie dazu, Sie, der Sie sich in diesen Dingen auskennen?«
»Um die Wahrheit zu sagen«, erwiderte der ehemalige Erste Kammerdiener, der die Ironie nicht bemerkte, die in der Stimme des Staatsanwalts mitschwang, »diese Tragédie-opéra hat das Publikum begeistert, und der Erfolg hat denjenigen von Iphigénie en Aulide im letzten April übertroffen.«
»Genau das habe ich auch festgestellt«, stimmte Noblecourt zu und genoss die Überraschung seiner Freunde, die wussten, dass der alte Staatsanwalt das Haus so gut wie nicht mehr verließ. »Nun, in Abwesenheit von Nicolas, der auf der Jagd nach schönen Damen und Tieren in den Wäldern von Compiègne war, habe ich anspannen lassen. Poitevin hat seine neueste Livree angezogen, und ab ging die Post.«
Er betrachtete Nicolas aus den Augenwinkeln und zwinkerte ihm zu.
»Als ich in die Oper kam, hat Monsieur Balbastre, unser serviler Leiter der Concerts Spirituels des Tuileries, mir honigsüß geholfen, meinen Platz zu finden. Überaus liebenswürdig, an der Grenze zur Scheinheiligkeit. Kurz, ich habe mir die Vorstellung angesehen und bestätige den Erfolg. Nur was für einen Erfolg? Bei wem? Abgesehen von Ihnen, La Borde, der fachmännisch zu urteilen vermag, selbst wenn ich in diesem Fall Ihren Geschmack nicht teile. Was habe ich gesehen? Einen Saal, gefüllt zu drei Vierteln mit alten Galanen und jungen Stutzern von der Art, die ihre Zeit damit verbringen, in den Modesalons Zuschnitte aus Papier zu machen. Diese Meute gerät aus dem Häuschen, sobald ein neuer Kopf auftaucht, sofern dieser mehr oder weniger aus dem allgemeinen Gedränge herausragt. Und was ich gehört habe, war nichts als ein Sammelsurium höchst unterschiedlicher Dinge. Ein katastrophaler Mischmasch von Tönen und Eindrücken, der den Verstand verspottet und lähmt, um die Einfallslosigkeit eines Komponisten zu kaschieren, der Gott um ein bisschen Inspiration anflehen sollte. O ja! Da gehe ich lieber zu den Klarissen in Longchamp, um mir dort die Leçons des ténèbres anzuhören. Für mich, meine Herren, ist mit diesem Christoph Willibald Gluck keinerlei Staat zu machen.«
Die Verblüffung nutzend, die sein drastisches Urteil bei den Anwesenden ausgelöst hatte, schnappte er sich mit der einen Hand eine Scheibe Lammkeule, während er mit der anderen in aller Eile sein Glas griff und es austrank.
La Borde schüttelte den Kopf. »Mein lieber Noblecourt, erlauben Sie, dass ich Ihnen widerspreche. Ich für mein Teil bin der Ansicht, dass der feinste Pinsel nicht ausreicht, die Details einer unvergesslichen Vorstellung wiederzugeben. Ja, Monsieur, endlich etwas Neues. Schluss mit der Vokalität à l’italienne! Schluss mit den traditionellen Automaten des Genres und ihren quälenden Rezitativen!«
»Und zugunsten von was?«, entgegnete Noblecourt. »Lauter falsche Töne und Spatzengesang! Wie es dieser Haute-contre bewiesen hat, der die Rolle des Orpheus gesungen hat.«
»Monsieur«, meldete Louis sich schüchtern zu Wort, »dürfte ich es wagen, Sie zu bitten, mir zu erklären, was einHaute-contre ist?«
»Ich gratuliere Ihnen, dass Sie diese Frage stellen. Man darf seine Wissenslücken niemals verbergen. Das ehrt Sie, und es wird uns stets eine Freude sein, Sie weiterzubilden, mein Junge. Es ist das Wissen, das den anständigen Menschen ausmacht, und nicht der brillante, dabei hohle Geist. Wer sein Thema beherrscht, wird immer ernst genommen und geschätzt. Monsieur de La Borde, der sich selbst an Opern versucht, wird Ihnen antworten, das verschafft mir eine kleine Pause, um Luft zu schnappen.«
»Luft ja, doch nicht noch ein Stück Lammkeule und keinen Saint-Nicolas mehr«, warf Semacgus ein. »Als Arzt verbiete ich Ihnen das aufs Nachdrücklichste.«
Noblecourt machte ein zerknirschtes Gesicht, während am Tischrand schnuppernd das Köpfchen von Mouchette, Nicolas’ Katze, auftauchte, angelockt von den verführerischen Düften.
»Ein Haute-contre«, erklärte La Borde, »ist eine hohe Tenorstimme, die vor allem in der französischen Oper vorkommt. Ihre Besonderheit besteht darin, dass die Höhe durch die Bruststimme erzeugt wird. Um auf unsere Diskussion zurückzukommen: Ich bin erstaunt, dass Sie diese Wahl für die Rolle des Orpheus kritisieren. Es ist schließlich eine Verbeugung vor den französischen Gewohnheiten, die Sie so lieben. All das, werden Sie mir sagen, zugunsten von was?«
»Ja, von was. Ich warte ungeduldig auf Ihre Antwort.«
»Na, zugunsten eines natürlichen Gesangs«, fuhr La Borde fort, »stets geleitet von dem wahrsten, empfindsamsten Ausdruck, mit einer überaus betörenden Melodie, einer unvergleichlichen Vielfalt in den Ausdrucksweisen und den größten harmonischen Wirkungen, die gleichermaßen für Schreckliches, Pathetisches und Anmutiges verwendet werden. Mit einem Satz, es ist echte musikalische Tragödie in der Linie von Euripides und Racine. In Gluck erkenne ich einen Mann von Genie und Geschmack, bei dem nichts schwach oder nachlässig ist.«
»Wenn man Sie beide so hört«, bemerkte Semacgus, »meine ich, das gleiche Diskussionsschema wiederzuerkennen, das unser Gastgeber so häufig anwendet, wenn er sich über die neuen Gepflogenheiten in der Küche auslässt.«
»Sie haben vollkommen recht. Abgesehen davon, dass unser Freund in der Küche das Natürliche und Wahre schätzt und in der Musik das Gekünstelte, Hohle und Geschminkte verteidigt.«
»Ich bin keineswegs überzeugt.« Noblecourt wiegte nachdenklich den Kopf. »Ich muss meine Widersprüche nicht rechtfertigen. So, wie ich der Meinung bin, dass Fleisch Fleisch sein und nach Fleisch schmecken muss, so entzückt mich in der Kunst die Fantasie. Eine geregelte und strukturierte Fantasie, die einen zum Träumen bringt.«
»Dafür regt einen die Tiefe des neuen Stiles zum Nachdenken an«, hielt ihm La Borde entgegen, »indem sie die Emotion der Tragödie mit dem Liebreiz und der Leidenschaft der Melodie verbindet.«
»Ich sehe darin nichts als Mängel und bloßen Schein. Weder Fisch noch Fleisch, falsch und trügerisch.«
»Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass Sie reden wie die Direktoren unserer Académie Royale de musique, die sich kaum für die ausländische Kunst interessieren, aus Furcht, sie würde die ihre vom Sockel stürzen.«
»Friede, meine Herren«, mahnte Semacgus. »Im Grunde haben Sie beide recht, aber aus einem perversen Vergnügen heraus treiben Sie Ihre Argumente mit noch mehr Boshaftigkeit auf die Spitze als der Präsident der Akademie.«
»Ach, darin besteht ja gerade das Vergnügen«, sagte Noblecourt und ließ ein Lachen hören. »Das Unhaltbare zu verteidigen, die Argumentation über das vernünftige Maß hinaus zuzuspitzen und ungeheuerliche Argumente vorzubringen, all das macht die Diskussion erst zu einem Vergnügen.«
»Sie geben es also zu?«
»Keineswegs. Ich sage bloß, dass man die Kontroverse verschärfen und seinen Ausführungen ein wenig Würze verleihen muss. Das Gegenteil würde darauf hinauslaufen, eine langweilige Doktorarbeit vor den Professoren der Sorbonne zu verteidigen.«
Marion näherte sich Louis, der sich kaum noch wach halten konnte, und gab ihm einen Beutel mit frischen Haselnüssen von einem Baum im Garten. Auch Nicolas bemerkte die Müdigkeit seines Sohnes.
»Ich glaube, meine Freunde«, sagte er und blickte auf seine Repetieruhr, »dass es Zeit wird, diesen denkwürdigen Abend zu beenden. Unser Gastgeber muss sich ausruhen nach diesem königlichen Festmahl und nach seinen Exzessen als Staatsanwalt.«
»So früh?«, protestierte Noblecourt. »Sie wollen diesen köstlichen Moment jäh beenden?«
»Es ist weit nach Mitternacht, und Louis muss zu seiner Mutter zurück, die auf ihn wartet. Morgen in aller Früh fährt er mit der ersten Postkutsche nach Juilly in sein Kolleg.«
»Bevor er uns verlässt, möchte ich ihm ein Geschenk machen«, sagte der Staatsanwalt, öffnete das zweite Päckchen und nahm zwei kleine Bücher heraus, die in Maroquinleder mit seinem Wappen gebunden waren.
»Das«, sagte er mit aufgeräumt würdevollem Ernst, »sind die Metamorphosen von Ovid, übersetzt vom Abbé Banier von der Académie Royale des inscriptions et belles lettres. Diese schönen Bücher sind mit Frontispizen und Illustrationen geschmückt. Mein lieber Louis, ich schenke sie Ihnen von ganzem Herzen …«
Und wie zu sich selbst fügte er leiser hinzu: »Die einzigen Geschenke, die zählen, sind die, von denen man sich schwer und mit Bedauern trennt.«
Dann, wieder lauter: »Mögen diese Fabeln mit ihren Göttern, die sich verwandeln, Sie zum Träumen bringen und die Liebe zur Literatur in Ihnen wecken. ›Hier wird, um uns zu entzücken, jede Möglichkeit nutzbar gemacht: Allen Dingen Körper und Seele, Gesicht und Geist verliehen.‹ Möge ihre Lektüre Sie davon überzeugen, dass das, was auf Lateinisch elegant klingt, nicht unbedingt auf Französisch genauso elegant ist, sondern dass jede Sprache einen Ton, eine Ordnung und ein Genie hat, die für sie charakteristisch sind. Wenn Sie übersetzen müssen, vergessen Sie nicht, dass Sie einfach, klar und korrekt bleiben, um die Gedanken eines Autors exakt wiederzugeben, ohne die Feinheit und Eleganz seines Stils zu vernachlässigen. Denn alles ist miteinander verbunden. Wie im Leben wird man in der Übersetzung hart und herzlos, wenn man sich zu sklavisch an die Prinzipien hält, und der Ton wird spröde und trocken, wenn man seine Gedanken über die des Autors stülpt.«
»Monsieur«, wandte Louis, wieder ganz wach, sich an seinen Gönner, »ich weiß nicht, was ich sagen soll, und möchte Sie auf keinen Fall eines Schatzes berauben, von dem ich weiß, dass Sie sehr daran hängen. Mein Vater hat mir von Ihrer besonderen Liebe zu den Büchern in Ihrer Bibliothek erzählt.«
»Absolut nicht, es ist mir eine Freude, Ihnen etwas davon zu schenken! Seien Sie unbesorgt, ich bewahre sorgfältig die große Folioausgabe mit prachtvollen Kupferstichen von Monsieur Burman auf, veröffentlicht 1732 von Westein et Smith …«
»Herzlichen Dank, Monsieur. Diese Bücher werden mir lieb und teuer sein, da Sie von Ihnen kommen«, sagte Louis, öffnete einen der Bände und blätterte aufmerksam und respektvoll darin. »Monsieur, was bedeuten diese kleinen handschriftlichen Anmerkungen?«
»Es handelt sich um die Übersetzungen, die meine Wenigkeit von den lateinischen Zitaten im Vorwort gemacht hat«, erwiderte der alte Staatsanwalt, der sichtlich seine Freude am Interesse des jungen Mannes hatte. »Sie können ihre Korrektheit überprüfen.«
»Louis«, mischte sich Nicolas ein, »das ist ein wertvoller Begleiter, den unser Freund Ihnen anvertraut. Befolgen Sie seine Ratschläge. Ich bin immer gut damit gefahren. Er war nämlich mein Lehrer, als ich nach Paris kam, und ich war damals höchstens ein paar Jahre älter als Sie.«
Alle erhoben sich, und die Verabschiedungen zogen sich noch eine Weile hin. Semacgus würde Louis mitnehmen und ihn auf der Rückfahrt nach Vaugirard in der Rue du Bac bei seiner Mutter absetzen. Nicolas gab seinem Sohn noch letzte Ermahnungen mit auf den Weg. Insbesondere wollte er, dass dieser ihm jede Woche einen Brief schrieb, und sei er noch so kurz. Als er seine Arme ausbreitete, warf Louis sich ihm an den Hals. Der Kommissar hatte das merkwürdige Gefühl, er sei in eine ferne Vergangenheit zurückgekehrt und sein Vater, der Marquis de Ranreuil, in der Person seines Enkels wiederauferstanden.
Nachdem die Gäste sich verabschiedet hatten, ging er in seine Gemächer hinauf, erfüllt von einer ruhigen Wehmut. Das Leben war ein Kampf voller Zufälle, und das Schicksal versetzte einem häufig mehrere Schläge hintereinander. Diesmal indes war es anders: Dass er in Ungnade gefallen war, wog nichts angesichts der Tatsache, dass das Schicksal ihm Entschädigungen angeboten hatte, die die Bilanz ausglichen. Hinzu kam, dass er die Entdeckung von Louis als unerwarteten Glücksfall betrachtete, für den er der Vorsehung sehr dankbar war.
Montag, den 3. Oktober 1774
Nachdem Mouchette ihn wie gewohnt geweckt hatte, indem sie ihm ins Ohr pustete, galt Nicolas’ erster Gedanke seinem Sohn, für den an diesem Morgen ein neues Leben begann. Er hatte ihm erklärt, dass er bei der Abfahrt der Postkutsche nicht dabei sein könne, weil er fürchte, seine Mutter in eine noch größere Gefühlskrise zu stürzen als die, in welche sie durch die ganzen Veränderungen geraten war. Zum Glück hatte Antoinette, wie die Satin fortan wieder hieß, sich bereit erklärt, die Vergangenheit zu löschen und ihrem Sohn eine Mutter zu sein, derer er sich nicht schämen könnte. Statt weiterhin ein zwielichtiges Etablissement zu betreiben, führte sie jetzt ein ehrbares Leben. Dabei fiel es ihm nach wie vor schwer, die Frau von damals mit der von heute in Übereinstimmung zu bringen.
Als er die Rue Montmartre verließ, hüllte ein herbstlicher Nebel die Passanten und Kutschen ein. Wo sollte er mit den Besorgungen anfangen, die er sich vorgenommen hatte? Er musste Benzin kaufen, um Flecken von Stoffen zu entfernen, und würde es Louis zukommen lassen. Internatsschüler hatten bekanntlich keine Möglichkeit, ihre Kleidung zu reinigen, lediglich die Leibwäsche wurde von der Schule gewaschen. Außer dem Vorteil, dass es die Farben der Stoffe nicht veränderte, hatte das Benzin die schätzenswerte Eigenschaft, Wanzen und ihre Eier, Schmetterlinge und Wolle fressende Insekten zu töten.
Nicolas hatte den Erfinder dieses wertvollen Produkts in Versailles in der Rue de Conti entdeckt. Der Erfolg der Formel hatte den Händler veranlasst, ein Lager für sein Produkt in Paris im Grand-Cour des Quinze-Vingt einzurichten, bei einem Kurzwarenhändler. Nicolas wusste, dass jede Flasche in einen Hinweiszettel gewickelt war, der seinen Sohn darüber aufklären würde, wie er dieses Benzin anzuwenden hatte.
Anschließend wollte er bei Madame Peloise vorbeischauen, die gegenüber der Comédie-Française ein Geschäft mit einer Vielzahl künstlicher Steine in verschiedenen Farben hatte, die Halbedelsteine imitierten. Er würde einen aussuchen und die Initialen seines Sohnes eingravieren lassen, damit er den Stein als Stempel benutzen konnte. Einen Augenblick lang ging ihm der Gedanke durch den Kopf, das Wappen der Ranreuils eingravieren zu lassen, um den Enkel in eine genealogische Linie mit dem Großvater zu stellen. Ein unbewusster Instinkt ließ ihn zögern. Es war, als fürchtete er, dieses Herausstellen hochadlige Abstammung könnte sich womöglich nachteilig für den Jungen auswirken.
Nicolas dachte lange darüber nach. Warum befanden sowohl sein Vater als auch er sich in der Situation, einen unehelichen Sohn zu haben? Einfach Zufall oder eine Art schicksalhafter Wiederholung, deren Grund ihm verborgen blieb? Als Letztes beschloss er, bei den Bouquinisten vorbeizuschauen, um ein paar wertvolle Bücher aufzustöbern, die er dem Paket beifügen würde, das er Louis in nächster Zeit ins Collège de Juilly schicken wollte.
Erfreut stellte er fest, dass seine geplanten Einkäufe ihn alle in dasselbe Viertel führen würden, in die Rue Saint-Honoré und die Gegend um den Louvre. Nach einem belebenden Marsch begann er seine Runde bei Madame Peloise. Eine geschickte Verkäuferin, die es fertigbrachte, dass er viel mehr ausgab als geplant. Ein antikes Intaglio, ein Schmuckstein, in den ein römisches Profil eingeschnitten war und der auf einem silbernen Griff stand, ließ ihn die ursprüngliche Idee eines Stempels mit Initialen vergessen. Das hier war nicht nur eleganter und weniger banal, sondern auch ungewöhnlicher. Von dort aus begab er sich zu dem Erfinder des Fleckenbenzins, der ihm die Sache insofern vereinfachte, als er ihm anbot, die gewünschte Menge nach Juilly an Louis Le Floch zu liefern.
Er verließ das Labyrinth der alten Straßen um den Grand-Cour des Quinze-Vingt herum, um sich zu den Galeries du Louvre zu begeben. Mit Bedauern stellte er fest, dass der alte Palast der Könige immer stärker durch alle möglichen Auswüchse entstellt wurde. Kaum war die Kolonnade freigeräumt worden, wurde sie sofort von einer Vielzahl von Trödlern mit Ständen voller Lumpen und Schund verunstaltet. Zudem hatte die Nähe der Akademien dazu geführt, dass einige ihrer Mitglieder auf das Palastgelände gezogen waren und in den Höfen überall Häuser aus Balkenwerk mit klobigen Treppen aus dem Boden schossen. Die einstige Majestät des Gesamtkomplexes war verloren.
Nicolas erinnerte sich an eine Unterhaltung zwischen Monsieur de La Borde und dem Marquis de Marigny, dem Bruder der Pompadour und Obersten Verwalter der königlichen Gebäude, in der es um den großzügigen Plan gegangen war, den Palast in seiner alten Pracht wiederherzustellen. Dabei war Voltaire zitiert worden, der darüber gejammert hatte, dass der Louvre, »Denkmal der Größe von Ludwig XIV., des Eifers von Colbert und des Genies von Perrault durch Gebäude von Goten und Wandalen« verdeckt werde.
Eine Vielzahl von Buden und Ständen hatte sich mittlerweile in Höfen und Durchgängen und vor allem in den Kolonnaden des riesigen Gebäudes eingenistet. Viele Händler verhökerten Bilder und Stiche, dabei übertraf die Zahl der Fälschungen diejenige der echten Werke bei Weitem, und die Polizeipräfektur war ständig damit beschäftigt, einige üble Affären aufzuklären, insbesondere wenn reiche Ausländer Opfer der berufsmäßigen Halsabschneider geworden waren und sich mit diplomatischem Geschick an ihre Botschafter gewandt hatten. 1772 war es Nicolas gelungen, eine Gruppe von Fälschern zu entlarven, und dieser Erfolg hatte der Szene einen empfindlichen Schlag versetzt.
Die Händler, anständig oder nicht, kannten ihn, und sein Auftauchen ließ sie stets vor Angst erzittern. Das Interesse ihrer aufgeklärten Klientel nutzend, machten die Bouquinisten neuerdings gemeinsame Sache mit den Verkäufern von Druckgrafik und Bildern, wobei sie manchmal weniger gute Ware und manchmal die beste anboten. Nicolas erinnerte sich an ein paar hervorragende Entdeckungen wie die einer Originalausgabe des Pâtissier Français von François-Pierre de la Varenne. Dieses kleine, in rotes Maroquin gebundene, 1655 in Amsterdam von Louys und Daniel Elzévir veröffentlichte Buch hatte Monsieur de Noblecourt an den Rand einer Ohnmacht gebracht, als er es ihm geschenkt hatte.
Im Übrigen waren die Bouquinisten immer zur Stelle, wenn es einen Trauerfall gab, und kauften den in Tränen aufgelösten Familien ganze Bibliotheken ab. Da jedoch nichts verborgen blieb, waren die seltenen Bücher schnell weg, und mit der Zeit stiegen wegen der hohen Nachfrage die Preise. Nichts, was ein Vermögen wert war, wurde mehr zu einem Spottpreis verkauft. Gefragte Objekte waren außerdem verbotene Bücher, die mit Verschwörermiene zu Wucherpreisen unter dem Ladentisch angeboten wurden. Ein gefährliches Geschäft, denn an diesen Ständen trieben sich bevorzugt die Polizeispitzel herum, um jene Leute zu identifizieren und zu denunzieren, die unerlaubte Broschüren und Bücher zum Verkauf anboten oder die Schmähschriften suchten, die dem Scheiterhaufen entgangen waren.
Bei einem dieser Bouquinisten entdeckte Nicolas einen Plautus, einen Terenz, die gesammelten Werke von Racine und einen Le Sage, die einen Schüler glücklich machen sollten. Amüsiert beobachtete er die Bücherfreunde um sich herum, die von der Vielfalt der angebotenen Auswahl magnetisch angezogen wurden. Sie bedrängten den Händler, der stets fürchtete, dass ihm ein wertvolles Buch gestohlen werden könnte, und blätterten stundenlang in den Büchern oder stöberten in den Kisten, ohne dass diese Suche immer zu einem Kauf führte.
In den Bericht einer Reise nach Westindien vertieft, spürte Nicolas plötzlich, wie eine Hand ihn an seiner Anzugjacke zog. Als er sich umdrehte, erkannte er die zerknirschte Miene eines Polizisten, der der Dienststelle des Polizeipräfekten in der Rue Neuve-Saint-Augustin zugeteilt war. Der Mann war nicht allein; ein zweiter Uniformierter, an dessen Gesicht er sich nicht erinnern konnte, beobachtete die Szene.
»Monsieur le Commissaire«, sagte der erste, »Sie müssen uns folgen.«
»Was heißt das?«
»Wir haben den Befehl, Sie unverzüglich zu Monsieur Le Noir zu bringen.«
Nicolas bemühte sich, seine Verblüffung zu verbergen. »Sie erlauben hoffentlich, dass ich zunächst meine Käufe bezahle.«
Nachdem das erledigt war, fand er sich mit den beiden Polizisten in einer Kutsche wieder. Die Fenster waren geschlossen und die Vorhänge vorgezogen. In der stickigen Luft stiegen ihm die Gerüche ungewaschener Körper besonders unangenehm in die Nase. Er nahm seinen Hut ab und zog sich in sich selbst zurück, um nachzudenken über das, was ganz wie eine Verhaftung aussah. Schließlich kannte er die Vorgehensweise und die Gewohnheiten einer Behörde, für die er viele Jahre gearbeitet hatte, allzu gut, hatte an so vielen Untersuchungen teilgenommen und so viele Geheimnisse geteilt, dass er nicht umhinkonnte, sich Gedanken zu machen.