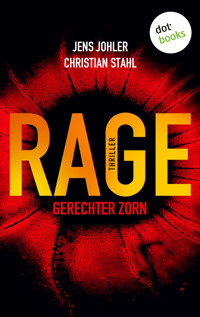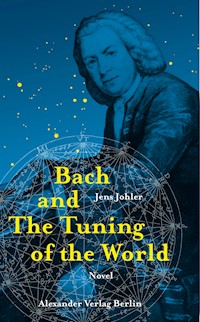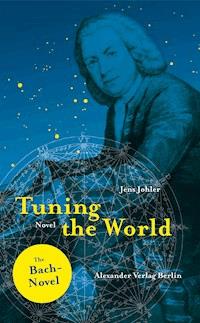Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Troller und Andersen ermitteln
- Sprache: Deutsch
Er mordet im Namen des freien Willens: der Wissenschaftsthriller »CONTROL – Mörderische Rache« von Jens Johler jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Serienmörder mit einer grausamen Mission … Regungslos sitzt ein Mann in einem Spezialstuhl, Arme und Beine gefesselt, der Schädel durchbohrt von Eisenstangen. Wissenschaftsjournalist Troller ist wie erstarrt, als er vom Mord an einem berühmten Gehirnforscher erfährt – denn in seinem Postfach befindet sich eine hochbrisante E-Mail, die niemand anders als der Täter geschickt haben kann. Warum nimmt der Mörder, der sich Kant nennt und behauptet, der Verteidiger des freien Willens zu sein, ausgerechnet mit ihm Kontakt auf? Als der eiskalte Killer ein zweites Mal zuschlägt und versucht, ihn in sein dunkles Spiel hineinzuziehen, ist klar: Troller und seine Partnerin Jane müssen Kant stoppen, bevor sein bizarrer Rachefeldzug weitere Opfer fordert – und Troller selbst in den Kreis der Verdächtigen gerät … Ein Science-Thriller, zutiefst erschütternd und hochspannend: »Bestens recherchiert!« Die Welt Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der temporeiche Thriller »CONTROL – Mörderische Rache« von Jens Johler, ursprünglich bekannt unter dem Titel »Kritik der mörderischen Vernunft«, ist der zweite Band der Reihe um die Ermittler Troller und Anderson, der unabhängig vom ersten Band lesbar ist. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Serienmörder mit einer grausamen Mission … Regungslos sitzt ein Mann in einem Spezialstuhl, Arme und Beine gefesselt, der Schädel durchbohrt von Eisenstangen. Wissenschaftsjournalist Troller ist wie erstarrt, als er vom Mord an einem berühmten Gehirnforscher erfährt – denn in seinem Postfach befindet sich eine hochbrisante E-Mail, die niemand anders als der Täter geschickt haben kann. Warum nimmt der Mörder, der sich Kant nennt und behauptet, der Verteidiger des freien Willens zu sein, ausgerechnet mit ihm Kontakt auf? Als der eiskalte Killer ein zweites Mal zuschlägt und versucht, ihn in sein dunkles Spiel hineinzuziehen, ist klar: Troller und seine Partnerin Jane müssen Kant stoppen, bevor sein bizarrer Rachefeldzug weitere Opfer fordert – und Troller selbst in den Kreis der Verdächtigen gerät …
Ein Science-Thriller, zutiefst erschütternd und hochspannend: »Bestens recherchiert!« Die Welt
Über den Autor:
Jens Johler, geboren 1944 in Neumünster, war nach seiner Ausbildung in München drei Jahre lang Schauspieler an den Städtischen Bühnen in Dortmund. Danach studierte er Volkswirtschaft in Berlin und arbeitete als wissenschaftlicher Assistent an der FU. Er schreibt Radiofeatures, Theaterstücke, Erzählungen, Politthriller und Biographien.
Jens Johler veröffentlichte bei dotbooks bereits mit Olaf-Axel Burow »GENIUS – Eiskalter Plan« und mit Christian Stahl
»RAGE – Gerechter Zorn«.
Die Website des Autors: jens-johler.de/startseite.html
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Januar 2021
Dieses Buch erschien bereits 2009 unter dem Titel »Das falsche Rot der Rose« bei Ullstein.
Copyright © der Originalausgabe 2009 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Stefan Hilden, hildendesign.de unter Verwendung von © Shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-138-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Control« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jens Johler
CONTROL – Mörderische Rache
Thriller
dotbooks.
Aber Fiona glaubte damals wie auch jetzt noch, dass jede Gesellschaft die Verbrecher bekam, die sie verdiente.
Val McDermid, Die Erfinder des Todes
Ein kaltblütiger Mörder hat eben das Pech, eine so niedrige Tötungsschwelle zu haben.
Professor Wolf Singer, Hirnforscher
Wo aber Bestimmung nach Naturgesetzen aufhört, da hört auch alle Erklärung auf, und es bleibt nichts übrig als Verteidigung, d. i. Abtreibung der Einwürfe derer, die tiefer in das Wesen der Dinge geschaut zu haben vorgeben und darum die Freiheit dreist für unmöglich erklären.
Immanuel Kant,
Grundlegung der Metaphysik der Sitten
Kapitel 1
Er trippelte mit kleinen, schnellen Schritten auf die Wand zu, stieß mit dem Kopf dagegen, hörte aber nicht auf zu laufen, seine Beine bewegten sich weiter, ohne dass er von der Stelle kam. Dann, endlich, kamen sie zur Ruhe. Er stand einen Augenblick still, drehte sich dann ruckartig um neunzig Grad nach rechts. Er sah auf seine Füße. Sah, wie sie ihn noch einmal um exakt neunzig Grad drehten und anschließend in die Richtung führten, aus der er gekommen war. Er befand sich jetzt auf dem Trottoir einer belebten Straße. Passanten wichen ihm aus, blieben stehen, machten große Augen, schüttelten die Köpfe. Er schämte sich, so viel Aufsehen zu erregen. Kinder rannten hinter ihm her, flitzten seitlich an ihm vorbei, zeigten auf ihn und kicherten mit hohen Stimmen. Vor einer Schaufensterscheibe blieb er stehen. Er sah sein Bild im Spiegel. Was war das da auf seinem Kopf? Erneut drehte er sich ruckartig in zwei Etappen um. Seine Beine trugen ihn jetzt direkt auf die Straße, mitten zwischen all die fahrenden Autos. Er wich ihnen nicht aus, sie wichen ihm aus. Er lief weiter auf die andere Straßenseite zu, ohne sein Tempo zu drosseln. Das kann nicht gutgehen, dachte er, als ein Lastwagen direkt auf ihn zuraste. Sein Kopf drehte sich nach rechts, auf die Kühlerhaube zu. Jetzt ist es aus, dachte er und schlug die Augen auf.
Troller starrte auf den Schatten des Fensterkreuzes an der Decke. Sein Herz klopfte. Er spürte den Schweiß auf seiner Stirn. Seine Beine schmerzten vom vielen Trippeln.
Er tastete mit der Hand nach rechts. Wo war Jane? Ein Schreck durchzuckte ihn, dann fiel es ihm ein. Jane war in London. Dies war nicht ihre Wohnung, es war seine. Er lauschte auf das hohe, sirrende Geräusch, das von den Heizungsrohren kam.
Ich muss die E-Mails checken.
Mit einem Ruck richtete er sich im Bett auf. Ein stechender Schmerz fuhr ihm durch den Kopf. Er hielt sich mit der linken Hand die Stirn, während er auf die Uhr schaute. Es war kurz nach halb vier.
Ich muss die E-Mails checken, dachte er wieder.
Es war vollkommen unsinnig, er konnte es genauso gut am Morgen machen, aber die Idee saß fest.
Er stand auf und machte sich auf den Weg ins Bad. Als er wieder herauskam, hielt er eine Schlaftablette und eine Doppelpackung Aspirin in der Hand.
In der Küche nahm er ein Glas aus dem Regal, füllte es mit Wasser, riss die Aspirinpackung auf und ließ zwei Brausetabletten ins Glas gleiten. Während sie sich auflösten, dachte er an das Telefongespräch, das er gestern Abend geführt hatte. Es ging eigentlich nur um die Verabredung am kommenden Samstag. Sein Freund Hans-Otto Martens wurde fünfzig und gab ein großes Fest, auf dem ihre alte Band aus der Schülerzeit noch einmal auftreten sollte. Sie hatten erst über die Songs geredet, die sie spielen wollten, und dann noch ein bisschen übers Älterwerden und darüber, dass Troller ja in diesem Jahr auch fünfzig wurde, und auf einmal war alles aus ihm herausgebrochen, er wusste selbst nicht, warum: dass er es leid war, dass er es satt hatte, das ganze Leben, die ewige Wiederkehr des Gleichen und vor allem die totale Wirkungslosigkeit. Natürlich war es undankbar, so zu reden, er hatte einen Job, um den ihn neunzig Prozent seiner Kollegen beneideten, er hatte eine Freundin, um den ihn neunzig Prozent der Männer beneideten, er hatte eine Tochter, die er liebte, auch wenn er sie zu selten sah, er verdiente gut, er war sogar gesund, was wollte er mehr? Er war undankbar, aber wem gegenüber? Dem Schicksal? Warum hatte ihm das Schicksal nicht ein anderes Leben zugewürfelt? Eines, in dem er etwas bewirken konnte. Eines, in dem er sich nicht so nutzlos fühlte. Denn das war er: nutzlos. Er schrieb bedeutende Artikel, aber was bedeutete das schon? Sie verpufften. Wie alles, was für den Pressemarkt geschrieben wurde. »Ich sage ja nicht, dass ich keinen Erfolg habe«, hatte er wörtlich gesagt, »ich habe Erfolg, die Kollegen klopfen mir auf die Schulter und sagen: interessant, hochinteressant, ich werde auch zu Diskussionsveranstaltungen eingeladen, man braucht ja Meinungsvielfalt, sonst wird’s langweilig, und ich bin eben die Kassandra vom Dienst, der Moralist, der Mann, der durch die Gegend läuft und Warnungen ausstößt, vor der Stammzellenforschung, vor der Präimplantationsdiagnose, vor dem Klonen, vor dem Eingriff in die Gehirne, vor Gedankenkontrolle. Ich bin der Exot, der Rufer in der Wüste. Die anderen verstehen nicht, warum ich mich über Dinge aufrege, die sie für banal und ungefährlich halten, und ich verstehe nicht, warum kein Mensch sich darüber aufregt.«
»Aber die Leute lesen doch Woche für Woche deine Artikel«, hatte Hans-Otto eingewendet, um das Gespräch dann schnell wieder auf den kommenden Samstag und den Auftritt der Band zu lenken, und Troller hatte nicht weiter insistiert. Es war auch sinnlos, mit Hans-Otto darüber zu reden.
Die Aspirin hatten sich aufgelöst. Er legte die Schlaftablette auf seine Zunge, spülte sie mit dem sprudelnden Zeug herunter und ging zurück ins Arbeitszimmer.
Auf dem Schreibtisch neben dem Notebook lagen stapelweise Bücher mit Titeln wie: Descartes’ Irrtum, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Mind Time – Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Der menschliche Geist oder Das Ende des Menschen. Bücher, mit deren Hilfe er wiederum ein neues Buch schreiben wollte.
Sinnlos.
Troller klappte das Notebook auf und öffnete den E-Mail-Ordner. Er sah die Anführungsstriche in der Absenderzeile und war drauf und dran, die Mail ungelesen zu löschen. Spam, dachte er. Die Verfasser von Spam-Mails hatten eine ausgeprägte Neigung, ihre phantasievoll erfundenen Namen mit Anführungsstrichen zu versehen. Der Absender dieser Mail nannte sich »Kant«. Das war bestimmt nicht sein richtiger Name, aber er weckte Trollers Neugier. Eine Mail mit dem Absender »Kant« schickt man nicht so einfach in den Papierkorb, nicht wenn man Journalist ist und sich mit Wissenschaft und Philosophie beschäftigt.
Wer war »Kant«? Wer Kant ohne Anführungsstriche war, wusste Troller natürlich, aber »Kant«? Selbst wenn es sich um Spam handelte – war es nicht komisch, den Namen des Philosophen der Aufklärung als Absender zu wählen, um damit Prozac, Viagra oder Cialis anzupreisen? Oder wollte »Kant« Bücher verkaufen? Oder philosophische Computerspiele? Die Schlacht zwischen Nominalisten und Realisten?
Aber niemand, der Computerspiele verkaufte, würde als Betreff das Wort Prolegomena eingeben.
Troller schwankte zwischen Neugier und Angst vor einem Virus, der seine Festplatte infizieren und zum Absturz bringen könnte. Schließlich siegte die Neugier.
Die Mail bestand aus einem einzigen Satz:
Ich werde in dieser Nacht mit unserer praktischen Kritik beginnen, Troller. – Kant
Diesmal ohne Anführungsstriche.
Ich werde in dieser Nacht ...?
Wer war dieser Kant? Und was meinte er mit »unserer praktischen Kritik«? Wer waren »wir«? Kant und ein anderer oder eine ganze Gruppe? Oder Kant und – er, Troller? Wie kam dieser Kerl dazu, ihm eine derart vertrauliche, ja verschwörerisch klingende Mail zu schicken?
Merkwürdig.
Es gab die drei berühmten Kritiken von Immanuel Kant: die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft, wobei man als sein Hauptwerk immer die Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781 bezeichnete, in der Kant dem menschlichen Verstand seine Grenzen aufzeigt. In der Kritik der praktischen Vernunft dagegen ging es um die Frage der Ethik. Alle drei Kritiken waren Bücher, philosophische Schriften – aber mit »praktischer Kritik« war normalerweise etwas anderes gemeint. Praktische Kritik, das hieß im Jargon der Revolutionäre des neunzehnten Jahrhunderts und auch später noch: Jetzt wird auf den Putz gehauen, jetzt bringen wir die Verhältnisse zum Tanzen, jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird gehandelt!
Was, zum Teufel, sollte es also bedeuten, dass jemand, der sich Kant nannte, in dieser Nacht mit irgendeiner praktischen Kritik begann?
Kryptisch, dachte Troller, äußerst kryptisch – und wenn er etwas hasste, dann war es Geheimnistuerei. Es gab genug Rätsel auf dieser Welt, da musste man nicht auch noch zusätzlich Verwirrung stiften.
Ich werde heute Nacht mit unserer praktischen Kritik ...
Die Schlaftablette begann zu wirken.
Troller klappte das Notebook zu und ging zurück ins Bett.
Ich werde heute Nacht, nein morgen, Jane anrufen, dachte er im Dämmerzustand, und sie fragen, ob wir mit der Kritik der praktischen Vernunft ...
Er schreckte aus dem Halbschlaf auf, legte sich auf die andere Seite – und schlief ein.
Kapitel 2
Das Wasser prasselte belebend auf ihren Kopf, rann über ihr Gesicht, das sie ihm mit leicht geöffnetem Mund entgegenhielt, und sprudelte energisch über Schultern, Brüste, Bauch und Beine. Es schmeckte nach Chlor, aber das war nun einmal so in großen Städten, zu Hause in Berlin nicht, aber dafür in New York, Boston oder San Francisco, und hier in London auch. Immerhin bereiteten sie den Kaffee nicht mit gechlortem Wasser zu, nicht hier im Méridien am Piccadilly, nur einen Steinwurf entfernt vom Piccadilly Circus.
Das Méridien war ein Fünfsternehotel mit einer großzügigen Bade- und Saunalandschaft, einem recht ordentlichen Schwimmbad und einem Fitnessraum, in dem Jane gerade eine Stunde trainiert hatte. Jetzt freute sie sich auf das Frühstück. Sie hatte noch viel Zeit, bevor sie losmusste. Es war der Tag der Urteilsverkündung über Frederick McKinnock, den Mann, den sie den Erlöser nannten.
Der Erlöser – niemand wusste, wer ihn zuerst so genannt hatte, die Presse, der Volksmund, er sich selbst? – war wegen Mordes in siebenunddreißig Fällen angeklagt, allesamt an schwerkranken, meist alten Menschen, die todgeweiht waren und sich nur noch von Tag zu Tag, von Minute zu Minute ihrem Ende entgegen quälten. Er hatte die unterschiedlichsten Methoden angewandt, um diese Menschen von ihren Qualen zu erlösen, wie er es selbst nannte. Es sei ihm nicht um Euthanasie gegangen, er habe nicht »unwertes Leben« beseitigen wollen, er habe nur an die Menschen gedacht. Er habe gesehen, wie sie den Tod herbeisehnten, und habe es nicht mehr mit ansehen können. So umstritten und heftig diskutiert seine Taten auch waren – dass es ihm nicht um Eigennutz oder persönliche Bereicherung gegangen war, schien niemand zu bestreiten.
Jane war während des drei Monate dauernden Prozesses einige Male in London gewesen, hatte mit Kollegen, Anwälten, Ärzten oder Leuten auf der Straße gesprochen und versucht, etwas von der erregten Stimmung und der hitzigen Diskussion über Sterbehilfe, Euthanasie, Apparatemedizin, lebensverlängernde Maßnahmen, humanes Sterben und so weiter nach Deutschland zu berichten, wo die Taten des Erlösers eine noch heftigere Debatte ausgelöst hatten als in England, weil in Deutschland die Erinnerung an die Euthanasieprogramme der Nazis immer noch lebendig war. Das hatte man auch an dem harten Urteil gegen den Krankenpfleger von Sonthofen gesehen, der an die dreißig Patienten getötet hatte, aus Mitleid und Überforderung, wie es hieß. Eine Kollegin, die Jane eigentlich sehr schätzte, hatte damals geschrieben, der Fehler läge darin, dass ein ungeschulter und schlecht bezahlter Pfleger mit solchen Fällen betraut gewesen sei, der Mann sei überfordert gewesen, ihm hätte es an Professionalität gefehlt. Aber was hieß Professionalität? Ein Arzt war in dem Prozess als Zeuge aufgetreten und hatte zu Protokoll gegeben, seine auf 47 Kilo abgemagerte Krebspatientin hätte mit künstlicher Ernährung durchaus noch eine oder sogar zwei Wochen am Leben gehalten werden können. War das Professionalität?
Jane schob den Hebel des Wasserhahns zurück, verließ die Duschkabine und trocknete sich mit dem flauschigen weißen Handtuch ab. Es war kurz vor acht. Die Urteilsverkündung war für 10.30 Uhr angesetzt. Von hier bis zum Old Bailey brauchte das Taxi kaum mehr als eine Viertelstunde. Sie hatte also unendlich viel Zeit für das grandiose Frühstück, auf das sie sich schon freute, und auch dafür, ihre Aufzeichnungen noch mal durchzugehen, damit sie alles im Kopf hatte, wenn sie sich gleich nach dem Urteilsspruch ans Notebook setzen und ihren Artikel schreiben würde.
Sie begann, ihre Haare zu föhnen, und überlegte dabei, ob sie Troller anrufen und ihn fragen sollte, ob er mit seinem Artikel über den Quantencomputer rechtzeitig fertig geworden war. Aber natürlich war er fertig geworden, sie kannte ihn gut genug. Es war nur möglich, dass er unzufrieden war. Das war sogar wahrscheinlich. Er war fast immer unzufrieden und glaubte, dass er es noch besser hätte machen können. Er gehörte nun einmal nicht zu den Kollegen, die jeden Satz, den sie geschrieben hatten, selbstverliebt bejubelten. Das waren ohne Zweifel die glücklicheren Naturen als die bis ins Pedantische hinein selbstkritischen, und das Gemeine daran war: Man konnte sich nicht einmal damit trösten, dass sie schlechtere Journalisten waren. Es war weder ein Zeichen von guter noch von schlechter Qualität, wenn jemand mit sich selbst zufrieden war, und ebenso wenig, wenn er es nicht war. Es hatte nur etwas mit seinem Temperament zu tun, mit seiner genetischen Grundausstattung oder seiner familiären Konditionierung. Die Unglücklichen neigten dazu, sich für ernsthafter, tiefer, seelenvoller, gründlicher oder was auch immer zu halten, damit sie wenigstens eine Kompensation für ihre Selbstquälerei bekamen, aber die Wahrheit war: Es gab einfach glücklichere und unglücklichere Naturen. Und Troller gehörte nun einmal nicht zu den glücklichen. Was wiederum nicht hieß, dass er ständig deprimiert war, das nicht, das hätte sie auch nicht ertragen. Er gehörte nur zu den Geistern, die, wenn sie ein Problem gelöst hatten, nicht vor Freude in die Hände klatschten, sondern gleich schon wieder das nächste sahen.
Sie selbst war unkomplizierter. Sie wusste, was sie konnte, und war im Großen und Ganzen damit zufrieden.
Als sie den Föhn ausstellte, hörte sie, wie ihr Handy die ersten Takte von Mozarts kleiner Nachtmusik dudelte. Sie klappte das Handy auf und fragte: »Schon wach?«
»Das wollte ich dich auch gerade fragen.«
»Ich konnte sowieso nicht länger schlafen. Bin viel zu gespannt darauf, wie das Urteil ausfällt.«
»Das weiß man doch. Der Erlöser wird ans Kreuz geschlagen.«
»Wird er, aber wofür? Für Mord in siebenunddreißig Fällen? Oder nur für Totschlag? Oder nur für Beihilfe zum Selbstmord? Die Richter müssen jeden Fall gesondert bewerten, und ich verspreche dir, das wird noch einmal richtig spannend. Davon gehen Signale für die Gesellschaft aus, deren Konsequenzen wir noch gar nicht absehen können.«
»Schon möglich.« Troller klang abwesend, so, als müsste er sich Mühe geben, ihr zuzuhören. Das war normalerweise gar nicht seine Art. Er interessierte sich immer für ihre Arbeit, mehr als sie sich für seine. Sie hatte einfach nicht immer Lust dazu, sich auf seine speziellen wissenschaftlichen Fragen einzulassen.
»Was ist los mit dir?«, fragte sie. »Ist was passiert?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht.«
»Willst du’s mir erzählen?«
»Ich will dich nicht vom Frühstück abhalten. Und du hast einen schweren Tag vor dir, ich nehme an, du willst auch deine Unterlagen noch mal durchgehen und ...«
»Ich liebe es, wenn du so rücksichtsvoll bist, Troller. Aber Altruismus ertrage ich nur in Kombination mit einem gesunden Egoismus. Sonst kriege ich Herzbeklemmung vor lauter schlechtem Gewissen. Also, was ist passiert?«
»Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht war es nur ein schlechter Scherz.«
»Hör zu, Troller«, sagte sie, »du musst dich entscheiden. Entweder du hast mir etwas zu erzählen oder eben nicht.«
»Okay«, sagte er, »wir können ja später noch mal telefonieren. Geh erst mal frühstücken.«
Und damit legte er auf.
Zurück blieb ein ungutes Gefühl. Das hatte er immerhin geschafft. Oder lag es an ihr? War sie zu ungeduldig gewesen? Wer hatte jetzt den Schwarzen Peter, er oder sie?
Sie zog sich an, und während sie sich vor dem Spiegel die Haare durchkämmte, lächelte sie sich aufmunternd zu. Als das ungute Gefühl dennoch nicht verschwand, nahm sie ihr Handy und wählte Trollers Nummer. Er hob sofort ab.
»Erzähl’s mir«, sagte sie. »Fang einfach an.«
Es war eine merkwürdige Geschichte. Von einer E-Mail, die Troller in der Nacht abgerufen hatte, von einem unbekannten Absender, der sich Kant nannte, und von einer zweiten Mail, die heute Morgen gekommen war, mit demselben Absender und dem Betreff: Prolegomena § 1.
»Und was steht drin?«, fragte Jane ungeduldig.
»In der Mail steht: ›Ich habe in Professor Ritters Hirn nach Spiegelzellen gesucht. Befund negativ. – Kant.‹«
Professor Ritter war, das wusste Jane, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Hirnforschung.
»Und was ist von der Sache zu halten? Klingt eher nach einem schlechten Scherz, oder? Ich meine, wie kann jemand im Hirn des Professors nach Spiegelzellen suchen, das ist doch absurd.«
»Es sei denn, er bohrt ihm den Schädel auf.«
»Wie bitte?«
»Der Witz ist, dass der Professor es selber macht. Mit Affen.«
»Und du meinst ...«, sie bekam auf einmal ein mulmiges Gefühl in der Magengegend.
»Das ist es ja, Jane. Ich weiß nicht, was ich meine. Es kommt mir nur unheimlich vor. Ich meine, wenn ich es ernst nehme, dann ...«
»Okay, fang an zu recherchieren.«
»Hab ich schon. Ich hab ins Internet geschaut, auf den Nachrichtenticker – nichts.«
»Hast du angerufen?«
»Wo?«
»In seinem Institut. Bei ihm zu Hause. Bei seinen Kollegen.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich weiß nicht.«
»Hast du Angst?«
»Wovor?«
»Davor, dass es nicht nur ein schlechter Scherz ist.«
»Ich meine, ich kannte – ich kenne ihn«, korrigierte er sich, »und wenn ich mir vorstelle, dass jemand ihn vielleicht gefesselt hat und mit einem Bohrer ...« Er atmete tief durch und sprach nicht weiter.
»Du musst herausfinden, was passiert ist, Troller.«
»Ja, ich weiß.«
»Dann fang an. Und zwar sofort.«
Er sagte nichts mehr dazu. Er fragte nur: »Wann kommst du zurück?«
»Morgen. Ich will mich nach der Urteilsverkündung sofort ans Notebook setzen und schreiben. Das kann ich im Hotelzimmer besser als auf dem Flughafen und im Flugzeug.«
»Von mir aus könntest du heute schon kommen«, sagte er. »Aber ich freue mich auch, wenn du morgen kommst.«
»Ich mich auch, Troller. Mach’s gut.«
Pass auf dich auf, Troller.
Nach allem, was er erzählt hatte, glaubte sie nicht eine Sekunde daran, dass es sich bei diesen E-Mails nur um einen folgenlosen Scherz handelte. Im Gegenteil. Da hatte jemand einen sehr genau durchdachten Plan, und was sie am meisten beunruhigte, war der Gedanke, dass Troller ein Teil dieses Plans war.
Kapitel 3
Die Wirklichkeit ist nicht einfach so da und hat dich im Griff oder du sie. Sie gleicht oft einem Traum, der sich erst nach und nach zur Realität verfestigt wie Lavaschaum zu Bimsstein oder wie ein Schiff im Nebel, von dem du anfangs nur das dumpfe Tuten des Horns wahrnimmst, bevor die ersten schwachen Konturen sichtbar werden, die Positionslichter, das Steuerhaus, die Masten, der Bug. Aber ganz sicher, dass es kein Spuk ist, bist du erst, wenn das Schiff am Quai angelegt hat und du es betreten kannst.
Troller wählte die Nummer von Professor Ritters Sekretariat. Normalerweise hätte sich Ritters Sekretärin gemeldet, und zwar mit einem routiniert aufgesagten: »Institute for Applied Neurophysics, Sekretariat Professor Ritter, mein Name ist Traudel Müller, was kann ich für Sie tun?« Stattdessen hörte Troller eine Männerstimme, die nichts weiter sagte als: »Ja, bitte?«
»Professor Ritter?«
»Nein«, sagte der Mann, »hier ist das Sekretariat. Mein Name ist Leoni. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich würde gern den Professor sprechen.«
»Das ist«, sagte der Mann und machte eine kleine Pause, »im Augenblick leider nicht möglich. Kann ich etwas ausrichten?«
Was hieß das, im Augenblick nicht? Im nächsten Augenblick doch?
»Wann kann ich den Professor sprechen?«
Wieder entstand eine kleine Pause. Der Mann schien zu überlegen, was und wie er antworten sollte. Dann sagte er: »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Am besten, Sie nennen mir Ihren Namen und Ihre Nummer, und wir rufen Sie zurück.«
»Wer ist ›wir‹?«
»Wenn Sie mir sagen, wer Sie sind, rufe ich Sie bestimmt zurück«, wiederholte der Mann.
Nun, warum eigentlich nicht?
Troller nannte seinen Namen.
»Und Ihre Telefonnummer bitte.«
»Die sehen Sie auf dem Display.«
»Sagen Sie sie einfach.«
Troller gehorchte.
»Danke«, sagte der Mann. »Wir rufen zurück.«
Troller legte den Hörer in die Halterung und stand einen Moment ratlos neben dem Schreibtisch, ganz still, bewegungslos, äußerlich wie innerlich. Nichts geschah. Gar nichts. Bis, einen kleinen Moment später, ein leiser Atemzug durch ihn hindurchging und er wusste, was zu tun war.
Er verließ die Avus an der Ausfahrt Wannsee und fuhr die endlos lange Königsstraße hinunter bis zur Glienicker Brücke, wo in früheren Zeiten die Agenten ausgetauscht wurden, Ost gegen West, Stasi gegen BND, KGB gegen CIA. Er passierte die Brücke und fuhr geradeaus weiter, immer dem Schild Sanssouci folgend. Er sah zu seiner Linken das Schloss und zu seiner Rechten die Mühle des Müllers, der Friedrich dem Großen zu widersprechen gewagt hatte, folgte dem Straßenverlauf um den Park von Sanssouci herum, verließ Potsdam, kam durch einen kleinen Ort mit Namen Eiche und erreichte schließlich Golm. Ein Zweitausend-Seelen-Dorf. Kopfsteinpflaster. Eine Kirche. Eine Schule. Ein Restaurant mit dem humorvollen Namen Golmé, in dem Troller noch vor wenigen Tagen mit einem Physiker zusammen gegessen hatte, um mit ihm über den Quantencomputer zu sprechen. Schließlich erreichte er den sogenannten Wissenschaftspark – ein Areal gläserner Neubauten, das in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts aus dem Boden gestampft worden war. Heute forschen hier rund tausend hochkarätige Naturwissenschaftler. Die Polymerforscher der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelten umweltfreundliche Kunststoffverbindungen, die Physiker des Max-Planck-Instituts mit ihren Superrechnern betrieben Gravitationsforschung, die Chemiker am Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung erfanden intelligente Werkstoffe, und die Forscher am zuletzt gegründeten und in Windeseile hochgezogenen Institute for Applied Neurophysics - IfAN - versuchten, dem menschlichen Geist auf die Schliche zu kommen. Troller musste an den Philosophen Piet van Dijk denken, den er mal auf einer Konferenz im Schloss Neuhardenberg kennengelernt hatte, einen dicken Mann mit fettigen blonden Haaren, der aus seinen müden Augen überheblich auf die kleinen Geister herabblickte und dabei asthmatisch schnaufte. Piet van Dijk hatte die These vertreten, Menschen seien Wesen, die, wo auch immer sie lebten, Parks einrichteten, um darin zu leben, Stadtparks, Nationalparks, Kantonalparks, Ökoparks. Was in seiner Aufzählung noch gefehlt hatte, war der Wissenschaftspark. Aber was immer man sich bei dem Wort Wissenschaftspark gedacht haben mochte, ein Architekturerlebnispark war das nicht. Das Wort klang nach Vielfalt, die Realität war gläsern und monoton. Aber es kam ja auch mehr auf die Vielfalt in den Köpfen der Wissenschaftler an, die hier beschäftigt waren.
Als Troller aus dem Kreisverkehr herausfuhr und in die Straße zum Institut einbog, sah er die Polizeifahrzeuge mit blinkenden Blaulichtern und in einiger Entfernung vom Haupteingang des IfAN kleine Gruppen wartender Wissenschaftler und Studenten.
Troller spürte, wie seine Muskeln kalt wurden, kalt und schwach. Sein Herz stockte, seine Hände hatten Mühe, das Lenkrad festzuhalten. Er überlegte, ob er anhalten sollte, auf den Parkplatz des Instituts fahren und sich unter die Menge begeben, um zu fragen, was passiert sei, aber er wusste es ja, wusste es besser als alle anderen, besser als die Polizei. Er wollte nur noch weg, zurück nach Hause oder in die Redaktion. Aber in der Redaktion war heute niemand, wenigstens niemand, mit dem er darüber sprechen konnte, und die Einzige, mit der er überhaupt darüber sprechen wollte, war in London und hatte genug mit dem Erlöser zu tun.
Er fuhr im Schritttempo am Parkplatz vorbei, gab vorsichtig Gas und atmete erleichtert auf, als er das Ende der Straße erreicht hatte und links in die Querstraße einbog, von der aus er das blaue Blinken nicht mehr sah, auch nicht im Rückspiegel. Deutschlands Hirnforscher Nummer eins. Der Engländer aus Bayern. Das Bindungsproblem gelöst? Der Herr der Spiegelzellen! Ist Empathie ein moralisches oder ein neurologisches Konzept? Auf dem Weg zu einem wissenschaftlich begründeten Strafgesetzbuch. – Troller fielen noch eine ganze Reihe weiterer Schlagzeilen ein, die seine Kollegen und er über Ritters Arbeit geschrieben hatten. Ritter war derjenige, der die deutsche Hirnforschung auch international am prominentesten repräsentierte. Und nun?
Er kam jetzt wieder an den Kreisverkehr, an den er vorhin schon einmal aus der anderen Richtung gekommen war. Wenn er ihn nur halb umrundete und geradeaus weiterfuhr, dann wäre er wieder auf dem Rückweg.
Was würde Jane an meiner Stelle tun? Jane hatte diese unbändige Neugier der Kriminalreporter, gepaart mit dem nötigen Mut. Seine eigene Neugier beschränkte sich in der Regel auf Philosophie und Wissenschaft. Aber hier gab es noch etwas anderes, etwas Dunkles, Bedrohliches. Etwas, das sofort einen Fluchtreflex bei ihm ausgelöst hatte, das aber nun, ohne dass er es wollte, einen immer stärkeren Sog entfaltete.
Er fuhr weiter und nahm wieder Kurs auf das Institut.
Er stellte seinen Wagen ab, stieg aus, verriegelte die Türen, gab sich innerlich einen Ruck und ging dann mit energischen Schritten auf das gläserne Gebäude zu.
Ob »Kant« jetzt auch hier war? Als Zuschauer unter den Wissenschaftlern und Studenten? Vielleicht selbst ein Wissenschaftler oder Student?
Troller widerstand der Versuchung, stehen zu bleiben und in der Menschengruppe nach dem Gesicht des Mörders zu fahnden. Er schaute nicht links, nicht rechts, sondern unbeirrt geradeaus und strebte mit geschäftigem Gang auf den Eingang zu, als gäbe es nicht den geringsten Zweifel daran, dass er ein Recht darauf hatte hineinzugehen. Just pretend. Janes Devise. Und es klappte sogar. Die beiden Uniformierten unterbrachen nicht mal ihr Gespräch. Er sprang die Stufen zum Eingang hinauf, öffnete die Glastür, eilte an der Pförtnerloge vorbei und war schon am Fuß der breiten Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte.
»Momentchen mal eben!«
Also doch.
Er blieb stehen und schaute sich um. Einer der beiden Uniformierten, an denen er eben vorbeigeeilt war, ein schlaksiger Kerl mit einer Warze auf der Oberlippe, fragte mit strenger Miene, wohin er wolle.
»Ich werde erwartet«, erwiderte Troller in einem Ton, als wäre damit alles gesagt.
»Von wem?«
»Ich habe vor einer halben Stunde mit Kommissar Leoni telefoniert.«
Das war die Wahrheit. Vorausgesetzt der Mann, mit dem er telefoniert hatte, war ein Kommissar.
»Und was wollen Sie jetzt von ihm?«
»Ich?«, fragte Troller empört. »Ich will gar nichts. Ich bin hergekommen, weil Herr Leoni mich darum gebeten hat.«
Es kam so überzeugend, dass er es beinahe selbst geglaubt hätte.
»Geben Sie mir bitte Ihren Namen, dann melde ich Sie an.«
Troller spürte, wie er weich wurde. Ein ganzer Chor in seinem Kopf fing an, ihn zu verunsichern. Du hast hier nichts zu suchen, flüsterten die Stimmen, was willst du dich hier hereinschleichen, du bist doch kein verdeckter Ermittler oder Undercover-Agent, du bist ein Wissenschaftsjournalist, und Wissenschaftsjournalisten spielen keine Cowboyspiele, also geh einfach wieder raus, setz dich ins Auto und fahr nach Hause, es war sowieso eine Schnapsidee, hierher zu kommen, du hast ihr auch nur nachgegeben, weil neuerdings das Bauchgefühl wieder in Mode ist.
Er hatte vor einer Weile ein Interview mit einem britischen Wissenschaftler geführt, der eine Lanze für das Unterbewusste brechen wollte. Das Unterbewusste sei, so behauptete der Mann, der bessere Rechner. Der Verstand quäle sich mit viel zu vielen Informationen herum, das Unterbewusste dagegen treffe aus dem Bauch seine Wahl und liege damit meistens richtig. Daher die Devise: Folge der Stimme deines Bauches. Oder: Geh, wohin dein Bauch dich führt. Troller hasste das Wort Bauchgefühl, aber wenn man stattdessen von Intuition sprach, konnte er damit leben. Die größten Mathematiker und Physiker hatten davon berichtet, dass sie ihre genialen Gedanken der Intuition verdankten, und manchem war die alles entscheidende Idee sogar buchstäblich im Schlaf gekommen.
»Am besten, Sie geben mir Ihren Ausweis«, sagte der Polizist mit der Oberlippenwarze.
»Okay.« Troller zog die Brieftasche aus dem Inneren seiner Lederjacke. »Welchen wollen Sie. Personalausweis? Oder Dienstausweis?« Den Begriff Presseausweis vermied er vorsichtshalber.
»Herr Dr. Marquardt?« Die Stimme kam von oben, vom ersten Stock.
Troller drehte sich um und sah einen kleinen drahtigen Mann die Treppe herunterkommen. Er trug eine schwarze Bundfaltenhose, schwarze Schuhe, ein schwarzes Hemd und einen orangefarbenen Schlips. Sein Schädel war – bis auf ein paar Stoppeln – rasiert, sein Teint dunkel, sein Aussehen levantinisch. Der Mann streckte Troller die Hand entgegen und sagte: »Wir warten schon auf Sie.«
»Tut mir leid«, sagte Troller.
Wird schon schiefgehen, dachte er.
»Leoni«, sagte der andere.
»Angenehm.«
»Schön, dass Sie da sind«, fuhr Leoni fort, während er die Treppe wieder hinaufeilte und Troller dabei ein Zeichen gab, ihm zu folgen. »Ich hab Sie schon vom Fenster aus gesehen, aber es sind ja wirklich ewig lange Gänge, die man hier zu laufen hat. Haben Sie es gleich gefunden?«
»Ja«, sagte Troller. »Kein Problem.«
»Na ja, ich dachte, für jemand, der in dieser Gegend fremd ist ..., aber Sie haben wahrscheinlich einen Navigator im Auto, stimmt’s?«
Troller nickte. Er hatte einen Navigator.
Leoni wandte sich, als sie oben angekommen waren, nach links in einen hellen, geräumigen Flur hinein, der mit graublauem Teppichboden ausgelegt war.
Troller folgte ihm und versuchte Schritt zu halten.
»Wir wissen natürlich auch, dass es absolut ungewöhnlich ist, bei einem einfachen Mord einen Profiler hinzuzuziehen«, sagte Leoni entschuldigend, »aber die Kollegin – Hauptkommissarin Graf – war der Ansicht, wenn Sie schon einmal hier in Potsdam sind und sowieso das Seminar mit uns abhalten werden, dann könnten wir Sie ja auch an unseren Ermittlungen teilhaben lassen, verstehen Sie?«
Troller verstand. Dr. Marquardt kam von irgendwoher, sollte ein Seminar abhalten und wurde nun mehr oder weniger zufällig hinzugezogen.
»Zumal dieser Mord schon seine Besonderheiten hat«, fügte Leoni geheimnisvoll hinzu, »aber na ja, ich sag lieber nichts. Unvoreingenommenheit, nicht wahr? Der erste Blick ist der wichtigste! Den ersten Eindruck festhalten. Den Tatort lesen. Und dann so peu à peu das Profil des Täters erstellen. Haben Sie nicht sogar noch beim alten Ressler gelernt, drüben beim FBI?«
»Ach«, sagte Troller vage, »das ist lange her.«
»Und, wie war er so?«
Troller begnügte sich mit einem Schulterzucken als Antwort.
»Ja, ja, ich weiß«, sagte Leoni und blieb stehen. »Inzwischen sind wir weiter. Ressler war noch zu undifferenziert. Ich hab vor ein paar Tagen im Fernsehen diesen Film gesehen, nicht Sieben, sondern den anderen, in dem es auch immer regnet, mit diesem Kerl, der den Highlander gespielt hat, ja, jetzt weiß ich’s wieder: Resurrection hieß er, Auferstehung, weil irgend so ein Irrer darin den Körper des gekreuzigten Christus zusammenbaut, und zwar aus lauter Leichenteilen von 33-jährigen Männern, die er aufs Grausamste ermordet, aber – was wollte ich denn jetzt sagen?«
»Ressler.«
»Ach ja, in diesem Film kommt doch ein FBI-Mann vor, auch so ein Profiler wie Sie, und Christopher Lambert, also der Kommissar, macht, bevor sein Kollege und er zu dem Profiler gehen, einen Witz. Pass auf, sagt er, gleich wird er uns sagen: Suchen Sie nach einem weißen Mann, intelligent, zwischen fünfundzwanzig und vierzig. Gut. Und dann sitzt ihnen der Profiler gegenüber, und was sagt der?«
»Suchen Sie nach einem weißen Mann, intelligent, zwischen fünfundzwanzig und vierzig.«
»Und zwar wortwörtlich! Ist das nicht komisch?«
»Ist es«, sagte Troller. Er hatte den Film zusammen mit Jane gesehen, und Jane hatte ihm erklärt, dass in dem Buch von Robert K. Ressler, dem Urvater aller Profiler, tatsächlich alle Serienmörder weiß, intelligent und zwischen fünfundzwanzig und vierzig waren.
»Und der größte Witz war«, sagte Leoni, »dass dieser Mann nicht nur selbst ein Weißer zwischen fünfundzwanzig und vierzig war, sondern, wie sich am Ende des Films herausstellt ...«
»... der Mörder.«
»Ist das nicht genial?«
»Und ob«, sagte Troller, der allmählich an Sicherheit gewann. »Vor allem, weil ja beide, der Kommissar und der Mörder, einander nur wechselseitig das Klischee vom Profiler bestätigen.«
»Wie jetzt?« Leoni ließ den Mund offen stehen.
»Nun ja, es hätte den Kommissar doch eigentlich misstrauisch machen müssen, dass der vermeintliche FBI-Mann genau das sagt, was dem Klischee entspricht! Stattdessen zwinkert er nur seinem Kollegen zu – hab ich nicht gesagt, dass er das sagen würde? – und geht vor lauter Überheblichkeit und Selbstüberschätzung dem Mann auf den Leim.«
»Donnerwetter«, sagte Leoni bewundernd und setzte sich wieder in Bewegung, »so weit hatte ich gar nicht gedacht. – Also, was ist? Wollen Sie sein Büro sehen?«
»Ritters?«
»Ja, klar, es kommt gleich hier links, und wir können ja einfach mal ...« Leoni blieb abrupt stehen, schaute Troller misstrauisch an und fragte mit veränderter Stimme: »Woher wissen Sie das?«
»Was?«
»Dass es Ritter ist. Das habe ich Ihnen am Telefon nicht gesagt. Absichtlich. Ich habe nur gesagt, es gibt einen Mord im Institut. Wir wollten ja, dass Sie unvoreingenommen sind. Also, woher wissen Sie es?«
Da haben wir’s. Ich bin dem nicht gewachsen.
Für einen Augenblick fürchtete Troller, Leoni werde Alarm schlagen und ihn festnehmen lassen. Aber was sollte schon passieren? Schlimmstenfalls würden sie herauskriegen, dass er Journalist war und sich unter falschem Vorwand hier hereingeschlichen hatte. Und nicht mal das hatte er getan. Leoni hatte ihn mit irgendeinem Dr. Marquardt verwechselt, und er hatte ihn in diesem Glauben gelassen, das war alles. Sie würden ihn rauswerfen und sich bei seiner Redaktion beschweren, darüber konnte er nur lachen. Komisch, dass man Angst vor einer Situation haben konnte, die nichts als ein bisschen peinlich zu werden drohte.
»Woher haben Sie es gewusst?«, hakte Leoni mit einer Schärfe nach, die Troller dem kleinen Mann gar nicht zugetraut hätte.
»Das ist eine gute Frage«, sagte er, um Zeit zu gewinnen. »Eine verdammt gute Frage. Ich würde sagen ...«
»Nun?«
Das Wort, das ihm vor ein paar Minuten durch den Kopf gegangen war, bot sich an: »Bauchgefühl.«
»Bauchgefühl?«
»Sie können es auch Intuition nennen.«
»Verzeihen Sie, aber – das mit dem Bauchgefühl habe ich noch nie verstanden. Ich kenne so etwas nicht. Können Sie’s mir erklären?«
»Ich fürchte, nein«, sagte Troller. »Ist ja auch irrational. Die rationale Erklärung lautet: Professor Ritter ist der Gründer, Direktor und die Seele dieses Instituts. Wenn man ans IfAN denkt, dann denkt man automatisch an ihn. Vielleicht ist es dem Mörder genauso gegangen.«
»Sie meinen, es ist nichts Persönliches, sondern hat was mit dem Institut zu tun?«
»Ich meine noch gar nichts«, sagte Troller. »Ich probiere Hypothesen aus. Und dann lege ich mein Augenmerk darauf, ob sich eine von ihnen bewährt.«
»Interessant.« Leoni setzte sich zögernd wieder in Bewegung. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Büro.«
Vor Ritters Büro stand ein Polizist in Zivil. Leoni gab ihm einen Wink. Der Polizist trat von der Tür zurück und ließ sie hinein.
Troller hatte hier vor zwei Jahren, kurz bevor das Institut seine Arbeit aufnahm, ein Interview mit dem Professor geführt. Der Raum hatte sich kaum verändert. Ein großes Eckzimmer mit einem halbrunden Schreibtisch aus Walnussholz, einem ergonomischen Schreibtischstuhl dahinter, eingebauten Bücherregalen, einer schwarzen Sitzecke im Bauhausstil und einer Vitrine mit exotischen Figuren und Handwerksarbeiten, die Ritter gesammelt hatte.
Troller und sein Kollege Hebold hatten Ritter damals eine hübsch geschnitzte Holzkröte aus Kambodscha mitgebracht, die einen Stock im Maul hatte, und den Professor gefragt, was bei ihrem Anblick in seinem Kopf vorgehe. Der Professor hatte ihnen etwas von einem zweidimensionalen Bild erzählt, das auf seiner Netzhaut erschien, von den Ganglienzellen der Netzhaut, die das Bild in Erregungsmuster verwandelten, die dann wiederum in der Großhirnrinde analysiert wurden, und von dem kombinatorischen Spiel, welches das Hirn nun veranstaltete, indem es die neuen Informationen mit den bereits gespeicherten Gedächtnisinhalten verglich. Daraufhin hatte Hebold den Professor gebeten, die Holzkröte in die Hand zu nehmen, und dieser hatte nach kurzer Überlegung den Holzstock aus ihrem Maul gezogen, damit auf den Rücken der Kröte geklopft und die durchaus zutreffende Vermutung angestellt, dass die Kröte ein folkloristisches Musikinstrument sei.
Jetzt stand die Kröte auf Ritters Schreibtisch, als Briefbeschwerer über einem Stapel von Briefen. Der Stock steckte in ihrem Maul.
»Nun«, fragte Leoni. »Was sagen Sie?«
»Nichts«, sagte Troller. »Nichts Ungewöhnliches.« Er machte sich auch nicht die Mühe, nach etwas zu suchen. Er wollte wieder weg. Hier im Büro war der Mord nicht geschehen, und er wollte den Tatort sehen, bevor der richtige Profiler kam und sein Schwindel aufflog. »War offenbar ein penibler Bursche, der Professor«, sagte er vage.
»Sieht ganz so aus.«
Und war auch so gewesen. Den Gentleman aus Bayern hatte man ihn genannt, weil er wie ein englischer Gentleman aussah, stets korrekt gekleidet, mit einem gepflegten Schnurrbart, der die etwas zu lange Oberlippe kaschieren sollte, mit vollen grauen Haaren, die er rechts gescheitelt trug, mit buschigen Augenbrauen und einer fleischigen Nase, die dann doch wieder mehr bayerisch als britisch aussah, jedenfalls nicht aristokratisch.
»Wo ist er ermordet worden?«
»Im Labor«, sagte Leoni. »Die Spezialisten sind noch bei der Arbeit.«
»Gut«, sagte Troller. »Dann lassen Sie uns gehen.«
Sie liefen einen langen, lichtdurchfluteten Gang entlang, der in Höhe des ersten Stockwerks das Bürogebäude mit dem Trakt verband, in dem sich die Labors befanden. Das Laborgebäude war niedriger als der dreistöckige Bürotrakt, es hatte nur zwei Ebenen und war wie ein Atrium gebaut. Im Innenhof mit dem Glasdach befand sich eine hübsch gestaltete Gartenanlage mit einem kleinen Teich in der Mitte, ein paar Bänken und einigen vermutlich afrikanischen Skulpturen, die besser zu einem modernen Museum gepasst hätten als zu einer wissenschaftlichen Einrichtung. Aber vielleicht brauchten die Wissenschaftler ja doch ein bisschen Kunst zur Inspiration.
»Gibt es eigentlich Zeugen?«, fragte Troller, während er stehen blieb und so tat, als wollte er sich den Innenhof noch genauer anschauen. »Hat jemand den Mörder gesehen?«
»Ich könnt’s Ihnen verraten«, sagte Leoni. »Aber wie steht’s mit der Unvoreingenommenheit?«
»Zeugenaussagen fallen nicht darunter«, sagte Troller.
»Nun gut.« Leoni war jetzt ebenfalls stehen geblieben. »Dann sag ich Ihnen, was wir bis jetzt herausbekommen haben.«
Kurz nach 22 Uhr, so Leoni, während sie sich wieder in Bewegung setzten, war ein Motorradkurier an der Glastür des Instituts erschienen, hatte dem Nachtwächter oder Nachtportier einen braunen, wattierten Briefumschlag hingehalten und ihn dazu gebracht, die Tür zu öffnen. Das war alles, woran der Portier sich erinnern konnte. Gleich darauf musste er von dem Unbekannten betäubt worden sein, zunächst mit Chloroform oder einem schnell wirkenden Gas aus einer Sprühdose, das war zu diesem Zeitpunkt noch unklar, danach mit der Injektion einer ebenfalls noch nicht identifizierten Substanz, die bewirkt hatte, dass der Portier erst am heutigen Morgen um halb acht aus einem narkoseartigen Tiefschlaf erwacht war. Es sei ein Wunder und aus der Sicht des Mörders wahrscheinlich eine Panne, dass der Mann sich an den Kurier erinnerte. Der Unbekannte hatte offenbar gewusst, dass sich zu diesem Zeitpunkt außer dem Portier und dem Professor nur noch eine dritte Person in dem weitläufigen Gebäude aufhielt, ein junger Doktorand aus Berkeley, dessen Studierzimmer sich im ersten Stock des Gebäudes befand, nicht weit vom Büro des Professors entfernt. Der Mörder hatte als Erstes diesen Doktoranden aufgesucht, ihn möglicherweise mit Hilfe einer Betäubungspistole bewusstlos geschossen und dann ebenfalls narkotisiert, so dass der Amerikaner erst heute Morgen gegen acht aus der Narkose erwacht war, ohne die geringste Erinnerung daran, wie und von wem er betäubt worden war.
Danach hatte der Mörder den Professor gesucht.
Und gefunden.
Sie waren jetzt am Labor angelangt. Durch den Spalt der halbgeöffneten Tür sah Troller einen Mann mit Latexhandschuhen und kleinen Pinseln in der Hand offenbar nach Fingerabdrücken suchen.
»Warten Sie«, sagte Leoni und zog sich nun ebenfalls Latexhandschuhe und transparente Überzieher über seine Schuhe an. »Ich bin gleich wieder zurück.«
Troller sah durch den Türspalt, wie eine blonde Frau mit roter Lederjacke auf den Spurensucher zuging, ihm etwas sagte, nickte und wieder aus dem Blickfeld verschwand.
Während er wartete, hörte er aus dem Keller Schreie, die ihn zusammenzucken ließen. Was war das? Kindergeschrei? Oder das Gelächter einer ganzen Bande von Verrückten? Tiergebrüll? Ja, jetzt hörte er es deutlicher: Es waren Affen. Es waren die Schreie der Schimpansen und Paviane, mit denen der Professor experimentiert hatte.
Leoni kam mit Latexhandschuhen und Schuhüberziehern für Troller zurück. Troller streifte die Teile über, dann betraten sie das Labor.
Troller sah den Mann von der Spurensicherung und die Frau mit der roten Lederjacke sowie zwei weitere Spurenexperten.
Und er sah den Primatenstuhl.
»Oh, mein Gott!«
Der Affen- oder Primatenstuhl war eine ausgeklügelte Vorrichtung für sehr spezielle Experimente. Es war tatsächlich ein Stuhl, auf dem der Affe sitzen oder auch stehen konnte. Der Stuhl war umrahmt von einem Gestänge mit vielfältigen Scharnieren und Gelenken, das man ausziehen und auch wieder zusammenschieben konnte, um es der Größe des jeweiligen Affen anzupassen, Makak, Schimpanse, Pavian. Das Gestänge enthielt Röhren, durch die diverse Kabel verliefen, deren Elektroden an einem Ende mit Puls, Haut und vor allem dem Gehirn des Versuchstiers verbunden wurden und die am anderen Ende zu einem Computer führten, der seine Rechenergebnisse auf verschiedenen Monitoren abbildete. Das Gestänge erlaubte es auch, die Glieder des Versuchstieres zu fixieren – die Beine mit Fußfesseln, die Arme mit Handfesseln und, auf zweierlei Weise, den Kopf: Man konnte ihn in eine Metallvorrichtung einklemmen, die an einen mittelalterlichen Pranger erinnerte, zwei Bretter mit jeweils einer halbrunden Aussparung, die um den Hals geschlossen wurden, so dass der Kopf über der Halskrause festgeklemmt saß und sich allenfalls ein wenig nach links oder rechts bewegen konnte. Zusätzlich konnte man Schraubzwingen von beiden Seiten her an den Kopf heranführen und ihn an den Schläfen fixieren, so dass er überhaupt nicht mehr zu bewegen war. Die Besonderheit an diesen Schraubzwingen war, dass sie hohl waren und erlaubten, durch ebenfalls hohle Stahl- oder Kunststoffbolzen, sogenannte Kammern, die man den Tieren in die Schädeldecke einsetzte, feine Elektroden ins Hirn zu führen. Mit deren Hilfe ließen sich bei verschiedenen Experimenten die elektrischen Signale messen, die diese oder jene Hirnregion bei dieser oder jener Wahrnehmung erzeugte.
Troller sah, eingezwängt in diesen Stuhl, einen in einen fleckigen Glencheck-Anzug gekleideten Menschenkörper. Er sah eine bizarr in die Lehne des Stuhls verkrallte Hand. Er sah einen mit blutverkrusteten Löchern verunstalteten Menschenkopf und ein Gesicht, das auch der Tod nicht erlöst hatte.
Troller hasste Filme, in denen die Leute sich beim Anblick einer verstümmelten Leiche oder sonstiger Scheußlichkeiten übergaben. Der Profi blieb kühl, der Neuling übergab sich, das war die Regel, aber wenn ein Mord besonders ekelhaft war, dann übergab sich auch der Profi. In dem Film, von dem Leoni vorhin erzählt hatte, Resurrection, übergaben sich alle. Troller hatte das für Ironie gehalten, Komik. Doch hier und jetzt war nichts Komisches daran. Die Übelkeit stieg in ihm hoch und verbreitete in seinem Mund einen bitteren, galligen Geschmack. Es war ihm unmöglich, den Blick auf den Primatenstuhl auszuhalten und nicht sofort woanders hinzuschauen, auf die blonde Frau in der roten Lederjacke, die jetzt auf ihn zukam, auf Leoni, der neugierig auf seine Reaktion zu warten schien, oder auf die anderen Männer im Raum, die sich nicht um ihn kümmerten, sondern stoisch ihrem Handwerk nachgingen.
»Rita Graf«, sagte die blonde Frau und gab Troller die Hand. Es gab einen elektrischen Schlag, als er ihre Hand berührte.
»Oh«, sagte er, »es hat gefunkt.«
»Die Gummisohlen«, sagte sie. »Ist Ihnen schon etwas aufgefallen?«
Ihm war etwas aufgefallen. Die Löcher im Schädel des toten Professors.
Ich habe in Professor Ritters Hirn nach Spiegelzellen ...
»Spiegelzellen«, sagte er. »Er hat nach Spiegelzellen gesucht.«
»Wer?«
»Der Mörder. Und Ritter. Ritter bei den Affen. Der Mörder bei Ritter. Sehen Sie die Löcher in seinem Schädel?«
»Was sind Spiegelzellen?«
»Spiegelzellen sind eine besondere Art von Neuronen«, antwortete Troller, froh, dass sie endlich ein Terrain betraten, auf dem er sich auskannte. »Spiegel deswegen, weil wir uns mit Hilfe dieser Neuronen in andere Wesen hineinversetzen, uns in ihnen spiegeln. Das ist die neuronale Basis für unser Mitgefühl. Natürlich weiß die Menschheit schon lange, dass es so etwas wie Empathie gibt. Aber die Entdeckung der Spiegelzellen gilt als der endlich gefundene wissenschaftliche Beweis. Und ich fürchte, der Mörder hat – in grausamer Parodie der Experimente, die Professor Ritter mit den Affen durchführte – nun seinerseits im Hirn des Professors nach Spiegelzellen gesucht.«
Von den beiden Mails, die er bekommen hatte, verriet Troller der Kommissarin nichts. Er war nur der Profiler. Er las den Tatort. Zählte zwei und zwei zusammen. Den Professor und die Affen. Den Mörder und den Professor.
»Und was sagen Sie zu dem da?«, fragte die blonde Frau und zeigte auf ein Plakat, das an der Stirnwand des Raumes hing, ein eher kleines Plakat, vielleicht sechzig mal vierzig, mit nichts als einem Paragraphenzeichen, einer Zahl und ein paar Worten in schwarzer Schrift darauf. Troller streifte das Plakat mit einem kurzen Blick, schaute wieder auf den Primatenstuhl, wandte seinen Blick mit einem Ruck zurück zu dem Plakat und machte ein paar Schritte darauf zu:
»Ist das von ihm?«, fragte er krächzend.
»Davon bin ich überzeugt.«
Sie schauten jetzt alle auf das Paragraphenzeichen und den Text darunter:
§1
In den Tierversuchen zeigt die Hirnforschung ihr wahres Gesicht. Die Beherrschung des Affenhirns ist nur die Vorstufe zur Beherrschung des Menschengehirns. – Kant
»Warum Kant?«, fragte die Kommissarin.
Troller antwortete nicht. Er starrte nur auf das Plakat.
»Warum Kant?«, wiederholte die blonde Frau. »Ist es ein Zitat? Von diesem Philosophen?«
»Nein«, murmelte Troller. »Ist es nicht.«
»Dann verstehe ich es nicht.«
»Ich auch nicht.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, obwohl er nicht wissen wollte, wie spät es war. »Entschuldigen Sie«, sagte er, immer noch bemüht, seine Fassung zu wahren. »Ich geh nur mal eben ...« Er machte eine vage Geste in Richtung Ausgang. »Ich komme gleich zurück.«
Aber wenn er etwas ganz bestimmt nicht vorhatte, dann war es das.
Kapitel 4
Jane begann das Frühstück mit einem Fruchtsalat aus frischen Früchten, ließ sich danach ein Omelette mit Champignons und Käse zubereiten und ging, während sie weiter Kaffee trank und hin und wieder mal in ein Croissant biss, ihre Aufzeichnungen über den Erlöser noch einmal durch. Das Stimmengewirr und die Bewegung im Raum störten sie nicht. Leute kamen herein, ließen sich an einen Tisch führen, standen wieder auf, gingen zum Buffet und trugen ihre Beute zurück an den Tisch. Die meisten sprachen in gedämpftem Ton miteinander. Nur an einem Tisch saß eine Gruppe von jungen Männern, die offenbar Wert darauf legten, dass die ganze Welt ihnen zuhörte. Es waren Landsleute, Amerikaner, und Jane schämte sich ein bisschen für sie.
Was den Prozess des Erlösers von ähnlichen Prozessen unterschied, war, dass hier jemand selbstbewusst und offensiv zu seinen Taten stand. Er entschuldigte sich nicht. Er plädierte nicht auf mildernde Umstände. Nein, er drehte den Spieß um. Die Apparatemedizin sei Teufelswerk, sagte er. Es sei unmenschlich, ja frevelhaft, vom Krebs zerfressene Menschen künstlich am Leben zu halten, Menschen, die kaum noch bei Bewusstsein waren, die nur noch Schmerzen hatten und keine Chance auf Heilung. Solchen Menschen durch Zwangsernährung und Zwangsbeatmung die Erlösung durch den Tod zu verweigern, sei ein Verbrechen! Eine Gesellschaft, die so mit ihren Sterbenden umgehe, mit Menschen, die sich gegen das medizinische Lebensdiktat nicht mehr wehren könnten, sei des Teufels.
Frederick McKinnock war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung fünfunddreißig Jahre alt gewesen, unverheiratet, Nichtraucher, Abstinenzler, Vegetarier, Christ. Er betete täglich morgens und abends und besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst. In den verschiedenen Gemeinden, denen er im Laufe der Jahre angehört hatte, war er einigermaßen beliebt gewesen, auch wenn man ihn für einen Sonderling hielt.
Er vollbrachte sein Erlösungswerk ganz im Geheimen, sprach mit niemandem ein Wort über das Thema, auch nicht in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, in denen er arbeitete, und sobald er das Gefühl hatte, man könne ihm auf die Spur kommen, wechselte er das Krankenhaus und meistens auch die Stadt. So hatte er im Laufe von fünf Jahren nach eigenen Angaben insgesamt siebenunddreißig Menschen »erlöst«, Alte und Junge, Frauen und Männer, Krebskranke, Wachkomapatienten, Querschnittsgelähmte, ALS- oder MS-Kranke und Aidspatienten.
Die meisten seiner Opfer hätten ihn sogar ausdrücklich um Erlösung gebeten, sagte er, ob er das nun beweisen könne oder nicht. Einer seiner Patienten – so nannte er seine Opfer – war ein an ALS erkrankter Mann, der im Rollstuhl saß, sich kaum bewegen konnte und künstlich beatmet wurde.
Jane hatte dieser Fall ganz besonders berührt, weil ein Freund ihres Vaters vor einigen Jahren an ALS erkrankt und in einer ähnlichen Lage gewesen war. Als sie das letzte Mal bei ihrem Vater in Naples, Florida, war, hatten sie Michael Wagner, so hieß der Freund, in seinem luxuriösen Pflegeheim in Bonita Springs besucht. Michael konnte schon nicht mehr ohne Sauerstoffgerät leben und auch nicht mehr mit seiner eigenen Stimme sprechen. Es war unendlich traurig. Am Ende hatte Michael noch mit ihrem Vater allein sprechen wollen, und der war vollkommen verstört gewesen, als er nach unten kam, wo sie auf ihn gewartet hatte. Er wollte es erst nicht sagen, aber dann hatte sie doch aus ihm herausgekriegt, dass Michael ihn gefragt hatte, ob er ihm helfen würde, wenn er so weit wäre. Er hatte es nicht genauer ausgedrückt, aber es war klar gewesen, was er meinte. Michael war sein bester Freund, und normalerweise würde er alles für ihn tun, wirklich alles, das Problem war nur, dass ihr Vater religiös bis in die Knochen war. Er könne es nicht tun, hatte er gesagt, es sei gegen das Gesetz. Womit er die Zehn Gebote meinte.
Was Jane während dieses ganzen Prozesses geärgert und aufgeregt hatte, war die Verlogenheit, die sie in allen Gesichtern las. Die Verwandten der unheilbar Kranken, die versuchten, deren qualvolles Dahinvegetieren noch als Leben »mit schönen Momenten« hinzustellen. Der Rechtsmediziner, der euphemistisch von einem »ondulierenden Krankheitsverlauf« sprach, wo der betreffende Patient schon kaum noch bei Bewusstsein war und nichts mehr aß. Und die Ärzte, die immer nur auf ihren Eid verwiesen und ihre Hände in Unschuld wuschen. Aber alle, man sah es ihnen an und hörte es aus ihren Mündern, wenn man sie beiseite nahm und inoffiziell mit ihnen sprach, alle dachten dasselbe: Wenn ich jemals in diese Lage kommen sollte, abgemagert bis auf die Knochen, mit einem vom Darmverschluss geblähten Bauch, von Schmerzen gepeinigt, gegen die auch kein Morphium mehr hilft, und vor allem: nicht mehr entscheidungsfähig, weil mein Hirn schon dabei ist, sich aufzulösen – wenn ich jemals in diesen Zustand geraten sollte, dann gebe Gott, dass ein Erlöser in der Nähe ist, der mich aus den Klauen der Ärzte und ihrer Apparate befreit!
Jane dachte auch so. Und deshalb würde sie genau das schreiben, sobald das Urteil gefällt war. Egal welches.
Es gab sie immer noch, die guten alten Taxis in London. Mit der Beinfreiheit im Fond, mit der Trennscheibe zwischen Fahrgast und Fahrer und mit den hartgepolsterten Ledersitzen. Diese hier waren dunkelrot. Zumindest waren sie das mal gewesen. Jetzt spielten sie mehr ins Schwärzliche hinein.
»Old Bailey«, sagte Jane.
»Oh«, sagte der Fahrer, der mit seinem karierten Jackett, dem gestutzten Schnäuzer und den buschigen Augenbrauen ebenso gut Apotheker, Schreibwarenverkäufer oder Buchhalter in einem Wettbüro hätte sein können, »wird heute nicht das Urteil gegen den Mann gesprochen, den sie den Erlöser nennen?«
»Ja«, sagte Jane. »Genau da fahre ich hin.«
»Sind Sie von der Presse?«
»Ja.«
»Amerikanerin?«
»Ja.«
»In Ihrem Land würde man ihn zum Tode verurteilen, da bin ich sicher.«
Jane erwiderte nichts darauf. Aber sie war gar nicht so sicher, dass der Erlöser die Höchststrafe bekommen würde. Die Stimmung auf der Straße und unter den Kollegen war geteilt. Und die Verteidigung hatte sich noch einen ganz besonderen Coup einfallen lassen. Sie hatte aus Deutschland einen Neurowissenschaftler einfliegen lassen, der den Erlöser in einen Kernspintomographen hineingeschoben und sein Gehirn untersucht hatte. Dabei war herausgekommen, dass irgendein Teil des Erlösergehirns, die Amygdala, nicht normal reagierte. Das bedeutete so viel wie: mildernde Umstände. Oder, wie der Gutachter, Professor Laurenz Block aus Bremen, auf die Frage des Verteidigers hin gesagt hatte: »Der Angeklagte hat seine Taten nicht aus freiem Willen heraus begangen. Er konnte gar nicht anders handeln. Deswegen kann man von einer Schuld im klassischen Sinne nicht sprechen.« Das klang wie ein eindeutiger Punktsieg für die Verteidigung. Allerdings war die Reaktion des Staatsanwalts ziemlich geschickt. Er rief den Gutachter noch einmal in den Zeugenstand und fragte, wie es denn generell um den freien Willen stünde, ob es Menschen mit freiem Willen gebe und andere ohne.
»Nein«, sagte der Professor, »so etwas wie einen freien Willen gibt es nicht. Der freie Wille ist eine Illusion. Wir alle sind durch die Architektur unseres Gehirns und die Verschaltungen unserer Neuronen determiniert. Nicht das Ich entscheidet, sondern das Gehirn entscheidet, das scheint mir eine wissenschaftlich korrekte Aussage zu sein.«
»Aber«, sagte der Staatsanwalt, »wenn niemand einen freien Willen hat, weder der Angeklagte noch die Geschworenen noch Sie oder ich, dann kann man die Frage nach dem freien Willen doch aus dem Prozess streichen. Dann spielt sie doch überhaupt keine Rolle mehr.«
»Ja, äh, nein«, fing der Professor an zu stammeln, »das ist zwar einerseits korrekt, aber Sie müssen doch andererseits auch sehen, dass seine Amygdala ...«
»Keine weitere Fragen«, hatte ihn der Staatsanwalt unterbrochen, und damit war die Aussage des Professors beendet.
Frederick McKinnock hatte sich übrigens gegen diesen Coup seiner Verteidigung zur Wehr gesetzt. Man habe die entsprechenden Experimente unter Vorspiegelung falscher Tatsachen mit ihm durchgeführt, sagte er mit einer Erregung, wie er sie sonst nicht ein einziges Mal gezeigt hatte. Es sei eine Frechheit, dass seine eigene Verteidigung – eine Pflichtverteidigung wohlgemerkt – ihn für verrückt erklären wolle! Er sei nicht verrückt. Er sei kein Psychopath oder Soziopath, er sei vollkommen normal. Er habe in vollem Bewusstsein gehandelt, in voller Verantwortung, aus freiem Willen. In dieser Hinsicht könne er dem Staatsanwalt nur zustimmen!
Als sie den Trafalgar Square umrundeten, kam eine SMS von Troller. Jane las: Ritter wirklich ermordet. Habe es mit eigenen Augen gesehen. Grauenvoll. – T.
Also doch. Sie hatte es ja geahnt. Aber wieso mit eigenen Augen gesehen? Wie hatte er das angestellt? Und warum schickte er nur eine SMS?
Sie wählte seine Nummer, hörte die Ansage von Trollers Mobilbox, hinterließ eine kurze Nachricht und legte wieder auf. Sie würde ihn später noch einmal anrufen.
Schon vom Taxi aus sah sie, dass im Old Bailey etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein musste. Die Kollegen, die vor dem Eingangsportal warteten, plauderten nicht so ruhig und entspannt miteinander wie sonst, sondern liefen durcheinander wie aufgescheucht. Jane erkannte in einem kleineren Pulk Marty Whitaker von der Times. »Was ist los, Marty?«
»Genau weiß es keiner«, sagte Marty und zuckte mit den Schultern, »aber es geht das Gerücht um, dass er sich umgebracht hat.«
»Der Erlöser?«
»Ironie des Schicksals«, sagte ein junger, sportlich aussehender Kollege, den Jane nicht kannte, der ihr aber schon einige Male aufgefallen war. »Der Erlöser hat sich selbst erlöst.«
»Woher wisst ihr das?«
»Das ist ja das Schöne«, sagte Marty. »Alle wissen es, aber keiner weiß, woher. Und es weiß auch niemand, ob es stimmt.«
»So ist das eben mit Gerüchten«, schaltete der junge Kollege sich ein, »sie kommen auf, sie entstehen, sie verbreiten sich, sie machen die Runde, sie eilen voraus, sie machen eine Menge verrückter Sachen, und alles ganz von allein. Kennen Sie die Zeichnung von diesem Deutschen, ich glaube, er hieß Webber oder Webster, der das Gerücht als Tier dargestellt hat, als Monster, als schlangenartiges Wesen? Der Mensch ist ihm ausgeliefert, weil er selbst ein Teil dieses Monsters ist, so sieht’s aus.«
»Das ist übrigens Frank Teschemacher von der SUN«, sagte Marty. »In seiner Redaktion verstehen sie eine Menge von Gerüchten.«
Die SUN war das reißerischste Boulevardblatt von ganz England, möglicherweise sogar der ganzen Welt. Schade, dachte Jane, während sie ihn in Augenschein nahm. Warum muss er ausgerechnet bei diesem Schundblatt arbeiten?
»Und das«, sagte Marty zu dem Kollegen, »ist Jane Anderson von Fazit.«
»Oh«, sagte der SUN-Mann mit einem freundlichen und zugleich ironischen Lächeln und reichte ihr die Hand. Es war ein hübsches, anziehendes Lächeln, und es war eine warme, trockene, sehr angenehme Hand.
»Also«, sagte sie, »was wisst ihr über den Erlöser?«
»Nichts«, sagte Marty. »Wenn man es genau nimmt, wissen wir nichts.«
»Der Witz an Gerüchten ist allerdings«, sagte Frank, »dass meistens etwas daran ist. Wenn wir wetten wollten, würde ich mein nächstes Gehalt darauf setzen, dass der Erlöser sich in seiner Zelle erhängt hat.«
»Womit?«
»Mit einem Strick aus seinem zerrissenen Hemd.«
»Woran?«
»Am Fensterkreuz.«
»Klar«, sagte Marty, »am Kreuz, wo sonst.«
»Gibt es da drinnen überhaupt ein Fensterkreuz?«
»Das sollten wir unbedingt herausfinden.«
»Aber warum sollte er sich umbringen?«, fragte Jane. »Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Er müsste doch an dem Urteil interessiert sein. Erhängen kann er sich doch immer noch.«
»Vielleicht wollte er verhindern, dass das Urteil gesprochen wird.«
»Aber er hat doch eine Botschaft. Er ist ja kein Triebtäter oder Mörder aus niederen Motiven. Der ganze Prozess hat ergeben, dass er nicht aus Eigennutz gehandelt hat. Er hat sich nicht wie andere Altenpfleger testamentarische Vorteile erschlichen oder sich sonst wie bereichert. Er hat’s getan, weil er es für richtig und barmherzig hielt. Er wollte sie wirklich erlösen.«
»Bist du auf seiner Seite?«, fragte Marty erstaunt. »Du redest ja geradeso, als fändest du es richtig, wie er gehandelt hat.«
»Nein, aber ...«
»Aber – was?«