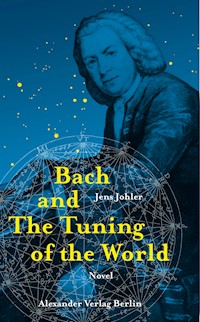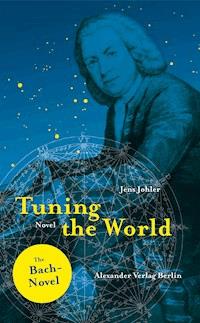Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich erinnere mich noch genau an die Worte unseres Direktors an dem Abend, als wir mit ihm zusammen in der Kulisse saßen, dem Theaterlokal an der Maximilianstraße. Er sagte, das Wichtigste im Leben eines Künstlers sei die Begegnung. Er zog, als er das sagte, die Augenbrauen bedeutungsvoll nach oben und ließ den Mund halb geöffnet stehen, wie es seine Art war. Dann schloss er ihn wieder und wiederholte noch einmal mit seiner hohen Stimme und demselben bedeutungsvollen Ausdruck: Die Begegnung! Ich dachte damals unwillkürlich an Johannes. Tatsächlich gab es - und gibt es bis heute - keine Begegnung, die mich so tief beeinflusst hat wie die mit ihm." Während der Fahrt zur Beerdigung des genialen Schauspielers Johannes Ronneburger liest der Schriftsteller Benjamin Bahner das Manuskript noch einmal durch, das er vor dreißig Jahren über diese Begegnung geschrieben hat - und er muss sich verwundert eingestehen, dass er noch immer nicht weiß, ob er dem Freund für den Eingriff in sein Leben dankbar sein oder ihn dafür verfluchen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich war aufgewachsen, wie eine Rebe ohne Stab, und die wilden Ranken breiteten richtungslos über dem Boden sich aus. (…) Ich fühlte, dass mirs überall fehlte, und konnte doch mein Ziel nicht finden. So fand er mich.
Hölderlin, Hyperion
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
DAS MANUSKRIPT
Johannes
The Guv’nor
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Puan Klent
Louis Armstrong spielt Bratsche
Die Lupe
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
When the Saints
Der bornierte Koloss
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Proben
Atom-Otto
Hänschen Rilow
Premiere
Höhenflüge
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Die Entscheidung
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
At the Jazzbandball
Meike Born
Johannes’ Zimmer
Die Welt der Gegensätze
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Der Privatdozent
An der Alster
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Allein
Der Brief
Rollenstudium
Der ältere Herr
Franzl
Die Burgschauspielerin
Im Kaffeehaus
Die Prüfung
Der Leopold
Nervenzusammenbruch
INTERCITY-INTERMEZZO
DAS MANUSKRIPT (SCHLUSS)
EPILOG
PROLOG
Ich las gerade in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Kevin Spacey, als mein Handy klingelte. Die Nummer auf dem Display sagte mir nichts. Ich überlegte, ob ich die Mailbox anspringen lassen sollte, wie ich es immer tat, wenn ich nicht wusste, mit wem ich es zu tun haben würde, nahm dann aber doch, ganz gegen meine Gewohnheit, das Gespräch an.
„Ronneburger“, sagte eine angenehme, warme, dunkle Stimme.
Erinnerungen stiegen in mir hoch. Ich kannte die Frau nicht, aber ich kannte den Namen. Jeder kannte ihn. Johannes Ronneburger war ein berühmter und, wie oft gesagt wurde, genialer Schauspieler. Er hatte in Bochum gespielt, in Bremen, in Düsseldorf, und war schließlich nach Engagements in Zürich und Wien (natürlich an der Burg) an den Münchner Kammerspielen gelandet. Ich war ihm in meiner Schulzeit begegnet, vor hundert Jahren, wie ich manchmal sagte. Genau genommen waren es etwas mehr als fünfzig. Wie alt wir geworden waren!
„Und Sie sind …?“
„Vera Ronneburger“, sagte sie, „seine Frau. Er hat mich gebeten, Sie anzurufen.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen“, sagte ich, ohne mir meine Überraschung darüber anmerken zu lassen, dass Johannes eine Frau hatte. „Aber“, fügte ich hinzu, „warum ruft er mich nicht selber an?“
„Oh“, sagte sie, und Bestürzung lag in ihrem Ton, „ich dachte, Sie wüssten es. Es kam schon in den Nachrichten. Johannes ist gestern früh gestorben.“
Kevin Spacey rutschte mir von den Knien, und es war mir peinlich, dass die Süddeutsche so raschelte, aber ich konnte einfach nicht sitzen bleiben, ich musste mich bewegen, zum Fenster natürlich, man geht in solchen Augenblicken immer zum Fenster, vielleicht, um den Himmel zu sehen oder wenigstens die Bäume. Ich war über mich selbst erstaunt. Ich hatte den Namen Johannes Ronneburger oft gelesen und immer wieder Fotos von ihm gesehen, im Kulturteil der FAZ, in der Süddeutschen, der Neuen Zürcher oder auch im Tagesspiegel, aber es hatte mich kaum noch berührt. Johannes war für mich eine Gestalt aus ferner, versunkener Vergangenheit, auch wenn mir immer bewusst war, dass ich ohne die Begegnung mit ihm nicht der geworden wäre, der ich war. Jahrelang hatte ich ihn dafür verflucht, nicht für alles, aber doch für vieles, was ich von ihm gelernt und übernommen hatte. Man lernt ja nicht nur gute und richtige Dinge, sondern auch falsche und vollkommen verquere.
„Sind Sie noch da?“, fragte Vera Ronneburger, deren Stimme mich, wie mir jetzt einfiel, an die Stimme von Johannes’ Tante erinnerte.
„Ja“, sagte ich. Entschuldigen Sie. „Ich bin nur etwas verwirrt. Hatte er einen Unfall?“
„Nein“, sagte sie. „Es war Krebs. Bauchspeicheldrüse. Sie haben es erst vor vier Wochen festgestellt, da war schon alles zu spät. Die Stunde der Palliativmedizin. Gottseidank hatte er kaum Schmerzen. Ich war bei ihm, als er starb. Er war schon nicht mehr bei Bewusstsein oder – wer weiß das schon so genau?“
Es entstand eine Pause, und ich dachte, sie wollte vielleicht noch etwas sagen, aber sie fragte nach einer Weile nur noch einmal: „Sind Sie noch da?“
„Verzeihen Sie“, sagte ich, „es berührt mich doch sehr. Mehr als … Er hat Sie also gebeten, mich anzurufen?“
„Ja“, sagte sie, „es war sein Wunsch, dass Sie zu seiner Beerdigung kommen.“
„Wirklich?“
„Oh ja. Er hat gerade in letzter Zeit wieder sehr viel von Ihnen gesprochen. Vielleicht überlegen Sie es sich?“
„Das werde ich“, sagte ich. „Ich werde es mir überlegen.“ Aber noch während ich das sagte, wusste ich, dass es da nichts zu überlegen gab.
„Wenn Sie erlauben“, sagte ich, „warum hat er mich nicht selbst gebeten zu kommen? Ich meine, als er noch lebte?“
„Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.“
Es klang ein wenig geheimnistuerisch, und ich war versucht zu fragen: Können Sie nicht oder wollen Sie nicht? Aber dann fragte ich doch nur, wann und wo die Beerdigung stattfände, und ob sie mir einen Platz in der Kirche reservieren könne, es werde doch sicherlich sehr voll werden.
„Nein“, sagte sie, „die Beerdigung findet in kleinem Kreise statt, die große Abschiedsfeier wird erst später von den Kammerspielen veranstaltet. Aber ich werde Ihnen in jedem Falle einen Platz freihalten. Danke, dass Sie kommen wollen.“
Drei Tage später saß ich im Zug nach München. Ich hatte ein Manuskript dabei, das ich vor rund dreißig Jahren geschrieben hatte, in einer Zeit, in der ich noch nicht wusste, ob ich über die Begegnung mit Johannes froh sein oder sie verfluchen sollte. Ich wusste es immer noch nicht, nur hatte ich aufgehört, darüber nachzudenken.
Als der Zug den Hauptbahnhof verlassen hatte, holte ich das Manuskript aus meiner Reisetasche und begann, darin zu lesen.
DAS MANUSKRIPT
Ich erinnere mich noch genau an die Worte unseres Direktors an dem Abend, als wir mit ihm zusammen in der Kulisse saßen, dem Theaterlokal an der Maximilianstraße. Er sagte, das Wichtigste im Leben eines Künstlers sei die Begegnung. Er zog, als er das sagte, die Augenbrauen bedeutungsvoll nach oben und ließ den Mund halb geöffnet stehen, wie es seine Art war. Dann schloss er ihn wieder und wiederholte noch einmal mit seiner hohen Stimme und demselben bedeutungsvollen Ausdruck: Die Begegnung!
Ich dachte damals unwillkürlich an Johannes. Tatsächlich gab es – und gibt es bis heute – keine Begegnung, die mich so tief beeinflusst hat, wie die mit ihm.
Johannes
In der Schule, auf dem Gymnasium, da sah ich ihn. Die Osterferien waren vorbei, das neue Schuljahr hatte begonnen, die Klasse war fast vollständig versammelt und wartete auf den neuen Deutschlehrer. Wobei warten soviel hieß wie Papierschwalben fliegen lassen, mit Bällen jonglieren, Tarzan-Hefte lesen oder einander von den Ferienerlebnissen erzählen. Doch plötzlich wurde es still, und als ich zur Tür blickte, sah ich einen hochgewachsenen jungen Mann mit Hornbrille, zurückgekämmtem Haar, gekleidet in eine dunkelgraue Hose, dunkelgraues Jackett und dunkelgrauen Pullover, unter dem der Kragen seines weißen Hemdes aussah wie das Kollar eines Priesters.
Alle hielten ihn für den neuen Deutschlehrer, und der Graugekleidete tat auch nichts, um diesem Eindruck entgegenzutreten. Er forderte uns auf, uns zu setzen und wartete mit strenger Miene, bis alle ihre Plätze eingenommen hatten. Dann begann er, immer noch in der Tür stehend, eine förmliche Begrüßungsrede, an deren Wortlaut ich mich nicht mehr erinnere, und erst, als Dr. Ahrndt, der echte Deutschlehrer, hinter ihm auftauchte, gab er sich als Mitschüler zu erkennen und suchte sich einen freien Platz. Er fand ihn neben Peter Pasing, dem Schüler, der gerade noch mit drei Bällen jongliert hatte.
Schon bald darauf bildete sich eine Clique um Johannes herum, zu der auch ich gehörte, obwohl ich mit Abstand der Jüngste in der Klasse war und vieles von dem, worüber die anderen scherzten und lachten, nicht verstand. Ich war vierzehn; die anderen fünfzehn oder sechzehn; Johannes, da er schon zweimal sitzengeblieben war, siebzehn. Wir alle, die wir nach der Schule im Pulk um ihn herum zum Othmarschner Bahnhof und in die Waitzstraße gingen, bewunderten ihn für sein umfangreiches Wissen über Geschichte und Politik, Literatur, Philosophie und Kunst. Nur von Mathematik, Physik und Chemie hatte er keine Ahnung, weil ihn die Naturwissenschaften nicht interessierten, ja, er verachtete sie sogar, und das war auch der Grund dafür, dass er schon zweimal sitzengeblieben war.
Unser Ziel, wenn wir in die Waitzstraße gingen, war die italienische Eisdiele, allein schon wegen der Jukebox. Wer immer ein paar Groschen übrig hatte, setzte das Schallplattenrad in Bewegung und bekundete damit seinen Musikgeschmack. Die Jazzfreunde wählten Ice Cream von Chris Barber, Skokiaan von Louis Armstrong oder Blueberry Hill von Fats Domino. Peter Pasing, der übrigens Pfarrerssohn war und später einmal ein berühmter Maler werden sollte, hielt es mehr mit Connie Froboess oder Caterina Valente, und der Einzige, der sich traute Rock ’n’ Roll zu wählen, war Klaus Hansen, aber auch er tat so, als wäre es ein ironischer Akt, wenn er Rock around the Clock von Bill Haley auswählte, oder Tutti Frutti von Elvis Presley. Wir alle waren fasziniert vom Rock ’n’ Roll, aber niemand traute sich, das zuzugeben. Rock ’n’ Roll war etwas für Halbstarke und Proleten, und wir waren keine.
Noch mehr als das Eis und die Jukebox bezauberten mich die Eisverkäuferinnen, Gina und Bruna. Bruna hatte rötlichblonde Haare und braune Augen, Gina schwarze Haare und blaue Augen. Bruna lachte jeden an und war ungeheuer sexy, Gina war ernst und lächelte in all den Jahren nicht ein einziges Mal. Die anderen schwärmten von Bruna, ich verliebte mich in Gina. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wollte ich sie aus ihrer Traurigkeit befreien. Vielleicht glaubte ich auch, es gäbe eine geheime Seelenverwandtschaft zwischen uns, und sie müsste das ebenso spüren wie ich. Aber sie schenkte mir in all den Jahren nicht ein einziges Mal ein Lächeln. Was mich tröstete, war nur, dass sie es auch keinem anderen schenkte.
Aber wenn ich auch zu der Clique gehörte, die sich um Johannes herum bildete, so blieb ich doch eher am Rande, an der Peripherie. Das lag nicht nur daran, dass ich der Jüngste war, sondern hatte auch damit zu tun, dass ich mich zur selben Zeit mit einem anderen Schüler anfreundete, der ebenfalls neu in unsere Klasse gekommen war.
Ich weiß nach all den Jahren nicht mehr, wie es dazu gekommen war, dass er neben mir saß. Hatte er sich zu mir gesetzt oder ich mich zu ihm? Ich weiß nur, dass er mir mit seiner schlaksigen Gestalt, seiner großen Nase und seinen lustigen Augen schon vorher aufgefallen war, schon bevor er zu uns in die Klasse kam, auf dem Schulhof oder auch in der Aula bei einem Schulkonzert. Es ist seltsam: ich habe nur das Bild im Kopf, dass Kai Banitzka, so hieß er, und ich im Klassenzimmer neben einander sitzen, es steht mir lebhaft vor Augen, wie man so sagt, aber das ist es eben, es ist nur ein Bild, ein Tableau; welches Geschehen, welche Geschichte, welcher Film zu dieser Si tuation geführt hat, kann ich mir nur noch zusammenreimen. Erinnern heißt fälschen, wird gesagt. Aber oft sind nicht die Bilder gefälscht, sondern nur die Geschichten, die wir mit ihnen verknüpfen.
Ob es nun genauso war oder nicht, Kai fing sofort an, mir vom Jazz zu erzählen. Er hatte eine ziemlich umfangreiche Plattensammlung, vor allem New Orleans- und Dixieland-Jazz, aber auch Chicago und Swing. Ich hörte ihm gern zu, weil er so begeistert davon erzählte, und auch weil ich seine näselnde Stimme und seine lustigen braunen Augen mochte. Er habe sich gerade ein Banjo gekauft, sagte er, und werde demnächst eine Band gründen, eine Jazzband. Ich beneidete ihn um seinen Enthusiasmus, kam aber nicht auf die Idee, dass ich in seinen Plänen eine Rolle spielen könnte.
Anfang Mai fragte Kai mich, ob ich mit ihm in ein Jazzkonzert gehen wolle, ins Curio-Haus. Er habe schon eine Karte, aber ich könne ja an der Abendkasse noch eine kaufen. Ich sagte ja, ich würde gern mitkommen, müsste aber erst zu Hause fragen.
„Zu Hause fragen?“ Kai schaute mich ungläubig an.So etwas gab es für ihn nicht. Er war sechzehn und lebte allein mit seiner Mutter zusammen, sein Vater war im Krieg geblieben, wie es damals hieß. Es klang immer so, als hätten die Männer sich freiwillig dazu entschieden.
„Jazz?“, sagte meine Mutter, als ich sie beim Mittagessen fragte. „Da gibt es doch immer Krawalle.“
Zum Glück saß mein Bruder mit am Tisch. Er war fünf Jahre älter als ich und hatte gerade sein Abitur bestanden. Das mit den Krawallen habe sich inzwischen erledigt, sagte er. Die habe es gegeben, als Lionel Hampton in der Ernst-Merck-Halle gespielt habe, und auch bei Louis Armstrong im Sportpalast in Berlin. Aber dass es im Curio-Haus zu Krawallen kommen könnte, sei völlig ausgeschlossen. Außerdem habe das Hamburger Abendblatt das Konzert empfohlen.
„Das Hamburger Abendblatt, wirklich?“
„Aber ja. Hast du das nicht gelesen?“
Das Hamburger Abendblatt war die Institution für meine Mutter. Wenn etwas vom Hamburger Abendblatt empfohlen war, dann musste es etwas Gutes oder zumindest Respektables sein, und damit war die Sache entschieden. Später verriet mein Bruder mir, er hätte sich die Sache mit dem Abendblatt nur ausgedacht. So war er. Er konnte jeden übers Ohr hauen. Mich sowieso. Als er sechzig wurde, hielt ich auf seiner Geburtstagsfeier eine Rede über den listigen Blick in seinen Augen. Bald darauf starb er. Den Tod hatte er nicht übers Ohr hauen können.
The Guv’nor
Das Curio-Haus lag an der Rothenbaumchaussee oder am Rothenbaum, wie man in Hamburg sagte.
Schon von Weitem sah ich, wie sich die Menge durch den hohen Torbogen in den Hof hineindrängte, über den man zu den Festsälen kam. Ich schlängelte mich durch die Leute hindurch in den Vorraum und wunderte mich, dass niemand protestierte. Drinnen suchte ich die Kasse, aber es gab nur einen weißen Tisch, hinter dem zwei junge Männer saßen und Programmhefte verkauften. Ich steuerte auf sie zu, um nach einer Karte zu fragen, und mir war, als hörte mein Herz auf zu schlagen, als ich das abgegriffene Pappschild mit der schwarzen Schrift darauf sah: AUSVERKAUFT.
„Okay“, sagte ich zu Kai und versuchte so lässig wie möglich zu erscheinen, „dann zisch’ ich mal wieder ab.“
„Kommt nicht in Frage“, sagte Kai, „entweder wir gehen beide rein oder keiner. Frag doch mal herum, ob jemand eine Karte übrighat.“
Es wäre so leicht gewesen. Ich hätte mich nur vor den Eingang zu stellen und zu rufen brauchen: Eine Karte gesucht! Wer hat noch eine Karte? Aber ich brachte es nicht über mich. Ich schämte mich, vor all den Leuten meine Stimme zu erheben. Ich öffnete den Mund, schloss ihn wieder und schüttelte nur den Kopf.
Kai kannte keine derartigen Hemmungen. Er erhob laut und deutlich seine näselnde Stimme und rief: „Eine Karte gesucht, wer hat noch eine Karte? Ein Königreich für eine Karte!“, und seine braunen Augen funkelten dabei so verschwörerisch, als wollte er sagen: Guck mal, wie überzeugend ich das mache, ich glaube fast, die fallen darauf herein.
Aber niemand fiel darauf herein. Die Leute schoben sich an uns vorbei und stiegen mit schabenden Schritten die breite Steintreppe hinauf. Auch die Zeit schob sich an uns vorbei. Sie kam von oben herab und sagte: Schönen Gruß aus dem Konzertsaal, er wird immer voller, und das Konzert beginnt in wenigen Minuten. Leider ohne euch.
„Das war’s, Alter“, sagte ich und spürte, wie mir die Enttäuschung das Gesicht verzerrte. Es war eben doch nicht so leicht, hier zu stehen und mit anzusehen, wie alle hineindurften, alle außer mir. Ich fühlte mich wie der Hund, der vor der Tür des Schlachterladens sitzt und auf dieses Schild starrt. Oder so, wie ich mich als Kind jeden Abend gefühlt hatte, wenn ich im Bett lag und durch die Wand hindurch meine Eltern und meine älteren Geschwister hörte, die sich Geschichten erzählten und aus vollem Halse lachten, als wäre das Leben jetzt erst schön, jetzt, wo der Kleine endlich im Bett war.
„Komm mit“, sagte Kai und zog mich hinein in den Strom der Besucher. Jetzt machten auch unsere Schritte das schabende Geräusch. Oben sah ich eine hohe, weit geöffnete Flügeltür und davor zwei junge Männer, die die Karten kontrollierten, einer links, einer rechts. Langsam, aber unaufhaltsam, schob uns die Menge auf die Tür zu. Nur noch zwei Meter, nur noch einer, ich drehte mich zu Kai um und wollte fragen, was wir jetzt tun sollten, doch bevor ich noch einen Ton herausbrachte, flüsterte er „Jetzt“, gab mir einen heftigen Stoß in den Rücken, und während ich, ohne recht zu wissen, wie mir geschah, in den Saal hineinstolperte, hörte ich seine näselnde Stimme rufen: „Hey, Sie quetschen mir ja die Rippen kaputt, Sie Oimel! Ich will ins Konzert und nicht ins Krankenhaus!“
Und ich war drin! Ich konnte es kaum fassen. Nur – wo sollte ich sitzen? Es war ausverkauft. Es gab Platzkarten. Für jeden Platz eine. Auf welchen Platz ich mich auch setzte, irgendwann würde jemand kommen und mich vertreiben. Ich setzte mich mit klopfendem Herzen auf einen – noch! – freien Platz in der dritten Reihe, stand hin und wieder auf, um Leute an mir vorbeizulassen, bangte jedes Mal, dass die Person mit der Karte für meinen Platz mich aufforderte den Platz freizugeben, aber, ob es nun die Wirklichkeit war oder ein Traum, es kam niemand. Es war wie ein Wunder! Das Konzert war ausverkauft, aber dieser eine Platz blieb frei. Das heißt, jetzt nicht mehr, jetzt saß ich ja darauf.
Das Licht ging aus. Das Stimmengewirr verwandelte sich in Gemurmel, das Gemurmel in Getuschel, das Getuschel in erwartungsvolle Stille. Nacheinander erschienen sieben ganz alltäglich gekleidete Männer auf der Bühne, gingen zu ihren Instrumenten (Schlagzeug, Bass, Klavier) oder trugen die Instrumente bei sich (Kornett, Posaune, Klarinette). Der Bärtige mit dem Kornett war der Bandleader. Er war nicht besonders groß, trug eine braune Cordhose und ein kariertes Hemd und nuschelte ein paar Worte ins Mikrofon. Dann gab er mit dem Fuß den Takt vor, und die Band fing an zu spielen.
Und auch die Musik war wie ein Wunder! Ein Wunder allerdings, das für mich mit einer so schmerzlichen Sehnsucht verbunden war, dass ich immer mehr hören wollte, mehr und mehr, um diese Sehnsucht zu stillen, was aber, wie ich ahnte, niemals gelingen würde. Kai hatte mir allerlei erzählt, von Harmonien und Improvisation, davon, dass der Blues zwölf Takte hatte, und auch davon, dass meistens am Anfang alle zusammenspielten und dann die Soli kamen, Posaune, Klarinette, Klavier, Kornett und manchmal auch Schlagzeug, Bass oder Banjo. Und was ich auch wusste, war, dass Ken Colyer, so hieß der Bandleader, die Angewohnheit hatte, sein Kornett in einen alten verbeulten Blechhut zu halten, was einen ganz eigenen, unverwechselbaren Sound ergab. Oder auch, dass er in Jazzerkreisen The Guv’nor genannt wurde, aus Zuneigung und Respekt.
Wenn der Guv’nor ein neues Stück ankündigte, nuschelte er wieder so, dass ich kein Wort verstand. Und wenn er sang – ja, er sang auch, er sang Halleluja, I’m walking with the King – dann war das nicht die Art zu singen, für die meine Eltern in die Oper gingen. Dieses Halleluja war ein anderer Jubel, viel bescheidener, ungekünstelter als alles, was ich von den Opernplatten meines Vaters her kannte. So ausgelassen die sieben Musiker dort oben spielten, so sehr war es doch auch wieder eine stille, innige Musik.
Während ich mit offenem Mund und immer höherschlagendem Herzen auf meinem Platz saß, wusste ich mit einem Male, dass ich mir nichts sehnlicher wünschte, als einmal selbst dort oben zu stehen, in Cordhose und kariertem Hemd, ein Kornett in der einen, einen Blechhut in der anderen Hand, und Halleluja zu spielen, Halleluja, I’m walking with the king.
INTERCITY-INTERMEZZO
Der ICE glitt gleichmäßig mit 200 km/h dahin, manchmal etwas schneller, manchmal etwas langsamer. Ich blickte aus dem Fenster, sah kleinere Waldstücke, dann wieder freie Felder mit ein paar Kühen und gleich da rauf eine Koppel mit Pferden. Mir fiel ein, dass ich einmal Reitunterricht genommen hatte, insgesamt zehn Stunden, in denen ich unter der Anleitung von Frau Kröger, der Reitlehrerin, lernte das Pferd zu satteln, aufzusitzen, im Schritttempo zu reiten und das Pferd traben zu lassen, wobei das Aussitzen im Trab die schwerere Übung war. In der letzten der zehn Stunden war ich auf dem Pferd, das den Namen Feldherr trug, durch die Kornfelder in der Nähe von Kappeln geritten, im stehenden Galopp, die Fäuste auf den kräftigen Nacken von Feldherr gestützt. Es kam mir unendlich schnell vor, viel schneller als die 193 km/h des ICE, in dem ich jetzt Richtung München fuhr.
Ich hatte damals einen Urlaub in Lindaunis verbracht, dort oben an der Schlei, und als ich zurück in Berlin war, wollte ich unbedingt weiter Reitunterricht nehmen, weil es mir mit Feldherr und Frau Kröger so gut gefallen hatte. Aber der Reitlehrer im Grunewald war ein so unangenehmer, herrischer, schnauzbärtiger Patron, der mir und dem Pferd so rücksichtslos seinen Willen aufzwingen wollte, dass mir schon nach der ersten Stunde das Reiten für immer verleidet war. Es gibt wunderbare, Mut machende Begegnungen wie die mit Feldherr und Frau Kröger, und es gibt Begegnungen, die einem alles verleiden, wie die mit dem schnauzbärtigen Patron, dessen Name es nicht Wert wäre, genannt zu werden.
So viel zu den Pferden auf der Koppel, an denen der ICE vorbei raste.
Ich nahm mir das Manuskript wieder vor und hörte vor meinem inneren Ohr noch einmal die Stimme von Ken Colyer, wie er I’m walking with the king oder Take this hammer sang. Ich hatte mir damals geschworen, diesem Mann und seiner Musik für immer treu zu bleiben, und in gewisser Weise habe ich meinen Schwur gehalten. Es gibt einen Schallplattenmitschnitt von diesem Konzert, und ich habe diese Platte in all meinen Lebensphasen immer wieder gehört, sie ist so etwas wie meine seelische Heimat. Was mich nur traurig stimmte, war, dass ich niemals einen Menschen gefunden habe, der meine Liebe zu Ken Colyer verstehen konnte. Die Leute liebten Bach oder die Beatles, Beethoven oder Bruckner, und wenn sie Jazz liebten, dann schwärmten sie von Miles Davis oder Bill Evans, aber Ken Colyer? Who?
Einer meine Lieblingsmusiker wurde später Van Morrison, und das größte Glück – ja, auch wieder ein Wunder! – war es für mich, als Kai (ein anderer Kai) mir eine CD schenkte, auf der Van Morrison den Blues sang, den Ken Colyer selbst geschrieben hatte, als sein Bekenntnis und seine Erkennungsmelodie: Goin’ Home. Van Morrison war der Rockmusiker, den ich am meisten liebte, ich hatte ihn in der Waldbühne in Berlin gehört und im Greek Theatre in Berkeley bei San Francisco, und nun ereignete sich das Wunder, dass Van Morrison, der irische Rockpoet, Ken Colyers legendäre Zeilen sang: Well if home is where the heart is, then my home’s in New Orleans.
Damals, als ich im Curio Haus diesen Blues hörte, war mir, als sollte der New Orleans Jazz auch meine Heimat werden.
DAS MANUSKRIPT (FORTS.)
Puan Klent
Ordnung, Sitte, Tugend bewahre deutsche Jugend
stand in Stein gemeißelt über der Eingangstür zum Haupthaus des Schullandheims Puan Klent auf Sylt.
Meine Mutter hatte mir für die Klassenfahrt eine dreiviertellange Popeline-Jacke gekauft. Sie war nicht vollkommen wasserdicht, aber doch imprägniert und wasserabweisend. Sie roch etwas säuerlich, als hätte man sie durch Essigwasser gezogen, war von graugrüner Farbe, changierte ein bisschen ins Rötliche und hatte einen Gürtel, den ich an den Seiten herunterhängen ließ. Ich fühlte mich in dieser Jacke, wenn ich sie nach hinten schob und die Hände in den Hosentaschen versenkte, nun, nicht gerade erwachsen, aber doch nicht mehr so kindlich wie in dem Fischgrat-Stoffmantel, den ich vorher getragen hatte. Es fiel aber kaum jemandem auf, nur Johannes sagte in dem ironischen Tonfall, in dem er immer sprach, die Jacke sei ja richtig dufte.
„Ja, findest du?“, sagte ich erfreut.
„Und ob“, sagte er, „allein schon wie der Gürtel an den Seiten herunter oimelt, das ist doch irre!“ – und erst jetzt begriff ich, dass er sich über den Jazzer-Jargon lustig machte, den ich von Kai übernommen hatte. Ich ärgerte mich über Johannes’ ironischen Spott, gestand mir aber ein, dass ich es nicht besser verdient hatte. Wie oft hatte ich darüber gelacht, wenn Johannes die Eigenheiten der Anderen ironisch imitierte oder parodierte, die der Lehrer, der Mitschüler, oder die von Politikern und Filmschauspielern. Er konnte mühelos in alle Rollen schlüpfen, welche es auch waren, und ich musste darüber lachen, ob ich wollte oder nicht, warum also sollte ich jetzt beleidigt sein? Wir redeten ja wirklich so, Kai und ich, wir sagten Alter zueinander und fanden, wir wären dufte Schaffer, und die Worte Oimel und oimeln waren die Joker in unserer Sprache, die auf alles passten. Es gab sogar eine Jazzband, die sich die Oimel Jazz Youngsters nannte.
Ich gab Johannes insgeheim Recht, aber andererseits – hätte ich mich nicht ebenso über seine pastorenhafte Kleidung lustig machen können oder über sein mit Brillantine zurückgekämmtes Haar? Oder über seine schiefe Kopfhaltung? Oder seine Angewohnheit, sich mehrmals täglich Nasentropfen zu verabreichen, Privin oder Otriven? Ja, hätte ich. Nur fehlte mir das parodistische Talent dafür, und daher hätte ich es eben doch nicht gekonnt.
Kai hatte einen Plattenspieler auf unsere Klassenfahrt mitgenommen, einen Phonokoffer mit eingebautem Lautsprecher. Jeden Tag nach dem Mittagessen zogen wir uns in unser Zimmer zurück und hörten 45er Platten von Humphrey Lyttelton, Louis Armstrong, Sidney Bechet oder auch die 33er mit dem Titel Ringside at Condon’s, die ich besonders liebte. Der Kornettist hieß Wild Bill Davison, und sein Spiel hatte tatsächlich etwas Wildes und Ungebärdiges, sein Ton war rauer und heiserer als der von Ken Colyer, und manchmal ließ Wild Bill ganz überraschend einen jubelnd hohen Ton aus seinen sonst eher dunkel mäandernden Phrasierungen herausplatzen, einen Trompetenlaut, der dem Rüssel eines Elefanten hätte entstammen können. Je öfter wir diese Platte hörten, desto mehr wünschte ich mir, so zu spielen wie Wild Bild Davison, und wenn ich nachts vor dem Einschlafen darüber nachdachte, dass ich doch eigentlich wie Ken Colyer hatte spielen wollen, dann beunruhigte es mich zutiefst, dass ich, kaum hatte ich meine erste Liebe zu einem Jazzmusiker entdeckt, dieser Liebe auch schon wieder untreu war. Ich würde aber sowieso nicht wie Ken Colyer spielen können, weder wie Ken Colyer noch wie Wild Bill Davison, ich würde überhaupt nicht spielen. Ein paar Tage vor unserer Abfahrt nach Sylt hatte ich meine Eltern gefragt, ob ich Trompete lernen dürfte, und sie waren kategorisch dagegen gewesen. Ich hatte Kai nichts davon erzählt, nicht einmal davon, dass ich überhaupt den Wunsch hatte, Trompete oder Kornett zu spielen, aber als er mir verriet, dass er sich demnächst ein paar Leute suchen würde, um eine Jazzband zu gründen, da gestand ich ihm unter Herzklopfen, dass ich mir seit dem Abend im Curio-Haus nichts sehnlicher wünschte, als Kornett zu spielen.
„Mensch, Alter, das wäre doch dufte“, sagte Kai.
Ja, sagte ich, aber meine Eltern hätten gesagt, Kornett oder Trompete kämen nicht in Frage, das sei zu laut. Allenfalls Querflöte.
„Querflöte?“, sagte Kai angeekelt.
„Ja, oder Klarinette.“
„Klarinette, im Ernst?“
Ja, sagte ich, aber das hätte ich natürlich abgelehnt. Ich hätte gesagt, entweder Kornett oder gar nichts.
„Bist du verrückt“, sagte Kai. „Klarinette ist doch ein duftes Instrument!“
Ja, sagte ich, aber ich hätte nun einmal den Wunsch, Kornett zu spielen, und diesmal wollte ich mir meinen Wunsch nicht wieder ausreden lassen.