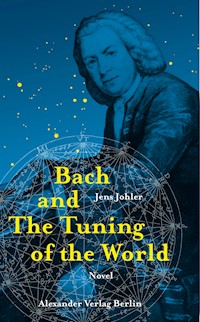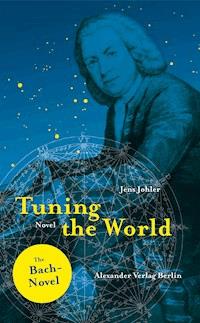Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Haben Sie schon mal ein Manuskript an einen Verlag geschickt und sogar - oh Wunder - eine Einladung zum Gespräch mit dem Verleger bekommen? Waren Sie einmal auf einem Verlagsfest, um die Kollegen kennenzulernen? Haben Sie je das Glück erlebt, aus Ihrem ersten Roman zu lesen? Oder die Pein, mit anderen Autoren (Vögeln), beobachtet von Kritikern und Lektoren (Ornithologen), in einen literarischen Wettbewerb zu treten? Jens Johler erzählt seine "Geschichten aus dem Literaturbetrieb" mit ironischem Blick nicht nur auf die Anderen, sondern vor allem auf sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Beim Verleger
Das Literaturfest
Im Literaturhaus
Seliges Vergessen
Ornithologie
Beim Verleger
Ich fuhr nach Zürich, um den Verleger zu besuchen. Eine innere Stimme warnte mich davor, aber ich hörte nicht auf sie.
Zürich ist eine ganz bezaubernde Stadt, besonders bei schönem Wetter. Fünf Tage hintereinander schien die Sonne, von Mittwoch bis zum Sonntag. Es war sehr warm, und man konnte im Zürisee baden. Ich habe es nicht getan, aber Andrea hat täglich gebadet, manchmal schon vor dem Frühstück. Wir wunderten uns beide mehrmals, dass man in einer weltbekannten Stadt so herrlich Urlaub machen kann. Das hatten wir nicht erwartet. Wir hatten gedacht, wir würden in der Stadt herumlaufen und uns die Häuser anschauen, die ja zum Teil noch aus dem Mittelalter stammen oder aus dem Rokoko. Aber wir waren immerzu am See, auf dem See oder – Andrea – im See.
Wir hatten auch ein gutes Hotel, das Bellerive au Lac. Es liegt, wie der Name vermuten lässt, direkt am See, und zwar am Ostufer, am sogenannten Utoquai. Wenn man, wie wir, ein Zimmer in der vierten Etage hat, kann man einen wunderschönen Seeblick mit Aussicht auf die Berge genießen. Es war nur etwas laut. Unten, zwischen Hotel und Seepromenade, verlief die Straße, und die Autos machten einen mörderischen Lärm. Aber ich hatte meine Ohrstöpsel dabei, und Andrea hatte mich am Telefon gebeten, auch für sie welche mitzubringen. Wenn wir des Nachts die Stöpsel in die Ohren schoben und die Fenster schlossen und die Jalousien herunterließen, war der Lärm durchaus noch zu ertragen.
Es war beinahe erstaunlich, dass mit Andrea alles gut ging, mehr als gut. Schon unser Wiedersehen war eine Freude. Ich kam mit dem Flugzeug aus Berlin, sie mit dem Zug aus Karlsruhe, wo ihr Bruder gerade einen Futonladen aufgemacht hat. Wir hatten uns eigentlich im Hotel treffen wollen, aber weil mein Flugzeug schon um 17.20 Uhr landete und ihr Zug erst um 18 Uhr ankam, und weil es, was ich vorher nicht gewusst hatte, eine direkte Zugverbindung vom Flughafen zum Hauptbahnhof gab, und weil mein Zug sofort losfuhr und Andreas Zug einige Minuten Verspätung hatte, war ich wider Erwarten und gegen unsere Verabredung, auf Plattform vierzehn, noch bevor der Zug aus Karlsruhe einlief.
Wie immer, wenn ich auf Andrea wartete, fürchtete ich, sie nicht mehr zu mögen, wenn sie kam. Sie hatte oft etwas allzu Zielstrebiges und daher Verhuschtes. Sie wieselte, so schien es, mit blinden Augen durch die Gegend, sah weder links noch rechts und war auch nicht darauf bedacht, gesehen zu werden. Aber diesmal! Wie angenehm war ich enttäuscht. Sie war sogar geschminkt. Ja, sagte sie, nachdem wir uns genug umarmt hatten, ihre Mutter habe sie zu einer Kosmetikerin geschickt. Sie habe sich die Augenbrauen zupfen lassen, Lidschatten, Rouge und Lippenstift aufgetragen, aber natürlich alles sehr dezent. Ob mir das gefalle?
„Und ob“, sagte ich.
Wir fuhren ins Hotel, machten uns ein wenig frisch, wie es immer heißt, und tranken eine halbe Flasche Champagner. Danach gingen wir in die Marktgasse, um zu essen. Man konnte draußen sitzen und brauchte sich um nichts zu kümmern, weder um die unfreundliche Bedienung noch darum, dass das Fleisch ein bisschen zäh war. Andrea erzählte fleißig von Landau in der Pfalz, wo sie gerade herkam, von ihrer Mutter, ihrer Tante Adelheid, vom Tennisspielen und von ihrem Bruder, der mit seinem Futonladen wieder mal den Vogel abgeschossen hatte –, und alles war sehr friedlich, sehr harmonisch, wie Andrea nicht umhinkam zu bemerken. Anschließend nahm ich noch einen Drink in der Hotelbar, und Andrea aß dazu Vanilleeis. Dann gingen wir zurück ins Zimmer.
Auf dem roten Teppichboden vor meinem Bett liefen ein paar winzig kleine Ameisen herum. Ich nahm eine der Socken, die ich gerade ausgezogen hatte, und zerrieb die Ameisen damit auf dem Teppichboden. Bald schliefen wir ein.
Schon beim Frühstück war ich aufgeregt. Ich hatte einen dösigen Kopf, wie immer, wenn ich zu viel geraucht und getrunken habe, und die Aufregung schlug mir auf den Magen. Andrea bestand darauf, dass ich ein Marmeladenbrötchen aß und bereitete es mir zu. Der Kaffee war sehr bitter, aber der frischgepresste Orangensaft rettete mich. Ich konnte wieder rauchen, das war ein gutes Zeichen.
Nun mussten wir noch die Zeit herumbringen, bis ich zum Verleger in die ***straße fahren konnte. Um 17 Uhr war ich mit ihm verabredet.
Andrea hatte die Idee, bis dahin noch ein bisschen auf dem See herumzufahren. Wir gingen zur Anlegestelle Bahnhofsstraße und nahmen ein Schiff, das uns nach Thalwil fuhr, einem kleinen Ort am Westufer. Wir gingen eine steil ansteigende Straße hinauf, trieben uns eine Weile in der Einkaufsgegend herum, gingen die Straße wieder hinunter und nahmen das nächste Schiff zurück. An der Anlegestelle Zürihorn stiegen wir aus, weil Andrea Hunger hatte. Es gab dort ein Gartenrestaurant, das Kasino. Andrea aß einen Salat, ich Rösti mit Spiegeleiern. Als ich zur Toilette ging, las ich an der Kabinentür einen Spruch, den ich Andrea unbedingt aufschreiben musste: Schicken ist fön.
Langsam schritt die Zeit voran.
Vom Kasino zum Hotel war’s ein Spaziergang. Wir gingen am Ufer entlang durch die Grünanlage, vorbei an einem blauen Zirkuszelt, an einem Fischrestaurant, an einer Plastik von Henry Moore und einem Bootsverleih.
Auf dem Kühlschrank im Hotelzimmer, der sogenannten Minibar, liefen ein paar Ameisen herum. Ich zerdrückte sie.
Andrea begleitete mich zum Theaterplatz, wo ich ein Taxi nehmen wollte. Ich bekam auch sofort eines, und Andrea wünschte mir viel Glück. „Lass dich nicht einmachen“, sagte sie.
Der Taxifahrer stammte aus Malaysia und sprach mit Schweizer Akzent. Ich fragte, ob ich rauchen dürfe, und er sagte ja. Ich kramte in den Taschen meines Jacketts nach Zigaretten und Streichhölzern und dabei fiel mir auf, dass ich mein Nasenspray vergessen hatte. Ich brauchte es im Augenblick nicht, aber ich war auch noch zum Essen eingeladen, und wenn ich weiter so viel rauchte, würde ich es brauchen. Ich bat den Fahrer, bei einer Apotheke zu halten, und er wurde etwas misstrauisch. Als ich zurückkam, war er sehr erleichtert und taute auf. Er hob eine Plastikflasche mit Erdbeerjoghurt in die Höhe und sagte, „Wahnsinn, alles künstlich, Wahnsinn! Kein Zucker – Assugrin. Wenn ist natürlich, ist zu teuer oder gibt es nicht. Wahnsinn. Muss man gesund leben, viel Gemüse, viel Obst, kein Fleisch. Ist nicht nötig dick sein, kommt von Ernährung. Viel Obst, viel Gemüse, nicht diese künstlichen Sachen. Leute tun Assugrin in Kaffee und essen dickes Stück Torte. Ist Wahnsinn. Oder.“
Als er mich in der ***straße absetzte, war es zehn vor fünf. Das Haus stand auf einem Eckgrundstück am Waldrand. Es war eine große Villa mit einem etwas verwilderten Garten. Aus einem Fenster im Hochparterre schaute eine Frau heraus, und ich dachte, jetzt hat sie mich gesehen, jetzt muss ich auch hineingehen, sonst denken die, ich habe Angst. Ich wäre aber lieber noch im Wald spazieren gegangen, um nicht überpünktlich zu sein. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich es überhaupt nicht mehr erwarten, dem Verleger die Hand zu schütteln und mich von ihm zum Autor machen zu lassen.
Das Taxi wendete, und ich ging auf die Gartenpforte zu. Ich sah, dass sie mit einer dicken Eisenkette verschlossen war. Macht nichts, dachte ich, dann nehme ich die andere. Ich ging um die Ecke, und tatsächlich gab es noch eine zweite Pforte.
Auf dem Weg zum Haus kam mir ein Hund entgegen. Er war größer als ein Spitz, kleiner als ein Schäferhund und hatte Haare wie ein Rauhaardackel. Ich glaube, er war noch sehr jung und verspielt und hatte keine Ahnung, wie man sich einem unbekannten und noch unveröffentlichten Autor gegenüber benimmt, zum Beispiel ob man/ hund ihn beißt oder ob man/hund ihm die Füße leckt. Er schnupperte und hechelte unentschieden an mir herum, und ich dachte, ich sollte mich vielleicht zu ihm hinunterbeugen und ihn streicheln, falls der Verleger gerade aus dem Fenster schaut. Ich hatte schon einmal einen Vertrag mit einem Verleger gemacht, für ein Theaterstück, das damals aber noch nicht aufgeführt war, und der Theaterverleger hatte einen Airedale. Ich habe für Hunde im allgemeinen nicht viel übrig, sie sind mir aber gleichgültig, solange sie nicht bellen oder beißen. Es gibt, glaube ich, nur vier Hundearten, die mir absolut zuwider sind, nämlich Schäferhunde, Doggen, dann diese weißen, fetten, kurzbeinigen, schweineartigen, deren Namen ich mir immer nicht merken kann, und schließlich Airedales. Und trotzdem habe ich den Hund des Theaterverlegers sofort gestreichelt und ihm die Schnauze getätschelt und ihn hinter seinen Airedaleohren gekrault, was er sich alles gefallen ließ, obwohl er mit seinem Instinkt hätte merken müssen, dass ich mich vor ihm ekelte. Vielleicht hat er es aber auch gemerkt und sich genauso widerwärtig verlogen von mir streicheln lassen, wie ich ihn gestreichelt habe.
Diesmal aber streichelte ich den Hund des Verlegers nicht, aus Stolz. Ich dachte auch, vielleicht guckt der Verleger gerade aus dem Fenster und denkt, was für ein unterwürfiger Mensch ist dieser Autor, dass er sich schon bei meinem Hund anfiezt, er hat, wie mir scheint, überhaupt kein Rückgrat, von dem bringe ich nicht eine Zeile. Damit wäre alles aus gewesen. Ich streichele einen Hund, und schon ist meine Karriere ruiniert.
Ich ging die Steinstufen bis zur Haustür hoch und wollte klingeln oder anklopfen, aber die Tür stand halb offen, und da ich schon gesehen worden war und niemanden mehr erschrecken konnte, ging ich ins Haus. Gleich links war eine Garderobe, und irgendwo sah ich ein Poster von einem prominenten Verlagsautor. Zu den Zimmern im Hochparterre führten erneut ein paar Stufen, und während ich es wagte, sie hinaufzugehen, kam eine schwarz-und kurzhaarige Frau herbeigeeilt und fragte mich etwas oder sah mich fragend an. Ich nannte meinen Namen, und sie sagte Achja und zeigte auf eine Tür. Die Tür sprang auf, und ein großer, um die vierzigjähriger, nicht unsympathisch wirkender Mann winkte mich herein. Er gab mir die Hand und sagte, er sei der Verleger.
Aha, dachte ich, das ist also der Verleger, und ich schaute ihn mir genauer an. Er trug eine bräunlich-beigefarbene Hose und ein bräunlich-beigefarbenes Hemd, und ich weiß noch, dass ich dachte, wieso zieht er zu seiner bräunlich-beigefarbenen Hose nicht ein anderes Hemd an, das ist doch zu farblos. Er war aber andererseits ein dunkler Typ, er hatte fast schwarze, krausgelockte Haare, und ich dachte, dunkle Typen können sich das vielleicht erlauben.
„Da ist ein Stuhl“, sagte er und zeigte auf einen alten, eng-geflochtenen Korbsessel, „den können Sie sich ja heranrücken.“
Damit wandte er sich von mir ab und ging zum Schreibtisch. Der Raum, in dem wir uns befanden, war ein kleines, schmales Zimmer, ich würde sagen, drei mal vier. Der Schreibtisch ragte in den Raum hinein, zerteilte ihn und ließ nur eine enge Gasse frei, durch die der Verleger hindurchgemusst hätte, wenn er zum Fenster hätte gehen wollen, um nach dem Hund zu schauen. Das Zimmer lag genau an der Ecke, an der ich in den Garten eingedrungen war.
Ich nahm den Korbsessel, trug ihn hinter dem Verleger her, stellte ihn in die Nähe des Schreibtisches und verstellte damit den Zugang zum Fenster ganz. Den Verleger schien das nicht zu stören, er war sowieso beschäftigt. Er hatte auf seinem Schreibtisch neben anderen Papieren ein Blatt, auf das neben- und untereinander kleine Köpfe geklebt waren, also Porträts. Es waren die Köpfe der Autoren, die das Glück hatten, von ihm verlegt zu werden. Eine Anzahl dieser Köpfe war schon in Reih und Glied geklebt, andere lagen noch als Einzelwesen auf dem Schreibtisch herum und warteten darauf, zu den übrigen hinzugeklebt zu werden. Auch eine Schere fand sich auf dem Schreibtisch.
Wenn doch auch mein Kopf schon da läge, dachte ich. Ich saß jetzt in dem eng geflochtenen Korbsessel und fühlte mich unbehaglich. Der Sessel war nicht, wie ich gefürchtet hatte, zu schmal, er war zu niedrig. Während der Verleger, der ohnehin von größerer Statur war als ich, auf seinem Schreibtischstuhl thronte, saß ich in diesem viel zu niedrigen Korbsessel ohne Kissen. Erst jetzt fallen mir die beiden Manuskripte ein, die ich von Berlin nach Zürich und vom Hotel hierhergetragen hatte. Es waren zwei getippte, photokopierte und gebundene Exemplare meiner längeren Erzählung, eine ältere und eine neuere Fassung. Beide zusammen ergaben etwa zweihundert Seiten, und diese hätte ich mir gut und gerne auf den Sitz legen können, um ein wenig größer zu wirken. Vieles fällt einem erst zu spät ein. Ich lehnte mich in meinem Sesselchen zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf, um lässig auszusehen, aber dabei wurde mir noch unbehaglicher zumute, und ich gab diese Haltung wieder auf.
Er arbeite gerade an einem neuen Prospekt, sagte der Verleger.
Ach, sagte ich.
Nein, sagte er, an einer ganz neuen Aufmachung.
Ach so, sagte ich.
Er habe überhaupt keine Zeit dafür, sagte er, aber er müsse es machen, es gehe nicht mehr weiter wie bisher. „Das Format!“ sagte er. „Ich muss das Format ändern. Das alte war gut, es war auch billig, aber ich brauche jetzt mehr Platz. Ich muss es wie die anderen machen, da hilft nichts. Aber natürlich mache ich es ganz anders!“
„Genau wie die anderen“, sagte ich.
„Nein“, sagte er und hielt ein paar Prospekte anderer Verlage in die Höhe, „so mache ich es nicht. Das Format ja, aber nicht diese Aufmachung. Zum Beispiel das hier, sehen Sie, das geht nicht.“
Ich musste mich aus meinem Korbsessel herausbemühen, um zu sehen, was er meinte. Er hatte einen Prospekt aufgeschlagen und zeigte auf einen einzelnen Kopf auf einer Seite, den Kopf eines Dichters inmitten der Titel seiner Werke. Mich störte daran nur, dass ich gebückt, die Hände auf die Oberschenkel gestützt, dastand. Ich hielt es überdies auch für verfrüht, mit dem Verleger fraternisierend über seine Köpfe zu reden.
„Nein“, sagte er, „die Köpfe gehören nicht in den Text, das geht nicht.“
„Ach ja!“ sagte ich, weil ich erst jetzt begriff, woran er etwas auszusetzen hatte. Er fasste das so auf, als wollte ich ihm beipflichten, und ich tat nichts, um diesen falschen Eindruck wieder aus der Welt zu schaffen. Ich war ja auch nicht anderer Ansicht, es war mir nur egal, weil ich noch nicht dazugehörte. Wenn ich mich eines Tages an der Veröffentlichtwerden und Tantiemekriegen gewöhnt hätte, würde ich vielleicht auch daran Anstoß nehmen, dass mein Kopf so vereinzelt dastand, anstatt in Reih und Glied mit all den anderen Verlagsautoren geklebt zu werden.
Die Nähe des Verlegers war mir auch deswegen etwas peinlich, weil ich für mein Empfinden zu stark parfümiert war. Ich hatte mir aus einem kleinen Probierfläschchen Marbert Man etwas Eau de toilette hinter die Ohren und unter die Achseln getupft, weil es ein heißer Tag war, und weil ich so schnell schwitze. Als ich im Hotelzimmer darauf wartete, dass meine Haare trockneten – die Schweizer haben andere Elektrostecker als wir, und im Hotel hatten sie keinen Umstecker, so dass ich meinen mitgebrachten Föhn nicht benutzen konnte –, dachte ich, es gibt an diesem Abend nur drei Gefahren. Erstens, der