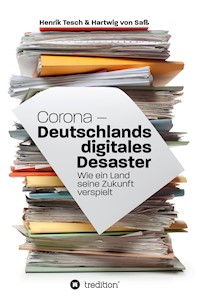
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zettel, Stift und Faxgerät - Deutschlands schärfste Waffen gegen die größte Gesundheitskatastrophe der Nachkriegsgeschichte. Schulen ohne Netz, Lehrer ohne Rechner, monatelanges Homeschooling auf dem Handy. Und dazu eine Verwaltung, die in Abläufen und Ausstattung im längst vergangenen Jahrhundert stecken geblieben war. Die Pandemie zerstörte in wenigen Wochen Deutschlands Selbstbild eines gut organisierten, modernen Staates. Corona machte das digitale Desaster plötzlich in voller Breite sichtbar. Jahrzehntelange Verantwortungsdiffussion, Innovationsfeindlichkeit und Reformangst hatten sich über Nacht zu einem lebensbedrohlichen Gemisch vermengt. Das lässt viele Menschen in Deutschland an ihrem Staat zweifeln. "Corona - Deutschlands digitales Desaster" zeichnet hochaktuell die Covid-19-Krise aus der Perspektive der Digitalisierung nach, arbeitet teils jahrzehntelange Gründe für das digitale Scheitern des Staates und gravierende Fehlentscheidungen im Pandemiemanagement auf. Welche Lehren sind zu ziehen und was muss jetzt getan werden? Damit Deutschland endlich digital wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Corona
Deutschlands digitales Desaster
Wie ein Land seine Zukunft verspielt
© 2021 Henrik Tesch, Hartwig von Saß
Umschlaggestaltung, Layout: Anja Giese
Lektorat, Korrektorat: Susanne Junge, Catrin Krawinkel
Covermotiv: iStock/malerapaso
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Hardcover
978-3-347-40785-5
Paperback
978-3-347-40787-9
e-Book
978-3-347-40786-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Die Autoren
Einleitung
TEIL EINS
Dezember 2019 - Am Anfang steht die Nachricht
Februar 2020 - „Wir haben ein gutes Ge sundheitssystem“
März 2020 – Ischgl – Europas Corona-Hotspot
INTERVIEW
Das muss dann auch funktionieren Gespräche im Kölner Gesundheitsamt
INTERVIEW
Wir halten uns selbst klein Interview mit Rostocks Oberbürgermeister
Die Corona Warn-App
Die Luca-App
Testpannen bei Urlaubsrückkehrern
Nach 11 Monaten Pandemie:
Die Elektronische Einreisekarte
Politische Entscheidungen auf unsicherer Datenbasis
Inzidenzwert 50: Analoge Begrenztheit als Maßstab für Grundrechtseinschränkungen
Chaos bei der Impfterminvergabe
Analoge Bürokratie - massive Verspätung bei digitalem Impfnachweis
Die dritte Welle - Deutschland droht zu scheitern
TEIL ZWEI
Verwaltung und Datenschutz
OZG allein reicht nicht aus
INTERVIEW
Wir wollen den Neustaat – Gespräch mit Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag
Wie schlägt sich Deutschlands
Wirtschaft in der zweiten Halbzeit?
Ohne Wettbewerb und ohne Markt – Deutschlands Verwaltung
Was also sollten Treiber der Digitalisierung in der Verwaltung sein?
Warum kommen wir nicht voran?
Datenschutz und Menschenleben
Digitale Souveränität – Jagd auf eine Illusion?
Insellösungen erschweren den Zugang zu Märkten und Technologien
Rechtssicherheit als elementares Grundbedürfnis der digitalen Gesellschaft und Ablenkung von Untätigkeit
TEIL DREI
Fazit:
Nur so wird Deutschland digital. Deutschland braucht eine Sprung Digitalisierung
Was ist hierfür notwendig?
Danksagung
Quellen
Die Autoren
Hartwig von Saß, Jahrgang 1966, volontierte nach seinem Studium der Politikwissenschaften und Geschichte bei der Deutschen Presse-Agentur und arbeitete dort insgesamt acht Jahre, zuletzt als Wirtschaftskorrespondent. Dann wechselte er in den PR-Bereich, zunächst drei Jahre im Volkswagen-Konzern, später bei der Deutschen Messe. Bis zu ihrer Einstellung war er verantwortlich für die Kommunikation der weltweit größten IT-Messe CEBIT. Foto: Kai-Uwe Knoth
Henrik Tesch, Jahrgang 1963, Politikwissenschaftler, Regierungsdirektor a.D. begann seine berufliche Laufbahn Anfang der 1990er Jahre in der öffentlichen Verwaltung. Ab 1999 verantwortete er die Regierungskontakte und politische Kommunikation bei Cisco und später bei Microsoft. Bis 2016 leitete er die Berliner Niederlassung von Microsoft. Heute arbeitet er als selbständiger Politikberater in Berlin. Foto: Alex Schelbert
Einleitung
„Bereite dich auf das Schlimmste vor, erwarte das Beste und nimm es, wie es kommt.“(Hannah Arendt)
Deutschland hatte anfangs gehofft, es bliebe verschont. Und als die Pandemie kam, musste das Land sie nehmen, wie sie kam. Zwar existierten Notfallpläne, und auch Übungen hatte es gegeben, aber wirklich gut vorbereitet war das Land nicht, als mit Sars-CoV-2 die größte Gesundheitskrise seit rund 100 Jahren über die Welt hereinbrach.
Einem Brennglas gleich machte die Pandemie schon in der ersten Welle im Frühjahr 2020 die Probleme eines Landes sichtbar, das sich im Selbstverständnis als Weltmeister des Organisierens und der Lösungsorientierung verstand. So geballt wie im März und April 2020 hatten sich die Probleme noch nie gezeigt. Ausgerechnet im Land der Erfinder und Ingenieure mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ offenbarte sich ein dramatisch schlechter Stand der Digitalisierung. Geradeso, als seien Innovationen in den vergangenen Jahrzehnten an zentralen Bereichen folgenlos vorbeigegangen, an den Verwaltungen, an den Gesundheitsämtern, an den Schulen.
Ohne Zweifel, es gibt viele Länder, die deutlich schlechter durch die Pandemie gekommen sind als Deutschland. Insgesamt haben sich bis Ende September 4,186 Millionen Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. 93.750 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Grundsätzlich zeigt sich im zweiten Corona-Sommer, dass die Stimmung viel schlechter ist als die tatsächliche Lage. Es rächen sich hier auch die gravierenden Schwächen der Krisenkommunikation des Staates und die vielen vollmundigen, ohne Not gegebenen Versprechen, die nicht gehalten wurden.
Auf die Einwohnerzahl bezogen beklagen viele Länder mehr Todesopfer, etwa Schweden, Frankreich, die USA, das Vereinigte Königreich, Italien, Brasilien oder Peru. Deutschland profitierte vom guten Netz der Krankenhäuser, einer Spitzenmedizin und allem voran Beschäftigten, die bereit waren, weit über die Grenze zu gehen. Aber es gibt auch Nationen mit deutlich geringerer Sterblichkeit. Auf 100.000 Einwohner bezogen starben in Deutschland 112,7 Menschen, was unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Japan aber hat auf 100.000 Einwohner 13,8 Todesfälle gezählt, in Taiwan waren es nur 3,5 und Singapur lediglich 1,2. Vermutlich sind für diese niedrigen Todeszahlen eine ganze Reihe Maßnahmen gemeinsam verantwortlich, nicht nur die Digitalisierung – aber die Korrelation zwischen geringen Zahlen einerseits und einem höheren Grad an Digitalisierung der Länder andererseits ist schon auffällig.
Eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie wird immer deutlicher, dass Corona die soziale Schere in Deutschland weiter spreizt. In den Schulen sind die leistungsstärkeren Kinder einigermaßen durchgekommen, bei den Schwachen zeigen sich eklatante Lernlücken. Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besser bezahlten Berufen konnten sich ins Homeoffice zurückziehen und mussten sich nicht, wie etwa als Kassiererin an der Supermarktkasse oder als Mitarbeiter in der Fleischproduktion, den Gefahren einer Infektion aussetzen. In Regionen, in denen Menschen überproportional an Armut leiden, ist das Risiko um 50 bis 70 Prozent höher, an Corona zu sterben. Auch der Zugang zu Impfungen, insbesondere in den ersten Monaten, war für sozial Schwache schwieriger. Schnell kommt die Frage auf, wer genau die Schuld trägt für Verwaltungen, in der die Papierakte noch immer Standard ist, für unzureichende digitale Infrastrukturen oder für ein Bildungssystem, das in großen Teilen noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen ist. Wer ist verantwortlich dafür, dass die öffentliche Gesundheitsverwaltung in die Bedeutungslosigkeit rutschte und mit technischen Hilfsmitteln des 19. Jahrhunderts einer weltweiten Pandemie begegnen musste?
Die Corona-Pandemie lässt sich nicht ausschließlich aus einer digitalen Perspektive betrachten oder gar bewerten. Digitalisierung hat immer eine Rückkopplung mit menschlichen Entscheidungen. Deshalb verstehen wir Digitalisierung nicht nur als technologisches Phänomen, sondern auch als eine Form von digitalem Mindset. Dazu gehört auch ein Führungsverständnis, das die Macht der Daten und die Stärken von Offenheit, Transparenz und Kollaboration fördert. So wird etwa völlig fehlendes digitales Mindsets deutlich, wenn der gemeinsame Krisenstab von Bundesgesundheits- und Bundesinnenministerium die Möglichkeit verstreichen ließ, das Momentum der Krise für den Einsatz neuer digitaler Tools zu nutzen. Auch die Chance, für wichtige Entscheidungen eine möglichst breite Datenbasis zu nutzen, wurde nicht erkannt.
Und auch wenn in diesem obersten Krisenstab die enge operative Einbindung der Länder unterblieb, hat das mit Digitalisierung im engeren Sinne wenig zu tun. Diese Entscheidung gegen Transparenz und Kollaboration aber hatte die fatale Folge, dass sich ein anderes Gremium mit dem operativen Kleinklein des Pandemiemanagements beschäftigen musste. Und sich darin verlor. Die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Hier verstrickte man sich immer tiefer in eine detailversessene Diskussion um Infektionskurven, Inzidenzwerte, Maskenpflicht oder die Gefahr beim Friseur oder der Fußpflege.
Das sieht auch der langjährige Bundesinnenminister Thomas de Maizière so, der im Tagesspiegel-Interview monierte, dass „heute selbst die Quadratmeterzahlen für die Ladenöffnung von der Ministerpräsidenten-Runde beschlossen (würden). So was sollte aber nicht Teil von politischen Leitungsentscheidungen sein, die Mikrosteuerung gehört in einen Krisenstab.“1 Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) verwaltete. Micro-Management im Kampf gegen die Pandemie. Operative Geschäftigkeit versus strategischer Weitblick. So blieb keine Zeit für Strategien, die über 14 Tage hinausgingen. Weder Bund noch Länder zeigten Leadership. Verordnung folgte auf Verordnung. Wohl noch stärker als im Krisenstab wurden in den Konferenzen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin die strategischen Chancen für das Land nicht genutzt.
Dabei hätte das Land – insbesondere in der ersten Welle und womöglich auch in der zweiten – vermutlich strategischen Weitblick und selbst klare Ansagen durchaus goutiert. Das zeigen die zeitweise rasant gestiegenen Beliebtheitswerte von Markus Söder, der sich immer besser in der Rolle des starken Ansagers gefiel, so sehr, dass er sich anschickte, Kanzlerkandidat der CDU/CSU für die Bundestagswahl werden zu wollen. Wie wenig ausgeprägt das digitale Mindset ist, offenbart sich auch beim Blick ins gemeinsame Wahlprogramm von CDU/ CSU. Wohlklingende Versprechen und Ideen werden dort gegeben, tatsächlich verstecken sich hinter den Zeilen an verschiedenen Stellen eine weitere Regulierung des Fortschritts und der Aufbau neuer Verwaltungsstrukturen zur Überwachung von Vermittlungsdiensten. Die Partei will nach der Bundestagswahl ein Modernisierungsjahrzehnt für den Staat. „Wir stellen die Abläufe auf allen Ebenen auf den Prüfstand, damit unser Staat auf der Höhe der Zeit ist.“
Auf der Höhe der Zeit der Digitalisierung war Deutschland weder in Verwaltung, in Gesundheitsämtern noch in den Schulen. Es ist eine Mischung aus organisierter Verantwortungsdiffusion des Föderalismus, arroganter Schläfrigkeit einer Nation sowie einer ausgeprägten Innovationsfeindlichkeit, die dazu führt, dass es keine digitalen Bildungskonzepte gibt, die Kontaktnachverfolgung mit Abreißblock funktioniert und die Berliner Verwaltung lächerliche 2.500 VPN Zugänge für die 100.000 Beschäftigten hat.
Es mangelt bei Führungskräften in Verwaltung und in der Politik erheblich an digitalem Sachverstand. Und dabei geht es nicht um komplizierte technische Zusammenhänge oder ums Programmieren. Klar ist aber auch: Wer einen Tweet veröffentlicht oder Instagram-Bildchen postet, ist noch lange kein Digitalexperte.
Es stellt sich die Frage, woran wir den Fortschritt bei der Digitalisierung messen. Was bedeutet Erfolg? Geben wir uns damit zufrieden, dass man inzwischen Behördentermine zur Beantragung von Dokumenten online vereinbaren kann? Dann ist Berlin ganz vorn mit dabei, denn voller Stolz berichtete der Senat Anfang Juli 2021, 50.000 neue Termine in den Bürgerämtern freizugeben.2
Oder misst man Erfolg daran, ob es gelingt, die Verwaltungsprozesse Ende-zu-Ende zu digitalisieren und zu automatisieren, behördenübergreifende Vorgänge online abzuwickeln und so beispielsweise die mehr als 250.000 Vorgänge, die sich in der Hauptstadt während der Pandemie angestaut haben, abzubauen? Nach 18 Monaten Corona in Deutschland stellt sich die Frage, wer die schnelle Digitalisierung des Staates und seiner Funktionen treiben kann? Der Bürger wird kaum für eine schnellere Kfz-Anmeldung oder einen digitalen Bürgerservice auf die Straße gehen, zumal er weniger als zweimal pro Jahr mit dem Staat in Berührung kommt. Dennoch hat er ein Recht darauf, dass seine Steuern möglichst effizient und wirkungsvoll eingesetzt werden und nicht in endlos analogen Verwaltungsakten zwischen Aktendeckeln versanden. Das gigantische Loch in den öffentlichen Kassen, das Corona und die Flutkatastrophe hinterlassen haben, könnte ein Treiber sein. Denn mit umfassender Digitalisierung lassen sich die Kosten von Verwaltung reduzieren.
Nur in einem digital modernen Land lässt sich der Wohlstand erhalten, der sich in Deutschland bislang vor allem auf Technologien von gestern stützt. Das mag auch der Grund sein, warum es mit der digitalen Souveränität Deutschlands und Europas nicht weit her ist. Denn Politik hat sich Jahrzehnte auf die Stärkung dieser Technologien fokussiert – Stichwort Abwrackprämie – und eine zukunftsgewandte Digitalpolitik allzu oft als restriktive Datenschutzpolitik fehlinterpretiert. Wer jahrelang politischen Fokus auf die Verhandlungen für eine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) legt, muss sich nicht wundern, dass Europa kein eigenes Google oder Apple an den Start bringt.
Im Nachhinein ist es immer einfach, Entscheidungen zu bewerten, und das einmal mehr, wenn man selbst keine Verantwortung trägt. Über die Corona-Politik ist schon viel geschrieben worden. Dieses Thema wird auch Gegenstand langfristiger Aufarbeitung sein, zumal die Pandemie in allen Bereichen der Gesellschaft Prozesse in Gang gesetzt hat, die in ihrer Komplexität auch nach eineinhalb Jahren noch nicht ansatzweise verstanden sind. Wir wollen uns in diesem Buch darauf konzentrieren, die Schwachstellen der Digitalisierung in den Bereichen Schule, Verwaltung und Gesundheitsämter herauszuarbeiten. Wir wollen Ursachen dafür analysieren und mögliche Lösungsbeispiele aufzeigen.
„Die Deutschen sehnen sich nach einem Staat, der seine in der Pandemie gezeigte Dysfunktionalität überwindet“, meint Gabor Steingart.3 Gleichzeitig glauben aber nur 18,5 % der Bevölkerung, dass die Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub auslösen wird. 44 % befürchten, dass so weiter gearbeitet wird wie bisher, auch weil das Geld für die notwendigen Investitionen fehlt (40 % der Befragten).4
Für die Autoren indes steht fest, dass wir einen massiven digitalen Ruck brauchen. Eine ambitionierte Digitalisierung ist jetzt genauso wichtig wie eine gute Klimapolitik. Denn eine schnelle Digitalisierung des Staates und all seiner Prozesse sowie ein neues digitales Mindset schaffen neue Spielräume für politisches Handeln. Für unsere Zukunft.
Hannover/Berlin im September 2021.
TEIL EINS
Dezember 2019 - Am Anfang steht die Nachricht
Die Corona-Pandemie erreicht Deutschland am 31. Dezember 2019, vormittags um 10.31 Uhr. Während sich Berlin gerade auf die traditionelle Silvesterparty am Brandenburger Tor vorbereitet, wird im zentralen Großraumbüro der Deutschen Presse-Agentur dpa in der Markgrafenstraße eine 32-Zeilen-Meldung aus China verarbeitet. Der Leiter des Büros in Peking, Andreas Landwehr, beschreibt unter der Überschrift „Mysteriöse Lungenkrankheit in Zentralchina ausgebrochen“, die Gesundheitsbehörde in Wuhan habe 27 Erkrankte identifiziert. Viele der Infektionen würden auf den Huanan-Fischmarkt zurückgeführt. Die Krankheit wird als virale Lungenentzündung behandelt. Sieben der Infizierten seien in ernstem Zustand.
Corona kommt nach Deutschland: Die dpa berichtet am 31. Dezember 2019 aus China
Bei den internationalen Nachrichtenagenturen gibt es für Meldungen grundsätzlich sechs Prioritäten, so auch bei der dpa: Je höher die Zahl, desto unwichtiger die Meldung. Die Stufen 5 und 6 werden seit gut 30 Jahren so gut wie nicht mehr verwendet. Die Meldung von Landwehr aus China bekommt routinemäßig die Priorität 4. Auch wenn die Meldung damit zu den Kellerkindern der Nachrichtenwelt gehört, wird sie auf vielen Online-Portalen automatisiert ausgespielt; vom Weser Kurierbis zur Süddeutschen Zeitung, selbst Neue Zürcher Zeitung und österreichische Medien übernehmen die Nachricht aufihren Online-Seiten.5
Davon völlig unbeeindruckt wollen Deutschland und ganz Europa unbeschwert den Jahreswechsel feiern, das neue Jahrzehnt, die sogenannten „Neuen Goldenen Zwanziger“ einläuten. Auch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zeigt sich in ihrer am Abend ausgestrahlten Neujahrsansprache6 optimistisch: „Ein neues Jahrzehnt liegt vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden. Überraschen wir uns einmal mehr damit, was wir können. Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen.“
Während Merkel ihre Rede beendet, wird in der Nähe des Kanzleramts schon getanzt. Am Brandenburger Tor kommen zu einer der größten Partys Europas mehrere hunderttausende Menschen zusammen. Was zu der Zeit keiner der Feiernden in Berlin weiß: Es wird für sehr lange Zeit die letzte große Sause im Herzen Deutschlands sein.
In den ersten Tagen des neuen Jahrzehnts interessiert sich niemand in Deutschland für das neuartige Corona-Virus, das sich derweil unter den elf Millionen Einwohnern in Wuhan ausbreitet. Niemand schert sich um die Lungenkrankheit, niemand in Deutschland sucht etwa auf Google in den ersten Wochen nach „Corona“ oder „COVID“.7
Die Fernsehzuschauer in Deutschland treffen am 20. Januar 2020 das erste Mal auf das Coronavirus.8 Barbara Hahlweg, Moderatorin der ZDF-Nachrichtensendung heute, spricht über „eine neue Atemwegserkrankung, die über Viren verursacht wird und nicht ungefährlich ist. (…) Hier in Deutschland sehen Experten keinen Grund zur Panik.“
Im folgenden Bericht zucken Blaulichter von Rettungswagen durch das nächtliche Wuhan. Menschen, mit weißer Schutzkleidung und Schutzbrillen huschen durchs Bild. Die Lage sei ziemlich ernst, erklärt Reporter Ulf Röller. Das sei daran zu erkennen, dass ein Fahrzeug der Straßenreinigung die Einfahrt zum Wuhan Medical Treatment Center mit Hochdruckstrahl desinfiziere. Die Zahl der Erkrankten sei dramatisch schnell gestiegen. Fernseh-Deutschland lernt Prof.
Zhong Nanshan von Chinas Nationaler Gesundheitskommission kennen: Es handele sich um eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, erklärt er. In dem Beitrag kommt auch Prof. Lothar Wieler, Leiter des Robert Koch-Institutes (RKI), zu Wort. Er beschwichtigt eher die Bilder aus dem fernen Wuhan, denn bislang seien nur wenige Fälle außerhalb Chinas bekannt geworden.
Auch die Zuschauer der 20: 00-Uhr-Tagesschau9 am selben Abend werden über das neuartige Virus informiert. In mehr als 200 Fällen sei das Virus inzwischen bestätigt, drei Menschen gestorben. Die meisten Infizierten seien aber „nicht schwer krank“. Die Behörden vermuten als Quelle den Huanan-Markt, auf dem auch wild gefangene Tiere verkauft wurden. Der Markt sei inzwischen geschlossen, heißt es.
Während sowohl heute als auch Tagesschau erst in der zweiten Hälfte der Sendung das Thema aufgreifen, wird Corona bei Caren Miosga in den Tagesthemen vom 20. Januar zum Topthema auf Platz eins. Das Virus wecke Erinnerungen an SARS, sagt Miosga. Und: „Die Sorge wächst, dass sich auch dieses Virus seinen Weg rund um den Globus bahnt.“ Welch bittere Wahrheit Miosga an diesem Abend noch recht gelassen ausspricht, wusste damals niemand. Von diesem Tag an hat das neuartige Coronavirus seinen festen Platz in den Nachrichtensendungen.
Coronavirus, COVID-19, Sars-CoV-2?
Coronavirus, Coronaviren gehören zu einer Virusfamilie, zu der auch das derzeit weltweit grassierende Virus Sars-CoV-2 gehört. Da es anfangs keinen Namen trug, sprach man in den ersten Wochen vom „neuartigen Coronavirus“.
Sars-CoV-2 Die WHO gab dem neuartigen Coronavirus den Namen „Sars-CoV-2” („Severe Acute Respiratory Syndrome“-Coronavirus-2). Mit der Bezeichnung ist das Virus gemeint, das Symptome verursachen kann, aber nicht muss.
COVID-19
Die durch Sars-CoV-2 ausgelöste Atemwegskrankheit wurde „CO-VID-19“ (Coronavirus-Disease-2019) genannt. COVID-19-Patienten sind dementsprechend Menschen, die das Virus Sars-CoV-2 in sich tragen und Symptome zeigen.
Deutsche Experten kommen in den nächsten Tagen in nahezu allen Medien zu Worte. Sie sollen die Gefahr für Deutschland einschätzen. Während Corona erneut die Spitzenmeldung der Tagesthemen am 22. Januar 202010 ist, vergehen in der Hauptnachrichtensendung des chinesischen Staatsfernsehens ganze 20 Minuten, bis über die neue Viruskrankheit berichtet wird. Die Weltgesundheitsorganisation prüft, ob sie eine internationale Notlage ausruft. In den USA wird der erste Fall registriert, auch Russland meldet Verdachtsfälle.
Prof. Christian Drosten von der Berliner Charité wird live in die Tagesthemen geschaltet, nachdem er schon wenige Stunden zuvor im ZDF-Beitrag11 zu Wort gekommen war. Drosten gilt als einer der weltweit profiliertesten Wissenschaftler in Sachen Corona. Er genießt in der Welt der Virologen den Ruf einer echten Autorität. Schon 2003 hatte er den SARS-CoV-1-Virus entdeckt und wenige Tage später den weltweit ersten diagnostischen Test entwickelt. Science zählt ihn zu den weltweit führenden Experten mit Blick auf Coronaviren. Und seine Bekanntheit wird in den nächsten Monaten auch außerhalb der Fachwelt enorm steigen. Drosten rät in den Tagesthemen, insbesondere in den asiatischen Großstädten auf die sogenannte „Kontaktverfolgung“ zu setzen. Man müsse die „gesamte Kontaktumgebung“ untersuchen. Mit Blick auf die Infektionswege habe man „eine Situation wie bei fast allen Erkältungserkrankungen“. Auch er hinterlässt bei den Zuschauern einen beruhigenden Eindruck.
Während Drosten den Fernsehzuschauern Corona erklärt, bereitet sich im bayerischen Landkreis Starnberg eine chinesische Mitarbeiterin des Automobilzulieferers Webasto gerade auf ihre Heimreise vor. Seit dem 19. Januar hatte die Frau aus Shanghai am Hauptsitz ihres Arbeitgebers im Gautinger Ortsteil Stockdorf eine Mitarbeiterschulung geleitet. Am nächsten Tag, dem 23. Januar 2020, wird die Frau zurück nach China fliegen. Auf dem Rückflug bemerkt die Frau erste Krankheitssymptome. Sie wird nach ihrer Ankunft in China positiv getestet. Angesteckt hatte sie sich, als ihre Eltern aus Wuhan sie vor ihrer Reise nach Deutschland besucht hatten.
27.1.20 Infizierte: 1 Tot: 0
An der Schulung in Bayern hatte auch ein 33-jähriger Kollege aus dem Landkreis Landsberg am Lech teilgenommen. Er hatte sich Tage später angeschlagen gefühlt, sich für zwei Tage krankgemeldet, war dann aber wieder zur Arbeit gekommen. Er fühlte sich besser. Dieser Webasto-Mitarbeiter wird am 27. Januar 2020 im Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München positiv getestet. Er wird Deutschlands Corona-Patient Nummer 1. Kurz vor Mitternacht an diesem Montagabend informiert das Gesundheitsamt die Öffentlichkeit. Der Mann kommt im Krankenhaus München Schwabing auf die Isolierstation.
Es hatte schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in unterschiedlichen Ländern immer wieder Erfahrungen in der Bekämpfung von derartigen, hochansteckenden und sich rasant verbreitenden Krankheiten gegeben. Gerade asiatische Länder hatten über verschiedene Pandemien hinlängliches Know-how aufgebaut. Dabei hatten sich im Wesentlichen zwei zusammenhängende Maßnahmen als am effektivsten erwiesen. Zum einen müssen Infizierte möglichst schnell isoliert werden, entweder durch Quarantäneauflagen oder in speziell ausgestatteten Isolierstationen in Krankenhäusern. Die zweite Maßnahme: die Kontaktverfolgung, sprich: Ermittlung, wo und wann sich die Person infizierte und mit welchen anderen Menschen die Person vor der Isolation Kontakt hatte. Es ist oftmals für die Behörden eine Art Detektivarbeit. Gemeinsam mit den Erkrankten – sofern möglich – werden für die Tage der Inkubationszeit rückwärts die Kontakte ermittelt. Es ist eine Arbeit, die sehr an polizeiliche Ermittlungen erinnert, aber sie hatte sich in der Vergangenheit als mächtigstes Instrument im Kampf gegen tödliche Viruserkrankungen gezeigt. Die „Kontaktpersonen-Nachverfolgung“, wie es in der Fachsprache des Robert Koch-Institutes heißt, soll die Infektionsketten unterbrechen und Ausbrüche eindämmen12.
Konkret für COVID-19-Fälle bedeutet das laut RKI:
• Zeitnahe Identifizierung von Kontaktpersonen, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie von einem bestätigten COVID-19-Fall („Quellfall“) angesteckt wurden
• Nach Möglichkeit umgehende Quarantänisierung enger Kontaktpersonen, um weitere Infektionen zu verhindern
• Schnelle Erkennung und Isolierung weiterer COVID-19-Fälle
• Prioritäre Verhinderung der Ausbreitung in Risikogruppen und bei medizinischem Personal (Reduktion schwerer bzw. tödlich verlaufender Erkrankungen)13
In Bayern fühlt man sich derweil bestens auf die neue Situation eingestellt. Auf einer Pressekonferenz am Tag nach der ersten COVID-19-Diagnose in Deutschland betont Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml: „Bayern ist (…) gut vorbereitet. So haben wir bereits seit Jahren eine Spezialeinheit für solche Fälle – die ‚Task Force Infektiologie‘ am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Diese Spezialeinheit ist jederzeit einsatzbereit.“ Und der TaskForce-Leiter, Dr. Martin Hoch, ergänzt: „Nach Einschätzung der ,Task Force Infektiologie‘ ist das Infektionsrisiko für die Bevölkerung durch dieses Virus nach derzeitigem Kenntnisstand gering. Gleichwohl wird zu den üblichen Vorsichtsmaßnahmen geraten – etwa zu einem gründlichen Händewaschen nach einer Fahrt mit dem Bus oder der U-Bahn.“14 Und Bayern tut das, was Behörden in einer Krisensituation immer machen: Man schaltet eine Hotline. Natürlich, der Freistaat ist bestens gerüstet.
Währenddessen taucht Corona langsam, aber sicher rund um den Globus auf, in mehreren Ländern Asiens. Aber auch in den USA gibt es die ersten fünf infizierten Patienten und mehr als 100 Verdachtsfälle. In China schnellen die Zahl der Infizierten und Toten rasant nach oben. Schon Ende Januar wird in vielen Ländern vor Reisen nach China gewarnt. In Frankreich starten Flugzeuge in Richtung China, um Franzosen aus Wuhan zurückzuholen in die Heimat. Es wird nicht die einzige Rückholaktion bleiben.
Am 29. Januar meldet Bild-Online um 15.41 Uhr: Lufthansa streicht alle Flüge nach China.15 Vorerst bis zum 9. Februar. Zuvor hatte British Airways sich für den Flugstopp entschieden. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in Deutschland vier bestätigte Fälle, die sich alle auf den Webasto-Fall zurückverfolgen lassen. In Nürnberg startet die Internationale Spielwarenmesse mit 2.843 Ausstellern aus 70 Ländern. 62.357 Menschen aus 136 Nationen besuchen die Veranstaltung, die bis zum 2. Februar dauern wird. 360 Aussteller aus China sind auch vor Ort. Chinas Staatsfernsehen meldet mehr als 6.000 Infizierte und 132 Tote. Volkswagen schickt seine Mitarbeiter in Peking ins Homeoffice. Toyota stellt die komplette Produktion in China ein, zunächst bis zum 9. Februar. Da sich in der betroffenen Region Wuhan auch Zulieferer für Apple-Produkte befinden, zeigen sich erste Folgen in der Apple-Lieferkette.
Derweil plant die Bundesregierung, mit dem Luftwaffen-Airbus „Kurt Schumacher“ knapp 100 Bundesbürger nach Deutschland zu holen, die sich in den Tagen zuvor auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes hatten registrieren lassen. Es wird entschieden, dass die Menschen nach ihrer Rückkehr sofort für 14 Tage in Quarantäne müssen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt, dass bislang sehr wenig über das neuartige Virus bekannt sei. Ein Impfstoff sei frühestens in drei bis fünf Monaten verfügbar.
Der Webasto-Fall zieht Kreise. Am 30. Januar müssen rund 90 Menschen aus dem Umfeld der Infizierten zuhause bleiben. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel ordnet Quarantäne an. Das Gesundheitsamt will die Betroffenen anrufen und nachfragen, ob sie sich auch zuhause aufhalten und ob sie Fieber haben.
Russland schließt seine Grenze zu China, Ikea hat 30 Filialen mit gut 14.000 Beschäftigten in China geschlossen, auch H&M schließt 74 Läden. Derweil legt Amazon Zahlen für das vierte Quartal vor. Der Umsatz steigt um 21 Prozent auf 87 Milliarden Dollar. Die Aktienkurse reagieren mit einem Sprung nach oben: Amazon ist jetzt mehr als eine Billion Dollar wert.
Schon jetzt zeigt sich: Der Online-Handel wird der Gewinner der Pandemie werden.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft in Genf den internationalen Gesundheitsnotstand aus.16 Der Schritt sei nicht als Misstrauensvotum gegen China zu verstehen, erklärt Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. Experten fürchten eine weltweite Pandemie mit vielen Toten. Erste kritische Stimmen fragen, ob Deutschland ausreichend gut auf eine solche Pandemie vorbereitet ist. Wie sind die Gesundheitsämter landesweit für eine Pandemie aufgestellt? Die Wochenzeitung Die Zeit zitiert Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik:
„Der Bund, viele Bundesländer und Kommunen investieren zu wenig in den öffentlichen Gesundheitsdienst.“17 Ein namentlich nicht genannter Gesundheitsexperte sieht den Gesundheitsdienst im Januar 2020 als stark überlastet an. In einem Gesundheitsamt in Thüringen gebe es keinen Arzt mehr, weil sich niemand bewerbe. Im Gesundheitsamt zu arbeiten sei für die meisten sehr unattraktiv.
Internationale Notlage
Eine internationale Notlage ist nach Festlegung der Weltgesundheitsorganisation „ein außergewöhnliches Ereignis, das aufgrund der internationalen Ausbreitung von Krankheiten ein Risiko für die öffentliche Gesundheit für andere Staaten darstellt und das möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert“. Breitet sich also eine besonders gefährliche Krankheit über die nationalen Grenzen hinweg aus und bedroht deshalb die Gesundheit der Weltbevölkerung, wird dies als sogenannte internationale Notlage gewertet.
Deutschland aber wiegt sich in Sicherheit. Und fühlt sich auch noch von offizieller Stelle bestätigt. „Deutschland hat wunderbar reagiert: Ein Fall wird erkannt, die Personen werden isoliert, behandelt, die Kontakte werden nachverfolgt, es werden die Daten weitergegeben an die WHO“, bewertet Christian Lindmeier, Sprecher der Weltgesundheitsorganisation.18
Und in der Tat scheint Deutschland zunächst grundsätzlich eingestellt auf eine solche Situation. Pandemien waren für die Behörden nichts Neues – in der Theorie zumindest. Immer wieder hatten unterschiedliche Ämter und Behörden in Risikoanalysen, Planspielen und groß angelegten Übungen den Ernstfall, die Katastrophe, geprobt, auch eine Pandemie.
Die Anlage 4 der Bundestagsdrucksache 17/12051 vom 10. Dezember 2012 etwa nimmt quasi die gerade in Deutschlands beginnende Corona-Pandemie schon vorweg. Unter dem Titel: „Pandemie durch Virus „Modi-Sars“ vom 10. Dezember 2012, Risikoanalyse Bevölkerungsschutz Bund“ wird das hypothetische Szenario beschrieben, dass ein neuartigerVirus mit Namen Modi-SARS von Asien ausgeht und sich weltweit verbreitet.
Demnach reisen mehrere Menschen in Deutschland ein, bevor die hiesigen Behörden die erste Warnung der WHO erreicht. Darunter sind auch zwei Infizierte, die durch eine Kombination aus einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen Infektiosität stark zurinitialen Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen. Der erste Fall tritt auf einer Messe in Norddeutschland auf, die zweite Person setzt nach einem Auslandssemester in China das Studium an einer Universität in Süddeutschland fort.
Obwohl die Behörden und das Gesundheitssystem rasch handeln und ihre Maßnahmen schnell und effektiv umsetzen, kann die rasante Verbreitung des Virus‘ aufgrund des kurzen Intervalls zwischen zwei Infektionen nicht effektiv aufgehalten werden. Zum Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle nach rund 300 Tagen sind gut sechs Millionen Menschen in Deutschland an Modi-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor immense Herausforderungen gestellt, die nicht bewältigt werden können.
In dem Szenario hat die Pandemie Deutschland drei Jahre im Griff. Auf Seite 64 kommt die Analyse zu dem Ergebnis: „Für den gesamten zugrunde gelegten Zeitraum von drei Jahren istmit mindestens 7,5 Millionen Toten als direkte Folge der Infektion zu rechnen.“
Diese erdachte Pandemie ist 2012 noch ein Szenario der „Klasse C“, also „bedingt wahrscheinlich, ein Ereignis, das statistisch in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1.000 Jahren eintritt“. Acht Jahre später wird es Realität. Simulationen von Pandemien waren schon Anfang des Jahrtausends in Mode gekommen. Gesundheitsexperten hatten diese Stresstests an die Planspiele der Militärs angelehnt.
Außerdem kam der Schock durch die Terroranschläge vom 11. September 2001 hinzu, der bis dahin Undenkbares fortan zur Grundlage von Übungen machte. Das Prinzip: Die an den Simulationen beteiligten Entscheider aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft werden mit einem hochdynamischen Szenario konfrontiert und müssen in Echtzeit Entscheidungen fällen. Den Ernstfall trainieren. Bestenfalls werden Lücken in der Kommunikationskette oder der Materialversorgung aufgedeckt, so dass nach Auswertung der Ergebnisse entsprechende Verbesserungen angeschoben werden können. Wenn es dann ernst wird, hat man es wenigstens schon einmal gemacht.
Zwei der ersten derartigen Planspiele wurden in den USA durchgezogen und simulierten biologische Angriffe, bei denen feindliche Staaten Pockenviren in den USA freisetzen: „Dark Winter“ und „Atlantic Storm“ wurden 2001 und 2005 von Think Tanks erdacht, die auf Biosicherheit spezialisiert waren.
„Einflussreiche Entscheidungsträger nahmen an ihnen teil, beispielsweise die frühere Leiterin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Gro Harlem Brundtland, sowie Madeleine Albright, Außenministerin der USA unter Präsident Bill Clinton. Im Verlauf von „Dark Winter“ und „Atlantic Storm“ erlebten die Teilnehmer, wie Machtkämpfe zwischen Politikern auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen gegen eine Epidemie mit rasant steigenden Infektionszahlen behindern können. Krankenhäuser waren vom Zustrom an Patienten überfordert und die nationalen Impfstoffvorräte reichten nicht aus. Die Ergebnisse der Simulationen führten zusammen mit den noch frischen Erinnerungen an die terroristischen Anschläge und Milzbrand-Attentate im Jahr 2001 dazu, dass der US-Kongress handelte, sagt Tom Inglesby, Leiter des Center for Health Security an der Johns Hopkins University in Baltimore, der auch an der Leitung beider Planspiele beteiligt war. Bereits kurz nach „Dark Winter“ verpflichtete sich die US-Regierung, einen nationalen Vorrat an Impfstoffen gegen Pocken aufzubauen. Und 2006 verabschiedete der Kongress den „Pandemic and All-Hazards Preparedness Act“, um die Reaktionsfähigkeit des nationalen Gesundheitssystems im Ernstfall zu verbessern. Dazu gehörte auch die verstärkte Förderung der Erforschung neu auftretender Infektionskrankheiten.“19
Auch in Deutschland hatte es schon oft Katastrophenschutzübungen gegeben. Ein Pandemietraining aber wurde das erste Mal am 7. und 8. November 2007 gestartet, die sogenannte „LÜKEX 2007“. LÜKEX ist eine Abkürzung für „Länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Übung (Exercise)“.
In diesen strategischen Übungen zum Krisenmanagement trainieren die obersten Krisenstäbe ihre Strukturen auf Bundes- und Landesebene, ihre Zusammenarbeit und ihre Abläufe. Dabei werden auch die kritischen Infrastrukturen (KRITIS) in privater Hand mit einbezogen.
An der Vorbereitung zur LÜKEX 2007 arbeiteten die Experten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit den Experten aus Bund, Ländern, Behörden, Organisationen und Unternehmen etwa 18 Monate. Schließlich waren bei der Simulation mehrere tausend Personen engagiert. „LÜKEX ist damit eine einzigartige Plattform, auf der Akteure zusammenkommen, um Ideen oder Befürchtungen zu teilen, Vernetzung zu betreiben und zu lernen, miteinander und mit der Bevölkerung vor, während und nach einer Krise zu kommunizieren.“20 Getreu dem Motto „In der Krise Köpfe kennen“ kann sich so idealerweise eine Abstimmungskultur entwickeln, die über die Übung hinaus das Krisenmanagement der Akteure verbessert.
Das Szenario für die Schreibtischübung: „Eine Influenzapandemie mit schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen / gesamtstaatlichen Auswirkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Gefahrenlage in Deutschland“. Es ist eine Großübung, bei der rund 3.000 Personen engagiert sind. Sieben Bundesländer sind mit dabei, Bundesbehörden, Verbände und Organisationen, 50 Unternehmen aus der Wirtschaft und mehr als 100 internationale Beobachter. Schließlich ist man im Ausland überzeugt, dass man etwas von Deutschland lernen kann. „Das gewählte mittelschwere Pandemie-Szenario wurde von den Übungsbeteiligten als besonders geeignet angesehen, um die gesamtgesellschaftlichen 125 Auswirkungen einer Krise darzustellen und ein bereichs- und länderübergreifendes Krisenmanagement herbeizuführen“, heißt es in dem 53-seitigen Abschlussbericht.21
Für die Länder ergaben sich verschiedene Schwachstellen: „Die Einlagen wurden teilweise stark operativ-taktisch mit zu geringem Bundesbezug behandelt. Auch eine Abstimmung der Länder untereinander in Fachfragen fand – mit Ausnahme der intensiven Diskussion in der Interministeriellen Koordinierungsgruppe – nur punktuell statt. Die intensive Beschäftigung der Stäbe mit landesinternen Problemen hat deshalb dazu geführt, dass die Kommunikation mit dem Bund und Beteiligten/Betroffenen außerhalb der öffentlichen Verwaltung als noch steigerungsfähig beurteilt werden muss. Eine intensive Einbindung der Wirtschaft in das gesamtstaatliche Krisenmanagement erfolgte in der Regel dort, wo deren Vertreter aktiv in die Vorbereitungen einbezogen waren. Teilweise wurden aus Sicht der Zentralen Übungssteuerung die in einer Pandemie auftretenden Ressourcenprobleme unterschätzt; die schnelle „erfolgreiche“ Bewältigung von logistischen Teilszenarien wirkte dadurch teilweise etwas unrealistisch.“
Empfehlungen gibt es auch für den Bund: Dabei geht es um Berichtsstrukturen und Zusammensetzungen der Stäbe, etwa die gemeinsame Führung durch Bundesinnen- und Gesundheitsministerium. „Das Erfordernis einer ganzheitlichen Risikobetrachtung hat sich an dem komplexen Szenario einer Pandemie besonders deutlich gezeigt. Eine nationale, d.h. bereichs- und ebenenübergreifende Risikoanalyse für besondere Herausforderungen und Schadensereignisse ist daher erforderlich.“
Schon damals zeigte sich interessanterweise: „Bereits in der Übungsvorbereitung wurde deutlich, dass detaillierte, wissenschaftliche fundierte Erkenntnisse bezüglich des Nutzens von Barrieremaßnahmen mittels Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. Masken für die Allgemeinbevölkerung fehlen. […] Vordringlich wurden auch konkrete Empfehlungen für die Bevorratung von PSA [Persönlicher Schutzausrüstung] zum Arbeitsschutz in der ambulanten Versorgung und im Rettungsdienst angesehen.“
Als Fazit heißt es schließlich: „In der Vorbereitung auf die Übung wurde auf Bundes- und Landesebene festgestellt, dass das Krisenmanagement insbesondere im Gesundheitsbereich für eine länger andauernde Krise Optimierungsbedarf zeigt. Dies betrifft zum einen die räumliche und (informations-) technische Ausstattung, zum anderen die personelle Besetzung der Krisenmanagementstrukturen sowie die Schulung der Mitarbeiter in der Stabsarbeit. […] Bei dieser Übung ist ein umfangreicher Handlungsbedarf im Bereich der Vorsorge identifiziert worden (Rechtsvorschriften, Verfahren für Haftungs-, Entschädigungs- und Regressansprüche, Ausnahmeregelungen, etc.).“
Übrigens: An der Übung waren auch Gesundheitsämter beteiligt, aus Ludwigslust, Bad Doberan,Schwerin undHamburg Altona. Auch in Rostock hatte sich das Gesundheitsamt eingebracht: Man war beide Tage in Bereitschaft, aber das Telefon klingelte damals nicht, wie Senator Steffen Bockhahn (Linke) am 12. August 2020 auf Anfrage der Stadtratsfraktion des Rostocker Bundes erklärte. Also ließen sich auch keine Lehren ziehen.
Die offizielle Bewertung von LÜKEX 2007 liest sich wenig dramatisch: Ja, es gibt Handlungsbedarf, man muss hier nachsteuern und da noch ein bisschen trainieren, aber alles in allem war das soweit in Ordnung. Eine Form von behördlichem Mittelmaß, das das Land entsprechend durch eine solche Krise bringen würde.
In einer dpa-Meldung werden die Erkenntnisse der Simulation allerdings anders beschrieben: „Das Ergebnis des Planspiels: Von den 86 trainierten Einzelübungen sind 20 nicht bewältigt worden. Weil Übungsteilnehmer falsch oder zögerlich reagierten, wäre es unter anderem zu Plünderungen von Apotheken gekommen, komplette Einheiten von Polizei und Feuerwehr wären kaum noch arbeitsfähig gewesen. In einigen Landkreisen wäre die medizinische Versorgung zusammengebrochen. In den Akten wird nach Focus-Informationen die „fehlende beziehungsweise unzureichende Kommunikation“ zwischen den Entscheidungsträgern bemängelt. Zudem seien Arbeitsschritte nicht ausreichend kontrolliert worden. In den Szenarien gehen die Behörden davon aus, dass bei Notfällen die Bürger zu Selbsthilfe greifen und beispielsweise Apotheken plündern, in denen noch Arzneimittel verfügbar sind.“
Die in LÜKEX 07 geforderte ganzheitliche Risikobetrachtung erfolgte dann tatsächlich 2012. Dabei wurden zwei Szenarien unter die Lupe genommen: eine Schmelzwasser-Katastrophe und eben eine Pandemie. Und es ist schon erstaunlich, wie deutlich die Parallelen zwischen dem Szenario und den Ereignissen 2020/2021 sind. Als sei 2012 eine Art Drehbuch der tatsächlichen Corona-Pandemie acht Jahre später geschrieben worden: „Der Erreger stammt aus Südostasien, wo der bei Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte auf den Menschen übertragen wurde […] Zwei der ersten Fälle, die nach Deutschland eingeschleppt werden, betreffen Personen, die sich im selben südostasiatischen Land angesteckt haben.
Eine der Personen fliegt noch am selben Abend nach Deutschland, um bei einer Messe in einer norddeutschen Großstadt einen Stand zu betreuen, die andere Person fliegt einen Tag später nach Deutschland zurück, um nach einem Auslandssemester in China ihr Studium in einer süddeutschen Universitätsstadt wieder aufzunehmen. Diese beiden Personen sind in Deutschland zwei der Indexpatienten, durch die die Infektion weiterverbreitet wird.“22
Im Planspiel dauert es drei Jahre, bis ein Impfstoff entwickelt werden kann. Das Virus bildet auch Mutanten. Nachdem der Tod von zehn Menschen angenommen wird, beginnen die antiepidemischen Maßnahmen.
Ein Infizierter steckt in der Betrachtung drei weitere Menschen an. Zwischen Tag 1 und Tag 411 erkranken insgesamt 29 Millionen Menschen in Deutschland, in der zweiten Welle, die von Tag 412 bis Tag 692 verläuft, weitere 23 Millionen Menschen. Die dritte Welle von Tag 693 bis Tag 1.052 zählt weitere 26 Millionen Kranke. 7,5 Millionen Menschen sterben an dem fiktiven Virus, da man davon ausgeht, dass 10 Prozent der Erkrankten an der Infektion sterben.
Auf Seite 66 heißt es zur Erwartbarkeit eines solchen Szenarios: „Das Auftreten von neuen Erkrankungen ist ein natürliches Ereignis, das immer wieder vorkommen wird. Es ist aber in der Praxis nicht vorhersehbar, welche neuen Infektionskrankheiten auftreten, wo sie vorkommen werden und wann dies geschehen wird. Daher ist eine spezifische Prognose nicht möglich.“
Auch wenn die Zahlen der Infizierten und Todesopfer weit über der Realität der Jahre 2020 und 2021 liegen, sehen die Experten 2012 eine andere Entwicklung mit hoher Präzision voraus: „Es ist von einer vielstimmigen Bewertung des Ereignisses auszugehen, die nicht widerspruchsfrei ist. Dementsprechend ist mit Verunsicherung der Bevölkerung zu rechnen. Zusätzlich ist ein (mehr oder minder qualifizierter) Austausch über neue Medien (z.B. Facebook, Twitter) zu erwarten. […] Es ist anzunehmen, dass die Krisenkommunikation nicht durchgängig angemessen gut gelingt. So können beispielsweise widersprüchliche Aussagen von verschiedenen Behörden/Autoritäten die Vertrauensbildung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erschweren. Nur wenn die Bevölkerung von der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen (z.B. Quarantäne) überzeugt ist, werden sich diese umsetzen lassen.“
Insgesamt kommt man zu dem Ergebnis: „Diese Aufgaben stellen die zuständigen Behörden im Verlauf des hier zugrunde gelegten Ereignisses vor große bzw. mitunter nicht mehr zu bewältigende Herausforderungen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die personellen und materiellen Ressourcen als auch in Bezug auf die Durchsetzbarkeit behördlicher Maßnahmen.“ Schon 2012 sehen das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, die Bundesregierung und die Länder anhand der Risikoanalyse voraus, dass eine Pandemie, ausgehend von zwei Infizierten, den Staat vor „mitunter nicht mehr zu bewältigende Herausforderungen“ stellt. Kapitulation mit Ansage.
Fünf Jahre später, im Jahr 2017, wurden alle bis dahin erstellten Risikoanalysen, also auch die zu anderen Katastrophenszenarien, zusammenfassend bewertet23. So heißt es auf Seite 8 des im April 2019 vorgelegten Berichts: „Eine Betrachtung der bisherigen Risikoanalysen erfolgte mit dem Fokus auf das jeweilige Schadensausmaß, das durch die Analyse der betrachteten Ereignisse ermittelt wurde. Hierbei zeigte sich, dass das Ereignis ,Pandemie durch Virus Modi-SARS‘ bei fast allen betrachteten Schutzgütern (Mensch, Volkswirtschaft und Immateriell) die größten Schäden verursacht.“ Die Pandemie, zumindest die fiktive, überrundet in der Gesamtbewertung sogar die „Freisetzung radioaktiver Stoffe aus einem Kernkraftwerk“.
Auch wenn die Pandemie als das folgenschwerste Szenario bewertet wird, sind die Empfehlungen überraschend zurückhaltend und wenig umfangreich, vermutlich, weil es dem Bundesamt qua Aufgabenstellung mehr um einen klassisch verstandenen Katastrophenschutz geht. Dennoch lassen sich die zu Beginn der Pandemie ergriffenen Maßnahmen von Bund und Ländern schon in der Zusammenfassung von 2017 auf Seite 31 nachlesen: „Durchführung von Infektionsschutzmaßnahmen: Zu den infektionshygienischen Maßnahmen, die je nach epidemiologischer Situation implementiert werden können, zählen: kontaktreduzierende Maßnahmen, Verhaltensmaßnahmen, Schutzkleidung, Desinfektionsmaßnahmen, Impfung (sobald verfügbar), Einsatz antiinfektiver Arzneimittel (unter Beachtung der Resistenzlage).
Beispiele sind: Absonderung/Isolierung von Erkrankten und Quarantäne von Kontaktpersonen eines Erkrankten, Einsatz von Schutzausrüstung, proaktive und reaktive Schließung von Schulen oder Kindergärten, Absage von Großveranstaltungen, intensivierte Händehygiene, Tragen eines Mund-Nasenschutzes oder einer Maske, Kontaktpersonensuche durch Gesundheitsämter, Einschränkung von Grundrechten und Versammlungsfreiheit sowie verpflichtende Impfung/Prophylaxe gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) möglich, Einschränkung von Grundrechten wie die Versammlungsfreiheit sowie verpflichtende Impfung/Prophylaxe gemäß IfSG möglich.“ Und schließlich wird auf den Nationalen Pandemieplan verwiesen.
Zur Vorbereitung des G20-Gipfels unter deutscher Präsidentschaft im Juli 2017 in Hamburg trafen vom 19. und 20. Mai 2017 erstmals überhaupt die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen der Mitgliedstaaten zusammen. Sie verabschiedeten die sogenannten „Berliner Erklärung der G20-Gesundheitsminister“.24
Darin heißt es unter anderem: „Globale Gesundheitsrisiken, wie etwa Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen (AMR), haben ernsthafte Auswirkungen auf das Leben und Wohlergehen von Millionen Menschen sowie auf die weltweite Wirtschaft. […] Die globale Vernetzung von Gesellschaften, Unternehmen und Regierungen bedeutet auch, dass die Gefahr durch eine an irgendeinem Ort auftretende Infektionskrankheit zu einer grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr werden kann – mit weitreichenden humanitären, gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsrelevanten Folgen. Daher bekräftigen wir die Notwendigkeit für ein gemeinsames Bekenntnis der internationalen Gemeinschaft zur Stärkung von Gesundheitssystemen.“
Neben der Berliner Erklärung beschäftigten sich die Politikerinnen und Politiker ebenfalls mit einer mehrstündigen Simulationsübung. Auch hier ging der Impuls von der deutschen Präsidentschaft aus. Der damalige CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe sah nämlich die Welt auf jeden Fall noch nicht ausreichend gerüstet für eine globale Gesundheitskrise.25
„Durch die Verdopplung des Reiseaufkommens in den letzten 20 Jahren können sich auch Krankheiten schneller grenzüberschreitend verbreiten. Auch der Ebola-Ausbruch in Westafrika hat gezeigt, dass die Welt nicht ausreichend auf solche Gesundheitsgefahren vorbereitet ist“, sagte er dem Ärzteblatt. In der geplanten Simulation sollte es darum gehen, die Verbreitung eines tödlichen Virus zu stoppen. „Da geht es um Fragen: Wie sind die Informations- und Entscheidungswege? Wie lässt sich die wirkliche Gefahr ohne Zeitverlust feststellen? Welche Ängste stehen einer frühen Anforderung von internationaler Hilfe im Weg? Wie kann Hilfe vor Ort organisiert werden? Wir brauchen mehr Klarheit darüber, welche Verantwortlichkeiten es vor Ort gibt, wenn eine Krise auftritt, wie wir sicherstellen, dass Informationen schnell weitergegeben werden, wer zügig Hilfe bereitstellt und welche Kontrollen erforderlich sind.“
Vermutlich hatte sich Gröhe auch mit den Ergebnissen einer Übung beschäftigt, die auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2007 erarbeitet worden waren. Dort hatten Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft – unterstützt von Weltbank und der Bill & Melinda Gates-Stiftung – ebenfalls eine Pandemie durchgespielt. Das Planspiel hatte verdeutlicht, dass Unternehmen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen sich besser vernetzen müssen, wenn es darum geht, die weltweiten Versorgungsketten für medizinisches Equipment, diagnostische Tests, Medikamente und Impfstoffe zu managen.
Nicht nur aus Übungen hatte man Lehren gezogen. Auch die Realität hielt immer wieder Herausforderungen bereit, etwa die rasante Verbreitung der schweren Lungenentzündung SARS 2002/2003. Das Virus hatte wohl seinen Weg zum Menschen gefunden, weil in Südchina Schleichkatzen als Delikatesse gelten, und dieser Erreger breitet sich über Tröpfcheninfektionen aus.
Bei SARS war erstmals geradezu in Echtzeit zu beobachten, wie ein Erreger in kurzer Zeit in der Lage ist, sich um die Welt zu verbreiten. Damals hatte es nur drei Tage gedauert, bis auf der gesamten nördlichen Halbkugel SARS-Patienten identifiziert worden waren. SARS war die erste Pandemie in diesem Jahrtausend, meinte 2017 Eilke Brigitte Helm, emeritierte Professorin des Frankfurter Uniklinikums.26 Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts erklärte: „SARS war zwar auch eine Pandemie, insgesamt war das eher ein relativ kleines Geschehen mit nur 8.096 Fällen und etwa 770 Todesfällen. Dennoch hat SARS nach Schätzung der WHO bis zu 30 Milliarden Dollar auch damals gekostet.“
Im Jahr 2009 war es dann die sogenannte Schweinegrippe, die im April zunächst in Mexiko und den USA aufgetreten war und tödliche Folgen hatte. Innerhalb weniger Wochen infizierten sich mindestens 30.000 Menschen in 74 Ländern. Am 11. Juni 2009 erklärte WHO- Generaldirektorin Margaret Chan den Beginn einer Grippe-Pandemie: „The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic.“ In Deutschland wurde daraufhin der Nationale Pandemieplan aktiviert.
„Gesundheit ist in Deutschland ein föderales Geschehen, was im Sinne der Seuche nicht günstig ist.
René Gottschalk, Gesundheitsamt Frankfurt
René Gottschalk vom Gesundheitsamt Frankfurt sagte dem Deutschlandfunk dazu 2017: „Gesundheit ist in Deutschland ein föderales Geschehen, was im Sinne der Seuche nicht günstig ist. Also, Sie brauchen da die Absprache mit 16 Bundesländern, damit alle das gleiche machen – oder sie machen alle nichts gleich, was nicht sonderlich günstig ist. Denn Unterschiede erzeugen Unsicherheit. Etwa, wenn die Bundesländer bei der Impflogistik verschiedene Konzepte verfolgen oder von verkündeten Pandemieplänen abweichen. Es mag gute Gründe dafür geben, doch dann muss die Kommunikation stimmen. Und genau die erwies sich bei der Schweinegrippe wieder einmal als besonders schwierig.“ Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts: „Ein Problem bei der Schweinegrippepandemie war wohl der Mangel einer Stimme der Bundesregierung, die sachlich über aktuelle Erkenntnisse sowohl zum Pandemieverlauf als auch zum Pandemieimpfstoff informiert hat.“
Die Schweinegrippe bildete damals – anders als erwartet – keine tödliche Mutation aus. Dennoch hatten die Bundesländer für mehr als 300 Millionen Euro Impfstoffe eingekauft. Da sich nicht einmal jeder Zehnte impfen ließ, blieben schließlich rund 30 Millionen Impfdosen übrig, die nach Ablauf der Haltbarkeit zu Sondermüll wurden. Und so endet Pandemie-Impfstoff im Wert von 250 Millionen Euro in der Verbrennungsanlage. Zumindest vom Oktober 2009 an saß übrigens Ursula von der Leyen mit am Berliner Kabinettstisch. Ob diese 250-Millionen-Impfstoff-Vernichtung mit zu dem anfangs zurückhaltenden Engagement der Europäischen Union bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen beigetragen hat, lässt sich nur mutmaßen.
Auf jeden Fall hielten viele damals das große Tamtam rund um die Schweinegrippe für völlig übertrieben. Die WHO geriet angesichts dessen massiv in die Kritik. Möglicherweise war das einer der Gründe, warum die WHO beim Ausbruch von Ebola fünf Jahre später nach Ansicht von Experten wiederum zu langsam reagierte. Damals erkrankten mehr als 28.000 Menschen, von denen rund 11.000 starben. Und auch bei der Corona-Pandemie hielt sich die Kritik an der Informationspolitik der WHO hartnäckig.





























