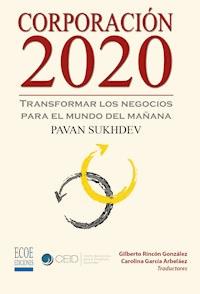Pavan Sukhdev
Corporation 2020
Warum wir Wirtschaft neu denken müssen
Aus dem Englischen vonAnnette Bus, Heinz Tophinkeund Kurt Beginnen
Dieses Buch erscheint in Zusammenarbeitmit der Heinrich-Böll-Stiftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Deutsche Erstausgabe
Copyright der Originalausgabe»Corporation 2020. Transforming Business for Tomorrow’s World«:© 2012 Pavan Sukhdev
Original erstmals veröffentlicht bei: Island Press, Washington D. C., 2012
Copyright der deutschen Erstausgabe© 2013 oekom verlag München
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Lektorat: Christoph Hirsch, oekom verlagKorrektur: Petra KienleSatz: Ines Swoboda, oekom verlag
eBook: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-86581-561-3
Für die Studierenden von heute – die Unternehmer von morgen
Das ist euer Buch.
Lasst die Vision Wirklichkeit werden.
Vorworte
Danksagung
Einführung
Kapitel 1Die Rechtsgeschichte des Unternehmens
Kapitel 2Deregulierung und Innovation: 1945 bis 2000
Kapitel 3Corporation 1920: die Repräsentantin der heutigen Wirtschaft
Kapitel 4Hinter den Spiegeln: die Parallelwelt der Externalitäten
Kapitel 5Externe Effekte einbeziehen
Kapitel 6Verantwortungsvoll werben
Kapitel 7Fremdkapital begrenzen
Kapitel 8Ressourcen, nicht Gewinne besteuern
Kapitel 9Corporation 2020: die Unternehmens-DNA der Zukunft
Kapitel 10Die Welt der Corporation 2020
Anmerkungen
Vorwort
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur
Wer nachhaltige Wirtschaftsformen befördern will, muss über nachhaltige Unternehmen nachdenken. Das klingt banal, ist es aber nicht. Unternehmen sind die zentralen Akteure unseres Wirtschaftslebens. Sie beschäftigen die große Mehrheit der Erwerbstätigen, erwirtschaften den überwiegenden Teil des Sozialprodukts, tätigen den Löwenanteil der Investitionen und sind der zentrale Treiber technischer Innovationen.
Die großen Etappen der industriell-technischen Revolution sind mit Pionierunternehmen verbunden, von Daimler-Benz, Siemens und Bosch bis zu Microsoft und Google. Erfindergeist plus Unternehmertum ist die Formel, die seit über 200 Jahren die Welt verändert. Aus Garagenfirmen wurden globale Konzerne, deren Finanzkraft die vieler Staaten übersteigt. Die enorme volkswirtschaftliche Bedeutung solcher Multis gibt ihnen einen starken Einfluss auf Gesetzgebung und Regierungshandeln. Sie kaufen dort ein, wo es am billigsten ist, investieren dort, wo es am rentabelsten ist und spielen Regierungen gegeneinander aus, um ihre Steuerzahlungen zu minimieren. Gleichzeitig prägen sie maßgeblich den ökologischen Fußabdruck der Industriegesellschaft: ihr Ressourcenhunger und Energieumsatz, ihre Abfallbilanz und ihre Emissionen tragen entscheidend zum Raubbau an den ökologischen Lebensgrundlagen bei.
Es ist also nur konsequent, wenn Pavan Sukhdev sein neues Buch der Zukunft des Unternehmens widmet. International bekannt wurde er als Koordinator der Studie »The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)« – der erste systematische Versuch, den Wert des »Naturkapitals« zu erfassen, das sowohl bei Unternehmensbilanzen wie bei der Errechnung des Bruttoinlandsprodukts ausgeklammert bleibt. Sukhdev gilt weltweit als Vordenker für die Einbeziehung von sozialen und ökologischen Faktoren in die volkswirtschaftliche und betriebliche Gesamtrechnung. Dieser Gedanke steht auch im Zentrum des vorliegenden Buches. Es geht darum, die Wechselbeziehungen zwischen Unternehmen, Gesellschaft und Biosphäre möglichst präzise zu erfassen. Erst die Internalisierung bisher verdrängter »externer Effekte« gibt Auskunft über die Auswirkungen unternehmerischen Gewinnstrebens auf den Wohlstand der Nationen.
»Corporation 2020« greift allerdings weit über eine Reform der Unternehmensbilanzen hinaus. Es geht um nichts weniger als um eine Vision für das Unternehmen des 21. Jahrhunderts. Im Zentrum unternehmerischen Handelns soll künftig der Mehrwert für die Gesellschaft stehen. Damit wird eine Entwicklung korrigiert, die im 19. Jahrhundert einsetzte. Waren frühere Unternehmen im Wesentlichen Körperschaften zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, deren Operationen von Staats wegen autorisiert wurden, setzte sich mit der Entwicklung des Marktkapitalismus in Europa und Amerika ein neuer Typus von Unternehmen durch: Kapitalgesellschaften mit begrenzter Haftung, deren Daseinszweck in der Erwirtschaftung von Gewinnen für ihre Eigentümer besteht.
Diese Entwicklung »vom Gemeinnutz zum Eigennutz« (für Sukhdev der große Sündenfall) wurde 1919 in einem Urteil des Obersten Gerichtshofs von Michigan (USA) kodifiziert. Darin heißt es: »Ein Unternehmen wird in erster Linie zu Gewinnzwecken für die Aktionäre gegründet. Die Vollmachten der Geschäftsführer sind zu diesem Zweck zu nutzen«. Damit warf das Gericht eine gemeinwohlorientierte Unternehmensphilosophie über den Haufen, die der legendäre Henry Ford mit den Worten formulierte, sein Unternehmen sei »ein Werkzeug des Dienstes (an der Gesellschaft), keine Maschine zum Geldverdienen.«
Betrachtet man das Spannungsfeld zwischen Gewinn und Gemeinwohl genauer, stellt sich freilich heraus, dass die Dinge komplizierter liegen als es in dieser schlichten Gegenüberstellung erscheint. Auch Ford war davon abhängig, Gewinne zu erzielen. Ohne Aussicht auf Gewinn konnte das Unternehmen weder privates Kapital noch Bankkredite zur Finanzierung von Innovationen und Investitionen mobilisieren. Außerdem war gerade der missionarische Kapitalist Ford auf Expansion aus, um die Vorteile der Massenproduktion zu nutzen. Auf diese Weise konnte er die Kosten seiner Fahrzeuge senken, mit denen er die Motorisierung Amerikas vorantreiben und stabile Einkommen für eine große Zahl von Lieferanten, Arbeitern und Vertriebsagenten ermöglichen wollte.
Insofern verkörperte Ford das Idealbild eines Unternehmers, der davon angetrieben wird, etwas Nützliches für die Gesellschaft zu leisten. Sein Profit resultiert gerade daraus, dass er Güter oder Dienstleistungen auf den Markt bringt, die den Bedürfnissen der Kundschaft entsprechen und ihr Leben verbessern. Wenn er davon spricht, es sei besser, viele Autos mit einem geringen Gewinn als wenige mit hohem Gewinn zu verkaufen, denn nur so könnten »mehr Menschen ein Auto kaufen und mehr Männer werden zu guten Löhnen eingestellt«, hat er eine Langzeitökonomie im Auge, bei der die Interessen des Unternehmens, seiner Beschäftigten und seiner Kunden konvergieren. Die Langzeitfolgen des Automobilverkehrs für die städtische Lebensqualität und die Umwelt bleiben bei dieser Formel allerdings außen vor.
Sukhdevs Kritik bezieht sich vor allem auf das Geschäftsmodell multi-nationaler Konzerne, bei denen sich der Profit als Unternehmensziel gegenüber dem gesellschaftlichen Nutzen verselbständigt hat. Eine wesentliche Ursache dafür sieht er in der Entgrenzung dieser Unternehmen, also ihrer Freisetzung von allen bürgerschaftlichen Bezügen und sozialen Rücksichten, in die traditionelle Unternehmen eingebettet waren. Auch die Ausweitung des Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital und die Tyrannei der Quartalsberichterstattung haben die Orientierung wirtschaftlichen Handelns auf kurzfristige Gewinnsteigerung verschärft. Zentraler Kritikpunkt bleibt freilich die Externalisierung ökologischer und sozialer Kosten, die es Unternehmen erlaubt, ihren Profit auf Kosten der Gesellschaft zu maximieren.
Wenn man mit Sukhdev davon ausgeht, dass Marktwirtschaft und Unternehmertum nicht abgeschafft, sondern reformiert werden müssen, landet man bei der zentralen Frage, wie die größtmögliche Konvergenz zwischen privatwirtschaftlichem Gewinn und Gemeinwohl gesichert werden kann. Dabei geht es zum einen um betriebliche Innovationen wie die Einbeziehung sozialer und ökologischer Faktoren in die Unternehmensbilanz, die transparente Berichterstattung über Arbeitsbedingungen, Ausbildung, Ressourcenverbrauch, Emissionen, Eigentümerstruktur etc. Im Kern hängt die Transformation zur gemeinwohlorientierten Corporation 2020 aber von einer Veränderung der Rahmenbedingungen ab, in denen Unternehmen agieren. Verbraucher/innen, Nichtregierungsorganisationen, Medien und Politik spielen eine zentrale Rolle, um die »DNA« von Unternehmen zu verändern.
Damit sind wir bei der entscheidenden Bedeutung des Ordnungsrahmens für eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft: Bilanzvorschriften, Haftungsrecht, Ressourcensteuern, Umweltabgaben, höhere Eigenkapitalquoten, Transparenzregeln, öffentliche Infrastruktur- und Forschungspolitik sind wirkungsmächtige Hebel, um die betriebswirtschaftliche Logik stärker auf gesellschaftliche Ziele und Interessen auszurichten. Diese Transformation zu einer wertorientierten Ökonomie ist bereits im Gang. Pavan Sukhdev liefert dafür nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern zeigt an zahlreichen Beispielen, wie betrieblicher Erfolg, gesellschaftliche Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit auf einen Nenner gebracht werden können.
Ralf Fücks, Vorstand Heinrich-Böll-Stiftung
Vorwort
Keine Ausreden für Untätigkeit
Unsere Meere sind fast leergefischt, unsere Wälder werden abgeholzt, die Artenvielfalt schwindet und die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nimmt zu. Wir gefährden die Ökosysteme, das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen. Die Gefahr steigt, dass wir irreversible Schäden anrichten und dass wir an den Punkt kommen, an dem es keinen Weg mehr zurück gibt. In dieser Situation ist nichts gefährlicher als Nichtstun. Untätigkeit befördert Akkumulationsprozesse, etwa bei den Treibhausgaskonzentrationen, und treibt die Kosten für einen Systemwechsel in die Höhe, so dass der Ausstieg aus der Verschmutzungswirtschaft immer teurer wird. Es sind die Ärmsten, die zuerst und am meisten betroffen sein werden. Aber wir alle werden die Folgen unserer Untätigkeit und unserer Verzögerungstaktik zu spüren bekommen, nicht zuletzt in Form gewaltiger Migrationsbewegungen und der dadurch ausgelösten Spannungen und Konflikte.
Viele, wenn nicht die meisten unserer Probleme, sind die Folge einer Kombination aus Marktversagen und verantwortungslosem und kurzfristig ausgerichtetem Verhalten. Es liegt an uns, diese Probleme zu lösen. Die Werkzeuge dazu stehen uns längst zur Verfügung: vernünftige Politik, Zusammenarbeit, Weitsicht, die die Konsequenzen unseres Handelns anerkennt, sowie kontinuierliche Reflexion von Technologie, Organisation und Politik. Alle diese Instrumente tragen im Zusammenspiel dazu bei, den Lebensstandard der Menschen, insbesondere der Armen, zu verbessern, die gesellschaftliche und ökonomische Inklusion und Gleichberechtigung zu stärken und für uns alle eine attraktivere und freundlichere Umwelt – kurz: mehr ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit – zu schaffen. Gelingt es uns nicht, diese drei Spielarten der Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, höhlen wir jede einzelne aus.
Im vorliegenden Buch wird dieses Argument überzeugend dargelegt. Pavan Sukhdev benennt aber auch konkrete Maßnahmen und gibt uns eine Ahnung davon, wie eine Politik aussehen muss, um die Probleme an der Wurzel zu packen, insbesondere das Übel des Marktversagens. Er zeigt, wie es gelingen kann, den Fokus eines überall vorhandenen Unternehmergeists und der Kreativität von Firmen, Personen und Gemeinschaften auf Erkenntnisse und Handlungen zu richten, die wirtschaftlich und gesellschaftlich sinnvoll sind, nicht nur für die Firmen, sondern auch für die Menschen und Gemeinschaften, ja für unseren ganzen Planeten. Bislang sind diese menschlichen Ressourcen darauf gerichtet, sich mit den Schäden auseinanderzusetzen, die verzerrte Märkte und verantwortungsloses Handeln angerichtet haben. Wenn es uns nicht gelingt, diese Verzerrung der Märkte bald wieder zurechtzurücken, werden sie uns noch weiter entgleiten. Wenn es uns aber gelingt, eine Politik der Nachhaltigkeit zu etablieren, dann werden wir gesünder, stärker und menschenwürdiger produzieren und konsumieren: sicherer, sauberer, ruhiger, gerechter und mit einer größeren Artenvielfalt.
Dieses Buch verdeutlicht eines: Die Green Economy Initiative des UNEP hat gezeigt, dass eine neue Wirtschaft, die ökonomische Entwicklung und soziale Gerechtigkeit fördert und gleichzeitig ökologische Risiken und Ressourcenknappheit mindert, nicht nur möglich, sondern für die Nachhaltigkeit unerlässlich ist. Schon viel zu lange jedoch reden wir über Richtungsänderungen auf der Makroebene, ohne zu erkennen, dass volkswirtschaftsweite Veränderungen nur möglich sind, wenn wir sie von der Mikroebene aus angehen. Das heißt: Wir brauchen eine vernünftige Mikropolitik, die das Versagen der Märkte in den Griff bekommt.
Diese Erkenntnis bringt uns zu den größten Akteuren in der Wirtschaft – den Unternehmen. Was wird sich ändern an der Art und Weise, wie Unternehmen agieren? Wie bei jeder »Spezies« muss sich auch bei den Unternehmen das Umfeld ändern, damit sie sich weiterentwickeln können. Zu diesem Umfeld gehören Institutionen, Politik und Preise. Es muss aber auch intensiver darüber diskutiert werden, was funktioniert, was Nachhaltigkeit ist und was bei einer Vielzahl relevanter Akteure der Begriff »Verantwortung« bedeutet.
Corporation 2020 benennt vier grundlegende Veränderungen, welche die Entwicklung eines Unternehmens hin zu einem höheren Verantwortungsbewusstsein ermöglichen:
Die Offenlegung der externalisierten Kosten und des externalisierten Nutzens: Investoren und Verbraucher erhalten mehr Informationen; Entscheidungen sind dadurch nicht allein auf Basis von Ladenpreis oder Rendite möglich.
Besteuerung von Ressourcen: Besteuert werden nicht die Güter, besteuert wird der Verbrauch von Ressourcen.
Verantwortungsbewusste und rechenschaftspflichtige Werbung: Die Verbraucher erhalten echte Informationen, nicht nur Werbeslogans.
Begrenzung des Fremdkapitals: Insbesondere bei Unternehmen, die als too big to fail gelten und deren Fremdkapital im Wesentlichen auf externalisierten Kosten beruht, die letzten Endes der Steuerzahler trägt, muss der Einsatz von Fremdkapital begrenzt werden.
Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht irgendwann 2050 oder 2100 damit beginnen, unsere Ökobilanz zu verändern. Die Wissenschaft mahnt uns, dass ein »weiter so« nicht geht, dass wir im nächsten Jahrzehnt umkehren müssen, wenn wir überhaupt noch die Chance wahren möchten, eine nachhaltige Gesellschaft zu errichten.
Alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, müssen das Folgende beachten:
Die Ergebnisse internationaler Verhandlungen sind meist nur sehr vage formuliert und beziehen sich auf die Makroebene, das heißt auf die Länder. Wenn wir echte Veränderung wollen, müssen wir jedoch auf die Mikroebene – die Unternehmen – blicken.
Wettbewerb führt häufig zu einer Effizienzsteigerung, sofern die Ressourcen korrekt bewertet werden. Unser aktuelles System jedoch bewertet die nicht finanziellen Formen des Kapitals sowie das öffentliche Kapital generell nicht hoch genug.
Wir sollten uns keine Sorgen darüber machen, ob eine Politik im Sinne der Corporation 2020 »Wachstum behindert«. Wer so denkt, verwechselt meist Wachstum und Entwicklung. Die hier beschriebenen politischen Maßnahmen sind unerlässlich, wenn unser aller Lebensstandard auf Nachhaltigkeit basieren und unser Kampf gegen Armut Früchte tragen soll. Natürlich müssen die Kennzahlen für Fortschritt über das eng gefasste BIP hinausgehen, wie diejenigen, die sich ernsthaft Gedanken über Entwicklung und Lebensstandards machen, längst erkannt haben.
Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft und Regierungen müssen zusammenarbeiten und das business as usual endlich beenden. Es gibt weder eine einzelne Institution noch ein Patentrezept, das die komplexen Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, lösen kann.
Es steht in unserer Macht, eine bessere, fairere und produktivere Welt zu schaffen. Wir sehen die Zerstörung, die unser jetziger Weg anrichtet und wir kennen ihre Ursachen. In diesem Buch werden konkrete Maßnahmen formuliert, die Märkte und Unternehmen nachhaltig verändern können. Für Untätigkeit gibt es keine Ausreden mehr.
Nicholas Stern, Professor an der London School of Ecnomics, Autor von The Economics of Climate Change: The Stern Review
Vorwort
Die Verantwortung des Unternehmens
Das Projekt Green Economy des United Nations Environment Programme (UNEP) zeigt, dass eine neue, inklusive Wirtschaft der einzige Weg zu einer wirklich nachhaltigen Welt ist. Aber eine »grüne Ökonomie« können wir nicht erreichen, wenn wir nicht vorab gründlich über die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure nachdenken. Veränderungen auf der Makroebene erfordern die gemeinsame Anstrengung aller Parteien auf der Mikroebene. Das bedeutet, wenn wir echte Fortschritte in Richtung einer Green Economy machen wollen, muss die Privatwirtschaft die treibende Kraft für Innovation und Problemlösung sein, auf die sich Regierungen und andere Stakeholder verlassen.
Unternehmen haben uns in die prekäre Lage gebracht, in der wir uns heute befinden. Aber sie sind auch die Institutionen, die am besten aufgestellt sind, um die für globale Lösungen benötigten Quantensprünge zu vollziehen. Als Unternehmen stehen wir in der Verantwortung: Unsere Geschäfte sollen keine Kollateralschäden verursachen, sondern Kollateralnutzen schaffen. Das ist eminent wichtig, denn wenn das aktuelle Profit-Rennen direkt mit dem sozialen und ökologischen Niedergang verknüpft ist, gewinnt niemand und verlieren alle.
Bis jetzt wurden die »kostenlosen Dienstleistungen«, die uns eine ausgeklügelte und funktionstüchtige Natur erbringt, ignoriert und gering geschätzt, gerade weil sie sich schwer schätzen und bepreisen lassen und weil sie nicht auf dem Markt gehandelt werden. Die Bewertung des Naturkapitals und die Einbeziehung der wahren Kosten der Geschäftstätigkeit auf Kosten der Natur sind eine wesentliche Variable in der Gesamtgleichung »nachhaltige Wirtschaft«. Die Messung der externalisierten Kosten und des externalisierten Nutzens und die ökonomische Bewertung der Umweltauswirkungen eines Unternehmens sind nicht nur eine Frage der Verantwortung gegenüber der Natur und somit für unsere Lebensqualität und unseren Lebensunterhalt, sondern auch eine Frage der Risikominderung und der Suche nach Innovation und neuen Möglichkeiten zugunsten einer langfristigen Nachhaltigkeit. Alle Unternehmen müssen die Kosten des Naturverbrauchs erkennen und messen, klare Konsequenzen ziehen und angemessene Lösungen finden, damit wir eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft schaffen können.
Ein solcher Ansatz steht im Fokus dieses Buches; der Autor plädiert leidenschaftlich für ein derartiges neues Unternehmensmodell. Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, rechenschaftspflichtig sind und vorangehen – das ist eine Überzeugung und eine Vision, die ich mit Pavan Sukhdev teile, und ich hoffe, dass es für die kommenden Generationen von Unternehmern selbstverständlich sein wird, dass jedes Geschäft eine »win-win-Situation« für alle Steakholder, für alle Beteiligten und Betroffenen darstellt – auch für Natur und Gesellschaft. Zweifellos wird es auch in der Welt der Corporation 2020 noch Wettbewerb geben, aber die Unternehmen werden in erster Linie um Innovation, Ressourcenschutz und zufriedene Verbraucher konkurrieren, nicht um die cleverste Steuerhinterziehung, das teuerste Lobbying und die geschickteste Externalisierung der Kosten.
In einer Sache jedenfalls bin ich mir völlig sicher: Ich freue mich darauf, in der Welt der Corporation 2020 Unternehmer zu sein.
Jochen Zeitz, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Puma AG
Anmerkung: Jochen Zeitz entwickelte während seiner Amtszeit als CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats von PUMA die weltweit erste Umwelt-Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bewertet die Umweltauswirkungen des Unternehmens entlang der gesamten Lieferkette.
Danksagung
Dreieinhalb Jahre hektischen Schreibens liegen hinter mir. Dreieinhalb Jahre habe ich an meinen (und fremden) Texten gearbeitet, um die Studien TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) und Towards a Green Economy für die Vereinten Nationen fertigzustellen, und nun habe ich mich erneut dem Stress des Schreibens ausgesetzt. Warum eigentlich? Ich bin weder »ausgebildeter« Autor noch macht mir das Schreiben besonderen Spaß. Mir war aber klar, dass die Green Economy ein Luftschloss bleiben wird, solange der entscheidende Akteur nicht im Fokus steht: Die wichtigsten Akteure der modernen Wirtschaft sind die Unternehmen – und die lassen sich weder mit Argumenten noch mit Anreizen dazu bringen, eine »grüne Ökonomie« zu verwirklichen. Ohne überzeugende Lösung für dieses »Akteursproblem« wird auch das TEEB, ein Instrumentarium zur Bewertung des nicht erfassten öffentlichen Nutzens der Natur, seine Wirkung verfehlen und ungenutzt auf den Regalen Staub ansammeln.
Aber auch dieses Argument hätte mich nicht an den Schreibtisch getrieben, wenn mich nicht zwei Freunde von der Notwendigkeit dieses Projekts überzeugt hätten.
Meenakshi Menon, CEO von Spatial Access, hat mir die Augen geöffnet und mich davon überzeugt, dass mir die TEEB-Studie und eine Green Economy viel zu sehr am Herzen liegen, als dass ich diesen letzten Schritt, das Buch über die Corporation 2020 zu schreiben, verweigern dürfte. Als Expertin für Medien und Werbung hat sie sich bereiterklärt, die Kampagne und die Internetplattform zu organisieren, die das Buch begleiten. Darüber hinaus war sie an einem zentralen Kapitel des Buchs beteiligt, nämlich am Kapitel über die Verantwortung in der Werbung (Kapitel 6). Dieses Thema ist ein wesentlicher Aspekt der Veränderung, der den Übergang zur Corporation 2020 bedeutend vorantreiben kann. Meenakshi, ich kann dir gar nicht genug danken.
Sanjeev Sanyal, Volkswirt bei der Deutschen Bank, mein Partner bei GIST, einem Projekt zur ökologischen Bilanzierung, und Verfasser eines Bestsellers (The Indian Renaissance: India’s Rise after a Thousand Years of Decline), ermutigte mich, den Sprung zu wagen. Seine frühen Empfehlungen zum »Wie« und »Warum« waren ungeheuer wertvoll. Sanjeev hat ebenfalls ein Kapitel dieses Buches (und der Kampagne Corporation 2020) entscheidend geprägt. Sanjeev, vielen Dank, dass du an meiner Seite warst – von GIST bis Corporation 2020.
Der Zweck war nun also definiert, was fehlte, waren die Mittel. M. K. Gandhi sagte: »Finde den Zweck und die Mittel werden folgen« – und er sollte Recht behalten, denn nun trat die Universität Yale auf den Plan. Im September 2010 traf ich mich mit Sir Peter Crane, dem Dekan der Fakultät für Forstwirtschaft und Umwelt. Ursprünglich ging es um die Frage, wie Yale die demnächst erscheinenden TEEB-Berichte nutzbringend einsetzen könnte, doch schon bald entwickelte sich das Fach- in ein Einstellungsgespräch. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte ich ein Angebot der Universität Yale als McCluskey Fellow für 2011 angenommen. Das Angebot beinhaltete Forschungsgelder für ein Buch mit dem Titel Corporation 2020. Danke, Peter, dass du die Vision dieser Partnerschaft hattest und die Vision zur Realität gemacht hast.
Meinem Forschungsteam in Yale, das viele Kapitel dieses Buchs vorbereitet und in eine erste Fassung gebracht hat, gebührt mein ganz besonderer Dank. Diese hervorragenden Studierenden lassen mich für die Zukunft hoffen. Bryant Cannon hat über die Rechtsgeschichte des Unternehmens recherchiert, was Michael Parks für Kapitel 1 zusammengefasst hat. John D’Agostino hat die Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg für Kapitel 2 recherchiert. Namrata Kala hat Informationen für Kapitel 4 und 5 zusammengetragen und jeweils erste Fassungen geschrieben und sich ihren Spitznamen dabei mehr als verdient: »Miss Externalities«. Rafael Torres hat das Kapitel zu Fremdkapital – einem weiteren wesentlichen Aspekt der Veränderung – vorbereitet. Brian Marrs hat viele Monate an wenig anderes gedacht als an die Besteuerung von Ressourcen, während er Kapitel 8 des Buchs vorbereitete. Joseph Edgar hat die Fakten zum Lobbying von Unternehmen zusammengetragen – ein Thema, das in mehreren Kapiteln eine wesentliche Rolle spielt. Michael Parks hat das letzte Kapitel zur Welt der Corporation 2020 recherchiert. Und Star Childs hat alle Diagramme entwickelt, eine Aufgabe, die sie aufs Beste gelöst hat. Diesem Yale-Team ein ganz herzliches Dankeschön.
Die schwierige Aufgabe, das stetig wachsende Projekt Corporation 2020 trotz knappster Termine zu organisieren, oblag Kevin Kromash, ebenfalls Graduate Student in Yale. Als mein Research Supervisor für das Projekt hat Kevin nicht nur alle, mich eingeschlossen, auf Linie gebracht und mit Engelsgeduld dafür gesorgt, dass wir unsere Termine einhalten, er hat auch alle Kapitel redigiert und Korrektur gelesen und mehrere Themen bearbeitet, die irgendwie durch das Raster gefallen waren. Wenn Corporation 2020 ein Unternehmen wäre, wäre Kevin sein Chief Operating Officer. Toll gemacht, Kevin, vielen Dank.
Ich danke Brad Gentry, Stuart DeCew und Amy Badner von CBEY, dass sie Corporation 2020 in Yale ein Zuhause gegeben und uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Ich bedanke mich auch bei George Joseph, Eugenie Gentry, Melissa Goodall, Jeanette Gorgas, Marian Chertow, Susan Welles, Victoria Manders und Jessica Foote von der Yale Universität für ihre Hilfe in den verschiedensten Phasen des Projekts.
Mehrere Personen haben sich mit Frühfassungen verschiedener Kapitel von Corporation 2020 auseinandergesetzt – bei ihnen bedanke ich mich für ihre sorgfältige Arbeit und die vielen Anregungen. Ich danke Ed Barbier für seine Kommentare zu beiden Kapiteln, die sich mit Externalitäten beschäftigen, Allen White für seine detaillierten Kommentare zur Einführung und zu den Kapiteln über die Corporation 1920 und die Corporation 2020. Camilla Toulmin hat das Kapitel »Deregulierung und Innovation 1945 bis 2000« kritisch durchgelesen, Andrew Metrick Kapitel 7 über Financial Leverage, Gautam Patel und Connie Bagley schließlich das Kapitel zur Rechtsgeschichte. Allen dreien herzlichen Dank. Dank auch an Tom Lovejoy für seine Kommentare zum Kapitel »Why 2020?«, die wissenschaftliche Begründung für schnelles Handeln. (Dieser Teil des Buches existiert ausschließlich als englischsprachiges E-Book – Anm. d. Ü.). Dank auch an Rajiv Sinha und Sanjeev Sanyal für ihre Durchsicht verschiedener Kapitel.
Ich bedanke mich ferner bei Romesh Sobti, Paul Abraham, Alessandro Carlucci, Mohandas Pai, Jochen Zeitz, Michael Izza, Julie Katzman, Jon Anda, Partha Bhattacharyya, Daniel Esty, Jochen Flasbarth, Stuart Hart, Andrew Kassoy, Tom Lovejoy, Juliet Schor, Peter Seligmann, Erik Solheim, Gus Speth, Rob Walton, Adam Werbach und Allen White, dass sie sich die Zeit für ein Interview für unsere Website www.corp2020.com genommen haben. Mein Dank auch an Michael Parks von Yale, der die Videoaufnahmen organisiert hat, ganz gleich, wo auf der Welt sie stattfanden. Ich bedanke mich bei Rick Leone, Doug Forbush, Phil Kearney und Lucas Swineford vom Yale Broadcast and Media Center für ihre hervorragenden Aufnahmen von vielen dieser Interviews.
Unsere Kampagne Corporation 2020 wurde während des Rio+20-Gipfels gestartet. Zwei sehr hektische Wochen lang stellten Sarah Wyatt, Brian Marrs, Lucia Ruiz, Mahima Sukhdev und Tais Pinhero – einmal mehr ein bestens eingespieltes »Yalie«-Team – unser Projekt in mehr als 20 Veranstaltungen innerhalb des Rio+20-Programms vor. Einen Großteil ihrer langen Arbeitstage verbrachten sie dabei im Taxi in den berüchtigten Staus auf Rios Straßen.
Für ihre Unterstützung und ihr Engagement bei zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen der Veröffentlichung dieses Buchs und unserer längerfristige Kampagne Corporation 2020 danke ich Camilla Toulmin, Steve Bass, Tom Bigg und ihren Kollegen am IIED; Peter Seligmann und den Conservation International Teams in den USA und in Brasilien; Richard Spencer und seinen Kollegen am ICAEW; Laurene Powell Jobs und ihrem Team des Emerson Collective; Julia Marton-Lefèvre, John Kidd und ihren IUCN-Kollegen in Cheju; Miriam Lyons und ihrem Team bei CPD in Sydney und unseren Kollegen vom Cambridge Program for Sustainability Leadership. Für ihre Rechercheunterstützung bedanke ich mich bei meinen Freunden und früheren Kollegen Anirban Lahiri, Saurabh Sen, Rajesh Tolani, Sunil Rangaiah, Abheet Dwivedi, Mohit Agarwal und anderen am Deutsche Bank CIB Centre in Mumbai (früher GMC Mumbai) sowie dem Team von GIST Advisory, Rhea Rajpal bei Spatial Access und Patricia Devlin, Yale.
Island Press ist ein wundervoller Verlag, der mich in jeder Phase dieses Buchprojekts optimal unterstützt hat. Chuck Savitt hat meinen Vorschlag aufgegriffen, eine Kampagne zu den Themen dieses Buchs zu entwickeln und sogar vor der Veröffentlichung zu starten, auch wenn dies die Gefahr barg, die Ideen des Buchs zu früh preiszugeben. David Miller hat kritisches und konstruktives redaktionelles Feedback höchster Qualität gegeben. Ich bedanke mich auch bei Sharis Simonian und Mike Fleming für das Lektorat und die Produktion sowie bei Maureen Gately, Denise Schlener, Meredith Harkel, Jaime Jennings und Rebecca Bright für ihre Hilfe während des gesamten Projekts. Für die Förderung und Unterstützung der deutschen Ausgabe danke ich der Heinrich-Böll-Stiftung sowie dem oekom verlag.
Meine Assistentin Gloria d’Souza bei GIST Advisory hat das Unmögliche möglich gemacht und erfolgreich meinen Terminkalender gemanagt, während ich dieses Buch geschrieben habe. Danke dafür. Dank auch an William Walker und Ashley Maignan von Yale und Cynthia D’Souza von Spatial Access. Anita Horam, Ruchir Joshi, Nayantara Kotian und andere bei Via Earth Productions haben eine tolle Website konzipiert und unsere CEO-Interviews hervorragend redigiert.
Die Arbeit von Johan Rockström und seinen Kollegen am Stockholm Resilience Centre über planetarische Grenzen hat uns gezeigt, wie dringlich das Thema dieses Buches ist. Die Arbeit der Tomorrow’s Company (Tony Manwaring) und des Tellus Institute (Marjorie Kelley und Allen White) zeigt ebenfalls, wie wichtig es ist, Unternehmen umzugestalten. Bei den vielen Autoren, die wir zitiert haben, kann ich mich nicht einzeln bedanken, wir haben aber auf sorgfältige Literaturangaben geachtet.
Vielen Freunden danke ich für ihre Hilfe und dafür, dass sie mich als Gast aufgenommen haben, während dieses Buch entstanden ist, besonders Keshav Varma, dessen friedlicher Balkon in seinem Zuhause in der Nähe von Washington mir geholfen hat, meine Schreibblockade zu überwinden und die Einführung zu Papier zu bringen. Meine Familie und meine Freunde haben in der Zeit, in der dieses Buch entstanden ist, noch weniger von mir gesehen als üblich – und ich bedanke mich bei ihnen für ihre Liebe und ihr Verständnis.
EINFÜHRUNG
Scheitern ist lediglich eine Gelegenheit,von vorne anzufangen – allerdings intelligenter.
Henry Ford
Sucht man im Internet nach »I’d like my life back«, stößt man auf ein Video mit Tony Hayward, Ex-CEO von BP.1 Seine Worte, nicht gerade ein Paradebeispiel unternehmerischer Diplomatie, machten Schlagzeilen, als er am 30. Mai 2010, vier Wochen nach der Explosion auf der BP-Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko, versuchte, die von der Ölpest betroffenen Einwohner von Venice, Louisiana, zu besänftigen.
Bemerkenswert an dem Video ist nicht nur Haywards Unfähigkeit zur Empathie, sondern auch die Vorgeschichte dieses Auftritts. Nur ein Jahr zuvor hatte Hayward in einem Interview betont, »Sorgfaltspflicht« sei der wesentlich Antrieb seines beruflichen Lebens.2 Zwar gab er unumwunden zu, dass BP zahlreiche Sicherheitsdesaster zu verantworten hatte, sei es in Texas, in der Prudhoe Bay in Alaska oder anderswo, behauptete aber dennoch, er habe sich seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2006 bemüht, Sicherheit ganz oben auf die BP-Agenda zu setzen, wobei – natürlich – zu bedenken sei, dass der Hauptzweck des Unternehmens die Erfüllung der Aktionärserwartungen, nicht die Rettung der Welt sei. Ein knappes Jahr später musste er sich einem Sicherheitsdesaster epischen Ausmaßes stellen, der größten Ölpest der Geschichte.3 Nach der Katastrophe war der BP-Aktienkurs abgestürzt: In weniger als sechs Wochen wurde Aktionärsvermögen im Wert von 70 Milliarden USD vernichtet.4
Nach der Deepwater Horizon-Katastrophe stand plötzlich ein völlig anderer Punkt auf Haywards Agenda ganz oben: Schadensbegrenzung. Er focht die Ergebnisse von mindestens drei getrennten und unabhängigen Wissenschaftlerteams an, denen zufolge bis zu 35 km lange Ölschlieren unter der Meeresoberfläche schwammen. Eigene Untersuchungen von BP, so Hayward, hätten keinerlei Hinweise auf ein solches Phänomen gegeben.5 Er musste sich schließlich auch die Frage stellen lassen, warum sich die BP-Manager auf der Deepwater Horizon nur wenige Tage vor dem Blowout offensichtlich nicht für die sichersten Optionen entschieden hatten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!